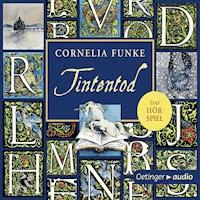13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Drachenreiter
- Sprache: Deutsch
Der Drachenreiter kehrt zurück: Fortsetzung von Cornelia Funkes erfolgreichstem Kinderroman!Zwei Jahre nach ihrem Sieg über Nesselbrand erwartet Ben, Barnabas und Fliegenbein ein neues Abenteuer: Der Nachwuchs des letzten Pegasus ist bedroht! Nur die Sonnenfeder eines Greifs kann ihre Art noch retten. Gemeinsam mit einer fliegenden Ratte, einem Fjordtroll und einer nervösen Papageiin reisen die Gefährten nach Indonesien. Auf der Suche nach dem gefährlichsten aller Fabelwesen merken sie schnell: sie brauchen die Hilfe eines Drachens und seines Kobolds. Die Feder eines Greifs ist Lesegenuss vom Feinsten: spannend, magisch und atmosphärisch. Ein großer, fantastischer Roman der international gefeierten, preisgekrönten Autorin Cornelia Funke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Drachenreiter kehrt zurück!
In der Abgeschiedenheit Norwegens erreicht Ben eine schreckliche Nachricht: Die letzten drei Pegasusfohlen werden vermutlich nie schlüpfen und mit ihnen werden die geflügelten Pferde für alle Zeit aus dieser Welt verschwinden. Um sie zu retten, machen sich Ben und Barnabas mit einem äußerst ungewöhnlichen Expeditionsteam auf den weiten Weg nach Indonesien, um dort eins der gefährlichsten Fabelwesen der Welt zu finden. Denn nur die Sonnenfeder eines Greifs kann die Fohlen vielleicht noch vor dem Tode bewahren. Doch Greife hassen Pferde, und das Wesen, das sie als ihren ärgsten Feind betrachten, ist Bens bester Freund − ein Drache.
Ein neues fantastisches Abenteuer mit Ben und seinem Silberdrachen Lung
Ich habe diese Geschichte nicht für die geschrieben, die die Welt regieren wollen.
Nicht für die, die ständig beweisen müssen, dass sie stärker, schneller, besser als alle anderen sind.
Oder für die, die den Menschen für die Krone der Schöpfung halten.
Diese Geschichte ist für all die, die den Mut haben, zu beschützen statt zu beherrschen, zu behüten statt zu plündern und zu erhalten statt zu zerstören.
Cornelia Funke
»Mein Junge«, sagte [Merlin], »du sollst alles sein, was es gibt – Tier, Pflanze, Gestein, Virus oder Bazillus: Mir ist’s einerlei. Ich habe noch viel vor mit dir. Aber du wirst dich meiner Rück-Sicht anvertrauen müssen. Die Zeit ist noch nicht reif, dass du ein Falke bist […], also setz dich erst mal hin und lerne, ein Mensch zu sein.«
T. H. White,Der König auf Camelot
1. Ein neuer Ort und neue Freunde
Es war ein großer Fehler, dass ich als Mensch geboren wurde. Als Möwe oder Fisch hätte ich es weiter gebracht.
Eugene O’Neill, Eines langen Tages Reise in die Nacht
Alles schien Lung so vertraut. Der nebelverhangene Wald vor dem Höhleneingang. Der Geruch des nahen Meeres in der kalten Morgenluft. Jedes Blatt und jede Blüte erinnerten ihn an die schottischen Berge, in denen er aufgewachsen war. Aber Schottland war weit, ebenso wie der Saum des Himmels, das Tal, das die letzten Drachen dieser Welt seit zwei Jahren ihr Zuhause nannten.
Lung wandte sich um und blickte auf den Drachen, der hinter ihm auf einem Bett aus Moos und Blättern schlief. Schieferbart war der älteste von ihnen. Er zuckte im Traum mit den Flügeln, als wollte er den wilden Gänsen nach, die draußen über den grauen Himmel zogen, aber er würde sich schon bald auf den längsten aller Flüge machen. Ins Land des Mondes, wie die Drachen den Ort nannten, zu dem nur der Tod die Tür öffnete. Schieferbart war als Einziger zurückgeblieben, als sie sich alle zum Saum des Himmels aufgemacht hatten. Die weite Reise war schon damals zu anstrengend für ihn gewesen, doch dank guter Freunde hatte er eine neue Bleibe gefunden, als die alte Heimat der Drachen im Wasser eines Stausees versunken war.
Die Höhle, in der Schieferbart schlief, war keine natürliche Höhle. Ein Troll hatte sie gebaut, nach der Anweisung von Menschen, die genau wussten, was Drachen brauchten. Aber in MÍMAMEIÐR gab es nicht nur Höhlen für Drachen. Ob Troll, Wichtel, Meerjungfrau oder Drache – jedes Fabelwesen konnte hier Zuflucht finden, auch wenn einige Gäste aus dem Süden sich über die kalten norwegischen Winter beschwerten. MÍMAMEIÐR. Lung fand, dass der Name so wundersam klang wie seine Bewohner. Für jeden gab es hier eine passende Unterkunft. Sie waren so unterschiedlich wie MÍMAMEIÐRs Gäste. Höhlen, Nester, Ställe, winzige Wichtelhäuser … am Ufer des nahen Fjords, in den umliegenden Wäldern und auf und unter den Wiesen, die draußen taufeucht die Morgensonne begrüßten.
»Wie geht es Schieferbart heute?«
Der Junge, der im Höhleneingang stand, hatte gerade seinen vierzehnten Geburtstag gefeiert. Sein Haar war schwarz wie Rabenfedern. Seine Augen blickten zugleich furchtlos und neugierig in die Welt, und Lung wäre jederzeit Tausende von Meilen geflogen, nur um ihn zu sehen.
Ben Wiesengrund.
Als sie sich in einem verlassenen Hafenspeicher zum ersten Mal begegnet waren, hatte Ben diesen Nachnamen noch nicht getragen. Er war ein Junge ohne Eltern und ohne Zuhause gewesen. Aber Lung hatte ihn zu seinem Drachenreiter gemacht und mit auf eine Reise genommen, die ihnen beiden eine neue Heimat beschert hatte. Ben hatte unterwegs sogar Eltern und eine Schwester gefunden: Barnabas, Vita und Guinever Wiesengrund, Fabelwesen-Schützer und sicher die beste Familie, die ein drachenreitender Junge sich wünschen konnte.
»Er schläft viel«, antwortete Lung. »Aber es geht ihm gut. Er macht sich bereit. Wenn ich dich das nächste Mal besuche, wird er fort sein.«
Ben strich Schieferbart über den schimmernden Hals. Seine silbrigen Schuppen wurden mit jedem Tag dunkler, als verwandelte er sich in die Nacht, die Lieblingszeit aller Drachen. Über dem riesigen schlafenden Körper flirrten ein paar winzige Lichter in der Dunkelheit, wie Staub, der in der Sonne tanzte.
»Es beginnt«, flüsterte Ben.
»Ja.« Lung legte ihm die Schnauze auf die Schulter. Es war das erste Mal, dass Menschen Zeuge wurden, wie ein Drache sich friedlich von diesem Leben verabschiedete. Lung hatte es Ben und den Wiesengrunds erklären müssen. In all ihren Büchern ließ sich darüber nichts finden, vielleicht, weil all die, die Drachen in alten Zeiten so gern die Köpfe abgeschlagen hatten, sich nicht damit aufgehalten hatten, zuzusehen, was danach geschah.
Ben blickte hinauf zur Höhlendecke, wo sich mit jedem Tag mehr Lichter sammelten. ›Wenn ein Drache stirbt, sät er neue Sterne‹, hatte Lung erklärt. ›Je friedlicher sein Abschied von diesem Leben, desto mehr werden es. Aber wenn das Ende eines Drachen blutig ist, gebiert sein Tod rote Sterne, in denen sein Schmerz und Zorn weiterleben. Leider gibt es davon am Himmel einige!‹
Schieferbart würde sicher keine roten Sterne säen. Er würde friedlich gehen. Dafür würden alle Bewohner von MÍMAMEIÐR sorgen. Und sie alle würden ihn vermissen. Ben ganz besonders. Er hatte den alten Drachen immer besucht, wenn seine Sehnsucht nach Lung allzu groß wurde. Der Saum des Himmels verbarg sich in den Bergen des Himalaja, und die waren schrecklich weit entfernt von Norwegen.
»Lung! Oh, sie gehören alle gegrillt! Ich weiß, Drachenfeuer sollte man sorgsam einsetzen. Aber es wäre für einen guten Zweck!«
Die Stimme, die trotz der frühen Stunde so schrill in die Höhle drang, kannte Ben fast ebenso gut wie Lung.
Schwefelfell.
Bei ihrer ersten Begegnung hatte Ben sie sehr zu ihrem Ärger mit einem Rieseneichhörnchen verglichen. Inzwischen wusste er natürlich genug über Fabelwesen, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass er eine schottische Koboldin vor sich hatte. Und dass Kobolde für Drachen so unersetzlich waren wie das Mondlicht, das sie nährte.
»Ihr hättet sehen sollen, wie sie sich aufgeführt haben! Wegen ein paar Pfifferlingen!« Schwefelfell senkte schuldbewusst die Stimme, als sie den schlafenden Schieferbart sah. »Als gehörte jeder Pilz in diesem verdammten Wald ihnen!«, flüsterte sie, während sie den Korb absetzte, den sie in den braunen Pfoten hielt. »Warum? Weil sie selbst wie wandelnde Champignons aussehen? Wer hat je gesagt, dass wir Pilze mit Armen und Beinen brauchen! Sie können froh sein, dass ich sie nicht einfach fresse!«
Schieferbart schlug die goldenen Augen auf und ließ ein belustigtes Grunzen hören. »Schwefelfell«, murmelte er. »Ich bin sicher, dass mich selbst im Land des Mondes morgens eine Koboldstimme wecken wird.«
»O ja, man entkommt ihnen bestimmt nirgendwo!« Der winzige Mann, der sich aus Bens Jackentasche schob und die verschlafenen Augen rieb, hörte auf den Namen Fliegenbein. Er war ein Homunkulus, vermutlich der Letzte auf der Welt, seit ein Ungeheuer namens Nesselbrand seine elf Brüder verspeist hatte. Derselbe Alchemist, der Nesselbrand erschaffen hatte, war auch Fliegenbeins Schöpfer und die einzige Art Vater, die Fliegenbein zu seinem Bedauern kannte. Es ist nicht leicht, ein künstliches Geschöpf zu sein, selbst wenn man das Glück hat, so ungewöhnliche Wesen wie Drachen und Kobolde zu seinen Freunden zu zählen.
»Ich nehme an, du hattest schon wieder Streit mit den Pilzlingen?«, fragte er Schwefelfell spitz, während er an Bens Arm hinaufkletterte und auf der Schulter des Jungen Platz nahm.
»Und?«, schnappte die Koboldin. »Pilzlinge! Senf-Wichtel! Odinszwerge! Igelmänner! All diese Winzlinge treiben jeden Kobold in den Wahnsinn! Du solltest wirklich mal mit deinen Eltern reden«, sagte sie zu Ben. »Warum erlasst ihr nicht eine Größenregel? So was wie: MÍMAMEIÐR nimmt nur Fabelwesen auf, die mindestens die Schulterhöhe eines Hundes haben. Alle anderen sollen bleiben, wo sie sind!«
»Ach ja? Schließe ich daraus, dass du mir auch das Aufenthaltsrecht entziehen willst?«, fragte Fliegenbein irritiert.
Der Homunkulus hatte lange gebraucht, sich mit der Koboldin anzufreunden, und selbst nach zwei Jahren Bekanntschaft fand er Schwefelfells Launen bisweilen sehr aufreibend. Ben tröstete Fliegenbein gern damit, dass Wassermänner und Leprechauns noch wesentlich launischer waren, obwohl auch Bens erste Begegnung mit Schwefelfell keineswegs glatt abgelaufen war. Ein Kobold ließ nichts und niemanden zwischen sich und seinen Drachen kommen, und Schwefelfell hatte den Jungen, der Lungs Herz so schnell gewonnen hatte, sehr lange mit Misstrauen und Eifersucht betrachtet.
»Schon gut, schon gut!«, murmelte sie, während sie sich vor Schieferbart hinkniete. »Rechthaberisch wie immer. Sind alle Homunkulusse so? Ich nehme an, wir werden es nie herausfinden, da es nur noch einen gibt.«
Sie griff in ihren bis zum Rand gefüllten Korb und nahm einen milchweißen, schwammigen Pilz heraus.
»Das hier ist eine ganz besondere Köstlichkeit! Ich habe mehr als zwei Stunden nach ihm gesucht und ein Dutzend Pilzlinge von meinen Beinen schütteln müssen, um ihn zu pflücken. Kobolde essen jeden Tag einen, wenn ihr Fell grau wird, also wird er Drachen sicher auch guttun! Ich weiß, ich weiß, euch schmeckt Mondlicht am besten. Aber selbst Lung macht ab und zu eine Ausnahme, wenn ich ihm besonders schmackhafte Blüten oder Beeren bringe. Nicht dass die sich im Himalaja leicht finden lassen!«, setzte sie mit einem vorwurfsvollen Blick in Lungs Richtung hinzu.
Dann legte sie Schieferbart den Pilz wie eine schweren Herzens dargebrachte Opfergabe zwischen die Tatzen. Jeder, der auch nur etwas über schottische Bergkobolde weiß, kann an diesem Geschenk ermessen, wie groß Schwefelfells Zuneigung für den alten Drachen war. Kobolde lieben nur eins ebenso sehr wie den Drachen, dem sie folgen: Pilze, ob klein oder groß, fest oder schwammig. Schwefelfell konnte Stunden damit verbringen, Farbe, Form und Geschmack ihrer Lieblingssorten zu beschreiben.
Schieferbart wusste all das natürlich. Er hatte drei Koboldgefährten in seinem langen Leben gehabt. Sie waren ihm alle ins Land des Mondes vorausgegangen und er vermisste sie sehr. Umso glücklicher hatte es ihn gemacht, dass nicht nur Lung die weite Reise unternommen hatte, um sich von ihm zu verabschieden, sondern auch Schwefelfell.
»Das ist wirklich über alle Maßen großzügig, meine verehrte Schwefelfell«, sagte er, während er den Kopf vor ihr beugte. »Du warst schon immer die begabteste Pilzsucherin unter allen mir bekannten Kobolden! Erlaube, dass ich dein Geschenk zum Abendessen verzehre.«
»Und ich werde ein Wörtchen mit den Pilzlingen reden müssen«, sagte Ben.
Er hatte sich freiwillig für die Betreuung aller Wichtel in MÍMAMEIÐR gemeldet (und zu denen musste man die Pilzlinge wohl zählen). Keine kluge Entscheidung, wie sich herausgestellt hatte. Guinever, Bens adoptierte Schwester, hatte die Wasserwesen übernommen – eine Wahl, um die Ben sie inzwischen beneidete. Selbst Fossegrimme, die fiedelnden norwegischen Wassermänner, von denen es einige in MÍMAMEIÐR gab, nahmen es an Streitlust nicht mit den Wichteln auf.
Aber als Ben aus Schieferbarts Höhle trat, um sich auf den Weg zu den Pilzlingsbauten zu machen, flatterte ein Nebelrabe zwischen den Bäumen hervor und landete vor ihm im taufeuchten Gras. Nebelraben verdanken ihren Namen nicht nur ihrem grauen Gefieder, sondern auch der Tatsache, dass sie sich unsichtbar machen können.
»Alarmstufe Rot!«, krächzte der Rabe. »Kommandozentrale! Sofort!«
Nebelraben haben eine Vorliebe für militärisches Vokabular und für Äußerungen, die bedeutsam und rätselhaft klingen. Doch sie sind auch erstklassige Kundschafter und sehr zuverlässige Nachrichtenüberbringer. Dass dieser ausgesprochen glücklich geklungen hatte, ließ Ben und Fliegenbein einen besorgten Blick tauschen.
Nur schlimme Nachrichten machten Nebelraben so glücklich.
2. Ein Anruf aus Griechenland
Mir erscheint die Natur als die größte Quelle menschlicher Begeisterung und sichtbarer Schönheit, als bedeutendster Ursprung intellektuellen Interesses. Sie ist die wichtigste Quelle von so vielem, was das Leben lebenswert macht.
Sir David Attenborough
Nicht viele Gebäude dieser Welt können sich unsichtbar machen. Aber das Haupthaus von MÍMAMEIÐR verschmilzt so vollkommen mit Wald, Erde und Himmel, dass die meisten Besucher es erst bemerken, wenn sie davorstehen. Ben kam es jedes Mal vor, als näherte er sich einem Lebewesen aus Holz, Stein und Glas, das großen Spaß daran hatte, sich vor ihm zu verstecken. Und wer weiß, vielleicht lebte das Haus tatsächlich. Schließlich hatte es ein Fjordtroll gebaut.
Sein Name war Hothbrodd und alle Gebäude MÍMAMEIÐRs wurden nach seinen Anweisungen gebaut. Meist schnitt Hothbrodd die Bretter und Balken sogar eigenhändig zu, und er verbrachte Wochen damit, die Fassaden seiner Bauwerke mit kunstvollen Schnitzereien zu verzieren. An diesem frühen Morgen säuberte er die Verzierungen über der Eingangstür, mit einem Messer, das ein noch furchterregenderer Anblick war als er selbst. Der geschnitzte Drache, der sich über einen der Balken wand, war ein sehr gelungenes Porträt von Lung, aber es fanden sich auch Große Kraken, Zentauren und fiedelnde Fossegrimme an der Fassade. Hothbrodd konnte jedes Geschöpf auf diesem Planeten schnitzen.
»Verdammte Nebelraben!«, schimpfte der Troll, als Ben mit Fliegenbein neben ihm stehen blieb. »Irgendwann drehe ich ihnen die grauen Hälse um, wenn sie nicht aufhören, meine Schnitzereien vollzuscheißen!«
Hothbrodd überragte selbst ausgewachsene Menschen um fast einen Meter, aber Ben hatte sich inzwischen an die Größe des Trolls gewöhnt. Schließlich war er mit einem Drachen befreundet. Hothbrodds Haut war graugrün und borkig wie die Rinde einer Eiche, und Ben hatte durch ihn gelernt, dass Trolle, im Gegensatz zu all den Geschichten, die man sich über sie erzählte, nicht nur sehr stark, sondern auch sehr klug waren. ›Fjordtrolle!‹, hätte Hothbrodd hinzugefügt. ›Bergtrolle sind genauso dämlich, wie man sagt.‹ Er hatte von Menschen keine bessere Meinung. Hothbrodd unterhielt sich lieber mit Kiefern, Buchen und Eichen (auch wenn er für die Wiesengrunds eine Ausnahme machte), und die Dinge, die er aus ihrem Holz fertigte, ließen einen an Zauberei glauben. Wie immer man seine Kunst erklärte: Es war Hothbrodd zu verdanken, dass MÍMAMEIÐRs Gebäude so außergewöhnlich wie ihre Bewohner waren, und für das Haupthaus galt das besonders. Die Außenmauern bestanden an vielen Stellen aus Glas, und Hothbrodds Messer hatte die Balken und Streben, die die großen Scheiben rahmten, mit so verschlungenen Mustern bedeckt, dass Ben ständig neue Geschöpfe darin entdeckte.
Ja, es gab sicher nirgendwo auf der Welt ein magischeres Haus als dieses.
An das Haus, in dem er geboren worden war, erinnerte Ben sich so vage wie an seine Eltern. Sie waren beide kurz nach seinem dritten Geburtstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und Ben hatte die folgenden sieben Jahre in einem Gebäude verbracht, das die Kinder, die darin wohnten, sicher niemals als Zuhause bezeichnet hätten. Das Wort nahm man unter seinem Dach ebenso wenig in den Mund wie die Wörter Vater oder Mutter. Warum von etwas reden, das man nicht hatte und sich doch so sehnsüchtig wünschte, dass einem bei dem bloßen Gedanken daran übel wurde? Väter und Mütter waren in Bens Kindheit so unwirkliche Geschöpfe gewesen wie der Drache, dem er mit elf Jahren begegnet war. Irgendwann hatten ihn Pflegeeltern zu sich genommen, aber sie waren noch schlimmer gewesen als das Heim, und Ben war ihnen davongelaufen – und hatte sich von da an nicht mehr erlaubt, von einer Familie zu träumen. Bis er die Wiesengrunds getroffen hatte. Vielleicht musste man Träume begraben, damit sie wahr wurden.
Bens adoptierte Eltern, wie Barnabas und Vita Wiesengrund sich gern nannten, hatten ihr Leben der Aufgabe gewidmet, die seltensten Geschöpfe dieser Welt vor menschlicher Gier und Neugier zu beschützen. Das machte nicht reich. Als Ben bei den Wiesengrunds eingezogen war, hatten sie in einem viel zu kleinen Haus im Nordwesten Englands gelebt, in dem Ben sich ein Zimmer mit seiner neuen Schwester Guinever, sechs schnarchenden Hobs (wie man Heinzelmänner in England nennt) und ein paar Grasfeen geteilt hatte, denen der Rasenmäher eines Nachbarn fast zum Verhängnis geworden war. Aber dann hatte eines Tages eine Zigarrenkiste mit zehn lupenreinen Edelsteinen auf der Türschwelle gestanden, Spende einiger dankbarer Steinzwerge, deren Dorf die Wiesengrunds evakuiert hatten, bevor es für eine neue Straße in die Luft gesprengt worden war. Und Bens adoptierte Eltern hatten endlich ihren Traum von einer Zuflucht für Fabelwesen in die Tat umsetzen können. Dass sie MÍMAMEIÐR nicht in England, sondern in Norwegen gebaut hatten, lag zum einen daran, dass ihre fabelhaften Gäste in dessen einsamen Wäldern leichter unbemerkt blieben – und dass Barnabas’ Vorfahren von dort stammten.
Ben sah, dass nicht nur Hothbrodd schon wach war, als er neben dem Troll stehen blieb. Ein Dutzend Nisserkinder saß andächtig zu seinen Füßen und bewunderte, wie geschickt Hothbrodd mit dem riesigen Messer umging. Er war ständig von Nisser- und Wichtelkindern umgeben – ein beunruhigender Anblick angesichts der riesigen Stiefel des Trolls –, aber noch war keiner der Winzlinge zu Schaden gekommen.
»Hey, Hothbrodd«, sagte Ben, während Fliegenbein auf seiner Schulter höflich ein Gähnen hinter der Hand verbarg. »Weißt du, was passiert ist? Der Nebelrabe, der uns gerufen hat, sah verdächtig glücklich aus.«
Hothbrodd runzelte die Stirn und schabte einem geschnitzten Wichtel den Rabenkot von der Nase. »Irgendeine Nachricht aus Griechenland«, brummte er. »Und ja, ich glaub, sie war ziemlich schlecht.«
Ben wechselte einen besorgten Blick mit Fliegenbein. Griechenland … Vita und Barnabas hatten dort vor knapp einem Jahr in einem Bergtal ein Pegasuspaar entdeckt. Vita war vor ein paar Tagen mit Guinever aufgebrochen, um nach ihnen zu sehen.
Ben überließ seine schlammigen Stiefel dem Leprechaun, der in dem Garderobenschrank hinter der Eingangstür wohnte, und betrat das Haus, das er mehr als jedes andere auf der Welt liebte.
Die Porträts und Fotos an den Wänden der Eingangshalle zeigten Freunde und Mitstreiter der Wiesengrunds. Einige hatten Fabelwesen unter ihren Vorfahren, auch wenn man ihnen das oft nicht ansah. Verdächtig spitze Ohren, ein Kuhschwanz, Froschhaut zwischen den Zehen … All das war leicht zu verbergen. Selbst eine Spur von Pelz im Gesicht ließ sich als lästig starker Bartwuchs ausgeben. Der Schnabel von Professor Buceros und die Kiemen von Doktor Eel waren da schon schwerer zu erklären – weshalb sich beide nur dem innersten Kreis von FREEFAB zeigten. (Den Namen hatten Ben und Guinever der Organisation ihrer Eltern gegeben. Vita und Barnabas sprachen lieber von den »Beschützern«.) Unter Doktor Eels Fotos schlief in einem Hundebett eine Familie fliegender Watobi-Schweine, die ein Freund der Wiesengrunds im Kongo vor Wilderern gerettet hatte. Unter der Garderobe ragte der schuppige Schwanz eines Fotomeleons hervor und von dem Leuchter unter der Decke blickten zwei gefiederte Frösche auf Ben herab. Wie konnte man MÍMAMEIÐR nicht lieben?
»Kommandozentrale«. Barnabas Wiesengrund war kein Freund des Namens, den die Nebelraben seiner Bibliothek gegeben hatten – auch wenn sie die Bezeichnung in vieler Hinsicht verdiente. Die Bibliothek war der größte Raum des Hauses, und zwei Wände waren, wie es sich für eine Bibliothek gehörte, bis unter die Decke mit Büchern gefüllt. Die Außenmauer aber war aus Glas, was einem das Gefühl gab, dass die Bücher zwischen Bäumen standen. Im Winter konnte man durch ihre kahlen Kronen den nahen Fjord sehen, doch an diesem regnerischen Maimorgen wimmelten die frühlingsgrünen Zweige von Krähenmännern und Tomtes, die ihre Behausungen zwischen die Nester von Ammern und Laubsängern bauten.
Das Lächeln, mit dem Barnabas Ben begrüßte, war warm wie immer, aber Ben sah ihm an, dass etwas wirklich Schlimmes passiert sein musste.
An der vierten Wand der Bibliothek hing ein Dutzend Bildschirme, über die Fabelwesen-Schützer aus aller Welt von Geschöpfen berichteten, die sich in die Obhut der Wiesengrunds begeben hatten. Sie waren dunkel bis auf einen, der Guinever in dem abgelegenen griechischen Bergtal zeigte, in dem ihre Eltern die zwei Pegasi entdeckt hatten. Bild und Ton waren so schlecht, dass Ben sich wieder einmal wünschte, Barnabas würde einen der Edelsteine, die von der Spende der Steinzwerge übrig waren, in neue Kameras und Computer investieren. Aber Barnabas wies immer wieder zu Recht darauf hin, dass sie angesichts der vielen Flüchtlinge, die nach MÍMAMEIÐR kamen, besser mit dem Geschenk der Zwerge haushalteten. Trotzdem – ›Froschschleim und Vogeldreck‹, wie Hothbrodd geflucht hätte –, das Bild war so schlecht, dass Guinever aussah, als stünde sie auf einem anderen Planeten! Was sie sagte, vertrieb allerdings alle Gedanken an bessere Kameras und erinnerte Ben daran, dass es sehr viel größere Sorgen gab.
»Wir nehmen an, dass es eine Hornotter war. Es ist furchtbar, Dad! Vielleicht ist Synnefo aus Versehen in das Nest der Schlange getreten. Das Gift hat schneller gewirkt als bei Menschen! Ànemos ist außer sich!«
Ben blickte bestürzt zu Barnabas hinüber. Synnefo war die Pegasusstute. Ànemos war der Hengst. Die zwei waren vermutlich die letzten Vertreter ihrer Art, und jeder in MÍMAMEIÐR erinnerte sich an die Aufregung, als Lola Grauschwanz, ihre beste Kundschafterin (und einzige fliegende Rättin dieser Welt), mit Fotos von einem Nest und drei frisch gelegten Pegasuseiern aus Griechenland zurückgekehrt war.
Hothbrodd schob sich durch die Tür und blickte mit besorgter Miene zu dem Bildschirm hinauf, auf dem nun auch Vita erschien. Ben nannte Vita Wiesengrund ebenso wenig Mutter, wie er Barnabas Vater nannte, auch wenn er sie sehr liebte. Die beiden schienen so viel mehr: Freunde, Lehrer, Beschützer.
Ben hatte Vita selten trauriger dreinblicken sehen. Ihre Augen waren verweint wie die von Guinever, und Vita kamen nicht leicht die Tränen.
»Wir können Ànemos kaum dazu bewegen, zu fressen, Barnabas!«, sagte sie. »Er ist halb wahnsinnig vor Verzweiflung! Und er weiß wie wir, dass er nun auch noch seine Kinder verlieren könnte. Es wird nicht leicht sein, die Eier im norwegischen Frühling warm zu halten, aber ich glaube, es gibt nur Hoffnung für die Fohlen, wenn wir das Nest und Ànemos nach MÍMAMEIÐR bringen. Guinever ist derselben Meinung.«
Guinever nickte bestärkend. Viele Leute reagierten sehr verwundert darauf, wie viel die Wiesengrunds auf die Meinung ihrer Kinder gaben. ›Erstaunlich, nicht wahr?‹, hatte Barnabas das einmal kommentiert. ›Als ob es nicht offensichtlich ist, dass Alter selten etwas über die Einsicht eines Menschen sagt. Ich möchte sogar behaupten, dass Dummheit und Engstirnigkeit sich in bedauerlich vielen Fällen mit jedem Geburtstag multiplizieren!‹
Die Wiesengrunds legten so viel Wert darauf, mit ihren Kindern zusammenzuarbeiten, dass Ben und Guinever zu Hause unterrichtet wurden. Und sie hatten wunderbare Lehrer: Fliegenbein brachte ihnen Geschichte und alte Sprachen bei (sehr wichtig, wenn man es mit Geschöpfen zu tun hatte, die leicht Tausende von Jahren alt waren), Dr. Phoebe Humboldt, ihre Lehrerin in Fabelwesen-Kunde, hatte vier Jahre in einem versunkenen Schiff nahe der ligurischen Küste verbracht, um Nymphen und Wassermänner zu studieren. In Geografie unterrichtete sie Gilbert Grauschwanz, ein weißer Rätterich, den Barnabas von der Hamburger Speicherstadt nach MÍMAMEIÐR gelockt hatte, um Landkarten anzufertigen, die die Wohnorte aller ihnen bekannten Fabelwesen festhielten. Einer von Bens wenigen menschlichen Lehrern, James Spotiswode, versuchte, ihnen Mathematik, Biologie und Physik beizubringen – eine ähnlich schwierige Aufgabe, wie Wölfe davon zu überzeugen, keine Wichtel zu fressen –, aber da Professor Spotiswode Ben und Guinever zur Belohnung für jedes gelöste naturwissenschaftliche Problem Lektionen in Roboterkunde und Telepathie gab, hatte er sehr eifrige Schüler. Kurz, die beiden lernten, was sie für die Aufgabe brauchten, der sie wie ihre Eltern ihr Leben widmen wollten: Beschützer all der Geschöpfe zu sein, die ohne ihre Hilfe vielleicht bald wirklich nur noch in Märchenbüchern zu finden sein würden.
»Den Stall warm zu halten, ist kein Problem.« Hothbrodd zog ein Stück Holz aus der Tasche und begann, daraus eine Eidechse zu schnitzen. »Die Wolleichler können das Nest und die Stallwände polstern.«
Barnabas nickte, auch wenn er nicht allzu überzeugt dreinblickte.
»Gut«, sagte er. »Hothbrodd wird den Stall vorbereiten, und ich werde Undset bitten, bei eurer Ankunft hier zu sein. Ich bezweifle, dass sie je einen Pegasus behandelt hat, aber vielleicht kann sie helfen, wenigstens Ànemos am Leben zu halten.«
Undset war eine junge Tierärztin aus Freyahammer, einem benachbarten Dorf, die schon zahllose Bewohner MÍMAMEIÐRs verarztet hatte. Es war nicht leicht gewesen, jemanden zu finden, auf dessen Verschwiegenheit sie sich verlassen konnten. Viele Jäger hätten ein Vermögen für die Information bezahlt, dass es in Norwegen einen verborgenen Ort gab, an dem man so rare Beute wie Wasserpferde und Drachen antreffen konnte. Aber Undset, Holly Undset mit vollem Namen, war eine so leidenschaftliche Gegnerin von Wolfs- und Bärenjagden, dass Barnabas sie eines Tages nach MÍMAMEIÐR eingeladen hatte.
Als der Bildschirm schwarz wurde, auf dem Vita und Guinever die schlechte Nachricht verkündet hatten, füllte bedrücktes Schweigen die Bibliothek. Selbst Hothbrodd hatte das Schnitzmesser sinken lassen. In einem der Regale lehnten Fotos des Pegasusnestes an den Buchrücken. Ben trat darauf zu und betrachtete die drei silbernen Eier. Sie waren kleiner als Hühnereier. Guinever hatte sich ausgemalt, wie winzig die geschlüpften Fohlen sein würden, bis Vita ihr erklärt hatte, dass Pegasuseier nicht so klein blieben, sondern nach zwei Monaten zu wachsen begannen.
»Wir könnten die Eier mit Heizdecken wärmen«, schlug Ben vor. »Oder in dem Brutkasten, den wir für das verlassene Wildgansgelege benutzt haben.«
Aber Barnabas schüttelte den Kopf. »Das könnte sich als riskant erweisen. Nicht nur, weil Technologie, wie du weißt, in der Gegenwart von Fabelwesen oft versagt. Die Eier einiger geflügelter Arten bersten, wenn sie mit Kunststoff oder Metall in Berührung kommen. Ein Risiko, das wir unmöglich eingehen können. Fliegenbein, du hast diese Bibliothek maßgeblich mitgestaltet und im Gegensatz zu uns allen jedes einzelne Buch gelesen. Kannst du uns weiterhelfen?«
Der Homunkulus war sichtlich geschmeichelt.
»Ich glaube mich zu erinnern, dass wir das Faksimile einer italienischen Handschrift besitzen, in der unter anderem auch von Pegasuseiern die Rede ist«, sagte er, während er an den Regalen entlangblickte. »Wo stand das noch gleich? Moment. Ah ja.«
Er kletterte behände an Bens Arm hinab und balancierte über Stuhllehnen und Tische, bis er vor seinem kaum streichholzschachtelgroßen Computer stand. Ben hatte ihn gemeinsam mit Professor Spotiswode für Fliegenbein gebaut. Der Homunkulus hatte das Tippen darauf so schnell gelernt wie alles, was man ihm beibrachte, und sogar seine eigene Software entwickelt, die niemand außer ihm selbst verstand.
»Ah ja. Da ist es: Pegasuseier, Besonderheiten: siehe italienische Alchemistenhandschrift, 17. Jahrhundert. Seite 27, Zeile 16.«
Fliegenbein klappte den Computer zu und kletterte so mühelos an einem der hohen Bücherregale hinauf, dass er seinem Namen alle Ehre machte. Der Homunkulus liebte seinen Streichholzschachtel-Computer. Er führte Tagebuch darauf, verzeichnete jeden fabelhaften Neuankömmling in MÍMAMEIÐR samt Beschreibung, Herkunft und Nahrungsvorlieben in endlosen Dateien und verbrachte Stunden damit, jede neue Information über Fabelwesen und andere seltene Geschöpfe darauf festzuhalten. Seine große Liebe aber waren immer noch Bücher. Fliegenbeins spitznasiges Gesicht verklärte sich mit kindlichem Entzücken, wenn er in bedruckten Seiten blätterte, und je älter sie waren, desto andächtiger wendete er Papier und Pergament. Ben hatte sich schon so manches Mal bei der Sorge ertappt, dass den Homunkulus eines Tages einer der schweren Wälzer erschlagen würde, die er aus den Regalen zog. Auch diesmal war das Buch, das er nach kurzer Suche zwischen den anderen hervorzerrte, sehr viel größer als er selbst.
»Darf ich dir helfen, lieber Fliegenbein?« Barnabas teilte Bens Sorge offenbar.
Er hob Buch und Homunkulus vom Regal und setzte sie auf einem Schreibpult ab, unter dem ein Hobgoblin hauste, der für Bens Geschmack allzu oft sehr misstönend auf seiner Mundharfe spielte.
»Einen Augenblick Geduld … Ich habe es gleich …« Fliegenbein blätterte die pergamentenen Seiten so behutsam um, als könnten sie ihm unter den winzigen Fingern zu Staub zerfallen. »25, 26 … Ja! Da ist es! Das Italienisch ist sehr altmodisch, ich gebe es in einer moderneren Übersetzung wieder …«
Er räusperte sich, wie immer, wenn er sich anschickte, etwas laut vorzutragen: »Das Ei des geflügelten Pferdes, Pegasus unicus, gehört zu den größten Wundern dieser Welt. Seine anfangs silberne Schale wird, während das Fohlen wächst, zunehmend transparent, bis sie kostbarstem Glas gleicht. Dennoch nimmt sie es an Festigkeit mit Diamanten auf. Die wundersamste Eigenschaft zeigt sich allerdings erst, wenn das Fohlen ein Alter von sechs Wochen erreicht und so groß ist, dass die Schale sein Wachstum beengt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Stute, an der Schale zu lecken, worauf das Ei zu wachsen beginnt, ohne seine Festigkeit zu verlieren. Allerdings …« Fliegenbein hob den Kopf und wechselte einen alarmierten Blick mit Ben und Barnabas. »Allerdings«, las er weiter, »ruft nur der Speichel der Mutter diesen Effekt hervor. Kommt sie zu Schaden, wächst das Ei nicht, und das Fohlen erstickt in der unzerbrechlichen Schale.«
Hothbrodd stieß sein Schnitzmesser so tief in das Schreibpult, unter dem der Hobgoblin saß, dass dem die Mundharfe aus den pelzigen Fingern fiel. Es hatte zu regnen begonnen. Barnabas trat vor die Glaswand, von der ein Dutzend Kristallschnecken die rinnenden Tropfen leckte, und blickte nach draußen.
»Hothbrodd, kannst du einen Nebelraben zu Undset schicken, damit sie Bescheid weiß und sich darauf einrichtet, hier zu sein, wenn der Pegasus eintrifft?«
Der Troll nickte wortlos und verschwand mit schweren Schritten nach draußen.
Der letzte Pegasus in MÍMAMEIÐR … Ben war sehr froh, dass sie Undset trauen konnten. Er wagte nicht, sich auszumalen, was geschehen würde, wenn die Welt von der Existenz eines geflügelten Pferdes erfuhr. Barnabas hatte sich früher offen dazu bekannt, an die Existenz von Fabelwesen zu glauben. Doch inzwischen waren die Wiesengrunds der Überzeugung, dass die einzige Chance für das Überleben dieser Geschöpfe Geheimhaltung war – Geheimhaltung und ein Netzwerk von Eingeweihten, in das man nicht leicht aufgenommen wurde. Inzwischen gehörten zu FREEFAB nicht nur Schützer von Großen Kraken, Sphinxen und Steinzwergen, sondern auch viele Männer und Frauen, die sich zu Fürsprechern anderer bedrohter Geschöpfe machten – ob Gorillas, Kegelrobben, Luchse, Meeresschildkröten oder eins der zahllosen anderen wundersamen Tiere, die vom Aussterben bedroht waren.
Hothbrodd kam zurück. Der Troll musste sich tief bücken, um durch die Tür zu passen. Als Fliegenbein ihn einmal gefragt hatte, warum die Türrahmen trotz der sehr unterschiedlichen Bewohner nach Menschenmaß gebaut waren, hatte der Troll nur geknurrt: ›Nicht Menschenmaß, Homunkulus. Sie sind für Barnabas gebaut.‹ Guinever vermutete, dass Hothbrodd ihrem Vater sein Leben verdankte, aber sie ließen sich beide nicht entlocken, wie genau sie einander begegnet waren.
»Irgendeine Idee, wie wir die Eier ohne die Stute zum Wachsen bringen, Barnabas?« Der Troll sprach oft aus, was alle anderen nur dachten. Barnabas schätzte diese Eigenschaft sehr.
»Ich habe nicht die geringste Ahnung, Hothbrodd«, murmelte er, während er hinaus in den Regen starrte. »Und wir können froh sein, wenn der Kummer den Hengst nicht auch noch umbringt. Ich gebe zu, ich bin etwas ratlos. Aber …«, er wandte sich zu den Bildschirmen um, die wie schlafende Augen von der Wand blickten, »… wozu hat man Freunde?«
3. Die Beschützer
An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.
Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer
Ein paar Stunden später blickte eine Ansammlung besorgter Gesichter von MÍMAMEIÐRs Bildschirmen. Ben kannte und bewunderte sie alle.
Da war Jacques Maupassant, Spezialist für fantastische Wassergeschöpfe (was natürlich Wale, Delfine und Korallen einschloss). Sir David Atticsborough, einer der angesehensten Naturfilmer der Welt, beriet FREEFAB beim Drehen von Videos, die Jäger und Tierhändler auf falsche Spuren und an falsche Orte lockten. November Tan organisierte Schutzpatrouillen gegen Wilderer in aller Welt und erforschte für FREEFAB die Nahrungsgewohnheiten von Fabelwesen. Inua Ellams, der weltbekannte Fürsprecher afrikanischer Vögel, war FREEFABs Spezialist für geflügelte Fabelwesen. Maisie Richardson hatte sich sehr verdient um den Schutz von Gras- und Farnfeen gemacht, und Jane Gridall konnte sich nicht nur mühelos mit jedem Primaten unterhalten, sondern war auch die Erfinderin einer Zeichensprache, die die Kommunikation mit fast jeder Spezies des Planeten möglich machte.
Schon bald wurde heftig debattiert, wie man die Fohlen retten konnte. Maupassant schlug vor, die Eier mit Drachenspeichel einzureiben, sobald die Fohlen in ihren Schalen zu groß wurden – allen FREEFAB-Mitgliedern war bekannt, dass Barnabas Wiesengrund sehr gute Beziehungen zu Drachen unterhielt. November Tan fragte, ob es Versuche mit Seepferdspucke gab. Maisie Richardson bot an, die Feen in ihrem Garten zu bitten, die Schalen mit ihrem Staub zu besprenkeln, in der Hoffnung, dass sie das zum Wachsen brachte. Jane Gridall berichtete von ihren Erfahrungen mit vorzeitig geschlüpften Küken des Elefantenstraußes, und Inua Ellams schlug vor, die Fohlen durch den Gesang eines Heilenden Himmelsvogels zu stärken (den er auf sehr eindrucksvolle Weise imitierte).
Barnabas nickte zu all dem interessiert, aber Ben sah, dass die Furchen auf seiner Stirn tiefer und tiefer wurden.
»Werte Kollegen und Freunde«, sagte er schließlich. »Ich bedanke mich vielmals, natürlich auch und vor allem im Namen des verzweifelten Vaters. Ich versichere, dass wir alle Vorschläge überdenken werden. Wir haben einen Himmelsvogel zu Gast, und selbst Drachen sind verfügbar, aber ihr Speichel ist so feurig, dass ich von dem Vorschlag abrate. Es wird, fürchte ich, unmöglich sein, die Schalen aufzubrechen, bevor die Fohlen das Alter zum Schlüpfen erreichen. Nein, wir müssen etwas anderes finden, das die Eier zum Wachsen bringt. Aber was?« Barnabas ließ einen Seufzer hören, der ein Dutzend Nisser zwischen den Büchern hervorlockte. »Und wie finden wir es in weniger als zwei Wochen? Eins steht fest: Wenn es uns nicht gelingt, werden wir die letzten Pegasusfohlen dieser Welt verlieren. Was vermutlich auch das Ende der Art bedeutet.«
»Aber das wäre eine Katastrophe, Barnabas!«, rief Inua Ellams.
»Ein Verlust epischen Ausmaßes für diesen Planeten!«, rief Sir David.
Die Ausrufe mischten sich, bis ein unverständlicher Chor von Stimmen die Bibliothek erfüllte. Ein schriller Pfiff ließ den Lärm abrupt verstummen. Er kam von einem Bildschirm, der bislang dunkel geblieben war. Der Neuankömmling war eindeutig kein menschliches FREEFAB-Mitglied. Seine Brille saß auf einem gewaltigen Schnabel und er rückte sie sich mit einem schwarz gefiederten Flügel zurecht.
»Entschuldige die Verspätung, Barnabas«, krächzte Sutan Buceros, ein Nashornvogel von beachtlicher Größe und legendärem Alter, der die Wiesengrunds schon oft beim Schutz von südostasiatischen Fabelwesen beraten hatte. Barnabas schätzte Sutans Alter auf sechshundertzwanzig Jahre. Die krächzende Stimme des Nashornvogels ließ das für Ben sehr glaubhaft erscheinen.
»Mein Assistent«, fuhr Buceros fort, »hat mir von dem Problem berichtet. Wurde schon der Vorschlag geäußert, die Pegasuseier durch die Sonnenfeder eines Greifs zu retten? Schließlich enthalten ihre Kiele eine Substanz, die sogar Metall und Stein zum Wachsen bringt.«
Die Stille, die Buceros’ Worten folgte, war so vollkommen, dass Ben einen überraschten Blick mit Fliegenbein wechselte. Er entdeckte nicht nur Ablehnung auf den Gesichtern, die von den Bildschirmen blickten, sondern auch einen Schatten von Furcht. Das einzige Gesicht, das sich aufgehellt hatte, war das von Barnabas.
»Nein, den Vorschlag hatten wir noch nicht, Sutan«, sagte er. »Sehr interessant. Und sehr peinlich, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin! Das könnte in der Tat die Lösung sein!«
»Aber Barnabas!«, rief Jane Gridall. »Greife sind wohl kaum für ihre Hilfsbereitschaft bekannt. Im Gegenteil. Sie verachten jede andere Kreatur! Ein Greif sieht alle Lebewesen nur als Beute an. Mit uns Menschen haben sie sich früher bloß eingelassen, weil wir ähnlich denken, aber das ist mehr als ein Jahrtausend her! Haben sie nicht nach irgendeiner Schlacht allen Menschen den Krieg erklärt und sind seither unauffindbar?«
»… eine, wie wir alle wissen, sehr begründete Reaktion auf die zwei großen G der menschlichen Spezies«, kommentierte Sutan Buceros.
Ben sah Barnabas fragend an.
»Gier und Größenwahn«, flüsterte er Ben zu.
»Ja, wir alle hier sind uns der zwei großen G schmerzlich bewusst, Sutan«, sagte Barnabas laut. »Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir das auch schon alle bewiesen haben. Aber hier geht es nicht um Menschen, sondern um das Überleben der letzten geflügelten Pferde!«
»Nun, ich fürchte, genau das verschärft das Problem, Barnabas.« Inua Ellams klang stets so, als sänge er die Worte mit seiner Stimme aus dunklem Samt. »Soweit mir bekannt ist, betrachten Greife Pferde als noch verachtenswerter und überflüssiger als jedes andere Lebewesen! Die Flügel machen da sicher keinen Unterschied.«
Die Köpfe auf den Bildschirmen nickten zustimmend und sichtlich erleichtert. Ben wusste nicht viel über Greife, aber vor ein paar Jahren hatte ihn ein Riesenvogel namens Rock fast an sein Küken verfüttert. Wenn Ben sich recht erinnerte, hatten Greife nicht nur einen ähnlich Furcht einflößenden Schnabel, sondern zusätzlich die Pranken eines Löwen und, als reichte das noch nicht, eine Giftschlange als Schwanz.
»Ich habe mehr als zwanzig Jahre lang nach einem Pegasus gesucht«, sagte Barnabas. »All die Jahre mit der Angst, dass es sie nicht mehr gibt, wie so viele andere wunderbare Geschöpfe. Und nun, wo es nach Jahrhunderten sogar Hoffnung auf Nachwuchs gibt, soll ich aufgeben? Unmöglich! Ich werde nicht untätig zusehen, wie diese Glück bringenden Geschöpfe aus meiner Welt und der meiner Kinder verschwinden! Selbst wenn das bedeutet, dass ich ein Fabelwesen um Hilfe bitten muss, das stolz auf seine Grausamkeit und sein Geschick beim Töten ist!«
Die Diskussion, die nun begann, konnte nach Bens Erfahrung viele Stunden dauern. Irgendwann nahm Barnabas ihn zur Seite und bat ihn, Lung von der bevorstehenden Ankunft des Pegasus zu berichten. »Aber kein Wort über Sutans Idee!«, raunte er Ben zu, während hinter ihnen darüber gestritten wurde, ob ein Greif sich durch Gold zur Herausgabe einer Sonnenfeder bewegen lassen würde. »Lung darf nicht erfahren, dass wir uns vielleicht auf die Suche nach einem Greif machen werden! Inua hat recht, sie verachten Pferde und ihre Verwandten mit Leidenschaft. Doch es gibt nur ein Lebewesen auf diesem Planeten, das sie als Konkurrenten und Erzfeind betrachten, und das …«
»… sind Drachen«, beendete Ben Barnabas’ Satz.
»Ganz genau! Du weißt so gut wie ich, dass Lung uns seine Hilfe anbieten wird, wenn er von dem Plan erfährt, aber es würde ihn in zu große Gefahr bringen!«
Ben nickte. Auch wenn er wusste, wie schwer es ihm fallen würde, Lung zu belügen. »Aber was soll ich ihm sagen?«, flüsterte er. »Falls wir vor ihm aufbrechen, wird er fragen, wohin wir fliegen!«
Barnabas runzelte die Stirn. »Warum sagst du nicht einfach, wir suchen nach der Feder eines Phönix? Das ist nicht gefährlich, und er wird glauben, dass wir seine Hilfe nicht brauchen!«
Würde er? Lung kannte ihn so gut.
Fliegenbein hätte die Phönix-Lüge sicher in wunderbar überzeugende Worte gefasst. (›Natürlich!‹, hätte Schwefelfell spitz kommentiert. ›Schließlich war er mal ein Verräter und Spion!‹) Aber der Homunkulus blieb bei Barnabas, um die Diskussion wie üblich in einem seiner Notizbücher festzuhalten. Ben vermisste ihn sehr, als er sich die Geschichte auf dem Weg zu Schieferbarts Höhle ein Dutzend Mal zurechtlegte. Was auch immer, Barnabas hatte recht. Lung würde sich nicht ausreden lassen, ihnen bei der Suche zu helfen, und die Greife klangen wirklich ganz und gar abscheulich … Ben musste zugeben, dass er inzwischen sehr neugierig auf sie war.
4. Nicht die ganze Wahrheit
Ich glaube an Feen, Mythen, Drachen. All das existiert, wenn auch nur in deinem Kopf. Wer kann denn sagen, ob Träume und Albträume nicht ebenso real sind wie das Hier und Jetzt?
John Lennon
Als Ben Schieferbarts Höhle erreichte, waren nur ein paar Odinszwerge dort, die sich mit Schieferbart angefreundet hatten, weil sie fast ebenso alt waren wie er. Sie erzählten Ben, dass Lung hinunter an den Fjord gegangen war.
Selbst die größten Fabelwesen haben ein beeindruckendes Talent, sich für Menschenaugen unsichtbar zu machen. Vielleicht unterscheidet sie das am deutlichsten von gewöhnlichen Tieren. Aber Bens Augen hatten Übung darin, sie selbst in den dichtesten Wäldern und dunkelsten Höhlen zu entdecken, und die Silhouette, nach der er Ausschau hielt, war ihm vertrauter als jede andere. Er fand Lung am Fjordufer. An einer Stelle, an der es so steil abfiel, dass sich die Nadelbäume, die es säumten, weit über das Wasser lehnten. Auch nach all den Jahren war es für Ben immer noch ein Wunder, wie reglos der Drache daliegen konnte – so eins mit der Welt, die ihn umgab, dass die meisten Menschen nichts von seiner Existenz ahnten.
Lungs Anwesenheit brachte noch mehr Fabelwesen als gewöhnlich nach MÍMAMEIÐR. Er und Schieferbart zogen selbst die an, die den Schutz der Wiesengrunds nicht brauchten. Der Fjord wimmelte von Sjöras und Wassermännern, und als Ben sich neben Lung ins Gras kniete, drang das Fiedeln von gleich drei Fossegrimmen zu ihnen herauf.
»Was ist passiert?« Der Drache beugte den Hals, bis sein Kopf auf Bens Augenhöhe war. »Du siehst sehr besorgt aus.«
O ja, Lung kannte ihn so gut. All die Monate, die sie inzwischen auf verschiedenen Seiten der Welt verbrachten, hatten daran nichts geändert. Wie sollte er ihm etwas vormachen? Doch. Er würde es können. Weil er es tat, um ihn zu beschützen. Der Drache und sein Drachenreiter … Es gab Nächte, in denen Ben die Sehnsucht nach Lung kaum schlafen ließ. Selbst an den kostbaren Tagen, die sie gemeinsam verbrachten, konnte er nie ganz vergessen, dass die nächste Trennung schon bevorstand. ›Das ist der Preis für die Freundschaft mit einem Geschöpf, das so anders ist als du selbst‹, hatte Barnabas eines Abends zu Ben gesagt, als er ihn draußen vor dem Haus gefunden hatte, sehnsüchtig nach Osten starrend. ›Du wirst immer Menschen brauchen und Lung wird sich immer vor ihnen verbergen müssen. Aber das macht eure Freundschaft nur umso kostbarer.‹ Barnabas hatte sicher recht, aber Ben fand es trotzdem schwer, sich damit abzufinden, dass er Lung nicht öfter sah – auch wenn er das dem Drachen nie gestanden hätte. Der Flug von Nepal nach Norwegen war zu gefährlich, um ihn ohne guten Grund zu riskieren.
»Barnabas hat mich gebeten, dir zu erzählen, dass wir bald sehr besonderen Besuch bekommen.«
Ben lehnte sich gegen Lungs silbrige Brust. Es war so wunderbar, seine Wärme und Kraft hinter sich zu spüren.
Der Drache schwieg, während Ben von den schlechten Nachrichten aus Griechenland erzählte.
»Ich bin sicher, Barnabas wird eine Lösung finden!«, sagte er, als Ben geendet hatte.
»O ja. Wir werden uns wohl auf die Suche nach einer Phönixfeder machen.« Ben war sehr froh, dass er Lung nicht in die Augen sehen musste.
»Eine Phönixfeder? Ich dachte, die setzen alles in Brand, was sie berühren?«
»O nein, nein. Diese nicht. Fliegenbein hat irgendwo gelesen, dass sie … ähm … dass sie sehr gut für Pegasuseier sind.«
Himmel. Ben wollte im Boden versinken. Er war so ein schlechter Lügner.
Aber Lung war zum Glück in Gedanken bei Schieferbart, der sich langsam in Sternenstaub auflöste, und spürte nichts von dem Unbehagen seines Drachenreiters.
»Gut«, sagte er nur. »Phönixe sind hilfsbereite Geschöpfe. Sie werden euch sicher helfen. Und ich freue mich darauf, einem Pegasus zu begegnen.«
Als es hinter ihnen raschelte, legte Lung schützend die Pranke um Ben, aber es war nur Schwefelfell, die zwischen den Bäumen hervortrat.
»Pegasus? Was ist das? Frisst es Kobolde?«
Wäre es nach Schwefelfell gegangen, hätte es nichts als Kobolde und Drachen auf der Welt gegeben. Sie schüttelte nur verständnislos den Kopf über die Bemühungen der Wiesengrunds, alle Geschöpfe zu retten, denen Menschen das Lebensrecht streitig machten. Aber da Lung ihnen half, tat Schwefelfell es auch. Natürlich war sie wieder auf Pilzjagd gewesen. Ben sah mit Sorge, dass sie gleich drei gefüllte Beutel über den pelzigen Schultern trug.
Schwefelfell sammelte Reiseproviant.
Lung legte Ben sacht die Schnauze auf die Schulter. »Wir brechen in drei Tagen auf. Schieferbart sagt, er will Abschied nehmen, bevor er noch schwächer wird. Drachen blicken dem Tod gern allein ins Gesicht. Im Gegensatz zu Kobolden!«, setzte er mit leiser Stimme hinzu. »Die können nicht genug Gesellschaft haben, wenn sie sich von dieser Welt verabschieden.«
Drei Tage. In drei Tagen war Vollmond. Natürlich. Die beste Flugzeit für Silberdrachen.
»Es ist seltsam, sich vorzustellen, dass Schieferbart nicht hier sein wird, wenn ich euch das nächste Mal besuchen komme«, sagte Lung. »Er war immer da. Seit ich denken kann. Er war schon ein erwachsener Drache, als meine Großmutter ein Kind war. So viel Leben. Ich schätze, irgendwann ist es genug. Ich glaube, er kann es nicht erwarten, dieser Welt den Rücken zu kehren.«
Ben nickte nur. Er schämte sich, dass die Tränen, die ihm in die Augen stiegen, nichts mit Schieferbart zu tun hatten, sondern nur mit der Tatsache, dass er wieder einmal von Lung Abschied nehmen musste. Würde er es eines Tages mit leichterem Herzen tun? Ohne dieses abscheuliche Gefühl, dass ihm ein Teil von sich selbst abhandenkam?
Schwefelfell bemerkte von all dem natürlich nicht das Geringste. Kobolde sind nicht gerade das, was man mitfühlend nennt. Sie war nur damit beschäftigt, ihre Beute vor ihnen auf dem Waldboden auszubreiten.
»Seht euch das an!«, sagte sie. »Nicht schlecht für einen Nachmittag, oder? Drei Pfifferlinge, vier Stoppelpilze, vier Schaf-Porlinge, zwei Reizker, ein Steinpilz und eine Rotkappe!«
»MÍMAMEIÐR gefällt ihr so viel besser als der Saum des Himmels!«, flüsterte Lung Ben zu. »Sie ist alles andere als beeindruckt von den Pilzen im Himalaja.«
Schwefelfell warf dem Drachen einen irritierten Blick zu. »Und, bist du dankbar für das Opfer, das ich bringe? Nein! Schwefelfell, warum bleibst du nicht in MÍMAMEIÐR? Schwefelfell, ich komme auch ohne dich aus. Pah!«
Sie schob die Pilze so vorsichtig zurück in die Beutel, als verstaute sie Glas. »Drachen brauchen Kobolde. So war es und so bleibt es, Spiss giftslørsopp!« Schwefelfell hatte ihren reichen Fluchvorrat durch norwegische Giftpilze bereichert. »Selbst wenn ich deshalb von Guchhi-Pilzen leben muss. Ich kann wirklich nicht verstehen«, fügte sie mit einem Blick auf Ben hinzu, »warum die bei deinesgleichen als Delikatesse gelten!«
Drachen brauchen Kobolde … Und Drachenreiter brauchen Drachen, wollte Ben hinzufügen.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)

![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)

![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)





![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)