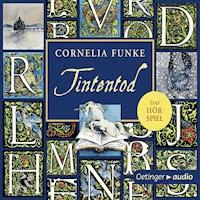6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Endlich ein neues Abenteuer mit Drachenreiter Ben und seinen Gefährten. Ein gigantisches Wesen aus der Tiefsee wird an Land kommen und seine Saat streuen. Ausgerechnet im dicht besiedelten Kalifornien. Wichtig ist, dem Ungeheuer friedlich zu begegnen. Und: Jede der vier Samenkapseln muss von einem Fabelwesen der vier Elemente entgegengenommen werden. Passiert das nicht, droht eine Katastrophe. Und als wäre das noch nicht genug, wittert ein Feind von Barnabas seine Chance.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Tief, tief unter dem Meer
Endlich! Ben ist an den Saum des Himmels gereist, um Lungs Nachwuchs kennenzulernen. Denn was gibt es Aufregenderes als junge Drachen? Aber da ruft auch schon das nächste Abenteuer nach dem Drachenreiter: Die Aurelia, ein riesiges Lebewesen aus der Tiefsee, hält auf die kalifornische Küste zu. Sie bringt Saat für neue Fabelwesen. Aber man muss der Aurelia friedlich begegnen. Fühlt sie sich bedroht, nimmt sie ihre kostbare Saat mit sich, und all die Fabelwesen, die die Wiesengrunds zu beschützen versuchen, würden verschwinden – die jungen Drachen eingeschlossen. Und als wäre das noch nicht genug, wittert ein Feind von Barnabas endlich seine Chance.
Die dritte abenteuerliche Reise mit Ben und seinem Silberdrachen Lung
Für Danny und Kat,
Laurel und Larry
und die wirkliche Mary und den wirklichen Alfonso;
als Dank dafür, dass sie mir das wirkliche Malibu gezeigt haben.
Eine Blume aus Federn
In Neuseeland ist der Januar ein Sommermonat, doch der Morgen war kühl und frisch, und Guinever Wiesengrund entdeckte elf Tauelfen, während sie ihrem Vater zu dem Boot folgte, das sie beide auf die Bucht hinausbringen sollte. Tauelfen liebten kühles Wetter. Sie hatten sich natürlich gut getarnt, wie alle Fabelwesen, und Guinever war ziemlich sicher, dass niemand sonst die winzigen Elfen bemerkte – weder die Männer, die ihre Boote am Kai beluden, noch die drei Angler, die nebeneinander auf dem Holzsteg saßen und ihre Leinen ins Wasser baumeln ließen.
»Unglaublich. Es fühlt sich fast so an, als wäre die Welt hier jünger«, flüsterte Guinever ihrem Vater ins Ohr. »Tauelfen, Möwlinge, Windreiter … Ich hab noch nie so viele Fabelwesen auf einmal entdeckt!«
»Und wieder mal sind wir wohl die Einzigen, die sie bemerken«, flüsterte ihr Vater zurück. »Wie können die Leute nur so blind sein?«
Er warf einen Blick auf die Angler. »Vermutlich haben die fabelhaften Freunde, die wir dabeihaben, ihre Artgenossen angelockt.«
Guinever hörte Stimmen aus dem kleinen Holzkoffer, den er trug. Doch bevor sie ihren Vater nach dessen Bewohnern fragen konnte, blieb Barnabas vor einem Boot stehen, dessen Name mit blauer Farbe auf den weißen Rumpf gemalt stand. Kaitiaki. So hießen die heiligen Wächter der Māori.
»Du hast übrigens recht, meine Liebe«, sagte Barnabas Wiesengrund, bevor er auf den schmalen Anlegesteg trat, »die Welt ist in Neuseeland tatsächlich jünger. Die beiden Inseln haben sich, soweit ich weiß, als letzte der größeren Landmassen aus dem Meer erhoben, und Menschen haben sich vermutlich frühestens 900 nach Christus hier angesiedelt. Außerdem ist Neuseeland der einzige Ort der Erde, wo viele der einheimischen Vögel zu Fuß unterwegs sind.«
»Was sich als ziemlich tödliche Angewohnheit erwiesen hat.« Der Mann, der jetzt hinter der Reling auftauchte, trug die traditionellen Tätowierungen der Māori im Gesicht. »Unsere Vögel haben nicht vorhergesehen, wie viele Raubtiere eines Tages per Schiff auf diese Inseln kommen würden, zusammen mit vielen weißen Männern.«
Er war ein Bär von einem Mann, und die kraftvolle Umarmung, mit der er Barnabas begrüßte, ließ Guinever einen Moment lang befürchten, er könne ihren schlaksigen Vater in der Mitte durchbrechen.
»Guinever, darf ich dir Kahurangi Ngata vorstellen?«, sagte Barnabas, als der Māori ihn schließlich losließ. »Er ist der einzige Mensch, der die Dialekte von dreizehn verschiedenen Walarten beherrscht.«
»Die weit einfacher zu erlernen waren als die drei Schildkrötensprachen, die ich spreche, ganz zu schweigen von den Kiwi-Dialekten, die ich mit meiner bleiernen Menschenzunge kaum herausbringen kann.« Kahurangi Ngata hielt Guinever eine Hand hin, die mit wirbelnden Linien und Blättermustern tätowiert war. »Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Guinever Wiesengrund, Beschützerin der letzten Pegasi, Freundin von Moosfeen und Flussnixen.«
Auf sein T-Shirt war ein Kiwi gedruckt, der berühmteste Laufvogel Neuseelands. Guinever hätte liebend gern einen gesehen, doch sie zeigten sich nie am Tag und waren für ihre Schüchternheit bekannt.
Guinever und Barnabas waren eigentlich auf dem Weg zum Himalaja, um dort ihren Bruder Ben und dreizehn frisch geborene Drachen zu besuchen. Den Abstecher nach Neuseeland hatte Barnabas bislang nur sehr vage erklärt, doch Guinever war so betört von all der Schönheit, die sie umgab, dass sie nicht weiter nachfragte. Neuseeland war schon immer ein Ort gewesen, an den sie gern hatte reisen wollen. Aber während Kahurangi Ngata das Boot durch ein Archipel aus Inseln steuerte, die wie moosbewachsene Schildkröten aus dem glasklaren Wasser ragten, fragte sie sich langsam doch, was der Zweck dieses Ausflugs war. In den letzten Monaten hatten Guinevers Eltern oft davon gesprochen, eine Farm in Neuseeland zu kaufen, denn MÍMAMEIÐR, die Zufluchtsstätte für Fabelwesen, die sie in Norwegen aufgebaut hatten, bot inzwischen kaum noch genug Platz für all die Flüchtlinge, die in der Hoffnung auf Schutz und Sicherheit zu ihnen kamen. Viele hatte eine neue Straße oder ein Staudamm heimatlos gemacht. Andere waren durch neue Felder, Abholzung oder Menschenkriege vertrieben worden. MÍMAMEIÐR bot ihnen allen Schutz, doch für einige war der Norden Norwegens einfach zu kalt. Deshalb war Guinever sicher gewesen, dass die Suche nach einem zweiten Zufluchtsort der Grund für den Umweg war. Doch als sie das zu ihrem Vater gesagt hatte, hatte Barnabas nur gemurmelt: »Nein, nein, mein Schatz, den Ort werden wir doch woanders einrichten, mein Herz. Aber es gibt da etwas, das ich mir kurz ansehen muss.«
Etwas, das ich mir kurz ansehen muss …
Das klare Wasser um sie her wimmelte von noch mehr Fabelwesen als der kleine Hafen. Guinever entdeckte sogar ein grünes Seepferdchen, ein so seltenes Wesen, dass ihr Vater sich unter normalen Umständen vor Begeisterung kaum hätte halten können, doch Barnabas warf nur einen flüchtigen Blick auf die winzige Kreatur. Er wirkte abwesend und besorgt, und er senkte die Stimme, als er mit seinem Māori-Freund sprach – ein Verhalten, das Guinever von ihren Eltern nicht kannte. Normalerweise hatten weder ihr Vater noch ihre Mutter Geheimnisse vor den Kindern.
Etwas, das ich mir kurz ansehen muss … Warum waren sie hierhergekommen? Das Ganze wurde immer rätselhafter. Und Hothbrodd hatte ihr auch nichts verraten wollen. Der Troll war wie immer ihr Pilot (schließlich hatte er auch das Flugzeug gebaut). »Wenn dein Vater es dir nicht sagt, werde ich das auch nicht tun, Guinever Wiesengrund!«, hatte er geknurrt. »Und falls es dich tröstet – mir hat er auch nicht viel verraten.«
Zwei Fliegende Fische sprangen über das Boot. Ihre winzigen Nixling-Reiter winkten Guinever zu. Ben wird so neidisch sein, wenn ich ihm von diesem Ort erzähle!, dachte sie. Nein, Guinever, korrigierte sie sich und lehnte sich noch weiter über die Reling, um ja nichts zu verpassen, dein Bruder ist gerade auf niemanden neidisch. Der hat wahrscheinlich gerade einen jungen Drachen auf dem Schoß.
Dieser Gedanke – das musste sie zugeben – füllte sie bis zu den Ohren mit Neid. Zum Glück hatte ihr Vater versprochen, dass sie nach diesem Zwischenstopp ohne weitere Umwege in das Tal im Himalaja reisen würden, wo die letzten Drachen Zuflucht vor den Menschen gefunden hatten. Und es war natürlich nur gerecht, dass Ben die Jungen als Erster kennenlernte. Schließlich hatte er den Drachen geholfen, das Tal zu finden. Und dann … war er zu ihrem Bruder geworden. Dein Findelkind-Bruder, meinte sie Ben sagen zu hören. Guinever vermisste ihn. Das tat sie immer, wenn sie zu lang voneinander getrennt waren, und es war inzwischen schon einen ganzen Monat her, dass er zum Saum des Himmels aufgebrochen war – so nannten die Drachen ihr Tal.
Kahurangi drosselte den Motor und ließ das Boot auf das steile Ufer einer Insel zutreiben, die noch immer in morgendlichen Nebel gehüllt war. Ein Schild neben der hölzernen Anlegestelle wies darauf hin, dass es sich um ein Vogelschutzgebiet handelte, und Guinever entdeckte zwischen und auf den Bäumen Fallen für Opossums und Ratten. Die Laufvögel Neuseelands waren leichte Beute für diese Räuber, die von Menschen auf die Inseln gebracht worden waren.
»Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Fußgänger-Vögel Neuseelands nicht aussterben dürfen«, raunte Barnabas Guinever zu, während sie Kahurangi einen Pfad hinauf folgten, der von tropischen Bäumen gesäumt war und Ausblick auf das Meer und auf andere Inseln bot. »Aber du weißt ja, dass deine Mutter und ich Fallen verabscheuen. Deshalb hat sie vorgeschlagen, dass wir den Koffer mitnehmen, den du schon die ganze Zeit so neugierig betrachtest. Mal sehen, was mein alter Māori-Freund dazu sagt.«
Er zwinkerte Guinever zu und blieb unter einem Baum stehen, der Guinevers Wissen nach ein Kauri-Baum war.
»Kahurangi!«, rief Barnabas ihrem Führer zu. »Wir haben dir ein Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt dir.«
Er legte den Koffer auf den Boden und öffnete ihn vorsichtig. Kahurangi runzelte die Stirn, als er die zwei Dutzend kleinen Männer und Frauen sah, die darin versteckt gewesen waren. Sie waren blau wie Kornblumen und kaum größer als eine Dose Bohnen.
»Was hat das zu bedeuten, Barnabas?«, fragte der Māori. »Du weißt doch, dass wir es gar nicht schätzen, wenn Lebewesen auf unsere Inseln gebracht werden, die nicht hierhergehören. Nach unserer Erfahrung richten sie nur Schaden an.«
Die Wichtel blickten ihn finster an, während sie aus dem Koffer kletterten.
»Du bist auch kein ursprünglicher Bewohner dieser Inseln, mein Freund«, erwiderte Barnabas. »Darf ich dich daran erinnern, dass die Māori wahrscheinlich vor nicht mal zweitausend Jahren hierherkamen? Das hier sind Bläulinge, und ich glaube, eure Vögel werden sehr dankbar sein, sie eine Zeit lang hier zu haben.«
»Die Opossums werden ihnen den Kopf abbeißen!«, protestierte Kahurangi.
Die Bläulinge brachen in Gelächter aus.
Einer von ihnen wandte sich dem Koffer zu und tippte mit dem Finger dagegen. Weg war er. Kahurangi starrte ungläubig auf die Stelle, wo er noch eine Sekunde zuvor gelegen hatte. Dann beugte er sich vor und hob mit spitzen Fingern einen Koffer auf, der so klein war wie ein Reiskorn.
»Das werden sie mit euren Vögelfressern machen«, sagte Barnabas. »Ich denke, so haben eure Vögel eine bessere Chance gegen die Opossums.«
Der Māori starrte auf den Wichtel hinab. »Die Wiesengrunds hatten schon immer ganz spezielle Methoden«, murmelte er.
»Das hoffe ich doch!«, sagte Barnabas. »Wir holen sie in einem Monat wieder ab. Behandele sie gut! Sie sind sehr gefragt! Aber jetzt zeig uns, weshalb wir gekommen sind.«
Der Pfad endete an einer hölzernen Plattform, die sich auf Stelzen aus dem hohen Farn erhob, der nur in Neuseeland wächst.
Die Plattform gewährte einen magischen Ausblick auf das Meer und die anderen Inseln. Tausende von Vögeln kreisten in Schwärmen über das türkisfarbene Wasser: Albatrosse, Sturmvögel, Kormorane, Tölpel und Raubmöwen … Guinever versuchte gar nicht erst, sie alle zu benennen. Immer mehr landeten auf den Wellen und bildeten mit ihren Körpern eine Formation, die an eine Blume erinnerte, eine riesige Blume aus Federn und Schnäbeln.
»Nun? Kommt dir das bekannt vor?« Kahurangi reichte Barnabas sein Fernglas. »Du musst zugeben, das erinnert sehr an die Geschichte, die uns einst so beschäftigt hat.«
Barnabas richtete das Fernglas auf die Vögel.
»Welche Geschichte?«, fragte Guinever, doch ihr Vater schien sie vergessen zu haben.
»Es könnte ein bloßer Zufall sein«, murmelte er. »Ich glaube es erst, wenn dasselbe an noch drei anderen Orten passiert.«
»Ich weiß. Vier, um sie anzukündigen, vier, um sie zu empfangen.« Kahurangi starrte ebenfalls auf die Vögel. »Aber was, wenn das hier schon die vierte Ankündigung ist?«
Barnabas ließ das Fernglas sinken.
»In Zeiten der Not …«, zitierte Kahurangi weiter, »… wird sie sich erheben … Wir leben in solchen Zeiten, denkst du nicht?«
Barnabas seufzte. »Ja, das tun wir sicherlich. Aber geschehen solche Dinge wirklich? Es fühlt sich wie eine närrische Hoffnung an.« Er richtete das Fernglas erneut auf die Vögel. »Nein, es ist unmöglich«, murmelte er. »Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, Träumen hinterherzulaufen, Kahurangi.«
»Könnt ihr bitte damit aufhören, in meiner Gegenwart in Rätseln zu sprechen?« Guinever stieß ihrem Vater freundschaftlich, aber bestimmt den Ellbogen in die Seite. »Sogar Sphingen sind leichter zu verstehen als ihr zwei!«
Sie hatte einmal eine Sphinx getroffen. Sie war abscheulich anstrengend gewesen.
»Entschuldige, mein Herz.« Ihr Vater legte ihr den Arm um die Schultern. »Es ist nur eine uralte Geschichte der Māori. Kahurangi und ich sind auf sie gestoßen, als wir Mitte zwanzig und beide von Seeungeheuern fasziniert waren. Aber, wie gesagt, … es ist nur eine alte Geschichte, eine von vielen.«
Guinever bemerkte den warnenden Blick, den er Kahurangi zuwarf, doch der hatte bloß Augen für die Vögel. Ein weiterer Schwarm Möwen traf ein. Die Welt schien nur noch aus Schnäbeln und Federn zu bestehen.
»Lass uns hoffen, dass wir zwei die Einzigen sind, die sich an diese Geschichte erinnern«, sagte der Māori. »Obwohl wir beide wissen, wen sie noch sehr interessieren würde.«
»Ja«, erwiderte Barnabas. »Und ich habe wenig Hoffnung, dass er nichts von den Ereignissen hier erfahren wird.«
»Er hat nicht viel Schaden angerichtet, seit du die Himmelsschlange vor ihm gerettet hast. Wie lang ist das jetzt her? Vier Jahre?«
Guinevers Vater nickte. »Keinen Schaden, von dem wir wissen«, fügte er hinzu. Seine Miene war ernst.
»Ich hoffe, er spürt immer noch ihr Gift.«
»Vielleicht.«
Manchmal verlor Guinever die Geduld mit den Erwachsenen, selbst wenn sie sie so sehr liebte wie ihren Vater. Natürlich sah er ihr Stirnrunzeln. Er bemerkte es immer, wenn sie oder Ben ärgerlich auf ihn waren. Er war ein ebenso guter Vater, wie er ein Beschützer der Fabelwesen war.
»Entschuldige, Kahurangi«, sagte er. »Aber wir müssen weiter. Es gibt noch sehr viel wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Richtig?«
Er zwinkerte Guinever zu.
Allerdings! Wie viele Zentimeter wuchsen neugeborene Drachen an einem Tag? Sie hatte schon dreißig Tage verpasst! Sie hatte den gerissenen Muskel eines jungen Pegasus in Griechenland versorgt, als ihr Bruder zum Saum des Himmels aufgebrochen war. Es war Chara gewesen, eins der Fohlen, die sie vor knapp zwei Monaten gerettet hatten.
Ihr Vater gab Kahurangi das Fernglas zurück.
»Auch wenn sich herausstellen sollte, dass es hier nur um alte Erinnerungen geht … danke, dass du mich gerufen hast. Doch jetzt müssen wir ein paar junge Drachen besuchen, sonst liebt mich meine Tochter nicht mehr.«
Kahurangi stieß einen tiefen Seufzer aus und wandte den kreisenden Vögeln den Rücken zu. »Junge Drachen? Ein Jammer, dass es mir so schwerfällt, diese Inseln zu verlassen. Ich fürchte, ich war in meinem früheren Leben ein Baumfarn.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein dreiäugiger Leguan warst«, lachte Barnabas. »Aber ich bin froh, dass du in diesem Leben menschliche Form angenommen hast. Leider ist es zu gefährlich, dir Fotos von den Drachen zu schicken, selbst über unser FREEFAB-Netz. Sie sind natürlich unser am besten gehütetes Geheimnis. Lass uns hoffen, dass diese Welt eines Tages ein Ort sein wird, an dem Drachen frei und unversehrt reisen können. Ich bin sicher, dass sie diese Inseln lieben würden.«
»Von so einer Welt sind wir noch weit entfernt«, erwiderte Kahurangi. »Vielleicht wird diese alte Geschichte ja deshalb tatsächlich Wirklichkeit.«
Sie gingen schweigend zum Boot zurück. Guinever dachte an die Drachen, doch sie war ziemlich sicher, dass Kahurangi und ihrem Vater andere Dinge durch den Kopf gingen. Er hat nicht viel Schaden angerichtet, seit du die Himmelsschlange vor ihm gerettet hast. Wollte sie wirklich wissen, wovon sie gesprochen hatten? Nein.
Sie konnten bereits die Anlegestelle sehen, als Kahurangi sich plötzlich bückte und etwas aufhob. Ein winziges Opossum saß in seiner tätowierten Hand.
»Ich weiß wirklich nicht, was ich von deinen Bläulingen halten soll, Barnabas«, sagte Kahurangi, während er das käfergroße Wesen auf ein Blatt setzte. »Sie könnten andere Probleme auslösen, die wir nicht vorhersehen.«
»Ich weiß«, seufzte Barnabas. »Aber ich will euren Oppossums wenigstens eine kleine Überlebenschance geben. Und Fallen finde ich einfach entsetzlich, wie du weißt.«
Guinever liebte ihn für den Abscheu auf seinem Gesicht. Ihr Vater verstand nichts vom Töten. Aber er wusste alles darüber, wie man Leben rettete.
Als sie das Boot erreichten, saßen zwei Bläulinge auf dem Steuerrad.
»Auf keinen Fall, Barnabas«, sagte einer von ihnen. »Viel zu viele Vögel auf dieser Insel. Wir verlangen, zurück nach MÍMAMEIÐR gebracht zu werden. Oder wo auch immer ihr hinfahrt.«
»Ja, keine Diskussion!«, zirpte der andere. »Schlangen oder Waschbären? Jederzeit. Aber keine Vögel!«
Kahurangi warf Barnabas einen amüsierten Blick zu, während er die beiden Bläulinge vom Steuerrad pflückte und in Guinevers Hände setzte. »Na, dann ist Neuseeland eindeutig nicht der richtige Ort für euch zwei«, sagte er. »Wir sind sehr stolz auf unsere Vögel.«
Über den Wolken
Hothbrodd war nicht nur ein auffallend großer und starker Tagtroll. Er konnte auch jeden Baum dazu überreden, genau die Stücke Holz wachsen zu lassen, die er gerade benötigte. Sei es, um daraus ein Haus zu bauen, ein Flugzeug oder einen Koffer für Bläulinge. Hothbrodd hatte in seinem langen Leben schon viele Dinge gebaut. Doch ganz besonders stolz war er auf das Flugzeug, dessen Tank er gerade mit Meereswasser füllte, als die Wiesengrunds von ihrer Expedition zurückkehrten. Der Troll hatte es ganz allein gebaut – mit Unterstützung von zehn Holzbohrerwichteln, deren Starrsinn, wie Hothbrodd behauptete, eine beträchtliche Anzahl seiner grünen Haare grau gefärbt hatte. Hothbrodd betrachtete die meisten Lebewesen als anstrengend, andere Trolle eingeschlossen, und Guinever fand es sehr schmeichelhaft, dass er ihre Familie ausnahm. Sie mochte den schlecht gelaunten Troll sehr.
»Ah, dann geht’s jetzt endlich dahin, wo wir hinwollten?«, knurrte Hothbrodd. »Oder hat noch ein alter Freund angerufen? Bei Thors Hammer, Barnabas! Wie viele alte Freunde kann ein Mann haben? Such dir einen anderen Piloten, falls du noch weitere Abstecher planst. Ich will diese jungen Drachen sehen, bevor sie größer sind als Guinever!«
»Ja, ja. Nächster Halt ist der Saum des Himmels!«, versprach Barnabas. »Heiliges Wiesengrund-Ehrenwort.«
Er war recht schweigsam in den nächsten Stunden, während Hothbrodd das Flugzeug durch die Wolken steuerte. Guinever konnte ihn nicht einmal dazu bewegen, ihr mehr über die Himmelsschlange oder die Māori-Sage zu verraten. »Kahurangi und ich haben uns nur in Erinnerungen verloren, mein Herz.« Das war alles, was er sagte. »Kahurangi und ich kennen uns seit der Schule, und wir waren damals beide besessen von den Fabelwesen des Meeres. Deine Mutter kannte ich damals kaum.«
Guinever konnte sich ihren Vater nicht ohne ihre Mutter vorstellen, auch wenn sie natürlich wusste, dass es einst einen Barnabas gegeben hatte, der weder Ehemann noch Vater gewesen war. Aber Fabelwesen des Meeres?
»Du gehst ja nicht mal schwimmen!«, rief sie, während Hothbrodd das Flugzeug durch Wolken flog, die sie wie schaumige Wellen umgaben. »Ich dachte, du magst das Meer nicht.«
»Oh, ich habe es mal sehr gemocht«, erwiderte ihr Vater. »Ich war sogar ein recht guter Taucher. Wusstest du, dass wir bislang nur etwa fünfzehn Prozent der Arten kennen, die in unseren Ozeanen leben? Die Fabelwesen nicht mit eingerechnet?«
Guinever starrte ihren Vater so ungläubig an, als hätte er ihr enthüllt, dass er Schwimmhäute zwischen den Fingern hatte. »Und wie hat sich das geändert?«
Barnabas schwieg und blickte in die Wolken.
»Ich wäre bei dem Versuch, eine Freundin zu retten, fast ertrunken«, sagte er schließlich, »und was noch schlimmer ist: Ich habe es nicht geschafft. Seit diesem Tag kann ich nicht mehr unter Wasser sein. Das ist vor allem schade, weil deine Mutter das Wasser so liebt.«
Mehr wollte er nicht verraten, und weil Guinever ihren Vater sehr liebte, respektierte sie sein Schweigen. Sie war sicher, dass ihr Bruder mehr über diese alten Geschichten herausfinden würde. Ben war sehr gut darin, ihre Eltern dazu zu bringen, von früher zu erzählen, vielleicht, weil er erst so viel später zur Familie dazugestoßen war. Sie fühlten sich verpflichtet, ihm das Gefühl zu geben, dazuzugehören, indem sie Erinnerungen mit ihm teilten.
Ihr Vater führte während des Fluges mehrere Telefonate mit MÍMAMEIÐR. Zuerst rief er Gilbert Grauschwanz an, FREEFABs genialen Ratten-Kartografen. (FREEFAB war die von ihren Eltern gegründete Geheimorganisation zur Erforschung und zum Schutz sämtlicher Fabelwesen dieser Welt.) Es ging um irgendeine Karte, die Gilbert erstellen sollte. Und darum, alle FREEFAB-Mitglieder (zu denen natürlich auch Guinever und Ben gehörten) nach Vogelformationen wie jener Ausschau halten zu lassen, die sie beobachtet hatten. Danach sprach ihr Vater noch lange und mit leiser Stimme mit Lola Grauschwanz, die nicht nur Gilberts Cousine, sondern auch die einzige fliegende Rättin der Welt und FREEFABs beste Kundschafterin war. Lola hatte wie immer viel zu erzählen, und Barnabas hörte hauptsächlich zu oder murmelte so rätselhafte Einwürfe wie: »Nein, das ist zu riskant, Lola!«, oder: »Achte einfach darauf, ob es Reisevorbereitungen gibt.«
Schließlich gab Guinever den Versuch auf, aus dem Gemurmel schlau zu werden, und setzte sich ins Cockpit zu Hothbrodd.
»Ich weiß, du willst es mir nicht verraten«, sagte sie, während sie den Koffer mit den zwei Bläulingen vom Sitz nahm. »Aber Dad sieht wirklich besorgt aus. Findest du nicht, dass seine Tochter wissen sollte, was los ist? Vor wem hat er eine Himmelsschlange gerettet? Und was hat das alles mit den Vögeln zu tun? Bitte, Hothbrodd!«
Sie lächelte ihm so aufmunternd zu, wie sie nur konnte.
»Komm mir nicht mit diesem Lächeln, Guinever Wiesengrund!«, knurrte Hothbrodd. »Der Dreckskerl, vor dem er die Schlange gerettet hat, heißt Cadoc Aalstrom … und ich verstehe, dass Barnabas euch nichts von ihm erzählt hat. Er kennt Cadoc seit der Schule, und die zwei haben im Laufe der Jahre viele Kämpfe ausgetragen.«
»Kämpfe?« Das war kein Wort, das Guinever mit ihrem Vater in Verbindung brachte.
»O ja!«, grollte Hothbrodd. »Dein Vater mag keine Schwerter oder Schusswaffen, aber Barnabas Wiesengrund ist ein entschlossener Verteidiger von allem, was er liebt und schätzt. Cadoc dagegen ist all das, was dein Vater nicht ist: gierig, grausam, selbstsüchtig und skrupellos. Ganz sicher niemand, den man seinen Kindern vorstellen will. Also vergiss ihn und lass mich dieses Flugzeug fliegen, oder du wirst die jungen Drachen niemals sehen!«
»Aber was hat dieser Cadoc Aalstrom mit den Vögeln zu tun?«
»Tu einfach so, als hättest du die Vögel nie gesehen!«, brummte Hothbrodd. »Je weniger du über sie weißt, desto besser. Und jetzt mach die Augen zu und träum von jungen Drachen. In neun Stunden sollten wir da sein. Ich hoffe wirklich, dass die Kleinen noch nicht fliegen können. Fy faen! Wenn wir diesen Teil verpasst haben, verfüttere ich deinen Vater an die Nachttrolle.«
Das klang nach keinem angenehmen Schicksal. Doch Guinever war mit den Drohungen des Trolls aufgewachsen, und sie brauchte nicht die Augen zu schließen, um von jungen Drachen zu träumen. Sie sah sie sogar in den Wolken, die vorbeizogen. Ihre Mutter Vita hatte ihr oft Geschichten von Himmelsschafen und Wolkendrachen erzählt, und Guinever hatte sich schon mit fünf geschworen, dass sie eines Tages auf einem Pegasus durch die Wolken reiten und nach ihnen suchen würde. Eines Morgens hatte ihre Mutter einen winzigen Drachen aus weißem Wollfilz auf ihren Frühstücksteller gelegt. »Damit du deinen Wunsch nicht vergisst«, hatte sie ihr zugeflüstert. »Dein Vater hat lieber festen Boden unter den Füßen, und mich hat schon immer das Wasser angezogen. Vielleicht bist du die Wiesengrund, die eines Tages den Himmel und die Luft erforscht.«
Der Filzdrache war längst nicht mehr weiß. Guinever hatte ihn zu oft in der Hand gehalten. Doch sie nahm ihn noch immer überallhin mit. Er steckte auch jetzt in ihrer Tasche. Luft … war das ihr Element? Hatte das nicht ihr drachenreitender Bruder für sich beansprucht? Oder war Feuer das passendere Element für Ben?
Vier, um sie anzukündigen, vier, um sie zu empfangen.
Wer war sie? »Ich sage es dir, sobald wir uns sicher sind. Versprochen!«, hatte ihr Vater auf diese Frage geantwortet. Der Dreckskerl, vor dem er die Schlange gerettet hat, heißt Cadoc Aalstrom … und ich verstehe, dass Barnabas euch nichts von ihm erzählt hat. Hothbrodds Worte folgten Guinever bis in den Traum, und als sie ihre Arme um einen jungen Drachen schlang, beugte sich ein Schatten über sie und entriss ihn ihr.
Zu gut, um wahr zu sein
Als Junge war Cadoc Aalstrom oft mit seinem Großvater in den Zoo gegangen. Eines Tages – sein Großvater erinnerte sich später nicht gern daran – hatten sie auf der Bank vor dem Tigergehege gesessen, und Cadoc hatte sich gerade gefragt, was so interessant an einer sehr gelangweilten riesigen Katze war, als ihm klar geworden war, dass sein Großvater nicht den Tiger beobachtete. »Siehst du ihn?«, hatte er geflüstert, als er Cadocs Blick bemerkte. »Sie sind sehr gut darin, sich zu verstecken.« »Wer?«, hatte er zurückgefragt, und sein Großvater hatte sein Augenmerk auf den Wassernapf des Tigers gelenkt. »Du musst lange hinsehen. Ohne es ihn merken zu lassen«, hatte sein Großvater geraunt. »Sie alle sind Meister der Tarnung.« Cadoc hatte gehorcht, und dann … nach einer schier endlosen Zeit, wie es ihm damals erschienen war, hatte er zum ersten Mal einen von ihnen gesehen. Fabelwesen. Der im Tigergehege war ein kaum daumengroßer Wichtel gewesen, der dem Tiger winzige Fetzen seiner Fleischmahlzeit stahl. »Ist er nicht wunderbar?«, hatte sein Großvater geraunt. »Sie sind überall, aber die meisten Menschen bemerken sie nicht.« Cadoc hatte schon damals gewusst, dass er sie alles andere als wunderbar fand. Sie erfüllten ihn mit Abscheu, all die Wichtel und Goblins, Elfen und Nixen, die sich in dieser Welt tummelten. Sein Großvater hatte das bald begriffen und sehr bereut, dass er ihm den Wichtel gezeigt hatte. Aber Cadoc war ihm dankbar, auch wenn sie ihn immer noch anekelten. Denn er hatte schnell herausgefunden, dass man ihre Magie für viele Zwecke nutzen konnte: Ob Reichtum oder Macht … die abscheulichen Geschöpfe konnten einem vieles bescheren, sogar ein wesentlich längeres Leben.
Cadoc war inzwischen fünfundvierzig Jahre alt, aber das ahnte niemand, der ihn sah. Das Leben hatte nicht eine Falte auf seiner blassen Haut hinterlassen, und seine blassblonden Haare zeigten keine Spur von Grau. Nein. Cadoc Aalstrom hatte immer noch den schlanken Körperbau und das glatte Gesicht eines vierzehnjährigen Jungen. Das hatte er einer seltenen Feenart zu verdanken. Die Magie von Moosfeen ließ die Jahre dahinschmelzen wie Butter in einer heißen Pfanne. Das funktionierte allerdings nur, solange man Sonnenlicht mied, weshalb sich die meisten Räume seiner Festung unter der Erde befanden. Doch wer wollte schon da draußen sein? Das Draußen war dreckig, meistens entweder zu heiß oder zu kalt und voll von pelzigen, fedrigen, schmutzigen Kreaturen …
Cadoc runzelte die Stirn und starrte auf den Bildschirm seines Computers. Darauf waren die Grundrisse der neuesten Erweiterungen zu sehen, die er seiner unterirdischen Festung hinzufügen wollte. Er genoss es, die langen, hell erleuchteten Korridore entlangzugehen, von denen die klimatisierten Lagerräume abgingen, angefüllt mit Schuppen, Hörnern, Knochen und anderen Artefakten, die angeblich irgendeine Art von Magie enthielten. Viele hatte er noch nicht durchschaut, aber es konnte nicht schaden, sie zu besitzen. In jedem Raum seines Hauses hingen Gemälde (sehr große Gemälde), auf denen zu sehen war, wie er Elfen, Wassermänner und andere Monstrositäten fing. Es war sehr befriedigend, sich so von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, wie erfolgreich er dabei war, ihre Magie zu stehlen.
O ja, er hatte seinen Spaß.
Spaß. Worum sonst ging es im Leben? Spaß war das Einzige, was Cadoc das leere Herz füllen konnte. Es war schon immer leer gewesen. Bis auf einen unstillbaren Hunger – zu besitzen, zu beherrschen, sich einzuverleiben, was immer die Welt zu bieten hatte. Und manchmal auch zu zerstören. Ja, bisweilen konnte das sehr befriedigend sein.
Cadoc legte die Füße auf den Schreibtisch und betrachtete liebevoll seine maßgefertigten Schuhe. Was für ein Leder war das? Kelpie? Wassermann? Er hatte es vergessen. Egal. Sie waren absolut wasserdicht. Er zog einen kleinen Spiegel aus der Westentasche und inspizierte sein Gesicht. Ja. Vierzehn. Kein Jahr älter. Er lächelte sich selbst zu – und runzelte die Stirn. War das etwa die Spur einer Falte, neben seiner Nase? Er würde Kupfer losschicken müssen, um frische Moosfeen zu fangen. Er mochte es, wie vierzehn auszusehen. Das war das perfekte Alter.
Apropos Kupfer … das Klopfen an der Tür klang metallen.
»Komm rein.«
Der Mann, der eintrat, passte kaum durch die Tür des großen, fensterlosen Raumes. Das elektrische Licht ließ seine rostrote Haut schimmern wie poliertes Metall. Sie hatten ihn entdeckt, als sie die Tunnel für die südlichen Korridore gegraben hatten. Natürlich war Cadoc der Einzige gewesen, der ihn entdeckt hatte – trotz seiner enormen Größe. Sein tatsächlicher Name war endlos lang und so gut wie unaussprechlich, also nannte Cadoc ihn bloß Kupfer. Er war unglaublich stark und gab einen guten Bodyguard ab, doch was noch wesentlich nützlicher war: Kupfermenschen waren sehr einfallsreich, wenn es darum ging, existierende Lebensformen zu verbessern. Ihre Magie brachte Erstaunliches zustande, was Effizienz und Gefährlichkeit betraf. Außerdem hatte Kupfer, obwohl selbst ein Fabelwesen, weder Pelz noch Schuppen. Eine Eigenschaft, die Cadoc sehr zu schätzen wusste.
»Hat sich die Sache mit den Vögeln bestätigt?«
»Ja. Sie bilden eine Blume, wie Ihr es vorhergesehen habt.«
Cadoc nahm seine polierten Schuhe vom Tisch und erhob sich aus seinem weißen Ledersessel. Aaah, da war er wieder, der stechende Schmerz in seiner Seite. Nach all den Jahren spürte er noch immer das Gift der verdammten Himmelsschlange, wenn er eine hastige Bewegung machte. Oder sich allzu sehr über etwas aufregte.
Sie bilden eine Blume …
War es wirklich möglich? Hatte sie sich wirklich aus den Abgründen des Meeres erhoben, die Kreatur, an deren Existenz er nie geglaubt hatte? Falls ja, würde er bald keine Moosfeen mehr brauchen! Die größte Magie, die es auf diesem Planeten gab, würde ihm gehören, ihm allein. Cadoc Aalstrom, unsterblich und ewig jung … Vermutlich würden sie ihm einen Tempel errichten. Welche Opfer würde er verlangen? O ja. Das würde unterhaltsam sein. Zumindest für eine Weile.
»Da ist noch etwas, Herr.« Kupfer war offensichtlich unwohl dabei, die nächste Nachricht zu überbringen. »Die Wachen haben die Ratte gesehen. Die fliegende Ratte.«
»Wo?«
»In einem der nördlichen Gänge.«
Nein! Wie war sie diesmal hereingekommen? Cadoc spürte erneut das Gift der Himmelsschlange, Erinnerung an die bislang demütigendste Niederlage, die ihm der Mann beigebracht hatte, dem die dreckige Ratte diente.
Barnabas Wiesengrund …
Nein! Denk nicht an ihn, Cadoc. Falls die Kreatur, die die Vögel ankündigten, sich tatsächlich erhob und er ihre Magie stahl, konnte das das Ende für all die bedeuten, die Barnabas Wiesengrund und seine FREEFAB-Freunde beschützten. Keine schlechte Aussicht! Es würde eine solche Erleichterung sein, sie nicht mehr überall sehen, riechen und herumrascheln hören zu müssen! Und sie nicht mehr zu brauchen, weil die, die sie alle in die Welt gebracht hatte, ihm ihren Zauber überlassen würde.
Ja, es war fast zu schön, um wahr zu sein!
Cadoc summte die ersten Takte von »Paff, der Zauberdrache« und ging zu dem Käfig, der an einer silbernen Kette von der Decke hing. Darin steckten sechs Moosfeen, mit grüner Haut und Flügeln, die in allen Farben des Regenbogens schillerten. Cadoc zog sich Lederhandschuhe über die schlanken Finger, bevor er den Käfig öffnete. Die Zähne der kleinen Biester waren spitz, doch ihr Staub würde die Falte glätten, die die Erwähnung der Ratte in seine Haut gekerbt hatte. Er packte eine an ihren dünnen grünen Beinen und zog sie aus dem Käfig. Die anderen griffen ihn an, doch ihre Zähne drangen nicht durch das Leder der Handschuhe.
Cadoc schüttelte die Moosfee, bis er ein kleines Glas mit ihrem silbrigen Staub gefüllt hatte. Kupfer sah ihm ausdruckslos zu. Der Dummkopf warnte ihn immer wieder davor, sie zu oft zu schütteln. Sie brauchten mehrere Tage, um sich zu erholen. Und? Er würde ihn ausschicken, neue zu fangen. Cadoc stieß das Flatterding zurück in den Käfig und ließ ihren Staub in einen Becher rieseln.
O ja, er war sicher, dass die Ratte für Barnabas arbeitete. Wer sonst würde ein so widerliches Wesen für sich spionieren lassen? Cadoc hatte Barnabas Wiesengrund von dem Moment an gehasst, in dem er in sein Klassenzimmer getreten war. Der Neue! Frisch von irgendeiner Provinzschule in Schottland. So klug und so bescheiden, immerzu großmütig, immerzu lächelnd. Schon an seinem zweiten Tag hatte Barnabas den Nerd mit der dicken Brille vor ihm beschützt. Und die Rothaarige mit der Zahnspange. Ja, das waren Freunde, wie Barnabas sie mochte. Wie hieß noch gleich der Klotz von einem Māori? Er hatte Barnabas sicher schon von den Vögeln erzählt.
Ja …
Cadoc goss heißes Wasser über den Feenstaub.
Er hatte in der Nähe eines leer stehenden Hauses Grasfeen gejagt, nur wenige Straßen von der Schule entfernt, als er herausgefunden hatte, dass auch Barnabas Wiesengrund sie bemerkte. All die Gnome und Feen und Nixen …
Wiesengrund hatte ihn dabei erwischt, wie er einer Elfe einen Flügel ausgerissen hatte. Na und? Elfenflügel verliehen einem für ein paar Minuten die Gabe zu fliegen! Barnabas hatte die Rothaarige dabeigehabt, Lizzie Persimmons. Cadoc erinnerte sich noch gut an den Ekel und die Verachtung in ihren Augen.
Nun … Lizzie Persimmons gab es nicht mehr. Weil sie sich in den Kopf gesetzt hatte, eine Meerfrau zu retten, der er ein paar von ihren geschuppten Fingern hatte stehlen wollen. Die Schwimmhaut zwischen ihnen machte es Menschen angeblich möglich, unter Wasser zu atmen. Er hatte die Finger leider nicht bekommen. Die Meerfrau war ihm dank Lizzie entwischt, aber ihrer Retterin war der Sog der Bootsschraube zum Verhängnis geworden. Lizzie Persimmons war in den Wellen verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Und Barnabas hatte sie nicht retten können, obwohl er sein Leben riskiert hatte.
Doch er hat viele andere gerettet, hörte Cadoc es in seinem leeren Herzen flüstern. Er runzelte die Stirn und nahm einen Schluck von dem Feenstaubtrank. Leider konnte man damit keine lästigen Gedanken auslöschen. Das vermochte nur Einhornblut. Aber tja …, die Einhörner gab es auch nicht mehr. Cadoc hatte das letzte eigenhändig getötet – um anschließend herauszufinden, dass ihre pulverisierten Hufe keine Unverwundbarkeit verliehen, wie es so viele Sagen behaupteten. Das war eine ziemliche Enttäuschung gewesen.
Was machst du da? Siehst du nicht, wie viel du von ihnen lernen kannst, Cadoc? Bis heute hatte er die Verachtung von Barnabas’ Stimme im Ohr. All die Geschichten, die sie inspirieren, all die Verzauberung, die Freude und die Hoffnung, die es uns gibt, von ihnen zu träumen! Fabelwesen sind die Übersetzer zwischen uns und allen anderen Bewohnern dieser Welt. Ja, solche Predigten konnte Barnabas Wiesengrund stundenlang von sich geben, während Lizzie ihm zulächelte und so viele andere bewundernd mit dem Kopf nickten.
Cadoc leerte den Becher.
Er war so viel besser als sie alle. Besser, schlauer, reicher (na ja, dank eines skrupellosen Vaters und einer ebenso gewissenlosen Mutter, aber wen interessierte das).
Er ging zum Schreibtisch zurück und langte spielerisch nach dem Spray, das immer neben seinem Computer stand.
»Ich will diese Ratte tot sehen, Kupfer.«
»Ja, Herr.«
Die glänzenden Augen füllten sich mit Furcht. Kupfermenschen reagieren empfindlich auf Salz. Und auf alles Saure. Deshalb hatte Cadoc immer eine Sprühflasche parat, die Salzwasser versetzt mit etwas Zitronensaft enthielt – ein einfaches Mittel, dafür zu sorgen, dass Kupfer sich elend fühlte, wenn er mit ihm unzufrieden war. So wie jetzt. Doch Cadoc stellte die Flasche zurück an ihren Platz. Sein Verstand war zu sehr damit beschäftigt, über die Vögel nachzudenken.
»Geh«, sagte er. »Das, was in Neuseeland geschehen ist, wird noch drei weitere Male geschehen. Finde heraus, wo genau.«
Der Kupfermann nickte und verschwand durch die Tür. Seinesgleichen bewegte sich erstaunlich geschmeidig und lautlos angesichts seiner Größe.
Als er fort war, ging Cadoc zurück zu dem Käfig und sah zu, wie die Feen panisch umherflatterten, während er mit den Fingern über die Gitterstäbe strich.
Sie erhob sich.
Ja!
Er würde ihr stehlen, was sie aus der Tiefe heraufbrachte. Und wer weiß, vielleicht würde das auch das Ende bedeuten für Barnabas Wiesengrund und all seine Mühen, seine fabelhaften Freunde zu beschützen.
Cadoc schüttelte den Käfig und beobachtete, wie die Feen gegen die Gitterstäbe taumelten.
Was könnte wichtiger sein?
Ben wusste nicht, was er herzerweichender fand: wenn Lungs ältester Sohn Silberschuppe (den alle nur Schuppe nannten) ein wild entschlossenes Gesicht machte und mit seinen kleinen Flügeln so heftig flatterte, dass sie ihm beinahe abfielen? Oder wenn seine Zwillingsschwester Mondtanz ihren Bruder Stachel (voller Name Stachelschwanz, genau drei Minuten jünger als Schuppe) durch die Höhle scheuchte und beide dabei über ihre eigenen Pfoten stolperten.
Junge Drachen waren definitiv zu viel für ein menschliches Herz.
»Du starrst sie ja nur noch an, Drachenreiter.« Lung legte seine warme Schnauze auf Bens Schulter, während Maja, die Mutter seiner Kinder, ihren Ältesten aus einer Felsspalte zog, in der er stecken geblieben war.
»Ich weiß«, seufzte Ben.
Es war ein sehr glücklicher Seufzer. Der Anblick der jungen Drachen erinnerte ihn an einen anderen verzauberten Tag – den Tag, an dem er Lung zum ersten Mal begegnet war. Wie anders sein Leben damals gewesen war. So leer und einsam.
In diesen zurückliegenden Wochen hatte Ben mehr Drachen-Zeit gehabt als je zuvor. Nicht einmal seine erste Reise auf Lungs Rücken konnte da mithalten. Er hatte zwischen Drachen gelebt, hatte mit ihnen gespielt, geschlafen, gelacht, war mit ihnen geflogen. Das Paradies – genau das war es. Nein. Es war noch besser als das. Er wünschte, es würde nie aufhören.
Autsch! Ben spürte einen stechenden Schmerz, als Mondtanz gegen ihn prallte und ihm sämtliche Krallen in die Brust bohrte. Sie waren sehr spitz, und Ben rechnete damit, Blut durch sein T-Shirt sickern zu sehen. Doch als er es hochzog, fand er nicht mal einen Kratzer auf seiner Haut.
Lung bemerkte seinen erstaunten Blick.
»Ich hatte immer gehofft, dass das geschieht«, sagte er. »Aber ich war nicht sicher. Weißt du noch, als Tattoos Feuer dich aus Versehen getroffen hat? Oder als Schuppe dich in den Arm gebissen hat? Nicht mal eine Schramme.«
Ben betrachtete seinen Arm. Ja. Schuppe hatte heftig zugebissen. Sie hatten gerungen, und die jungen Drachen wussten noch nicht, wie stark sie waren. Er hatte damit gerechnet, dass sein Arm schwer lädiert sein würde, aber …
»Du veränderst dich«, sagte Lung sanft. »Spürst du es?«
Ja. Jetzt, wo Lung es erwähnte … Ben fühlte sich tatsächlich anders. Wie sollte es ihn auch nicht verändern, so viel unter Drachen zu sein? Er fühlte sich mutiger nach den letzten Wochen, stärker – und ein bisschen wilder. Aber was Schuppes Biss und Tattoos Feuer betraf … er fuhr sich mit den Fingern über die Haut. Nein. Er spürte wirklich keinen Unterschied.
Lung lächelte.
»Keine Sorge, dir werden keine Schuppen wachsen. Ich hätte es dir längst sagen sollen, aber Schwefelfell meinte, das seien alles nichts als Märchen, die man Drachen- und Koboldkindern erzählt. Es heißt, dass Drachenreiter mit den Jahren einige Eigenschaften ihrer Drachen übernehmen. Eine der ersten ist angeblich eine weniger verletzliche Haut. Du bist jetzt schon eine ganze Weile ein Drachenreiter, und wir haben zuletzt viel Zeit miteinander verbracht, also …«
Ben sah ihn ungläubig an. »Du meinst …«
Lung nickte. »Du wirst stärker werden. Deine Muskeln, deine Knochen … sie werden mehr und mehr von meiner Kraft aufnehmen. Deine Augen werden nachts so gut wie meine sehen. Dein Gehör wird schärfer werden. Vielleicht ist es das schon. Feuer wird dir nichts mehr anhaben können, und irgendwann wirst du anfangen, die anderen reden zu hören.«
»Die anderen?«
»Tiere, Pflanzen … die anderen Lebewesen dieser Welt.«
Ben blickte zu den Fledermäusen hinauf, die sich unter der Höhlendecke drängten. Wie würde es sich anfühlen, ihren Unterhaltungen zuhören zu können? Großartig!
Er sah zu Lung auf und lächelte. »Also bekommt man sogar eine Belohnung dafür, ein Drachenreiter zu sein?«
»Eine Belohnung, die hoffentlich die Gefahren aufwiegt, die damit verbunden sind.«
Ben schlug Lung spielerisch die Faust gegen die silbrige Brust. »Du weißt doch, dass mich die Gefahr nie gestört hat! Solange wir nur zusammen sind!« Er strich über die glänzenden Schuppen seines Drachen. »Werde ich auch nur von Mondschein leben können?«
Lung lachte. »Nicht dass ich wüsste. Dir werden auch keine Flügel wachsen, falls du das gehofft haben solltest! Und darüber bin ich froh, denn sonst würde ich vielleicht meinen Drachenreiter verlieren.«
Ben schlang ihm die Arme um den Hals und vergrub das Gesicht in seiner Wärme. »Drachen verlieren niemals ihre Drachenreiter.«
»Luuuuuuung!«, hallte eine zornige Stimme durch die Höhle. »Dein Nachwuchs hat schon wieder ein Versteck von mir gefunden! Was sind das für Drachen, die Pilze mögen?«
Schwefelfell stand mit gesträubtem Fell im Eingang der Höhle. Lungs Kobold-Gefährtin gefiel es gar nicht, von jungen Drachen umgeben zu sein. Ganz im Gegenteil.
»Reg dich ab, Schwefelfell!« Der Kobold, der hinter ihr auftauchte, hatte vier Arme und in jeder Hand einen halb verspeisten Pilz. Burr-burr-tschan war ihr Reiseführer gewesen, als sie nach dem Saum des Himmels gesucht hatten. Ohne Lungs Entschlossenheit, diesen legendären Ort zu finden, wären die letzten Drachen in einem schottischen Tal umgekommen. Stattdessen zogen sie jetzt eine neue Generation groß, im Schutz der Gipfel des Himalaja. Ben lächelte. Das Leben war ziemlich wunderbar.
»Du musst sie besser verstecken, Schwefelfell!« Lung fing einen jungen Drachen auf, der seinen Rücken hinunterrutschte. Sie mochten es, auf den Erwachsenen herumzuklettern, an ihrem Schwanz zu zerren oder auf Klauen und Fingern herumzukauen. Für Menschenhaut konnte das ziemlich schmerzhaft sein. Ben fuhr sich mit der Hand über den Arm. Es heißt, dass Drachenreiter mit den Jahren einige Eigenschaften ihrer Drachen übernehmen. Vielleicht hatten seine Abenteuer gerade erst begonnen.
»Fauliger Fungus! Ich habe sie ja gut versteckt! Diese kleinen Rotznasen sind schlimmer als Trüffelschweine!« Schwefelfell zog Burr-burr-tschan einen der angebissenen Pilze aus der Pfote und hielt ihn anklagend hoch. »Das ist eine Goldene Löwentatze. Unglaublich selten. Und jetzt voller Drachenspucke! Ekelhaft! Sie schmeckt wie angebrannt.«
»Natürlich! Sie sind kleine Drachen, Schwefelfell.« Maja trat an Lungs Seite. »Und sie finden deine Pilze, weil sie eine genauso gute Nase haben wie ihre Mutter. Das tut mir leid.«
»So oder so, das bleibt nicht ungestraft!« Die angebissene Löwentatze traf Schuppes Kopf. »Von jetzt an werde ich Stinkmorcheln unter meine Pilze mischen! Bin gespannt, wie die deinen Sprösslingen schmecken. Und wie es euch allen gefällt, wenn eure Pilze stehlenden Kinder sich hinter jedem Stein in dieser Höhle übergeben!«
Lung seufzte.
»Es tut mir leid, Schwefelfell«, sagte er. »Wirklich. Aber sie sind noch so jung. Und es sind ziemlich viele.«
Das stimmte. Wohin auch immer der Blick in der gewaltigen Höhle fiel, überall kam gerade ein junger Drache hinter einem Stalaktiten hervorgestolpert oder von einem Felsen geflattert. Dreizehn. Dreizehn junge Drachen! Niemand hatte mit so zahlreichem und gesundem Nachwuchs gerechnet.
Die letzten Drachen dieser Welt, die mit Lung aus Schottland hergekommen waren, würden nicht die letzten bleiben. Sie hatten ein neues Kapitel in der langen Geschichte ihrer Art begonnen.
»Übrigens … du wirst unten am See erwartet, Drachenreiter.« Schwefelfell nahm einen Bissen von einem Pilz, den Burr-burr-tschan fortgeworfen hatte, und spuckte ihn angeekelt aus. »Angebrannt!«, murmelte sie. »Mein gesamtes Leben schmeckt angebrannt.«
»Am See? Wieso?«
Ein junger Drache flatterte von einem Felsen und überschlug sich beim Versuch, vor Bens Füßen zu landen. War das Glimmer oder Sterngucker? Lungs Kinder kannte Ben inzwischen genau, aber die anderen … es war nicht immer leicht, sie voneinander zu unterscheiden. Sie alle hatten die silbrigen Schuppen und goldenen Augen ihrer Eltern, kurze dicke Beine und kräftige Hälse.
»Der Homunkulus will mit dir reden.« Schwefelfell öffnete ihren Rucksack und warf die Pilzreste hinein.
»Fliegenbein?« Ben stellte Glimmer auf seine Pfoten. Ja, das war eindeutig Glimmer. »Wann hast du mit ihm gesprochen?«
Schwefelfell zuckte die Schultern. »Vor ein paar Stunden. Er sagte, er hat eine Nachricht für Barnabas. Dein Vater und Guinever haben irgendwo haltgemacht. Aber das Spinnenbein sagt, sie müssten jeden Augenblick hier sein. Er war wegen irgendwas ziemlich aufgeregt, aber du weißt ja, das passiert bei ihm leicht.«
»Die Nachricht ist schon ein paar Stunden alt?«, rief Ben aufgebracht.
»Ich hab dir gesagt, wir hätten es ihm gleich erzählen sollen!« Burr-burr-tschan kratzte sich den pelzigen Bauch mit zweien seiner vier Hände.
»Wir mussten neue Vorräte suchen!«, gab Schwefelfell schnippisch zurück. »Weil sie ständig aufgefressen werden.«
Ben zählte Schwefelfell inzwischen zu seinen besten Freunden, aber manchmal wünschte er sich fast, sie möge an einem ihrer geliebten Pilze ersticken.
Das Tal, in dem die letzten Drachen ihre Jungen aufzogen, war vor langer, langer Zeit schon einmal ihre Heimat gewesen. Ihre Vorfahren hatten den See, von dem Schwefelfell gesprochen hatte, Auge des Mondes genannt. Man konnte unschwer erkennen, warum. Der See lag schimmernd wie ein Silberspiegel zwischen den schneebedeckten Gipfeln, die den Saum des Himmels schützen. Als Ben an sein Ufer trat, zogen über ihm schwere Regenwolken auf. Ben blickte besorgt zu ihnen auf, bevor er sich in das kurze Gras am Ufer kniete. Für das, wofür er gekommen war, musste das Wasser glatt wie ein Spiegel sein.
Das Auge des Mondes weckte in Ben immer noch finstere Erinnerungen. Als er zum ersten Mal auf den See herabgeblickt hatte, war Nesselbrand aus seinem Wasser aufgetaucht. Mehr als zwei Jahre waren inzwischen vergangen, seit Lung, Maja und einige der anderen Drachen diesen tödlichen Feind besiegt hatten, gemeinsam mit Kobolden, Steinzwergen, einem Homunkulus und einer fliegenden Ratte, in genau der Höhle, die jetzt ihren Kindern Schutz bot. Aber erst vor Kurzem hatten sie begriffen, dass dieser schreckliche Feind etwas sehr Nützliches hinterlassen hatte.
Ben beugte sich vor und zeichnete mit dem Finger einen Kreis auf das eiskalte Wasser. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Fliegenbeins Gesicht erschien, so klar und deutlich, als blickte der Homunkulus Ben aus einem Spiegel entgegen. Fliegenbein war Nesselbrands Spion gewesen, bevor er sein Herz an den Jungen verloren hatte, der einen Drachen ritt. Damals hatte er seinen Meister immer durch Wasser kontaktiert. Es hatte Fliegenbein und Ben zwei Jahre gekostet, eine Methode zu entwickeln, die diese Form der Kommunikation nachahmte. Nach einigen Rückschlägen funktionierte es inzwischen nahezu perfekt – solange es nicht regnete –, und Ben hatte fast jeden Tag mit Fliegenbein gesprochen, obwohl der Homunkulus weit fort in MÍMAMEIÐR, ihrer Schutzstation für Fabelwesen in Norwegen, war. Seit Beginn ihrer Freundschaft waren sie nie so lange voneinander getrennt gewesen. Es fühlte sich seltsam an, aber Fliegenbein hatte einen guten Grund gehabt, nicht mitzureisen.
Dieser Grund stand direkt hinter ihm, als seine schmale Gestalt auf der Wasseroberfläche erschien.
Fliegenbein hatte immer gedacht, dass er der Letzte seiner Art war. Er hatte gesehen, wie Nesselbrand seine Brüder verschlang, und war selbst nur deshalb verschont geblieben, weil sein Meister jemanden brauchte, der seine Schuppen polierte. Doch dann hatte er erfahren, dass sein jüngster Bruder dem Massaker entkommen war.
Freddie (so nannte er sich selbst, eigentlich hieß er Flohkopf) winkte Ben mit breitem Lächeln zu. Er hatte ein Bein verloren, als er sich aus Nesselbrands Zähnen befreit hatte, und genau wie Fliegenbein hatte er mehr als dreihundert Jahre lang geglaubt, dass all seine Brüder umgekommen waren. Die zwei hatten sich durch puren Zufall wiedergefunden, oder durch eine Fügung des Schicksals, wie Freddie es nannte. Er hatte sogar ein Theaterstück darüber geschrieben. Es hieß die »Die Vulkan-Mission«, und Freddie hatte es schon mehrmals in MÍMAMEIÐR aufgeführt, mit einer Gruppe von Wichteln, Zwergen und allen, die mitmachen wollten. Fliegenbein nannte das Stück eine Ausgeburt von Freddies zügelloser Fantasie. Aber … die Brüder waren seit ihrer Wiedervereinigung so gut wie unzertrennlich, und da Hothbrodd Freddie gerade ein neues Holzbein angepasst hatte, als Ben sich auf die Reise machte, um die frisch geborenen Drachen zu besuchen, war Fliegenbein in MÍMAMEIÐR geblieben. Er hatte sich große Sorgen gemacht, dass es seinem Bruder schwerfallen könnte, sich an das neue Bein zu gewöhnen, aber Freddies strahlendes Lächeln bewies, dass Fliegenbein die Zähigkeit seines jüngeren Bruders unterschätzt hatte.
»Meister! Endlich!«
Schwefelfell hatte recht. Fliegenbein regte sich sehr schnell auf. »Ich war mir sicher, dass die pilzfressende Waldkoboldin vergessen hat, meine Nachricht zu überbringen!«
»Ich hab dir doch gesagt, dass du dich auf Schwefelfell verlassen kannst«, sagte Freddie. »Du machst dir zu schnell Sorgen, Bruder.«
Fliegenbeins Gesicht verriet, dass er sich manchmal fragte, ob das Leben ohne seinen Bruder nicht doch einfacher gewesen war. Freddies Optimismus war eine ziemliche Herausforderung für jemanden, der wie Fliegenbein davon ausging, dass die meisten Dinge schlecht endeten. Doch Ben sah auch, wie selbst das Streiten mit Freddie Freude in Fliegenbeins Leben brachte. Der Einzige seiner Art zu sein, macht sehr einsam. Ben kannte dieses Gefühl aus seinen eigenen Tagen im Waisenhaus.
»Sind Euer Vater und Guinever mittlerweile eingetroffen, Meister?«
Fliegenbein warf Freddie einen strengen Blick zu, als ein klitzekleiner Gnom aus dessen Kragen kletterte. Freddie hatte immerzu irgendeine winzige Kreatur in der Tasche. »Es ist absurd!«, stöhnte Fliegenbein gern. »Er zieht sie an wie das Licht die Motten!« Manchmal lugte ein ganzes Dutzend Wesen aus Freddies struppigem roten Haar. Ben vermutete, dass inzwischen einige der kleinsten Flüchtlinge, die MÍMAMEIÐR beherbergte, fest in Freddies Taschen lebten.
»Nein«, sagte er. »Sie sind noch nicht angekommen.« Die Wolken, die sich im Wasser spiegelten, waren wirklich bedenklich dunkel. »Schwefelfell sagt, du hast eine Nachricht für Dad?«
Fliegenbein und Freddie nickten im Einklang. Ihre Bewegungen waren häufig die gleichen. Ben fand das witzig, aber Fliegenbein ärgerte sich darüber. Es hat auch Vorteile, sich für den Einzigen zu halten. Alles, was man tut, ist einzigartig. Freddie erinnerte Fliegenbein mit schmerzhafter Regelmäßigkeit daran, dass ihr Schöpfer, der Alchemist Petrosius von Bilsenkraut, für ihn und seinen Bruder dasselbe Rezept benutzt hatte. »Ich bin sicher, dass es da ein paar Variationen gab«, hatte Barnabas den Homunkulus getröstet, als er sich einmal traurig als »bloße Kopie« bezeichnet hatte. »Bilsenkraut hat sicher nicht den Lebensfunken des gleichen Tieres für dich und Freddie verwendet.«
»Stimmt«, hatte Fliegenbein gemurmelt. »Ich vermute immer noch, dass meiner von einer Kakerlake stammt, aber Freddies war sicher der Lebensfunke einer Pfauenspinne. Warum sollte er sonst ständig tanzen wollen?« Fliegenbeins Bruder liebte es, stundenlang auf dem langen Bibliothekstisch in MÍMAMEIÐR zu steppen, während sein Bruder die Bücher in den Regalen erkundete.
»Ja! Die Nachricht! Natürlich!« Fliegenbein sah seinen Bruder erneut streng an, als Freddie anfing, vor sich hin zu summen. »Barnabas hat uns gebeten, ihn sofort zu informieren, wenn sich ein vergleichbares Vorkommnis wie das in Neuseeland ereignen sollte. Das ist geschehen. Bitte sag ihm, dass wir gerade einen Bericht aus dem Ochotskischen Meer erhalten haben …«
»… das liegt bei Kamtschatka«, fügte Freddie hinzu.
![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)



![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)

![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)




![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)