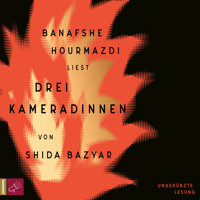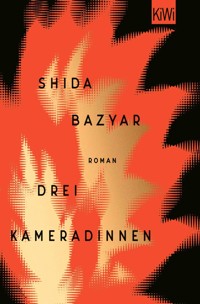
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021 Was Freundschaft bedeutet, wenn die Gegenwart Feuer fängt. In ihrem neuen Roman erzählt Shida Bazyar voller Wucht und Furor von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart – und von drei jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was kommt. Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch egal ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt. Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz, was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und überall infrage gestellt zu werden, aber auch, wie sich Gewalt, Hetze und Ignoranz mit Solidarität begegnen lässt. »Drei Kameradinnen« ist ein aufwühlender, kompromissloser und berührender Roman über das außergewöhnliche Bündnis dreier junger Frauen – und das einzige, das ein selbstbestimmtes Leben möglich macht in einer Gesellschaft, die keine Andersartigkeit duldet: bedingungslose Freundschaft. »Uns gibt es in dieser Welt nicht. Hier sind wir weder Deutsche noch Flüchtlinge, wir sprechen nicht die Nachrichten und wir sind nicht die Expertinnen. Wir sind irgendein Joker, von dem sie noch nicht wissen, ob sie ihn einmal zu irgendetwas gebrauchen können.« Aus: »Drei Kameradinnen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Shida Bazyar
Drei Kameradinnen
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Shida Bazyar
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Shida Bazyar
Shida Bazyar, geboren 1988 in Hermeskeil, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und war, neben dem Schreiben, viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman »Nachts ist es leise in Teheran« erschien 2016 und wurde mit dem Bloggerpreis für Literatur, dem Ulla-Hahn-Autorenpreis und dem Uwe-Johnson-Förderpreis ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. »Drei Kameradinnen« folgte 2021 und stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch egal ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis ein dramatisches Ereignis alles infrage stellt.
»Drei Kameradinnen« ist ein aufwühlender, kompromissloser und berührender Roman über das außergewöhnliche Bündnis dreier junger Frauen – und über das Einzige, das ein selbstbestimmtes Leben möglich macht in einer Gesellschaft, die keine Andersartigkeit duldet: bedingungslose Freundschaft.
»Uns gibt es in dieser Welt nicht. Hier sind wir weder Deutsche noch Flüchtlinge, wir sprechen nicht die Nachrichten und wir sind nicht die Expertinnen. Wir sind irgendein Joker, von dem sie noch nicht wissen, ob sie ihn einmal zu irgendetwas gebrauchen können.«
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung und -motiv: Nurten Zeren/zerendesign.com
ISBN978-3-462-31937-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Zeitungsartikel »Jahrhundertbrand in der Bornemannstraße«
Romanbeginn
Fortsetzung Kapitel 2
Fortsetzung Kapitel 2
Aggressiv und verblendet: Saya M. aus R. hat sich radikalisiert und die Welt schaute zu.
»Sie hat schon in der Schule Streit gesucht und ständig provoziert«, sagt eine ehemalige Bekannte über M., »Saya hat diese Wut einfach in sich, sie ist sozusagen Teil ihrer DNA.«
Ist es diese Wut, die gestern Abend so viele Menschen das Leben kostete? Während die Behörden noch auf die laufenden Ermittlungen verweisen und sich nicht zu dem Fall äußern wollen, sprechen die Zeugenaussagen eine eindeutige Sprache.
Frühere Nachbarn berichten, schon Anfang der Neunzigerjahre habe Saya M.s Familie mutmaßliche Islamisten, die per Besuchervisum nach Deutschland kamen, bei sich aufgenommen. Es sei allerdings unklar, welchen Untergruppierungen diese angehört hätten. Faktisch könne man jedoch von einer radikalisierten Ideologie ausgehen, mit der Saya M. aufwuchs.
Offenbar hat M. bis zuletzt versucht, auch andere zu missionieren: Unter dem Deckmantel der Berufsberatung gab die junge Frau seit mehreren Jahren Workshops an Schulen. So noch am Morgen vor der Tat, als sie den Schülern des Wilhelm-Gymnasiums predigt: »Lernt Arabisch, das ist die einzige Sprache, die eine Zukunft haben wird!«
Kurz darauf attackiert sie vor einem Café in der Bornemannstraße einen Mann unter »Allahu Akbar«-Rufen.
Volker M. befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Über seinen Anwalt lässt er mitteilen: »Wir waren lange genug tolerant. Es sind Menschen wie Saya M., die die Sicherheit unseres Landes mit ihren Ideologien gefährden. Wie viele Anschläge muss es denn noch geben?«
Die Attacke auf Volker M. ereignete sich nur wenige Stunden vor dem tödlichen Brand in der Bornemannstraße, den Saya M. vermutlich zu verantworten hat, und der bereits jetzt als einer der verheerendsten in der Nachkriegszeit gilt. Nach wie vor sprechen die Behörden nicht von einem islamistischen Terroranschlag. Die zur Schau getragene linke Gesinnung der Täterin scheint sie zu schützen.
Berichte darüber, dass in dem abgebrannten Gebäude ein Anhänger einer patriotisch orientierten Gruppierung wohnte, konnten bislang nicht bestätigt werden, verweisen jedoch auf ein mögliches Tatmotiv der Saya M.
Ich möchte fair bleiben, alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein kein Geheimnis daraus machen, was dieser Text ist und was er nicht ist.
Ich möchte das doch nicht.
Ich möchte fair bleiben, alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein erklären, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich bin nicht: die Ausgeburt der integrierten Gesellschaft. Ich bin nicht: das Mädchen, das ihr euch angucken könnt, um mitleidig zu erklären, ihr hättet euch mit den Migranten beschäftigt und es sei ja alles so dramatisch, aber auch so bewundernswert. Ich bin nicht: das Mädchen aus dem Getto.
Ich bin: das Mädchen aus dem Getto. Aber das ist eine Frage der Perspektive. Es gibt echte Mädchen aus echten Gettos, die lachen mich dafür aus, dass ich dieses Wort benutze, sobald sie erfahren, in welchem Kaff und in welcher schäbigen Ecke ich groß geworden bin, und es gibt Mädchen, die hätten es keinen Tag dort ausgehalten.
Ich bin nicht: ein Mädchen. Ich bin zu alt, um Mädchen genannt zu werden, denn ich könnte, wenn in meinem Leben einiges anders und einiges schlechter gelaufen wäre, schon Mutter von Mädchen sein, die sich nicht mehr Mädchen, sondern Teenager nennen lassen würden. Das bin ich aber nicht. Dafür trage ich einen Pferdeschwanz und einen Rock und beides, in Kombination mit den fehlenden Kindern, macht mich in dieser Welt zu einem Mädchen. So lange, bis ich ausspucke und losschreie und laut bin. Dann bin ich eine hysterische Frau.
Dieser Text ist der Versuch, mich eine Nacht lang zusammenzureißen. Eine Nacht lang niemanden aus dem Fenster zu schmeißen, kein Internet-Troll zu werden, zu warten. Der Versuch, auf meine Freundin Saya zu warten, die aus dem Knast kommen soll.
Ich sage Knast, weil ich lässiger klingen möchte. Weil ich schon als Kind die Wörter mochte, die lässiger klingen. Ich sage nicht Knast, weil es ein Relikt meiner Herkunft ist. Man kann in einem Getto aufwachsen, das kein Getto ist, wo Kriminalität und Prügeleien zum Alltag gehören, und trotzdem genauso wenig mit dem Knast zu tun haben wie die Pferdemädchen ein paar Straßen weiter etwas mit echten Pferden. Wenn ich Knast sage und dabei aussehe, wie ich aussehe und spreche, wie ich spreche, nicken mir die Pferdemädchen aber wissend zu. Klar, denken sie, der Knast. Der Ort, an dem du deinen Vater besucht hast, als Kind; der Ort, an dem dein erster Freund mehrere Monate verbracht hat, bevor er rauskam und plötzlich ganz verändert war; der Ort, an den du manchmal nostalgisch denkst. Dabei war ich noch nie im Knast und kenne auch niemanden, der schon mal drin war, zumindest nicht in Deutschland. Bis heute. Aber das Letzte, was ich will, ist, dass ich auch noch dort lande, deswegen setze ich mich hierhin, an diesen Schreibtisch, die Insel meiner Diplomarbeit, die Insel meiner, ungelogen, 83 Bewerbungen, die Insel meiner Hartz-IV-Bescheide, und schreibe.
Also zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte: zum Versuch, eine Nacht auf meine Freundin zu warten, die aus dem Knast kommen soll. Sie wird zu mir kommen, sobald sie kann, denn sie wohnt gerade bei mir, für einige Tage, bevor sie wieder zurück in ihre Stadt und ihr eigenes Leben fliegt. Eigentlich nämlich wollte sie ja Urlaub bei mir machen und zwischendurch die Hochzeit von Shaghayegh feiern.
Es ist Freitagnacht, 2:28 Uhr, und ich versuche, vorne anzufangen. Das wird nicht klappen, denn vorne, das wäre in einer Zeit, als es uns noch nicht gab. Ich fange also weiter vorne, aber eher so in der Mitte an. Mit dem letzten Montag. Mit dem Montag beginnt ja auch jede Woche und tut dabei so, als wäre sie etwas Neues. Damit wir nicht merken, dass alles immer einfach weitergeht, elendig, elendig weitergeht, und dass nichts passiert. Montag aber war Saya noch gar nicht hier. Saya stieg Dienstagnachmittag in ihrer Stadt ins Flugzeug und landete Dienstagabend in meiner und Hanis Stadt. Fangen wir also beim Dienstag an.
»Ich habe ihn angelächelt, und zwar nett, eindeutig ohne Flirt, einfach angelächelt, und er hat zurückgelächelt, eindeutig mit Flirt, und hat mich angesprochen«, sagte Saya und reichte die Bierflaschen an uns weiter, »und zwar auf Englisch.« »Auf Englisch«, lachte ich, nahm die zwei Flaschen, und gab eine an Hani weiter, »wie einfühlsam!« Hani lachte ebenfalls, wenn auch etwas unsicher, gab mir die Flasche wieder zurück und hielt mir ihr Feuerzeug hin. Als einzige Raucherin von uns dreien hatte sie das nötige Equipment, aber trotzdem keine Ahnung, wie man eine Flasche damit öffnete. Ich gab ihr die geöffnete Flasche zurück, stieß mit ihr an und sagte, »Wahrscheinlich hatte er auch noch einen fetten deutschen Akzent.« Ich machte einen fetten deutschen Akzent nach, indem ich einen englischen Satz von mir gab, ich tat das gleich zweimal hintereinander, damit wir beim Anstoßen zweimal kichern konnten, so ein anfängliches, unbeholfenes Kichern, das man von sich gibt, wenn man schon oft miteinander gelacht, sich aber lange nicht mehr gesehen hat. »Sein Englisch hatte nicht nur einen fetten deutschen Akzent, sondern war natürlich auch noch voller Fehler«, fuhr Saya fort, stützte das Kinn auf ihren angewinkelten Knien ab und schaute über die Stadt. »Das ist doch das Peinlichste an so Leuten, die denken, sie müssten Englisch mit uns reden: dass sie es nicht einmal können.« »Ist doch okay, kein Englisch zu können, oder nicht«, sagte Hani, denn Hanis Englisch war natürlich auch nicht so gut, meines ehrlich gesagt auch nicht. Hanis war nicht gut, weil sie auf einer schlechteren Schule war, meines, weil ich es eigentlich erst brauchte, nachdem ich in diese Stadt gezogen war, in der es zum guten Ton gehört, sofort Englisch zu sprechen, wenn jemand von außerhalb mal mitfeiert. Sayas Englisch war Weltklasse. Sie hatte es zwar auch erst nach der Schule gebrauchen können, dafür aber war sie damit dann auch um die Welt gereist, hatte in dieser und jener Metropole gelebt, Beziehungen geführt, ein Studium beendet. »Keiner muss Englisch können, ist doch klar«, sagte sie jetzt, »aber das ist doch das wirklich Merkwürdige an diesen Leuten. Wenn man was nicht so gut kann, dann wartet man doch erst mal ab, ob man es machen muss oder nicht. Man textet doch nicht einfach so hilflose Leute zu. Typen wie er denken, unser Deutsch wäre so was von nicht vorhanden, dass ihr grottiges Englisch der bessere Weg ist, um mit uns zu kommunizieren.« »Und was hat er jetzt gesagt«, fragte ich, »hast du auf Deutsch geantwortet?« »Quatsch«, sagte Saya, »der Flug hat anderthalb Stunden gedauert und er saß direkt neben mir. Auf Deutsch zu antworten hätte ja bedeutet, dass ich länger mit ihm hätte reden müssen. Ich habe auf Englisch geantwortet, dass mein Englisch nicht so gut sei. Er hat dann ganz mitleidig geguckt und nur noch gelächelt.« »Und was, wenn er einfach nett war und dir nur entgegenkommen wollte?«, fragte Hani und schaute auch auf die Stadt, so ein bisschen über sie hinweg, als läge irgendwo hinter den Dächern und Kirchtürmen der Beweis dafür, dass die Menschen alles immer nur gut meinen. »Ihr wart doch im Flugzeug, da kann man doch nie wissen, wer von wo kommt. Vielleicht hätte er dich auf der Straße auf Deutsch angesprochen. Er wollte bestimmt nur plaudern.« »Ja, ja, egal, die Geschichte ist noch nicht zu Ende«, sagte Saya.
Sie war seit einer halben Stunde bei uns, hatte ihren Wanderrucksack in meinem Zimmer abgelegt, in der Küche kurz gefragt, ob sie meine aktuellen Mitbewohner noch kennt, geduldig gewartet, bis Hani mit dem Bier vom Späti zurückgekommen war, und musste dann unbedingt aufs Dach, weil es ihr in Wohnungen gerade zu eng war. Erst hier oben wollte sie erzählen, wie ihr Flug war. »Eine Katastrophe«, hatte sie angekündigt, sie habe neben einem nervigen Mann gesessen. Überhaupt würde sie immer, auf jedem Flug ihres Lebens, neben nervigen Männern landen. Sie erzählte dann also und sah dabei gar nicht nach Katastrophe aus. Sie sah aus wie jemand, der sowieso jede Katastrophe überstehen würde und dabei auch noch ganz genau wusste, wie man es sich hinterher so richtig gemütlich macht. Saya klang völlig normal. So wie man klingt, wenn man froh ist, etwas Alltägliches zu erzählen, um wieder miteinander warm zu werden. Sie hat das so beiläufig, so nebenher erzählt. Da konnten wir ja wirklich nicht ahnen, was alles passieren würde.
»Dann ist eine Frau ins Flugzeug eingestiegen, die ein Kopftuch trug«, fuhr Saya fort. »Auweia«, sagte ich. »Auweia, richtig«, sagte Saya, »die Leute um mich herum fingen an, nervös auf ihren Sitzen rumzurutschen und sich umzuschauen. Könnte ja sein, dass zu der Frau auch noch ein bärtiger Mann gehört, das Risiko besteht ja, und der würde vermutlich anfangen, alle anderen Frauen zu belästigen und danach eine Bombe zünden.« »Nee, davor würde er noch seine Frau unterdrücken«, sagte ich. »Richtig«, sagte Saya, »er würde erst kurz seine Frau unterdrücken und danach die Bombe zünden.« Ich wollte noch mehr sagen, ich wollte noch einen draufsetzen. Aber wir hatten uns noch nicht warm geredet. »Macht ihr euch jetzt über Terroristen lustig? Oder über die Leute?«, fragte Hani und sah uns an. Wir schauten weiter auf die Dächer ringsum, so wie andere ins Lagerfeuer schauen. Wir hörten Autos hupen, hörten leise Gespräche von den Menschen unten auf der Straße. Ich wollte nicht antworten, ich fand, dass Hani uns noch eine Weile hätte weitermachen lassen können. Doch seit Saya angefangen hatte, von ihrem Flug zu erzählen, fragte sich Hani, ob es eine Geschichte war, wegen der man sich ärgern müsste. Das war, was sie befürchtete, wenn Saya erzählte: dass die ganze Geschichte darauf hinauslaufen würde, dass man sich am Ende ärgerte. Dabei war in dieser Geschichte bis jetzt ja noch alles in Ordnung. Überhaupt, als Saya ins Flugzeug stieg, war die ganze Welt noch in Ordnung. Fast hätte Saya vergessen, dass die Welt ein Ort war, an dem sie sich ärgerte. Sie hatte einen Fensterplatz und war eine der Ersten gewesen, die einsteigen durften, ohne dass sie dafür mehr bezahlt hätte. Abends würde sie uns sehen und sich hemmungslos betrinken. Die schönste Stadt der Welt wartete auf sie, ohne dass Saya dabei über deren Mietpreise nachdenken musste. Als der Typ mit dem schlechten Englisch neben ihr Platz nahm, fand sie das eher amüsant als nervig. Dann stieg die Frau ein. Sie wäre Saya nicht weiter aufgefallen, wenn sie nicht etwas verloren auf ihr Ticket, die Platznummern, ihr Ticket und wieder die Platznummern geschaut hätte. Etwas schien nicht zu stimmen, ihr Platz schien besetzt zu sein. Sie sagte es mehrmals, sagte es den Leuten, die vor Saya saßen, so oft, bis sie gehört wurde und man ihr entgegnete, dass das nicht stimme, sie sitze nicht am Fenster, sondern am Gang und der Platz sei ja auch noch frei. Es gab einen kurzen Moment, in dem die Frau so etwas sagte wie »Aber es ist Sitz A, Sitz B, Sitz C!« und nacheinander auf die Sitze zeigte und die Frau vor Saya daraufhin antwortete, »Nein, es ist Sitz A, Sitz B, Sitz C!« und genau von der anderen Seite aus auf die jeweiligen Sitze zeigte. »Können Sie sich bitte hinsetzen, die anderen Passagiere warten hinter Ihnen!«, sagte die Flugbegleitern in ihrem Rücken. Sie war unfreundlich und hatte trotzdem recht, es hatte sich eine Schlange missmutiger Menschen gebildet, die sich in dem kleinen Flugzeug aneinander quetschten und warteten. Saya wusste, dass die Frau mit dem Kopftuch zwar richtiglag, was das ewige Sitz-A-Sitz-B-Sitz-C-Spiel anging, aber sie wusste auch, dass sich die Frau vermutlich gleich einfach auf den falschen Sitz setzen würde, anstatt jetzt auch noch mit der Flugbegleiterin zu diskutieren. So wichtig war ein Fensterplatz am Ende ja doch nicht. Außerdem war die Flugbegleiterin genervt, hatte den Ton einer Gouvernante und sah aus, als würde sie hungern, um ihre Figur zu halten. Mit hungernden Menschen diskutiert es sich schlecht. Die Frau aber, nennen wir sie der Einfachheit halber Yağmur, weil sie aussah wie Yağmur aus der Serie Türkisch für Anfänger, wandte einen für Saya ganz neuen, interessanten Move an. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte sie zu der Frau, die auf ihrem Platz saß, »wir tauschen einfach, dann müssen Sie nicht extra aufstehen und ich sitze auf Ihrem Platz am Gang.« Das klang wie das wohligste Angebot ever, Saya hätte so gerne das Gesicht der Frau vor ihr gesehen. Als Nächstes wandte sich Yağmur an die Flugbegleiterin und sagte, »Schön, dass Sie da sind. Können Sie mir mit meinem Gepäck helfen? Ich darf nichts Schweres heben.« Sie strich sich mit beiden Händen über ihren Bauch, um zu betonen, wie schwanger sie war. Man sah zwar überhaupt keinen schwangeren Bauch, aber das konnte man ja schlecht sagen. Die Flugbegleiterin hatte darauf natürlich überhaupt keine Lust und Saya keine Ahnung, ob das zum Job einer Flugbegleiterin gehörte oder nicht. Die Augen verdrehend hob sie den Koffer schließlich ins Gepäckfach, denn sie wollte ja, dass es weiterging. »Nur 12 Kilo im Handgepäck«, zischte sie Yağmur an, als sie unter dem Koffer ächzte. Niemand half ihr. Wahrscheinlich, weil alle Angst vor ihr hatten. Oder weil alle zusehen wollten, wie sie ihre Unfreundlichkeit ausglich, indem sie sich nützlich machte: eine schwangere Frau, ein Koffer, eine gute Tat. »12 Kilo«, wiederholte die Flugbegleiterin mit erhobenem Finger, sobald der Koffer verstaut war. Sie klang, als würde sie jeden Moment ihre Peitsche rausholen und die umstehenden Menschen zu sekundengenauer Fließbandarbeit antreiben. Yağmurs Stimme zitterte, als sie sagte, »Ich weiß das schon von ihren Kollegen, die haben den Koffer gewogen, bevor ich eingestiegen bin. Vielen Dank für Ihre Hilfe, das ist sehr freundlich.« Das »Sehr freundlich« brachte sie so zitternd hervor, dass Saya verstand, hier zitterte jemand aus keinem anderen Grund als aus Wut. Saya, eine Reihe hinter den drei Frauen, wurde von den beiden Gefühlen übermannt, die sie am besten kannte. Wut und Solidarität. Solidarität ist kein Gefühl, würde Hani einwerfen, wenn Saya das, was ich hier beschreibe, überhaupt in dieser Form erzählt hätte. Aber sie würde nichts erwidern, wenn ich das Gespräch daraufhin mit einem simplen »Doch« beenden würde. Denn wer einen Menschen so kennt, wie wir Saya kennen, der weiß, dass Solidarität ein Gefühl ist und Unfreundlichkeit ein Grund für rasende Wut. Deswegen ist es auch Quatsch, Yağmur Yağmur zu nennen, denn die Yağmur aus der Serie war nie so würdevoll wütend wie die Frau aus Sayas Flugzeug, und wenn euch eine andere Frau des deutschen Fernsehens einfällt, die ein Kopftuch trägt, ruft mich an, dann ändere ich den Namen.
Als Yağmurs Koffer also endlich verstaut war, setzte sie sich auf ihren falschen Platz und nahm das Kopftuch ab. »So ein Mistwetter«, sagte sie, als sie mit den Händen durch ihre Locken fuhr. Es hatte während des Boardings geregnet, doch ihre Frisur saß dank des Schals noch ganz gut. Die Menschen bewegten sich schließlich, wenn auch schleppend, weiter durch das Flugzeug und als sich die Frau näherte, die sich neben Sayas Sitznachbarn setzen sollte, sprang er sofort auf, um ihr den Koffer abzunehmen. Saya beugte sich vor, um zu sehen, ob diese Frau auch schwanger war, konnte es aber nicht mit Sicherheit sagen. Mit Sicherheit sagen konnte sie nur, dass er sie nun die kommenden anderthalb Stunden auf Deutsch volltexten würde.
»Und fand sie das gut?«, fragte Hani, denn jetzt, endlich, war der Moment gekommen, in dem sie die Geschichte für interessant befunden hatte. Ich hörte einen Moment lang nicht zu, ein warmer Wind umgab uns und unten brüllte jemand etwas, das ich nicht verstand. In der Luft lag der Dunst von blühenden Bäumen, dieser Wichsegeruch, der zu dieser Jahreszeit in der Stadt hängt, es roch nach Abgasen und Hanis Zigarette. Es roch so gut. Alles war so gut. Die Stimmen von unten wurden lauter, weil vorbeigehende Menschen dem brüllenden Menschen irgendwas entgegneten, und es war so schön, hier oben zu sitzen und damit einfach nichts zu tun zu haben. Nicht um sein Leben fürchten, engagierte Zeugin sein, aufpassen, einschreiten zu müssen. Alle Alarmmechanismen, die man sich in einer Großstadt so angewöhnt, sind auf dem Dach völlig unbrauchbar. Wir kriegen hier oben viel zu wenig mit, um irgendwie relevant zu sein. Das ist großartig. Sayas Stimme, Sayas Körper neben mir zu haben, ist großartig, und zu wissen, dass Hani alles abdämpft, was die Laune trüben könnte, ebenfalls. Dass alle das tun, was sie am besten können, und dass mein Bier lauwarm und trotzdem das beste Getränk der Welt ist. Saya erzählte vom missglückten Flirt zwischen dem Sitznachbarn und der neuen Frau neben ihm und kam endlich zur Pointe, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut hatte, denn ich wusste schon, was passieren würde, ich hatte es mir die ganze Zeit gedacht, ich wusste, dass Saya genau das getan hatte, was ich in ihrer Situation gerne getan hätte. »Dann hat uns die Flugbegleiterin Getränke gebracht. Alle haben erwartungsvoll so Sachen gesagt wie ›Tomatensaft‹ oder ›Cola light‹ und alle haben dann enttäuscht geguckt, denn man hat natürlich nur so einen halb vollen, labbrigen Pappbecher bekommen, der einen eher traurig als glücklich macht. Der Typ neben mir, ganz Gentleman, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Getränke angeboten werden, er aber geduldig warten kann, er hat sich zu mir gedreht und gesagt: ›Ladies first‹«, Hani und ich buhten ihn aus, aber nur kurz, um gleich zu erfahren, wie es weiterging. »Ich habe dann meinen Kopf vorgestreckt und zur Flugbegleiterin gesagt: ›Einen Kaffee mit Milch und Zucker bitte‹, laut und deutlich und sehr deutsch habe ich das gesagt.« Hani und ich grölten jetzt, applaudierten und fragten, »Und? Wie hat er geguckt? Hat er was gesagt?« »Natürlich nicht. Er hat so getan, als wäre nichts gewesen. Später, beim Aussteigen, habe ich im Vorbeigehen zu ihm ›Tschüss, schönen Abend noch‹ gesagt.« »Und hat er geantwortet?« »Nein. Er war damit beschäftigt, die Frau ohne Kopftuch vollzuquatschen.«
Saya wickelte sich in ihren Schal, der einer riesigen Decke glich, und ich dachte, dass ich eigentlich auch auf die Idee hätte kommen können, dass diese Schals gut aussehen. Nur war ich wie immer zu faul gewesen, sie anzuprobieren. Wenn ich Klamotten in Schaufenstern sehe, ist mir das Risiko, sie anzuprobieren und festzustellen, dass ich meine Zeit verschwende, zu groß, darum verlasse ich mich auf das, was ich kenne. Saya scheut kein Risiko. Saya probiert an, legt weg, probiert an, kauft ein, schmeißt weg, tauscht, sieht am Ende gut aus. Selbst die schäbige Bank mitten auf dem Dach wurde durch Sayas Besuch besser. Weil sie mit einem Blick Potenzial und Probleme erkannt und dann sämtliche Kissen unserer WG hier hochgeholt hatte. Wie Rentner an der Nordsee, die einen eigenen Strandkorb besitzen, saßen wir jetzt auf diesem Dach der Stadt, die uns gehört. Daran hatte es früher nie einen Zweifel gegeben, für Saya und mich. Wenn wir irgendwann die Siedlung verlassen würden, käme für uns als neues Zuhause nur diese Stadt mit ihren vielen Versprechen infrage. Mit den Versprechen von Abenteuern und Freiheit, vor allem aber dem, dass wir hier endlich einmal nicht auffallen würden.
»Auf mehr Kilos im Handgepäck von Schwangeren«, sagte Saya und hob ihre Flasche, um gleich mehrere große Schlucke daraus zu nehmen. Hani griff irritiert nach ihrer Flasche, wusste aber nicht, ob wir darauf nun wirklich anstoßen müssten, ob das Sayas Ernst sein konnte und wir von nun an die Lobby für schwangere Frauen spielen würden, bis jemand anderes aus der Unterdrückung gerettet werden musste.
Als Sayas Mutter mit Saya schwanger war, saß sie im Gefängnis. Ich sage diesmal Gefängnis, weil es, wenn es politische Gründe für die Haft gibt, irgendwie nicht richtig zieht, lässig sein zu wollen. Und wer zu Zeiten eingesessen hat, in denen die Fotos nicht nur analog, sondern auch noch schwarz-weiß waren, hat umso mehr ein Anrecht darauf, dass man »Gefängnis« statt »Knast« sagt. Wir waren ungefähr 14 und saßen auf dem Teppich in Sayas Wohnzimmer, als wir uns die Fotos anschauten. Es kam bei uns allen eher selten vor, dass die anderen Familienangehörigen mit ihren ewigen Gästen geschlossen das Feld räumten, deswegen war es eine ausgemachte Sache, dass wir uns in diesem Fall in der Wohnung derjenigen trafen, die gerade sturmfrei hatte. Wir wurden innerhalb von Minuten sehr erwachsen, wenn wir uns an den Kühlschrank wagten, uns etwas zu essen zusammensuchten und hinterher selbst unser Geschirr in die Spülmaschine räumten. Wir waren aufgeregt, wenn wir uns auf die endlich freien Sofas setzten und ganz ohne die kritischen Blicke von Vätern und Müttern entspannt eine Folge Beverly Hills 90210 sahen. Wir tranken Saft aus Sektgläsern, die unsere Eltern ohnehin nie benutzten. Und Hani hatte immer das merkwürdige Bedürfnis, in den Werbepausen aufzustehen und sich auf den kleinen Balkon zu stellen, der in all unseren Wohnungen exakt gleich aussah, weil unsere Familien in den exakt gleichen Wohnungen lebten. Hani wohnte aber auch als Einzige von uns in einer Wohnung, in der es nach kaltem, versehentlich eingelassenem Zigarettenrauch roch, und der Unterschied zwischen ihrem und unseren Balkonen lag eben auch darin, wofür man ihn nutzte und wofür nicht.
Manchmal, wenn Menschen so was wie »Wochenende« oder »Feierabend« sagen, habe ich genau dieses Bild vor Augen. Ich, auf ein Sofa gefläzt, das sonst immer belegt ist, in der Hand das Sektglas, gebannt vom Rausch der RTL-Werbung, Hani, die sinnlos auf dem Balkon steht und über die Dächer der Stadt schaut. Der ewige Geruch dieser Wohnungen, der Geruch von Füßen, alter Tapete und getrockneten Kräutern, die sich, je nachdem, bei wem wir waren, noch mal unterschieden. So, wie sich die Sprachen unserer Mütter und der Geschmack ihrer Gerichte unterschieden.
Als wir also einmal bei Saya zu Hause waren und ihre Eltern unterwegs, zeigte sie uns das Fotoalbum und Hani und ich waren dabei nicht deswegen so andächtig, weil wir so gute Freundinnen waren, sondern weil wir ganz einfach wussten, dass dies ein privater Gegenstand war, in einem Raum, in dem die Erwachsenen kein Privatleben hatten. In dem übrigens auch die Kinder kein Privatleben hatten. In dem niemand ein Privatleben hatte, denn dafür war in diesen Wohnungen einfach zu wenig Platz und in dem Miteinander und den Gewohnheiten zu wenig Verständnis. Die meisten Gegenstände in diesen Wohnungen waren entweder nützlich oder dekorativ. Saya hatte das Fotoalbum erst vor einigen Tagen zum ersten Mal gesehen, weil ein Bekannter eines Onkels zu Besuch gekommen war und es mitgebracht hatte. In den vergangenen Jahren musste das Album auf verschlungenen Wegen von vertrauter Person zu vertrauter Person weitergereicht worden sein. Seit Sayas Eltern ihre Wohnung und das Land ohne Abschied verlassen hatten, hatte es darauf gewartet, zusammen mit dem anderen Hab und Gut der drei gerettet zu werden. Saya war vierzehn, als sie das erste Mal Bilder aus der Jugend ihrer Eltern sah. Dass das für sie eine einschneidende Erfahrung war, konnten Hani und ich nicht wissen, wir fanden bloß spannend, wie diese langweiligen alten Leute in jungen Jahren ausgesehen hatten. Saya zeigte uns ein Foto, auf dem ihre Mutter einen halblangen Haarschnitt und ein Militärhemd trug, einen Fuß auf einem Stein und eine Hand in die Hüfte gestemmt hatte. Für meine und Hanis Begriffe sah sie da zwar jung, aber auch ziemlich uncool aus, doch Saya zeigte stolz darauf und sagte, »Das war kurz bevor sie ins Gefängnis musste.« Dann fügte sie noch stolzer hinzu, »Also war das kurz bevor sie schwanger wurde. Vielleicht ist sie auf diesem Foto auch schon mit mir schwanger, aber weiß es noch nicht.« Ab da war ich ziemlich neidisch auf Saya. Wegen ihrer Mutter, die im Gefängnis gesessen hatte, und weil Saya dadurch irgendwie auch schon mal im Gefängnis war. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages so hier sitzen und mir wünschen würde, Saya wäre einfach nie im Gefängnis gewesen, damals nicht und erst recht nicht heute Nacht. Warum bitte muss sie denn ausgerechnet in diesem einen Punkt nach ihrer Mutter kommen?
Jedenfalls: Als wir auf dem Dach saßen und Saya sich in ihrer Erzählung gerade mit der Schwangeren im Flugzeug solidarisierte, klang sie, als wäre eine Schwangerschaft eine selige Zeit voller Glück, die auf keinen Fall getrübt werden darf. Das ist insofern absurd, als ihre eigene Mutter eben nur einmal schwanger war und in dieser Zeit eingepfercht zwischen zehn anderen Frauen saß, jeden Tag zum Verhör abgeholt wurde und nicht wusste, ob ihr Mann noch lebte. Meine Mutter war fünfmal schwanger und in jeder Schwangerschaft musste sie hoffen, dass das Kind in ihrem Bauch trotz ihrer nächtelangen Arbeit in der Wäscherei überleben würde. Solche Gruselgeschichten kannten wir in der Regel nur aus unseren Familien, darum orientierten wir uns von klein auf lieber an der Realität der anderen, als gäbe es unsere nicht. Was auch wichtig war, damit die anderen Kinder das, was wir erzählten, überhaupt verstanden. Also sprachen wir im Sommer davon, »in den Urlaub« zu fahren, obwohl das in unserem Fall nie Strand und Ferienwohnung, sondern immer nur mehrtägige Besuche bei Freunden unserer Eltern bedeutete, in deren kleinen Wohnungen wir dann den ganzen Tag Fernsehen guckten.
Heute machen wir das manchmal immer noch so, wir nehmen das, was uns als Realität verkauft wird, und übermalen damit unsere eigenen Biografien. Und in dieser Realität sind Schwangere nun mal glückliche Frauen, die eine tolle und intensive Zeit mit ihrem Körper verbringen und die man darin unterstützen muss, alle Störfaktoren aus dem Weg zu räumen. Wenn ihnen jemand keinen Respekt zollte, musste man also, ging es nach Saya, für sie eintreten und für ihre Rechte kämpfen. »Ist Shaghayegh schwanger?«, fragte Saya, und ich kam zum ersten Mal auf die Idee, dass so etwas möglich sein könnte. »Warum fragst du? Weil sie heiratet?« »Ja. Wieso heiratet sie?« »Ich weiß es nicht.«
Ich wusste nicht, warum wir auf dem Dach saßen und statt über schöne Dinge über so was reden sollten, und warum Saya ihren Kronkorken mit einem Mal auf die Straße warf, als wüsste sie nicht, dass sie da unten jemanden treffen und verletzen könnte. Ich hatte auf einmal kein gutes Gefühl mehr dabei, hier oben zu sitzen. »Habt ihr euch nicht gewundert, dass sie heiratet?« Saya klang, als wäre heiraten ein Unding, als bräuchte man gute Gründe dafür. »Doch«, sagte ich, »ich habe mich gewundert, dass sie uns überhaupt einlädt. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres, als dass Menschen heiraten wollen.« »Ist doch kein Verbrechen zu heiraten«, sagte Hani, »ich freue mich für Shaghayegh.« »Ich weiß eben nicht, warum man sich da freuen sollte«, legte Saya endlich los, und ich hoffte, dass der anstehende Vortrag nicht allzu lange dauern würde, denn das Thema langweilte mich. Er ging aber eine ganze Weile, ich beschränke mich mal auf ihre Hauptthesen. »Menschen heiraten, weil sie im Kino gelernt haben, dass das zum Happy End dazugehört, aber in Wirklichkeit existiert die Ehe nur, damit Männer Frauen an sich binden, sie kontrollieren und von ihnen abhängig machen können. Dass das Konzept bis heute überlebt hat, liegt allein an den zwei Millionen Steuervorteilen für Verheiratete, was so was wie finanzielle, konservative Erpressung ist, und das ist ekelhaft und war nebenbei bemerkt in den letzten Jahrhunderten auch ein Mittel, um alle auszuschließen, die in einer heterosexuellen Welt nicht dazugehören sollen. Alle, die nicht ausrasten vor Glück bei der Vorstellung, wie ein klassischer Mann und eine klassische Frau zu sein haben, sollten und sollen auch weiterhin buchstäblich dafür zahlen und sich jeden Tag aufs Neue so richtig schämen. Das ist das einzige Ziel der Ehe. Ich freue mich ja auch, dass Shaghayegh uns eingeladen hat, aber ich will eben vorher wissen, was bei ihr schiefläuft.« »Schiefläuft? Das ist aber ein bisschen übertrieben, oder?«, fragte Hani. Saya schüttelte den Kopf, »In Zeiten wie diesen nicht. Sich in Zeiten wie diesen mit so was Banalem wie Heiraten zu beschäftigen ist ein Luxus, den man sich erst mal leisten können muss. Da muss doch was bei Shaghayegh schieflaufen, dass sie ihre Prioritäten so setzt.«
Das also würde Sayas Mission in den kommenden Tagen bis zur Hochzeit sein: herauszufinden, warum genau Shaghayegh heiratet, um dann feiern zu können. Denn wegen der Feier hatte sie ja überhaupt den weiten Weg aus ihrer Wahlstadt auf sich genommen.
Zwei Stunden später hatten wir den Pegel, den ich mir jetzt gerade wünschen würde, und unser dreckiges Lachen hallte in den leeren Straßen unter uns. Die Stadt tat, als wäre sie friedlich. Vom Dach aus wirkte sie wie ein behüteter, stiller Ort. Es war ganze sechs Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gemeinsam auf einem Dach dieser Stadt betrunken hatten. Auf einem anderen Dach, in einer Silvesternacht, und selbst da war alles merkwürdig andächtig und friedlich gewesen. So friedlich, dass wir damals nichts gegen das in der Ferne tosende Feuerwerk hatten und auch nicht mitleidig an traumatisierte Kriegsgeflüchtete, Kriegsrentner und verstörte Hunde dachten, die angsterfüllt in ihren Wohnungen saßen, während alle anderen um sie herum einen Kriegslärmpegel imitierten, weil sie sich sonst nie gehen lassen durften. Vielleicht hatten wir aber auch deswegen kein Mitleid, weil in dem Stadtteil, in dem wir damals feierten, ohnehin keine Geflüchteten und keine Rentner mehr wohnten und sich unser Mitgefühl für die Hunde der Hipster in Grenzen hielt. Sechs Jahre ist es her, dass wir Silvester überhaupt zusammen und nicht mit neuen Freundeskreisen, neuen Partnern oder neuen Partner-Freundeskreisen feierten, sondern ganz selbstverständlich miteinander, auf dem Dach meiner damaligen WG. Und ganz selbstverständlich saßen wir jetzt zusammen, als wäre seitdem kein Tag vergangen. Hanis Lachen klang noch immer so, als wäre sie riesig, als käme es aus einem gigantischen Resonanzkörper, als würde es den Boden zum Beben bringen können. Sie schmiss den Kopf nach hinten und schlug sich auf den Oberschenkel, als wir über irgendwas redeten, das irgendwann passiert war und das Hani damals irgendwie kommentiert hatte. Sayas Lachen klang kehlig, als würde sie jeden Ton genießen, ich lachte auch, konnte dabei aber nicht aufhören, den anderen beiden beim Lachen zuzuschauen. Beim Lachen nämlich merkten sie nicht, dass ich sie anstarrte, um mir jedes Detail einzuprägen, denn es gibt wenige Menschen, die man so gut kennt, dass man immer wieder aktualisieren muss, wie sie gerade aussehen. Damit man sie später, wenn man an diesen einen Moment zurückdenkt, genau so vor sich sieht. Wie macht man das wohl, wenn man so richtig alt ist und sich an ein unbestimmtes Früher erinnert? Sieht man dann die Mode vor sich, die Frisuren, wie sie mal waren? Oder gibt man sich nur Mühe, das alles zu sehen, weil man es sich als möglichst wahr vorstellen möchte? Ich mache das beim Schreiben, beim Denken: Ich will keine merkwürdigen Schemen von den Menschen, an die ich denke, ich will sie so sehen, wie sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt ausgesehen haben, und es ist ein Glück, dass ich das kann, denn sonst wäre ich nicht in der Lage, all das zu beschreiben, was uns passiert ist.
Hani dagegen kann meistens nicht so gut beschreiben, was ihr passiert ist, aber wir hören ihr natürlich trotzdem zu. Sie begann irgendwann zu erzählen, wie sie mal geflogen war und die Flugbegleiterin wirklich alles falsch gemacht hatte. Das dauerte ziemlich lange. Wir verstanden es nicht so richtig, deswegen dauerte es noch länger, denn Hani gab sich Mühe, dass wir den Punkt, den sie machen wollte, am Ende doch verstanden. Es ging um einen Mann, der auf dem falschen Platz saß, um Leute, die sich beschwerten, und eine Flugbegleiterin, die helfen wollte, aber nicht richtig zuhörte und dann den falschen Mann zum Aufstehen zwang, und Hani machte in der Luft eine kleine Zeichnung davon, wer wo saß und wer falsch saß und wo sie selbst saß. Sie ging unendlich, diese Geschichte, Hani merkte nicht, wie viel Raum sie einnahm, und Saya sagte irgendwann, dass sie bald schlafen müsse, und Hani sagte, »Moment, die eine Zigarette noch«, und am Ende rauchte sie noch drei Zigaretten, damit wir irgendwas verstanden, und wir gingen erst schlafen, nachdem wir Hani versichert hatten, dass sie damals im Flugzeug eindeutig recht hatte. Hani schlief bei uns und ich genoss, dass Saya bei mir zu Gast sein musste, weil sie in dieser Stadt zu Gast war, und dass Hani hier zu Gast sein wollte, um in unserer Nähe zu bleiben. Also war ich, was ich von klein auf hätte sein sollen: eine gute Gastgeberin.
Ich höre jetzt auf, weiterzuschreiben. Das hat keinen Zweck, denn ich versuche mir permanent vorzustellen, wer ihr seid, während ihr euch vorzustellen versucht, wer wir sind. Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt. Weil ihr keine Kindheit hattet, die so roch wie unsere, und weil ihr keine Freundinnen habt, mit denen ihr diese stinkende Kindheit hättet teilen können. Ihr habt auf jeden Fall gerade verschiedene Gedanken. Ihr findet Hani jetzt schon unsympathisch und ihr stellt euch Saya jetzt schon hübsch vor. Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor ihr euch in uns eindenken könnt. Das ist für euch eine ungefähr so wichtige Information wie die, am Rand welcher deutschen Kleinstadt wir aufgewachsen und wie alt wir sind und wer von uns die Heißeste ist. Ich sage euch dazu nichts. Da müsst ihr durch. Ich weiß ja auch über euch nichts. Ihr werdet das hier lesen, vielleicht, je nachdem, wie die Presse mit dem Fall umgeht. Wenn die Presse nämlich versucht, mich zu erreichen, und das wird sie, dann werde ich keine Interviews geben, denn ich weiß, wie Interviews funktionieren, ich habe oft genug Zeitung gelesen und die Polit-Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Ich werde dieses Manuskript ausdrucken. Ich werde mir in den Finger schneiden und mein Blut darübertropfen lassen. Ich werde es der BILD-Zeitung geben und dann könnt ihr loslegen, über uns zu schreiben. Ich beschreibe Saya hier so, wie sie ist, und ihr macht aus ihr das, was ihr aus ihr machen wollt. Wenn ich die Geschichte fertig geschrieben habe und die Nacht noch immer nicht rum ist, schreibe ich sie einfach noch mal. Dann vielleicht aus eurer Sicht. Wie die Geschichte ginge, wenn einer von euch sie geschrieben hätte. Halt, stopp, um das zu wissen, muss ich ja nur in ein paar Stunden die Zeitung aufschlagen oder ins Internet gehen. Ich höre jetzt also doch nicht auf zu schreiben. Ich schreibe weiter, obwohl ich nur Leitungswasser und Tee zu trinken habe und aus dem gekippten Zimmerfenster der kalte Zigarettenrauch des Nachbarn hereinzieht und ich es schöner fände, Bier zu trinken, und es heute sogar schöner fände zu rauchen. Aber für beides müsste ich erst einmal das Haus verlassen. Das tue ich ohnehin schon ungern und das möchte ich heute erst recht nicht mehr. Draußen sind die Leute völlig unberechenbar, ich will nicht vor ihnen davonlaufen müssen, nur weil ich mir etwas zu trinken kaufen wollte. Im Späti gegenüber sagt der Verkäufer außerdem jedes Mal zu mir – und er verkauft es wie eine Frage –, dass ich immer hübscher werde: »Du wirst auch immer hübscher, oder?« Ich kichere dann künstlich, weil ich nicht weiß, was man dazu sagen soll. Wahrscheinlich, weil man dazu gar nichts sagen kann, denn es geht nicht darum, dass man was sagt. Es geht darum, dass er was sagt. Ich habe Angst, dass er sich nutzlos fühlt, weil er so was Überflüssiges sagt, also lache ich und tue so, als wäre mir das nicht unangenehm. Ich spüre dann manchmal das Phantom einer Berührung am Hintern, obwohl der Verkäufer hinter seinem Tresen steht und die Hände bei sich hat. Das habe ich manchmal, dass mein Körper sich an ungewollte Berührungen aus Bus und Bahn und von der Tanzfläche erinnert, obwohl jemand gerade auf andere Art nervt als auf die körperliche. Vielleicht, weil mein Körper mich dazu animieren will, nachträglich zu reagieren und irgendwem eine zu knallen. Das tue ich natürlich nicht, denn das hat der Späti-Verkäufer dann auch wieder nicht verdient. Deswegen mache ich eben meistens nichts. Da fällt mir ein, das ist eine Geschichte, die man über Saya erzählen muss, denn Saya macht immer etwas, sie lässt die Dinge nicht stehen. Sie haut auf Tische, auch wenn die Tische dabei kaputtgehen können, und sie ist deswegen nicht automatisch gewalttätiger als andere.
Wir waren eben schon bei Silvester. Das vor sechs Jahren, das letzte gemeinsame. Es war ein besonderes Silvester, denn alles war noch schön und aufregend. Das würde ich allerdings über alles sagen, was länger als drei Jahre zurückliegt, denn drei Jahre ist die Frist, nach der die Dinge schön und aufregend werden, solange sie nicht schlecht oder langweilig waren. Es waren Leute da, die ich kannte, und Leute von meinen Leuten aus der WG, die ich nicht so gut kannte. Es waren auch zwei da, die ich in- und auswendig kannte, und das waren Saya und Hani. Wir drei verbrachten die Stunden bis Silvester dabei nicht miteinander, sondern mit unterschiedlichen Menschen, lachten und tranken und flirteten, ja, ganz sicher, ich flirtete mit dem niedlichen Mitbewohner, den ich damals hatte, und weil er neu eingezogen war, befanden wir uns noch nicht an dem Punkt, an dem man entweder miteinander schlafen oder den Flirt beenden musste. Ich wusste noch nicht, dass er irgendwann anfangen würde, sich seinen Kaffee immer dann zu kochen, wenn er hörte, dass ich in der Küche war, und ich deswegen aufhören würde, über seine Witze zu lachen und den Kopf schräg zu legen, wenn er mir etwas erzählte. An Silvester aber fanden wir uns noch spannend. Wie das eben immer so ist, mit den Flirts und den Mitbewohnern. Sie sind so lange wichtig, wie sie aktuell sind, und sobald man auszieht, verliert man sie aus den Augen und aus dem Leben. Ich musste sogar eben eine Weile überlegen, bis mir einfiel, wie er hieß, er hieß nämlich Felix, so wie Leute eben heißen, die in den Achtzigern geboren sind und bei denen alles prima läuft. Felix hatte einen Kumpel, der vollkommen egal war, der schon damals egal war, der aber auf der Party niemanden kannte außer Felix, und irgendwie auch mich, weil ich ihm einmal einen Kaffee mitgekocht hatte, als er bei Felix zu Besuch war. Weil er niemanden kannte, stellte er sich zu uns und störte den Flirt, denn sobald man beim Flirten beobachtet wird, schämt man sich ja für das, was man tut. Es ist ja nur so lange spannend, wie man sich vormachen kann, gar nicht zu flirten. Der Freund, nennen wir ihn Gabriel, weil er engelsgleiche Locken hatte, stand also neben uns, machte den Flirt sichtbar und beteiligte sich nicht am Gespräch. Kurzum: Er störte.
Als Hani, eher zufällig, irgendwann neben uns stand, machte ich kurzen Prozess und stellte die beiden einander vor. Ab da beobachtete ich ihr Gespräch aus den Augenwinkeln. Er fragte, woher Hani kam, und Hani antwortete wahrheitsgemäß. Er fragte, was Hani arbeite, und Hani antwortete, sie arbeite als Kauffrau für Büromanagement. Er fragte, ob man das nicht auch genauso gut Sekretärin nennen könne, und fing an, einen zweifelhaften historischen Abriss über Berufsbezeichnungen zu geben, woraufhin Hani irgendwann etwas sagte wie »Ich mache Buchhaltung und Verwaltung, ich muss schon auch rechnen«. Hani stand da und setzte das Gespräch fort, weil ich ihr Gabriel ja vorgestellt hatte und sie natürlich nicht wissen konnte, dass er ein unwichtiger Mensch war. Sie sah nicht gerade amüsiert aus, aber sie blieb und plauderte. Gabriel tat dabei, als würde er sie akustisch nicht verstehen, was vielleicht ja auch der Wahrheit entsprach, auf jeden Fall beugte er sich immer wieder vor und näherte sich mit seinem schönen Kopf Hanis Mund. Weil diese Körperhaltung unmöglich zu bewerkstelligen ist, wenn man dabei alle weiteren Körperteile bei sich behält, legte er seine Hand sachte auf Hanis oberen Rücken, während er fragte, was das für ein Unternehmen sei, in dem sie arbeitete. Hani mag Hände auf ihrem Rücken und sie mag Männer mit Locken, also hatte sie jetzt neben der Höflichkeit, die sie mir zu schulden glaubte, einen Grund mehr, noch etwas länger bei Gabriel stehen zu bleiben. Sie erklärte ihm das Unternehmen, bei dem sie damals gerade erst angefangen hatte, und verwendete dabei Worte, die das Unternehmen selbst zu diesem Zweck nutzte: Es gehe ihnen um Tierschutz, aber um einen Tierschutz, der sich an den Regeln des Kapitalismus orientiere, man vereine beides, denn nur so könne es den Tieren in der Welt, in der wir leben, wirklich gut gehen, alles andere habe keinen Sinn. Gabriel hatte dazu eine Menge zu sagen, als hätte er bereits Tage und Wochen darüber nachgedacht, ob das ein sinnvolles Konzept war. Hani, die ja tatsächlich Tage und Wochen darüber nachgedacht hatte und bereits zu dem Schluss gekommen war, dass es das nicht war, aber trotzdem nun mal ihren Lebensunterhalt sicherte und ihren Alltag bestimmte, fand seine Argumente weder interessant noch relevant noch gut. Da waren ihr dann auch die Hand und die Locken egal, sodass sie schnell fragte, »Und was arbeitest du?« Ich sah ihr an, dass von dieser Frage die Zukunft des weiteren Gesprächs abhing. Als er antwortete, änderte sich an der Körperhaltung der beiden zunächst nichts, allerdings fand seine Antwort so schnell kein Ende, er arbeitete irgendwas, was ich aufgrund des Gespräches, das ich ja selbst gerade führte, nicht verstand. Hanis Gesichtsausdruck aber verriet, dass sie von seinem Beruf weder Ahnung hatte, noch etwas daran sympathisch fand, und auch ihre Haltung fing allmählich an, sich zu verändern. Ihr Ohr entfernte sich von seinem schrägen Kopf und dem ständig redenden Mund, was aber nicht viel brachte, weil er ihrem Ohr folgte. Als Hani kleine Schritte von ihm weg machte, folgte sein Körper ihrem, was ja ganz gut ging, denn seine Hand hatte auf Hanis Rücken einen guten Halt und verriet ihm, wohin sie sich bewegte. »Ich gehe mal eine rauchen«, sagte Hani, ein Ausweg, um den ich sie immer beneidet hatte. Wer Raucherin war, konnte sich immer zurückziehen, wenn es unangenehm wurde, konnte immer andere auf sich warten lassen, konnte immer neue Gesprächspartner finden, mit denen man sogar sofort ein Gesprächsthema hatte, nämlich im Zweifelsfall das Rauchen. »Ich wollte auch gerade rauchen«, sagte Gabriel aber ungünstigerweise, was Hani überraschte, denn er sah überhaupt nicht nach Raucher aus und sie hatte ihn bisher auch noch nicht auf dem Balkon getroffen. Später, auf dem Dach, rauchten eh irgendwann alle, aber so früh am Abend verschlug es nur die nach draußen, die es brauchten. Sie gingen also Richtung Balkon und als sie sich umdrehten, versuchte seine Hand noch kurz, etwas tiefer zu sinken und den unteren Teil ihres Rückens zu streifen, was Hani aber geahnt zu haben schien und mit einer schnellen Bewegung Richtung Balkon zu verhindern wusste.
Ich blieb mit Felix, den ich zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, ausgesprochen witzig und interessant fand, zurück und fühlte mich ein wenig schlecht, dass ich Hani benutzt hatte, um Gabriel abzuschieben. Aber ich sagte mir auch, dass Hani erwachsen war und weggehen konnte, wenn er sie nervte, und dass er so nervig ja auch wieder nicht war. Er hatte die üblichen, nicht gerade originellen Fragen gestellt, was soll’s, es gab schlechtere Gesprächspartner, er schien doch auch ernsthaft an Hanis Leben interessiert zu sein. Und so sprach ich lieber weiter mit Felix über das Aufwachsen auf dem Land und die Dorfpartys, statt mir Gedanken über zwei Erwachsene zu machen, die einander jederzeit kommunizieren konnten, wenn sie nicht miteinander kommunizieren wollten. Als ich sah, dass Saya Richtung Balkon ging, um sich ein kühles Bier zu holen, dachte ich nicht mehr weiter darüber nach.
Es dauerte drei, vielleicht vier Minuten, ehe Hani und Saya lachend und etwas verstört zu uns zurückkamen, und ich hörte, wie Saya sagte, »Das war ja nicht mehr auszuhalten.« Den Rest des Abends sahen wir Gabriel nicht wieder, sondern öffneten nach seinem Abflug den Schnaps. Einen selbst gebrannten, vom Land, von dort, wo Felix herkam, aus den Quitten seiner Eltern, und mein Gespräch dauerte bis Mitternacht, bis alle, wie gesagt, auf dem Dach standen und auf die vermeintlich friedliche Stadt blickten. An dem Abend, an Silvester, hat Saya irgendwas gemacht oder gesagt, wonach ich mich nicht zu fragen traute, aber hätte sie Gabriel zum Beispiel eine geknallt, hätte ich es ja bestimmt irgendwann irgendwie erfahren. Andererseits habe ich Gabriel nicht vom Balkon zurückkommen sehen. Ich habe ihn einfach nie wiedergesehen, nicht an diesem Abend und nicht danach, und als ich Tage später seinen Namen nannte, schauten alle nur betreten und wechselten das Thema. Ich habe mir so oft vorgestellt, was passiert ist, dass ich mir inzwischen sicher bin, dass meine Version stimmt. Meine Version geht so: Saya hat den Balkon betreten, sich nach den Bierkästen gebückt und währenddessen genug von Hanis und Gabriels Gespräch mitbekommen, um die Situation einordnen zu können. Sie hat ihre Flasche an der Balkonbrüstung geöffnet und ist geblieben, um weiter zuzuhören. Sie hörte zu und die anderen beiden rauchten und redeten, das heißt, Hani war in erster Linie am Rauchen, Gabriel am Reden, bis er Saya ansah und sie fragte, ob er ihr helfen könne. Saya hat daraufhin ihr Bier abgestellt, ihn freundlich angelächelt, an den Schultern gepackt und über die Balkonbrüstung geworfen. Gabriel hat engelsgleich seine Flügel ausgebreitet, seinen Heiligenschein aktiviert und sich, davonfliegend, nicht mehr nach der desinteressierten, rauchenden Hani und der starken, nicht rauchenden Saya umgedreht. So wird es gewesen sein, denn Saya findet immer einen Weg, wie sie ihre Freundinnen beschützen kann. Hani ist zwar weniger lösungsorientiert als Saya, dafür aber geht es ihr immer gut. Wenn Saya nicht eingeschritten wäre, hätte Hani einfach den Abend mit Gabriel verbracht, ihn sich schlau, umsichtig, diskret und egofrei getrunken. Dann hätte sie das Problem gelöst, ohne ein Problem gehabt zu haben. Mit dieser Strategie gelang ihr das mit dem Feiern auch irgendwie immer besser als Saya und mir. Als wir in den letzten Jahren zum Beispiel vor Clubs oder dem Festivalgelände kontrolliert und abgetastet wurden, rasteten Saya und ich vor Wut regelmäßig aus, während Hani bloß kicherte. Sie kicherte wirklich, denn sie fand es schön, dass sie die freundlichen Türsteherinnen abtasteten, das kitzelte sie, und so hatte sie immer ein gutes Verhältnis zu jenen Personen, die von Saya und mir nie ein Wort des Grußes geschweige denn des Dankes hörten. Hani ging gut gelaunt zu Partys, vor denen wir uns erst einmal abreagieren mussten.
Als Hani damals in die Siedlung zog, fing unsere Pubertät gerade an. Wir lasen die BRAVO, die sich die anderen Siedlungskinder von ihren älteren Geschwistern geliehen hatten, und wir lasen sie draußen, damit unsere Eltern uns nicht dabei erwischten. Saya, zwei Jahre älter als ich, las immer die Dr.-Sommer-Seiten, was mir auffiel, mich aber nicht weiter interessierte. Damals hieß das noch, dass auf Sayas Knien ein aufgeschlagenes, buntes Heft lag, auf dem nackte Teenager, na gut, sagen wir, junge Erwachsene, abgebildet waren. Eine redaktionelle Entscheidung, die die BRAVO irgendwann skandalös werden ließ und die sie später wieder zurücknahm.
Als unsere Pubertät begann, war die Rubrik schon gar nicht mehr so richtig skandalös und auch noch nicht abgeschafft, sodass sie einen wertvollen Beitrag zu unserer Aufklärung leistete, um die sich sonst ja kein Mensch kümmerte. Manchmal zeigten wir uns die Seiten auch gegenseitig, um uns totzulachen. Auf einem Bild zum Beispiel war ein junger Mann zu sehen, der seiner Freundin Sahnetupfer auf den nackten Körper gesprüht hatte, um sie dann wegzuküssen. Wir kriegten uns nicht mehr ein. Ich höre Saya heute noch lachen, »Guck ma’, der hat da überall Sahne draufgemacht!«, sehe, wie sich unsere ungeformten Oberkörper krümmen. Hani stand daneben und lachte mit, wenn auch immer ein wenig verhaltener als wir. Das hat sich geändert, irgendwann, vermutlich, als sie die Sprache verstand und nicht mehr so tun musste, als wäre sie eine von uns, sondern tatsächlich eine von uns war. Durch Hanis Hinterkopf waberten verschiedene Sprachen, die sie in Deutschland niemals brauchen und die hier niemals als Kompetenz oder Qualitätsmerkmal anerkannt werden würden. In ihrem Gesicht stand die Neugier und das Interesse geschrieben, von uns zu lernen, was man lernen musste, um nicht aufzufallen. Nicht, weil sie so wissbegierig war, sondern weil alles andere zu Problemen geführt hätte. Probleme aber hatte sie hinter sich gelassen. Hanis Eltern, ihr Bruder und sie waren dem Krieg, einem blutigen, unnachgiebigen, schonungslosen Krieg, entkommen, ohne dass man sie hier dafür lobte oder bemitleidete. Man nahm sie eher so am Rande wahr und hoffte, weil sie ja keinen allzu weiten Weg gehabt hatten, dass sie zurückkehren würden, sobald der Krieg vorbei war. Ich weiß nicht, ob Hani und ihre Eltern, ein weißhaariger, schnauzbärtiger Mann und eine junge, fröhliche Frau mit blonden Locken, das auch hofften. Sie wirkten immer, als wäre ihnen vor allen Dingen wichtig, hier und sicher zu sein. Auf dem Balkon in Ruhe rauchen, sich über die Sonne freuen zu können und den Freunden ihrer Kinder liebevolle Gastgeber zu sein.
Hani, wie sie uns beim Lesen der BRAVO zusah, war irgendwie wichtig. Wir kamen uns erwachsener vor, wenn sie da war. Vielleicht ja auch, weil ihr anfängliches Schweigen erahnen ließ, dass sie viel mehr wusste als wir und die BRAVO nicht brauchte.
Als Hani dazukam, waren auch die Zeiten vorbei, in denen Sayas Fantasie mit ihr durchging und wir ihr alles glaubten. Wir, das waren ein paar andere Mädchen aus der Siedlung und ich. Es war immer klar, wer bei uns die Bestimmerin war, denn Saya hatte einfach das größte Talent dafür, und das Leben wäre zum Sterben langweilig geworden, wenn jemand ihr diesen Posten streitig gemacht hätte. Saya erzählte uns Zeug über die Welt und wir glaubten ihr, weil es die Welt besser machte.
Die nummernschildlosen Schrottkarren, die auf den Parkplätzen vor unserem Haus vor sich hin rosteten, waren so ein Beispiel dafür. Sie waren uns egal, wir interessierten uns nicht für Autos und hinterfragten die Abgefucktheit unserer Umgebung nicht. Bis Saya uns eine herzzerreißende Geschichte erzählte. Ein alter Mann, Herr Zimmermann, habe diese Autos hier geparkt, sei dann schwer krank geworden und inzwischen seit Jahren im Krankenhaus. Bald werde der arme Opi entlassen und er werde sicher sehr traurig sein, wenn er zurückkommen und sehen würde, in welchem Zustand sich seine Autos mittlerweile befanden. Wir müssten dem alten Mann helfen, sagte Saya, wir müssten die Autos für ihn sauber machen. So was gelang nur Saya: am Ende fünf Leute zusammenzutrommeln, die anfingen, irgendwelche Schrottkarren zu waschen. Wenn jemand das gesehen und uns gefragt hätte, wären wir vielleicht auf die Idee gekommen, dass Saya sich das alles nur ausgedacht hatte. Aber weil niemand kam und weil uns Sayas Geschichte absolut plausibel schien, gaben wir alles, um den armen Herrn Zimmermann vor diesem Anblick zu bewahren. Als Hani kam und wir also gerade alt genug waren, nicht jeden Quatsch zu glauben, konnte Saya sich solche Geschichten nicht mehr erlauben. Hani, die Zuschauerin, hätte sie entlarvt, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ich glaube aber, in dem Alter hatte Saya auch gar kein Interesse mehr an solchen Geschichten. Sonst hätten wir ja nicht mit den Zeitschriften vor dem Haus gesessen.
Aber jetzt ist die Reihenfolge durcheinander. Dabei war eben noch Dienstag, der Dienstag, an dem Saya hier ankam und alles noch in Ordnung war.
Wobei es in der Nacht schon nicht mehr in Ordnung war. Das kann man ja später, vor Gericht, auch so sagen. Oder Sayas Psychotherapeuten, das ist ja vielleicht wichtig, wenn man herausfinden will, ob sie durchgeknallt ist. Wir legten uns hin, Saya und ich in mein Bett, Hani auf eine Matratze auf dem Boden. Wir hatten alle die gleiche Zahnbürste