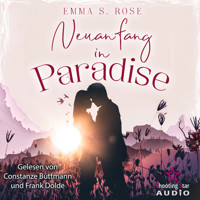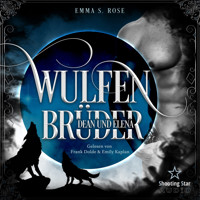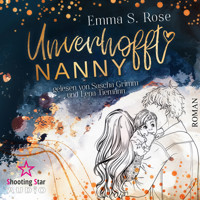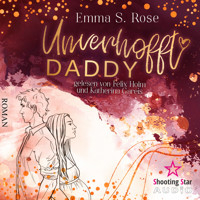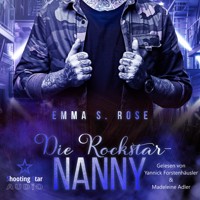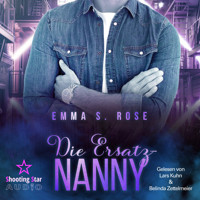3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn du kein Vertrauen in die Liebe hast – gibt es dann ein Happy End für dich? Trix ist laut, aufgeschlossen und fröhlich – so nimmt sie zumindest jeder wahr. Dass sie eine harte Vergangenheit hinter sich hat, wissen die wenigsten. Neben dem Studium jobbt sie in dem charmanten Café ihres Onkels und geht gerne feiern. Beziehungen schließt sie kategorisch aus, für mehr als einmalige Abenteuer ist sie nicht bereit. Erst, als Henri in die WG zieht, scheint jemand zu bemerken, dass es tief in ihr drin brodelt. Henris größter Traum war es schon immer, von seiner Musik zu leben, sehr zum Missfallen seiner Eltern. Besonders die fehlende Anerkennung seines Vaters verletzt ihn tief. Als er in die turbulente WG zieht, findet er dort schnell Anschluss, aber es ist Trix, die ihm sofort den Kopf verdreht. Er spürt ihre innere Zerrissenheit, aber weiß auch, dass sie nicht zu mehr bereit ist. Also ist er das, was sie am meisten braucht: Ihr Freund. Kann Henri endlich das tun, was er wirklich will? Und kann Trix ihre Vergangenheit hinter sich lassen, um endlich das zu finden, was sie für immer verloren glaubte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DREI MOMENTE FÜR DIE EWIGKEIT
EMMA S. ROSE
Drei Momente für die Ewigkeit – Trix & Henri
Emma S. Rose
1. Auflage
Februar 2021
© Emma S. Rose
Rogue Books, Inh. Carolin Veiland, Franz - Mehring - Str. 70, 08058 Zwickau
Buchcoverdesign: Sarah Buhr / www.covermanufaktur.de unter Verwendung von Bildmaterial von Nadi Spasibenko
Alle Rechte sind der Autorin vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Autorin gestattet.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung des Werkes in andere Sprachen, liegen alleine bei der Autorin. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu entsprechendem Schadensersatz.
Sämtliche Figuren und Orte in der Geschichte sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Orten entspringen dem Zufall und sind nicht von der Autorin beabsichtigt.
Für all jene dort draußen,
die Angst vor der Liebe haben.
Liebe und Schmerz sind eng miteinander verbunden,
aber was wäre die Welt ohne Liebe?
Liebe ist die Brücke zur Ewigkeit.
(UNBEKANNT)
INHALT
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Danksagung
Newsletter
Über den Autor
PLAYLIST
LA On A Saturday Night - Hearts & Colors
Locked Away (feat. Adam Levine) - R. City
Hear Me Tonight - Alok, THRDL!FE
Rhythm Of The Night - Fedde Le Grant
Africa (Acoustic) - Tyler Ward, Lisa Cimorelli
Don’t Give Up On Me - Andy Grammar
Chasing Cars - Snow Patrol
Broken (Acoustic) - lovelytheband
Hold My Girl - George Ezra
Fairytale Gone Bad - Marcus Layton
High - Aexcit, HILLA
Missing Peace - JJ Heller
Before You Go - Lewis Capaldi
Dir gehört mein Herz - Gregor Meile
Ich glaube, das hier ist die dümmste Idee meines bisherigen Lebens.
Wankend versuche ich, mein Gleichgewicht zurückzuerlangen. Vor mir breitet sich eine wogende Menge aus. Menschen wie ich, die an einem Freitagabend ihren Kopf freibekommen wollen und sich sämtlichen Stress von der Seele tanzen. Die trinken, lachen, Spaß haben. Na gut. Nicht jeder von ihnen würde es so wie ich für eine gute Idee halten, auf einen wackeligen Stehtisch zu klettern und dort seinen Hüftschwung zu üben. Andererseits zweifle ich ja selbst an meiner Entscheidung. Ach verdammt. Ich kichere los. In meinem Kopf herrscht mal wieder ein völliges Durcheinander, so wie an etwa neunzig Prozent aller Tage. Erschwerend kommt mir heute auch noch der Alkohol in die Quere, und das macht es nicht unbedingt besser.
Das aktuelle Lied endet, geht direkt in einen schnelleren Track über. Das hier wäre die perfekte Stelle, um zu twerken, aber ein letzter Rest Vernunft ist mir geblieben. Käme wohl nicht ganz so gut, dabei kopfüber zu Boden zu stürzen. Seufzend wische ich mir über die Stirn, halte kurz inne und lasse meinen Blick über all die fremden Gesichter fliegen. Etwas in mir reißt und zerrt; findet keinen Fixpunkt.
Natürlich.
Beim Versuch, einen Schluck aus meiner Bierflasche zu nehmen, verfehle ich knapp meinen Mund. »Fuck«, rufe ich aus, während ich spüre, wie die Flüssigkeit an meinem Kiefer hinab in den Ausschnitt tropft. Dumm gelaufen, was?
»Wow, Süße, heiße Show. Darf ich dir das Zeug einfach weglecken?« Da. Vor mir taucht ein Kerl auf. Einer von vielen, von den Austauschbaren. Ein Piercing in seiner Unterlippe macht den schmierigen Spruch wieder etwas wett. Außerdem hat er glänzendes, dunkles Haar und, glaube ich zumindest, intensive Augen. Augen, die gerade mehr als lüstern über meine Silhouette gleiten. Normalerweise wäre ich voll darauf eingestiegen. In mir wächst schon wieder diese seltsame Unruhe, die ich an Abenden wie diesen zu bekämpfen versuche. Doch ausgerechnet heute sperrt sich etwas in mir. So, als würde der Alkohol ausnahmsweise mal die richtigen Knöpfe drücken, nicht die falschen.
»Nein danke«, bringe ich hervor, wende mich ab und versuche erneut ein paar Tanzschritte, doch die bringen den Stehtisch nur zum Wackeln. Verdammt. Was genau suche ich hier oben, und wie bin ich überhaupt hierher gekommen?
»Geile Nacht, oder?«, brüllt Zoe in diesem Moment vom Stehtisch neben mir, und es fällt mir wieder ein. Na klar. Zoe – das ist meine neue Freundin. Neu im Sinne von »seit heute Abend.« Wir haben uns an der Theke kennengelernt, als Hannah, Chris, Lisa und Ryan mich stehengelassen haben, um tanzen zu gehen. Wie sich herausstellte, wurde sie ebenfalls von ihren Pärchenfreunden zurückgelassen, und wir haben beschlossen, den Abend legendär zu machen. Auf unsere Art und Weise.
Aber da sind Lücken. Ich weiß es, doch je genauer ich darüber nachdenke, desto größer werden die Löcher. Irgendwas fehlt, irgendein Aspekt …
»Hey, Baby!«
Oh, jetzt wird es doch ärgerlich. Ich blicke hinab – und starre erneut diesem dunkelhaarigen Kerl in die Augen. Verdammt, er ist anhänglich. Vielleicht sollte ich doch … oder besser nicht. Nein. Heute bin ich wirklich in keiner guten Verfassung.
»Was ist?«, bringe ich hervor, in dem vollen Bewusstsein, dass er mir gerade unter den Rock starrt. Wieso noch gleich bin ich heute in ein Kleid gestiegen?
Da kommt der nächste Erinnerungsfetzen zurück, nicht fortgeschwemmt von Bier oder Wodka-E: Mariella. Die ist auch noch hier irgendwo. Sie hat mich zu dem Kleid überredet, und außerdem …
»So, ich denke, das reicht an dieser Stelle.«
Wie aus dem Nichts taucht jemand anderes vor mir auf. Das genaue Gegenteil von Mister Dunkle-Haare-und-Piercing; langes, blondes Haar, weiche Gesichtszüge und kluge, dunkle Augen, die mich jedoch irgendwie … angespannt mustern.
»Hey, Alter, was mischt du dich überhaupt ein?« Der Dunkelhaarige strahlt eine eindeutig aggressive Aura aus, doch davon lässt sich der neue Typ nicht beirren.
Der neue Typ – das letzte fehlende Puzzleteil.
»Henri«, bringe ich hervor, und zu meinem großen Entsetzen klingt es viel zu erleichtert. Plötzlich setzt er ein, der Schwindel, und die Übelkeit klopft auch direkt an. Noch während Henri seine Arme nach mir ausstreckt, falle ich ihm praktisch entgegen. Er ächzt zwar, fängt mich aber sicher auf, und schon im nächsten Moment habe ich wieder richtigen Boden unter meinen Füßen.
Richtigen Boden, der leider auch ganz schön schwankt.
»Was tust du nur«, raunt Henri mir ins Ohr; seine Sorge ist ihm mehr als deutlich anzuhören, selbst in meinem nicht mehr ganz so klaren Zustand. »Komm mit.«
Ich protestiere nicht, reagiere auf Zoes überraschten Ausruf mit einem schwachen Winken, ehe ich mich von Henri durch die wogende Menge führen lasse, die mir mehr und mehr wie eine fremde Wand vorkommt. Lauter Menschen, die wie ich Spaß haben wollen, aber im Gegensatz zu mir sind sie auf dem Boden geblieben, und plötzlich fühle ich mich gar nicht mehr mit ihnen verbunden.
Scham brennt in mir, aber nur schwach. Ich bin zu betrunken für solche Befindlichkeiten, bin jenseits von Gut und Böse.
Zwei Wodka-E, dreieinhalb Bier und die Überzeugung, nicht in diese heile Pärchenwelt zu passen, in der es sich die anderen mehr und mehr bequem machen, haben mir den Rest gegeben. Damit ist heute offiziell keiner dieser Abende, an denen ich viel vertrage.
»Was tun wir?«, bringe ich dennoch hervor, sobald wir das Foyer erreichen. Als würde das wirklich zur Debatte stehen.
Henri hält nicht eine Sekunde inne. »Wir bringen dich nach Hause, Zwerg. Für uns ist die Party vorbei.«
Kein Protest. Stattdessen lächle ich vor mich hin, spüre, wie sich eine diffuse Wärme in mir ausbreitet, und folge ihm brav nach draußen. Noch im Eingangsbereich denke ich, dass der Abend gar nicht so übel gewesen ist. Dann jedoch schnuppere ich frische Nachtluft – und die gibt mir den Rest. Der Alkohol schlägt gnadenlos zu.
Ich erinnere mich nicht an den folgenden Heimweg.
* * *
Es muss bereits Mittag sein, als ich meine verkrusteten Augen aufschlage, anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, wieso es so verdammt hell in meinem Zimmer ist, oder wieso meine innere Uhr völlig verrückt spielt.
Andererseits … fühlt sich gerade alles ziemlich falsch an. Stöhnend kneife ich die Augen wieder zusammen. Okay, Bestandsaufnahme.
Kopfschmerzen – Check.
Schreckliche, hämmernde Kopfschmerzen – Doppelcheck.
Übelkeit – aber hallo.
Eine volle Blase – auch das.
Abgesehen davon … spüre ich nichts Seltsames »da unten«. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich niemanden mitgenommen habe, aber da ich so verkatert bin, muss ich gestern gut betrunken gewesen sein. Fehlende Erinnerungen sind also kein allzu verlässliches Kriterium. Zögerlich taste ich neben mich – mein Bett ist leer, die Fläche neben mir kalt. Nein, kein nächtlicher Besucher. Keine bösen Überraschungen.
Stöhnend wälze ich mich herum, presse mein Gesicht ins Kissen und beende diese kurze Bestandsaufnahme zugunsten eines weiteren Moments gnädiger Dunkelheit. Alles tut mir weh, und das nicht nur auf körperlicher Ebene. Ich fühle mich verdammt beschissen. Wenn man bedenkt, dass ich eigentlich erst zwanzig bin, sollte ich mich nicht so zerstört fühlen, aber so ist es. Wenn mein Körper könnte, würde er mir kündigen. Oder für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen und selbstgebastelte Schilder in die Luft recken. Verdammt – ich hasse mich!
Wieso tue ich mir das eigentlich an?
Das Hämmern in meinem Kopf wird immer lauter. Selbst mein unwilliges Brummen kann es nicht übertönen.
Oder – Moment. Kann es sein, dass es gar nicht ausschließlich in meinem Kopf ist? Ich erstarre, halte für einen winzigen Moment sogar die Luft an, und ja. Es klopft an meiner Tür.
Ach verdammt, nein!
»Geh weg«, brumme ich – und erschrecke über meine raue, schmerzende Stimme. Es fühlt sich also nicht nur so an, als hätte ich ein totes, pelziges Tier als Zunge, scheinbar habe ich auch noch Scherben verschluckt.
Was zur Hölle ist nur mit mir geschehen? Ich habe doch längst nicht so viel getrunken, wie an manch anderem Abend … oder?
Eventuell lacht jemand vor der Tür, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Trotz meiner protestierenden, lauten Gedanken kann ich jedoch nicht überhören, wie besagte Tür aufgeschoben wird. Ein amüsierter Fluch dringt an meine Ohren.
»Meine Güte, Trix. Dass du noch nicht erstickt bist! Hier riecht es wie in einer billigen Spelunke!«
Wenn ich seine Stimme nicht längst erkannt hätte, hätte ich es bei seiner Wortwahl getan. Nur er schafft es, gleichzeitig arschig und distinguiert zu klingen. »Hau ab, Henri! Ich habe dich nicht hereingebeten!«
»Nö.« Unbeirrt marschiert er durch mein Zimmer. Nicht, dass ich es sehen würde, ich presse mein Gesicht noch immer ins Kissen. Aber ich höre ihn leider. Jeder einzelne seiner Schritte dröhnt laut in meinem schmerzenden Schädel. Offenbar ist er meine höchstpersönliche Strafe für gestern Abend.
»Achtung«, sagt er ungerührt, beinahe amüsiert. Dann höre ich, wie der Satansbraten tatsächlich die Vorhänge aufzieht und damit noch mehr Licht in mein Zimmer lässt.
»Du Monster!«, stöhne ich, doch das hindert ihn nicht daran, auch noch das Fenster aufzureißen.
»Du brauchst frische Luft, sonst erstickst du noch.« Henri bleibt stehen. Zumindest höre ich keine Schritte mehr. Trotz des Dröhnens meiner Kopfschmerzen, die zum Kater meines Lebens gehören, spüre ich sein Zögern.
Ich presse mein Gesicht noch fester in die Kissen.
»Hör mal, ich sage es ja nicht gerne, aber du solltest aufstehen.«
Ich kneife zusätzlich die Augen zu, weil ich genau weiß, was nun kommt. Und ich will es nicht. Ich untermale das mit einem undefinierbaren Stöhnen, was von Henri natürlich nicht akzeptiert wird.
»Raus aus den Federn, Trix. Ich gebe dir eine halbe Stunde, um zu duschen und dich frisch zu machen. Dann gehen wir raus.«
»Hau ab«, versuche ich es noch einmal schwach, doch ich weiß, dass ich verloren habe.
»Eine halbe Stunde.« Donnernde Schritte, jeder einzelne droht, mir den Schädel zu spalten. »Ich warte auf dich.«
Die Tür knallt viel zu laut. Ich bin alleine. Bin völlig zerstört. Und doch habe ich keine Wahl. Zwischen Henri und mir hat sich in den letzten Monaten eine Art stillschweigendes Abkommen entwickelt. Er passt auf mich auf, wenn ich drohe, mal wieder zu weit zu gehen, aber das nur zu seinen Bedingungen. Scheiß verdammter Aufpasser. Leider habe ich bereits mehr als schmerzlich erfahren dürfen, wie genau diese speziellen Bedingungen lauten. Wenn es so läuft wie immer, und davon gehe ich aus, wird er in der nächsten Stunde gnadenlos meine Gedächtnislücken auffüllen – und er wird dafür sorgen, dass ich etwas gegen den Kater tue. Beides Dinge, auf die ich liebend gerne verzichten würde, vielen Dank auch. Vor Henri sah ein Morgen wie dieser so aus, dass ich vor mich hin leidend in meinem Bett gelegen habe, nur unterbrochen von kurzen Stippvisiten im Badezimmer oder in der Küche. Ich hätte etwas gegen die Kopfschmerzen getan und wäre in Selbstmitleid zerflossen, ehe ich mich schließlich mit fettigem Zeug vollgestopft und dann so getan hätte, als wäre nichts geschehen.
Das ist ein richtiges Katerprogramm. So heilt man dieses unsägliche, selbstverschuldete Leiden. Doch ich habe es schon eine ganze Weile nicht mehr durchziehen dürfen. Dank einer gewissen, herrischen Person mit langem, blondem Haar.
Obwohl jede Faser meines Körpers dagegen protestiert, erhebe ich mich stöhnend. So laut stöhnend, dass er es hoffentlich hört, selbst wenn er mittlerweile in seinem Zimmer hockt, das direkt neben meinem liegt.
Ich hasse ihn dafür.
Und gleichzeitig bin ich ihm dankbar.
Welcher normale Mensch kommt mit diesen verrückten Extremen schon klar?
* * *
Den Blick in den Spiegel spare ich mir wohlweislich, stattdessen schlüpfe ich aus meinen Schlafsachen und steige direkt unter die Dusche. Mir ist auch so klar, dass ich aussehen muss wie ein depressiver Panda. Oder besser: ausgesehen habe. Das Wasser läuft warm über mein Gesicht und spült die Überreste des vergangenen Abends weg. Zögerlich versuche ich mich daran, in den Erinnerungsfetzen zu stochern, doch mehr als ein paar einzelne Bilder wollen sich nicht aufbauen, und die reichen mir schon, um mich vor Scham zu winden.
Diese Tische! Was zur Hölle habe ich eigentlich mit Tischen aller Art? Schon viel zu oft kam es mir wie eine gute Idee vor, auf sie zu klettern und mich dort zum Narren zu machen, sobald ich ein bisschen zu viel getrunken habe. Mehr als einmal wäre ich dabei fast auf die Nase geflogen. Es ist dem puren Glück zuzuschreiben, dass ich mir nicht bereits die Haxen gebrochen habe. Wie an diesem einen Abend, als wir Ryans Geburtstag gefeiert haben … Nein. So weit gehe ich jetzt nicht. Am besten nie wieder. Es gibt Erinnerungen, die sollte man lieber dort lassen, wo sie sich befinden – in den hintersten Ecken unseres Gedächtnisses.
Kopfschüttelnd strecke ich mein Gesicht in den Wasserstrahl – und setze zum ultimativen Kater-Todesstoß an: Ich drehe den Wasserhahn schlagartig auf kalt.
Mein schriller Schrei prallt lautstark von den Fliesen ab. Mit Sicherheit weiß nun jeder in der WG, dass ich wach und am Duschen bin. Mittlerweile kennen sie diese Angewohnheit, die ich mir in den letzten Monaten angewöhnt habe. Genauer gesagt, seit ich Henri kenne. Er hat mir mal gesagt, kalte Duschen wären gut für den Kreislauf. Nachdem ich es das erste Mal versucht habe, hat er mich amüsiert damit aufgezogen, dass ich es immer gleich auf die Spitze treiben muss. Nun, was soll ich sagen: Aus reinem Protest tue ich es weiterhin, auch wenn es wirklich einer Folter gleicht. Andererseits fühle ich mich danach immer lebendig. Immer. So auch jetzt.
Im Anschluss an meine Dusche wage ich endlich einen Blick in den Spiegel. Ich sehe müde aus und mein kurzes, schwarzes Haar bildet einen starken Kontrast zu meiner blassen, ungesunden Gesichtsfarbe. Ein letzter kleiner Rest Kajal klebt unter meinem rechten Wimpernkranz. Ich wische ihn energisch fort. Während ich eilig Zähne putze und mein Haar trockenföhne, debattiere ich innerlich, ob ich mich schminken soll oder nicht. Die tiefe Müdigkeit in meinen Knochen und das Gefühl, ich hätte soeben einen Ironman absolviert, wenn auch ohne den ganzen Triumph im Anschluss, halten mich schließlich davon ab. Das hier wird meine persönliche Katerqual mit Henri, kein Grund, deshalb dick aufzutragen.
Exakt dreiunddreißig Minuten nach seinem Ultimatum bin ich fertig. Er steht bereits im Flur, in einer Hand einen Thermobecher, in der anderen ein Sandwich, von dem ich hoffe, dass es aus viel Käse und Remoulade besteht. Mit einem amüsierten Grinsen reckt er mir beides entgegen. Da ich weiß, dass der Becher keinen Kaffee beinhaltet, ignoriere ich ihn, aber in das Sandwich beiße ich, ehe ich auch nur ein »Dankeschön« hervorbringen kann.
Henri quittiert das mit einem amüsierten Schnauben.
»Nicht so laut«, stöhne ich, den Mund voller Toast und Käse und Herrlichkeiten, die mein Magen genau jetzt am besten vertragen kann.
»Zieh deine Schuhe an«, erwidert Henri erbarmungslos. »Du musst jetzt raus. Dein Körper braucht frische Luft und Bewegung.«
Habe ich bereits erwähnt, dass ich ihn hasse?
Abgesehen von unserem Abkommen hat sich in den vergangenen Monaten zwischen uns eine erstaunliche Freundschaft entwickelt. Während ich trotz all meines Unmuts seiner Aufforderung folge und in meine Stiefel schlüpfe, denke ich darüber nach, wie wunderlich das Ganze doch ist. Niemand sonst hätte mich an einem Tag wie diesem dazu bringen können, rauszugehen. Selbst Hannah, eine meiner Mitbewohnerinnen, zu der ich von Anfang an einen besonderen Draht aufgebaut habe, hätte sich die Zähne an mir ausgebissen. Doch Henri ist anders. Das war er schon vom ersten Moment an, da er die WG für sein Vorstellungsgespräch betreten hat. Trotz der Differenzen, die er anfangs mit Ryan hatte, hat er uns alle schnell für sich gewinnen können. Zu Beginn war es Lisa, mit der er am meisten Zeit verbracht hat, doch seit sie und Ryan ebenfalls auf den Pärchenzug aufgesprungen sind, haben Henri und ich irgendwie diesen Part übernommen. Nicht, dass wir ein Pärchen wären. Nicht einmal auf dem Weg dorthin. Niemand wird mich jemals so um den Finger wickeln können. Aber er steht mir nahe, und ich schätze ihn und seine Meinung so sehr, dass er mich selbst an Tagen wie diesen dazu bringen kann, Dinge zu tun, von denen er glaubt, sie wären gut für mich.
Wie ein verdammter Spaziergang an einem sonnig herbstlichen Samstag, an dem gefühlt jede Familie mit lärmenden Kleinkindern auf den Straßen unterwegs ist. Dieser Kerl kennt einfach keine Gnade.
Im ersten Moment hoffe ich noch, wir würden in seinen alten Volvo steigen und rausfahren, doch er läuft geradewegs an dem Wagen vorbei und steuert die Straße an, die uns vom Zentrum fortführt, dafür aber in Richtung einer der Parks, die sich überall in der Stadt verteilen und die besiedelten Flächen auflockern. Wie gesagt, keine Gnade.
Die ersten Minuten bringen wir schweigend hinter uns. Ich esse mein Sandwich, das wirklich gut ist, und versuche, den pochenden Schmerz in meinen Schläfen zu ignorieren. Ich hätte mir eine Schmerztablette einwerfen sollen, bevor wir aufgebrochen sind. Tja, zu spät.
Wann immer ich einen Seitenblick wage, blickt Henri geradeaus. Ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen, und er wirkt, als würde er genau das tun, wozu er gerade Lust hat. Als wäre es so ein großer Spaß, Zeit mit einem übellaunigen, verkaterten Menschen zu verbringen.
»Was denkst du?«, fragt er mich urplötzlich, als ich einen weiteren Blick wage und er mich dabei erwischt.
Ich strauchle, kann mich aber im letzten Moment noch fangen. Dennoch umfasst Henri meinen Arm, stabilisiert mich, und lässt mich auch ein paar Sekunden lang nicht los, nachdem ich schon wieder sicheren Schrittes unterwegs bin.
Ich seufze leise auf. »Nicht viel.« Ein Schulterzucken. Dann der Entschluss, vollkommen ehrlich zu sein. »Ich frage mich, ob du nichts Besseres zu tun hast, als dich um jemanden wie mich zu kümmern.«
»Jemanden wie dich?« Henri ist ein ruhiger Kerl, mit sanfter, wohlklingender Stimme und erfüllt von gleichmütiger Ruhe. In diesem Moment jedoch klingt er für seine Verhältnisse erstaunlich erbost. »Was soll das denn heißen?«
Augenblicklich bin ich verunsichert, spiele meine Worte herunter. »Ach, nichts. Du weißt schon. Verkatert und so …«
Er schnaubt leise auf. »Und so.« Erneut verfallen wir in Schweigen, aber ich ahne, dass er noch nicht fertig ist. Er deutet an mir vorbei auf einen Zebrastreifen. Dahinter öffnen sich die Pforten zu einem der schönsten Grünanlagen, die Waldstädt zu bieten hat. Ein kleiner Bach gurgelt in einem flachen Becken, Trauerweiden säumen das Ufer und bieten viele versteckte Sitzgelegenheiten, außerdem gibt es ein paar sehr natürlich angelegte Spielplätze, die die Kinder dazu einladen, zu verweilen. Natürlich sind die Sandflächen heute überbevölkert von all diesen kleinen, wuseligen Menschen, die mir immer schon diffuse Angst eingejagt haben. Sie sind so klein. So zerbrechlich. Und gleichzeitig so laut!
Henri und ich waren bereits ein paar Mal hier. Wir biegen automatisch nach links ab und folgen dem äußeren Schotterweg, der uns einmal rund um die Flächen führen wird. Mit etwas Glück legen wir irgendwann eine kleine Pause auf einer der Bänke ein und ich kann meine schmerzenden Glieder ausstrecken, die noch immer jenseits von Gut und Böse sind.
»Gestern habe ich mir Sorgen um dich gemacht«, lässt Henri unvermittelt die große Bombe platzen, als sich der Bach gerade unserem Weg angenähert hat – oder andersherum. Für einen kurzen Moment ziehe ich in Erwägung, einfach ins Wasser zu springen und mich von ihm und diesem Gespräch davontreiben zu lassen, aber das ist natürlich völliger Quatsch.
Seufzend reibe ich mir durchs Gesicht. »Ich schätze, du wirst mir jetzt erklären, wieso genau.«
»Damit hast du vollkommen Recht.«
Wir wechseln einen Blick. Ich sehe Besorgnis in Henris Augen aufblitzen – und noch mehr. Aber ich wende mich zu schnell wieder ab, um es genauer definieren zu können.
»Ehrlich gesagt kann ich mich an vieles nicht mehr erinnern. Ich schätze, du musst mir ein wenig auf die Sprünge helfen.« Dieses Geständnis kostet mich viel. Meine Schritte werden langsamer, aber Henri passt sich beinahe automatisch an. Natürlich.
»Das ist einer der Gründe, wieso ich mir solche Sorgen mache, Zwerg.«
Der Spitzname. Etwas blitzt auf, eine Erinnerung. Ich sehe, wie ich mich in Henris Arme stürze, und plötzlich ist da auch wieder dieser Kerl mit dem Lippenpiercing. Ich stöhne auf.
»Wenn du nicht gerade Druckbetankung vollzogen hast, als ich weg war, hast du gestern nicht so viel getrunken, und trotzdem warst du völlig hinüber.« Nun ist er es, der stehen bleibt. Er greift nach meinem Ellenbogen, hält mich zurück. Als wäre das wirklich nötig. »Was ist los, Trix?«
Kälte erfasst mich. Henri schlägt diesen Tonfall selten an, aber wann immer er es tut, wird es ernst. Plötzlich habe ich das Gefühl, der Grund für diesen Spaziergang ist nicht alleine mein Kater, sondern vielmehr das Bedürfnis nach Ungestörtheit. Die findet man in einer sechsköpfigen WG nämlich eher selten. »Was soll schon sein?«, erwidere ich leichthin.
Henri schüttelt den Kopf. »Hey, ich bin es. Mit mir kannst du reden.«
Völlig hilflos lasse ich mich von seinem Blick gefangen nehmen. Henri hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. Normalerweise liebe ich es speziell. Grün wie bei Chris zum Beispiel, oder ein helles, intensives Grau. Henris Augen sind blau. Tiefblau wie der Ozean und so warm, dass ich mich jedes Mal darin verlieren könnte. Jetzt jedoch strahlen sie so viel Sorge aus, dass ich fröstele. Ich will nicht, dass er sich Gedanken um mich macht. Und noch viel weniger will ich, dass er mich so ansieht. So … intensiv. Als würde er meine Geheimnisse ergründen wollen – und als wäre er auf einem verdammt guten Weg.
Nein, auf diese Art von Durchleuchtung kann ich sehr gut verzichten, vielen Dank auch.
»Ich weiß«, bringe ich verspätet hervor. »Und lass dir gesagt sein – das ist normal bei mir. An manchen Tagen trinke ich einen Sekt und kippe um. An anderen kann ich einen Russen unter den Tisch saufen und anschließend noch problemlos auf einem Seil balancieren. Irgendwas in meinem Körper spielt verrückt, was das angeht. Gestern … war nicht so ein guter Tag, schätze ich.«
Wow. Das ist das Understatement aller Understatements. Henri scheint das zu kapieren. Er sieht mich beinahe enttäuscht an, was es für mich noch schlimmer macht. Ich will ihn nicht enttäuschen. Aber ich will mit ihm auch nicht darüber reden, warum es Tage gibt, an denen ich viel vertrage und Tage, an denen ich das Trinken besser sein lassen sollte. Dass es da einen direkten Zusammenhang zu meinem seelischen Gleichgewicht gibt. Blöderweise sind genau diese unausgeglichenen Tage oftmals die Gelegenheiten, an denen ich auf ganzer Linie versage, was dieses Vernunft-Ding betrifft.
»Es wird häufiger«, erklärt Henri leise. »Das ist es, was mir Sorgen macht.«
»Du musst dich nicht um mich kümmern«, erwidere ich eilig. »Ich weiß, dass es ganz schön lästig sein kann …«
»Hör sofort auf!« Wow, das war sogar beinahe laut. Henri starrt mich wütend an. »Ich will nicht nochmal hören, dass du so etwas sagst. Ich habe gesagt, ich passe auf dich auf, und das meine ich auch nach wie vor. Aber genau deshalb ist mir auch aufgefallen, dass sich die Male häufen, an denen du … die Kontrolle verlierst.«
Das Ende klingt lahm, aber es hallt schmerzhaft in meinem Innersten wider. Mir ist klar, was er meint. Tische. Unbekannte Gesichter von irgendwelchen Kerlen. Nicht, dass ich ständig jemanden abschleppe (oder mich abschleppen lasse), aber ab und an kommt es vor, und jedes Mal fühle ich mich danach total leer und enttäuscht. Schwarze Löcher in meinem Gedächtnis.
Abrupt wende ich mich ab und beginne, weiterzulaufen. Henri folgt mir, natürlich, aber dieses Mal lässt er mir etwas Raum, um zu atmen. Ich kneife kurz die Augen zu, sperre die viel zu grelle Sonne aus und versuche, mich zu sortieren. Er sagt die richtigen Worte. Er weiß, wovon er redet. Henri ist in vielen Dingen unbestreitbar gut, und dazu gehört auch seine Beobachtungsgabe. Und seine sanfte Beharrlichkeit.
»Trix, du musst nicht vor mir wegrennen. Du weißt, ich bin nicht dein Feind in dieser Sache, sondern dein Freund.«
»Natürlich bist du das«, erwidere ich mit rauer Stimme. Mir ist nach einem ironischen Kichern, aber das verkneife ich mir im letzten Moment. Plötzlich fühlt es sich an, als würde ich fliegen. Aber nicht auf gute Art und Weise. Eher, als würde sich unter mir ein Abgrund auftun, der mich mit sich reißen will, egal, wie sehr ich dagegen ankämpfe. Auch ein Gefühl, das in letzter Zeit immer häufiger auftaucht.
»Gestern habe ich kurz befürchtet, dieser Kerl könnte dir etwas in den Drink getan haben«, murmelt Henri und trifft mich damit vollkommen kalt.
»Oh Gott, nein!«, erwidere ich eine Spur zu heftig. Seine Augen weiten sich vor Überraschung. Klar, kein Wunder. Er kennt Hannahs Geschichte nicht, zumindest nicht im Detail. Glaube ich zumindest. Er versteht nicht, wieso mich diese Aussicht so schockiert – und wieso ich im Gegenzug auch ziemlich sicher sagen kann, dass ich selbst angetrunken auf solche Dinge achte. »Das kann ich ausschließen, ehrlich.«
Er starrt mich an. Seine Pupillen huschen hin und her, so als müsste er jeden Millimeter meines Gesichts nach einem Funken Wahrheit absuchen. Oder nach einer Lüge. Falls er fündig wird, lässt er sich nichts anmerken. Er atmet tief durch. »Ja, wie auch immer. Hör mal, ich habe nachgedacht.«
Ich mustere ihn stumm. Mittlerweile stehen wir schon eine ganze Weile mitten auf dem Weg herum, aber obwohl der Park gut bevölkert ist, nähert sich uns niemand. Ganz so, als würden wir ein deutliches »Lasst uns bloß in Ruhe« ausstrahlen oder etwas in der Art. Henri überragt mich mehr als einen Kopf; dabei ist er noch nicht einmal besonders riesig. Aber ich bin klein, daher rührt auch sein Spitzname für mich. Ich lege meinen Kopf in den Nacken, verliere mich in seinem Blick, der noch immer von Sorge und Anspannung beherrscht wird, und warte geduldig darauf, dass er weiter redet. Seine sanfte Art beginnt, ihre Wirkung zu entfalten.
»Wie wäre es, wenn wir es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen? Die letzten Wochen waren ziemlich heftig. Wir waren fast jeden Freitag im Club. Ich dachte, wir könnten einfach mal zuhause bleiben. Oder mal wieder in den Trunkenbold gehen oder so.«
»Als wenn ich im Trunkenbold nicht auch schon abgestürzt wäre.« Natürlich muss ich es wieder mit einem dummen Spruch versuchen; die Wahrheit hinter seinen Worten wiegt einfach zu schwer. Dabei weiß ich, wieso er das sagt. Mir ist absolut glasklar, wieso er mich aus dem Club raushaben will. Und obwohl ich ihm dankbar sein sollte, spüre ich Widerstand. »Ich weiß nicht. Die anderen gehen in letzter Zeit ganz gerne aus.« Wow, das ist sogar für meine Verhältnisse eine sehr überstrapazierte Ausdehnung der Wahrheit. Ich weiß genau, dass Lisa nichts dagegen hätte, häufiger zuhause zu bleiben. Mariella und ich waren in letzter Zeit die Triebfeder, was die Abendgestaltung angeht. Mehr als einmal mussten wir die anderen überreden, unseren WG-Freitag außerhalb zu verbringen. Henri scheint das ebenso bewusst zu sein wie mir, denn er hat nicht einmal eine Erwiderung für mich übrig. Stattdessen wandert seine rechte Augenbraue fast schon provokant langsam nach oben.
Ich atme tief durch, während ich kapituliere. »Ja, vermutlich wäre es nicht verkehrt, wenn ich mal ein, zwei Wochenenden aussetze. Sagt sicherlich auch mein Konto.«
»Ach komm, von uns allen hast du doch die geringsten Geldprobleme«, erwidert Henri schnaubend. Er untermalt die Worte mit einem wohlgemeinten Schulterstoß, der mich leider beinahe ins Bachbett befördert. Schmunzelnd hält Henri mich fest, während ich strauchle. Ich schubse ihn beiseite.
»Jetzt tu mal nicht so, als würde ich in Geld schwimmen, Mister ›Ich-starte-bald-durch‹!«
Nun lacht Henri lautstark auf. »Davon bin ich noch weit entfernt.«
»Und ich bin weit davon entfernt, keine Geldsorgen zu haben«, gebe ich pikiert zurück. Dabei entspricht das nicht so ganz der Wahrheit. So schwer es mir auch fällt, es zuzugeben, aber in gewisser Weise hat er recht. Meinem Onkel gehört das Rock’n’Coffee, ein gut laufender, alternativer Laden, in dem man verschiedene Kaffeespezialitäten genießen kann. Meiner Meinung nach die perfekte Antwort auf Ketten wie Starbucks, ohne dass man auf die Vielfalt und die Qualität leckerer Getränke verzichten muss. Seit einer Weile schon jobbe ich bei ihm, und ich verdiene ehrliches Geld. Zusätzlich ist das Trinkgeld ein netter Bonus – und davon kassiere ich einiges. Ich kann ja auch nichts dafür, dass Kerle besonders spendabel sind, wenn man nett zu ihnen ist. Aber man darf nicht unterschätzen, wie teuer es ist, wenn man sein Studium komplett selbst finanzieren muss, inklusive Lebensunterhalt und allem drum und dran. Im Vergleich zu anderen, und dazu zählt auch Henri, habe ich keine Eltern, die mich finanziell unterstützen. Einzig mein Kindergeld landet auf meinem Konto, aber damit kann ich so gerade eben die Miete bezahlen. Satt werde ich davon noch lange nicht.
Was Henri betrifft – während er BWL studiert, träumt er eigentlich davon, mehr aus seinem musikalischen Talent zu machen, deshalb der Spruch mit dem Durchstarten. Ich weiß, dass er viel erreichen kann, wenn er will. Aber obwohl er am liebsten von seiner Musik leben würde, fehlt ihm der letzte Funken Ehrgeiz. Seit Wochen bearbeite ich ihn, dass er einen Youtube-Channel eröffnen soll, weil ihm das mit Sicherheit sehr schnell viel Aufmerksamkeit bringen würde, aber er sperrt sich dagegen. Stattdessen zieht es ihn in kleine Kneipen, wo er bei Open-Mic-Abenden singt. Oder er steht als Erstes auf der Bühne, sobald irgendwo Karaoke angeboten wird. Sowas halt. Nichts, was ihn wirklich weiterbringen würde – weil, wie groß sind schon die Chancen, dass ausgerechnet dann jemand in der überschaubaren Menge ist, der auf der Suche nach jemandem wie ihm ist? Meine Lösung ist eindeutig Youtube oder eine andere Musikplattform, aber da spielt er den Zögerlichen. Meinen Vorschlag, ihn bei einer Talentshow anzumelden, hat er ebenfalls abgeschmettert. Nicht unbedingt überraschend.
Wenn er also sagt, er wäre weit davon entfernt, hat er einerseits Unrecht – und andererseits auch nicht.
Langsam schlendern wir weiter. Erstaunlicherweise stelle ich fest, dass das Pochen in meinen Schläfen nachlässt. Auch mein Magen ist bedeutend ruhiger geworden. Ich strecke meine Hand aus, und Henri überreicht mir den Thermobecher, nicht ohne mich dabei süffisant anzugrinsen. Dieser Blödmann! Was würde ich jetzt für einen Kaffee geben! Stattdessen tue ich mir sein Geheimrezept an. Mittlerweile weiß ich, dass es im Großen und Ganzen eine Mischung aus heißer Zitrone, Magnesium und Salz ist. Klingt genauso ekelig, wie es schmeckt. Aber auch an dieser Stelle muss ich sagen – es hilft. Gemeinsam mit einem deftigen Sandwich hat mich dieses Gesöff noch immer aus meinem Katerloch geholt. Seufzend nehme ich einen Schluck, ziehe die Nase kraus und ignoriere Henris Lächeln, das irgendwie zärtlich wirkt.
»Komm, setzen wir uns dort in die Sonne.«
Genau die Worte, die ich hören wollte. Zu unserem großen Glück ist eine der Bänke frei, die fernab von den Spielplätzen liegt und uns ein wenig Ruhe ermöglicht. Gemessen an meinem Zustand herrscht fast schon ironisch gutes Wetter. Dank der Sonne klettern die Temperaturen in einen niedrigen zweistelligen Bereich, und da es nahezu windstill ist, schaudere ich wohlig in der letzten Wärme des Jahres. Die Sonne erhitzt mein blasses Gesicht, aber da der Kopfschmerz nachlässt, genieße ich es. Während ich schluckweise den Becher leere, gönnt Henri mir Schweigen. Selten ist es unangenehm, wenn wir einander nichts zu sagen haben. Heute merke ich zwar überdeutlich, dass Dinge zwischen uns in der Luft schweben, aber er gibt mir trotzdem nicht das Gefühl, ich müsste jetzt zwingend die Lücken füllen.
Und das ist so viel wert.
Obwohl ich es nicht will, drängt sich eine Erinnerung auf. Ich denke an meine Kleinkinderzeit. Viel ist mir nicht geblieben; vor allem sind es spezielle Gefühle. So wie eine Art Déjà-vu, das man nicht einordnen kann, nur dass ich eben sehr genau weiß, woher es rührt. Meine ersten Lebensjahre waren geprägt von heftigem Streit und einer unschönen Trennung. Vieles davon habe ich natürlich nicht bewusst erlebt; die Lücken haben meine Tante und mein Onkel aufgefüllt, als sie dachten, ich wäre alt genug.
Und als sie nicht mehr wussten, wie sie mit meiner sehr rebellischen Phase umgehen sollten, die ich als Teenager hatte.
Das meiste ist also eher eine Art unbewusstes Wissen, ein diffuses Gefühl, das sich gerne wie ein Filter über meine Wahrnehmung legt. Es gibt Dinge, mit denen ich nicht umgehen kann, und das sind zum Beispiel Erwartungshaltungen, denen ich nicht gerecht werde. Emotionale Erpressung. Und das Gefühl, ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Abgesehen von meinem Onkel und meiner Tante gibt es niemanden, der von alledem weiß. Sie haben mich durch all diese dunklen ersten Lebensjahre geführt, als sie mich bei sich aufgenommen haben. Kein Rechtsstreit, keine Sache fürs Jugendamt. Meine Eltern waren völlig damit beschäftigt, sich gegenseitig zu zerfleischen, und scherten sich nur wenig darum, dass ich dabei mehr als einmal zwischen die Fronten geraten bin. Als Onkel Rick mich eines Morgens gepackt und mitgenommen hat, war es meinen Erzeugern im Großen und Ganzen ziemlich egal.
Und dabei ist es auch geblieben.
Bis heute habe ich praktisch gar keinen Kontakt zu ihnen. Ich weiß, dass sie nicht mehr hier in der Stadt wohnen, und darüber bin ich auch verdammt froh. Keine Ahnung, wie es mir gehen würde, wenn ich ihnen plötzlich über den Weg liefe. Trotz alledem sitzt diese Sache natürlich tief. Meine ultimative Waffe gegen diesen schrecklichen Verlust: die Flucht nach vorne. Klar. Es gab Zeiten, in denen ich es nicht gut verkraftet habe. Welches Kind kommt schon damit zurecht, von den eigenen Eltern aufgegeben zu werden und mitzuerleben, wie Menschen, die sich mal geliebt haben – Menschen, die gemeinsam ein Kind in die Welt gesetzt haben! – sich gegenseitig fertig machen? Ich war gerade mal drei, als ich dieses toxische Umfeld verlassen habe, aber ich hatte bereits viel zu viel davon miterlebt. Doch ich habe meiner Vergangenheit den Kampf angesagt. Ich habe zwei Jahre bei einem Kinderpsychologen verbracht und in zweiwöchentlichen Therapiesitzungen aufgearbeitet, was geschehen ist. Ich habe meine rebellische Phase bezwungen, die depressive – und all die vielen Momente des Zweifels dazwischen. Geblieben ist mir nur noch die Überzeugung, dass Partnerschaften nichts für mich sind, weil sie die Macht haben, mich und mein Umfeld zu zerstören – und die diffusen emotionalen Situationen, mit denen ich nur schwer umgehen kann.
Obwohl Henri mir vorhin seine Sorgen offenbart hat, löst er seltsamerweise nicht den zu erwartenden Konflikt in mir aus. Normalerweise hätte ich jetzt den Angriff nach vorne gewagt, um seine Befürchtungen abzuschmettern. Bei jedem anderen hätte ich so reagiert – nur nicht bei ihm. Ich kapiere es einfach nicht, verstehe nicht, was genau an ihm anders ist. Es ist, als wäre er sozusagen die Schweiz, zumindest, was all diesen negativen Ballast angeht. Er triggert nichts davon; gleichzeitig schafft er es aber, dass ich mich besser fühle. Meistens zumindest. Und er blickt hinter meine Fassade. Meine Flucht nach vorne, meine laute, fröhliche und offene Art, die jeden davon abhält, tiefer zu graben, scheint bei ihm nicht zu funktionieren. Jeder geht davon aus, dass es bei mir keinen Ballast gibt, weil ich so fröhlich daher komme; nur Henri hat mich direkt durchschaut. Dabei ist es nicht einmal gelogen. Wie gesagt, im Großen und Ganzen habe ich meine Probleme aufgearbeitet.
Ich bin fröhlich.
Ich bin aufgeschlossen.
Aber ich kann auch nicht von der Hand weisen, dass in letzter Zeit die Phasen wieder länger werden, in denen mich Zweifel packen. In denen der Druck auf meiner Brust groß wird, so wie damals, als ich schließlich Hilfe in Anspruch genommen habe.
Gedankenverloren reibe ich über meine Oberschenkel, dann lehne ich mich seufzend zurück und beginne zu reden. »Der Typ gestern. Denkst du, ich wäre mit ihm mitgegangen?«
Henri zögert.
Ich wage einen Blick in seine Richtung, doch dieses Mal scheint er mir bewusst auszuweichen. Mein Herz macht einen Sprung. War ich so schlimm?
»Nein, ich denke nicht«, sagt er schließlich – und ich atme erleichtert aus. »Aber wie gesagt, er kam mir seltsam vor. Was ist, wenn er dich weiter bedrängt hätte? Wenn ich nicht da gewesen wäre?«
»Aber das hat er nicht und du warst da, wir müssen uns darüber also keine Gedanken machen.« Beklommen schlinge ich die Arme um meinen Oberkörper. »Deine Idee ist wirklich gut. Lass uns die nächsten Wochen zuhause bleiben. Wir könnten mal wieder einen WG-Abend veranstalten. Du packst deine Gitarre aus, wir machen Toast Hawaii und spielen ›Stille Post Extrem‹.«
Endlich sieht Henri mich wieder an. Ich bin jedoch nicht darauf vorbereitet, wie zerrissen er wirkt. »Klar. Natürlich. Können wir ja mal mit den anderen besprechen.«
Ein Herzschlag vergeht, noch einer. Ich versuche zu begreifen, was gerade in ihm vorgeht, aber ich kann es nicht sagen, und ich traue mich auch nicht nachzufragen.
Also tue ich, was ich immer tue. Ich grinse. Ich nicke wie ein Wackeldackel. Und ich tue so, als wäre alles bestens. »Super, das tun wir.«
Mechanisch lege ich meinen Kopf in den Nacken, recke mich der Sonne entgegen und atme tief durch. Atme die Übelkeit ebenso weg wie den Kopfschmerz, der bedeutend geringer geworden ist, aber noch nicht verschwunden.
Alles ist wie immer, versuche ich mir einzureden. Alles ist bestens.
Aber etwas in mir wird lauter. Eine Stimme. Ein Zweifel. Der Druck auf meiner Brust verstärkt sich.
Und ich kann nichts dagegen tun.
Der Montag ist ein typischer Vertreter seiner Art, so wie eigentlich jede Woche. Normalerweise bin ich ein Gegner von Klischees, aber irgendwie hat der Tag etwas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Jeder erwartet, dass es schlimm wird, also wird es das. Davon kann selbst ich mich nicht freisprechen – und wenn es in meinem Fall auch nur bedeutet, dass ich mich vor Müdigkeit kaum wach halten kann. Ich ziehe sogar ernsthaft in Erwägung, den Trick mit den Streichhölzern zwischen den Augenlidern auszuprobieren, während ich versuche, Professor Altmann zu lauschen. Er doziert monoton über Makroökonomie und wirkt, als würde er selber nicht wissen, ob er sich im Koma befindet oder nicht. Man munkelt, er müsste bereits seit zehn Jahren in Rente sein, aber er hätte schlicht und ergreifend vergessen, dass er längst im Ruhestand sein dürfte. Wieder andere behaupten, er wäre älter als das Interieur der meisten Hörsäle. Ich finde ihn grundsätzlich sympathisch und weiß auch, dass er einiges auf dem Kasten hat, aber gleichzeitig habe ich in diesem Semester gelernt, dass es definitiv keine gute Idee ist, Montagmorgens um neun mit ihm zu starten. Altmann ist nichts für morgens und auch nichts für spätnachmittags; Zeiten, in denen es mir besonders schwerfällt, mich zu konzentrieren. So wie etwa neunundneunzig Prozent aller Studenten, würde ich sagen.
Eines steht jedenfalls fest: Im nächsten Semester wähle ich einen Mittagskurs, sollten sich unsere Wege erneut kreuzen.
»Hey, Mann. Wie war denn dein Wochenende?«
Ich werfe meinem Kumpel Sascha einen Blick zu. Er strahlt bis über beide Ohren, und das kann ich auch nachvollziehen. Er und seine Freundin hatten Samstag Jahrestag, er ist verliebter denn je. Ich gönne es ihm von Herzen, auch wenn Helens Auftritt letztlich einen Keil in unsere Freundschaft getrieben hat – und das nicht nur, weil ich wegen ihr aus unserer Wohnung geschmissen wurde. Er spürt es, ich spüre es, es steht wie ein riesiger, rosafarbener Elefant im Raum zwischen uns. Zwar hat mich der Umstand versöhnt, dass es mir in der neuen WG richtig gut geht, aber manche Dinge kann man nicht einfach so vergessen – und das hier gehört leider dazu. Auch wenn sowas eigentlich gar nicht meine Art ist.
Ich bemühe mich um einen lockeren Tonfall. »Ganz gut. Entspannt.« Mehr gebe ich ihm nicht, obwohl ich durchaus etwas zu berichten hätte. Ohne den Professor aus den Augen zu lassen, rutsche ich etwas tiefer auf meinen Stuhl und beginne, mit meinem Kuli zu spielen. Ich könnte einen unserer alten Männerabende gut gebrauchen. Einfach mal zusammen abhängen, ein wenig Mist labern, Musik machen. Aber mir ist klar, dass so etwas aktuell nur mit Helen stattfinden würde, und das ist einfach nicht dasselbe, also behalte ich meinen Wunsch für mich.
Sascha gibt ein Geräusch von sich, das Zustimmung sein könnte, aber auch mehr. Er hakt nicht nach, fragt nicht weiter, und zwischen uns schwebt der unausgesprochene Vorwurf vergangener Fehlentscheidungen. Ob unsere Freundschaft jemals wieder dieselbe sein wird?
Vielleicht. Vermutlich nicht.
Aber ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass es mir nicht mehr so wichtig ist wie einst.
Im Anschluss an Makroökonomie besuche ich eine Vorlesung in Rechnungswesen. Auch nicht gerade mein Lieblingsfach, aber wesentlich packender als Makro, alleine schon, weil ich den Dozenten auch privat kenne. Obwohl ihm das mit seinem konservativen Auftreten in den Vorlesungen niemals jemand abkaufen würde – er leitet den Hochschulchor, dem ich im vergangenen Semester beigetreten bin. Freiwillige Creditpoints, die ich gut gebrauchen kann.
Die Stunde fliegt nur so an mir vorbei, und als der Dozent mir am Ende bedeutet, zu ihm zu kommen, weiß ich bereits, worum es geht. Im Chor sollen wir ihn duzen, aber in den Vorlesungen bleibe ich förmlich. »Worum geht’s, Herr Teichert?«
Dirk lächelt mich an. »Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht?«
Ich hätte es mir denken können. Grinsend kratze ich mir den Kopf. »Habe ich denn eine Wahl?«
Er erwidert mein Grinsen, wirkt direkt ganz anders als noch vor dreißig Minuten, während er mit uns über Gewinn- und Verlustrechnungen gesprochen hat. Viel jungenhafter. »Nein, eigentlich nicht.«
Ich verdrehe die Augen. »Also, wieso dann die Frage?«
Augenblicklich wird er ernst. »Ich will, dass du dich bewusst dafür entscheidest, Henri. Es ist eine große Sache und wir alle müssen voll dabei sein. Du jedoch müsstest mehr geben, hundertfünfzig Prozent …«
»Machen wir doch gleich zweihundert draus. Wir ziehen das durch, Dirk. Keine Sorge.« Mich erfasst ein Kribbeln. Diese Entscheidung habe ich wirklich aufgeschoben, jetzt jedoch fälle ich sie spontan und aus vollstem Herzen. Vielleicht wird es Zeit, mir ein Projekt zu geben. Eines, das mich beanspruchen und ablenken wird und sich um das dreht, was mir am meisten liegt: die Musik.
Dirks Grinsen droht, sein Gesicht zu sprengen. »Dir ist klar, dass du Extra-Proben haben wirst?«
»Hoffentlich kriege ich das ganze Programm. Ich kann eine Diva sein, wenn ich will …« Ich halte inne, wir mustern uns einen Moment – und lachen beide gleichzeitig los. »Na gut, vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Geht es schon vorher los, oder besprechen wir alles weitere Mittwochabend bei der regulären Probe?«
»Mittwoch reicht. Wir haben ja noch ein paar Monate.« Dirk klopft mir auf die Schulter. »Ich bin froh, dass du an Bord bist. Ich sage sowas nur ungern, aber du hebst dich von den anderen ab, Henri. Vielleicht bist du unser Ticket ins Finale.«
»Ja, ja.« Verlegen trete ich einen Schritt zurück. Seltsam, dass ich so schlecht damit umgehen kann, wenn man mir solche Dinge sagt. Eigentlich sollte ich das besser packen können. Immerhin ist gerade dieses Talent meine Zukunftsvision. Wenn ich mich ihr denn irgendwann einmal stelle.
Ich wende mich ab – und stelle fest, dass ich spät dran bin. Wenn ich mich nicht beeile, wird nichts mehr von den Käsemakkaroni da sein. Erstaunlicherweise schmecken die nicht wie einheitliche Pampe, sondern sind verdammt lecker. »Also, bis Mittwoch«, rufe ich Dirk noch zu, ehe ich aus dem Hörsaal jogge. Meine Gier nach Makkaroni überdeckt nicht die Aufregung, die mich erfüllt. Verdammt. Was Trix wohl dazu sagen wird?
Und wieso muss sie ausgerechnet die Erste sein, mit der ich darüber reden will?
Ich werde es wohl nie lernen.
* * *
Der Tisch ist übervoll, aber ich quetsche mich zwischen Ryan und Hannah. Trix sitzt am anderen Ende, sie ist in ein Gespräch mit Mariella verwickelt. Wie immer ist das eine laute Angelegenheit. Mein Herz macht diesen seltsamen Satz in die Höhe, als Trix ihren Kopf in den Nacken wirft und lacht. Es wirkt immer eine Spur zu viel, und nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob es wirklich niemand anderem auffällt, dass hinter alledem eine Dunkelheit lauert, die mich gleichzeitig ängstigt und anzieht. Wann immer ich Zeit mit Trix verbringe, habe ich das dringende Bedürfnis, meine Arme um sie zu legen und sie zu schützen. In letzter Zeit stelle ich mir allerdings immer häufiger die Frage, wie genau ich sie schützen soll, wenn sie selbst ihr größter Feind ist.
Danach sieht es nämlich immer mehr aus.
»Hey, Kumpel, was meinst du?«
Wie immer reagiere ich im ersten Moment überrascht, wenn Ryan mich so nennt. Zwischen uns hat sich eine Art Frieden hergestellt. Nachdem wir mehr als holprig gestartet sind, scheint er endlich kapiert zu haben, dass ich keine Bedrohung für ihn bin. Wer wäre ich, ihm vorzuwerfen, dass er sich anfangs wie ein Arsch aufgeführt hat? Mag sein, dass Saschas Verhalten mich nachhaltig verletzt hat, aber grundsätzlich bin ich kein nachtragender Mensch, und Ryan gibt sich wirklich Mühe. Jetzt jedoch kann ich beim besten Willen nicht sagen, was er von mir will, und das drücke ich eloquent, wie ich bin, aus. »Hä?«
Ryan lacht auf. »Mann, wo steckst du schon wieder? Du musst nicht immer dieses Klischee voll ausfüllen, weißt du?«
»Welches Klischee?«, hake ich nach, obwohl mir bereits schwant, wohin das führt.
»Na das des Künstlers.« Ryan verdreht die Augen. »Also, nochmal von vorne. Chris hatte die Idee, dass wir uns das Spiel Singstar besorgen. Dann könnten wir demnächst einfach mal die Karaoke-Party in die WG verlegen.«
Bilder tauchen vor meinem inneren Auge auf, die ich eilig wieder verdränge. Stattdessen lasse ich zu, dass der Vorschlag mich begeistert.