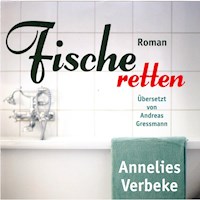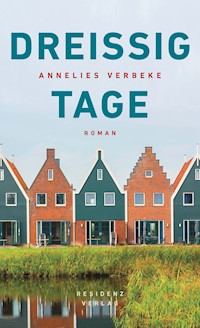
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Gegensatz könnte größer nicht sein zwischen dem offenherzigen, senegalesischen Musiker Alphonse und dem verregneten, flämischen Flachland mit seiner zugeknöpften Biederkeit und seinen Weltkriegsgräbern. Und doch zieht Alphonse mit seiner Brüsseler Freundin Kat genau hierher, um am Dorf ein neues Leben zu beginnen. Er verdingt sich als Heimwerker, und während er stets gut gelaunt Hecken schneidet, Dachböden ausräumt und Wände streicht, erzählen ihm die Nachbarn von Träumen und Affären, Familiengeheimnissen und Alltagssorgen. Alphonse arbeitet, hört zu und wird bald unentbehrlich. Und während wir Leser uns in Alphonses Charme und Menschenfreundlichkeit verlieben, braut sich bei den Einheimischen eine unvermutete Feindseligkeit zusammen…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annelies Verbeke
Dreißig Tage
Annelies Verbeke
Dreißig Tage
Roman
Aus dem Niederländischenvon Andreas Gressmann
Residenz Verlag
Dieses Buch wurde mit Unterstützung von Flanders Literature herausgegeben (flandersliterature.be).
© Annelies Verbeke, 2015
Die niederländische Originalausgabe ist unter dem Titel »Dertig dagen« im Verlag De Geus erschienen.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2018 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4603 3
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1697 5
How with this rage shall beauty hold a pleaWhose action is no stronger than a flower
WILLIAM SHAKESPEARE, SONNET LXV
Inhalt
Kapitel 30
Kapitel 29
Kapitel 28
Kapitel 27
Kapitel 26
Kapitel 25
Kapitel 24
Kapitel 23
Kapitel 22
Kapitel 21
Kapitel 20
Kapitel 19
Kapitel 18
Kapitel 17
Kapitel 16
Kapitel 15
Kapitel 14
Kapitel 13
Kapitel 12
Kapitel 11
Kapitel 10
Kapitel 9
Kapitel 8
Kapitel 7
Kapitel 6
Kapitel 5
Kapitel 4
Kapitel 3
Kapitel 2
Kapitel 1
Danksagung und Quellenangaben
30
Er fährt durch das warme, heitere Wetter, durch die Landschaft, die ihm fremd bleibt, die er aber zögerlich zu lieben begonnen hat. Zuweilen fehlen ihm noch die Stadt, die Farben, die Geräusche, die Ablenkung. Hier ist es anders, nicht schlechter. Die Blüten und das Summen des Frühlings sind in einen vielversprechenden Sommer übergegangen, der vor einem Zuviel an Regen die Flucht ergriffen hat und dann zurückgekehrt ist, um den nahenden Herbst zu verwirren. Die Äcker sind noch sumpfig. Als würden sie nie stumpf und fleckig werden, nicken die Baumkronen mit verhaltenem Siegeswillen dem Himmel zu, unaufhörlich: immer nur her damit. Hopfenstangen ächzen unter der Last dicker Glocken, trunken von sich selbst, bereit für die Ernte. Einsamer Staub wird aufgewirbelt und strandet in Pfützen. Die Kreisverkehrskunst ist an einem Tiefpunkt angelangt. Er weiß nicht genau, ob ihn das alles stärkt oder eher betäubt.
In einem Dorf, das sich Frankreich und Belgien teilen, sieht er auf dem Gehsteig zwei Männer mit Mützen und Körben, darin ein paar Tauben, vielleicht. Außerdem viele Ponys und einen Bauern, Möwen umkreisen leidenschaftlich seinen blitzenden Traktor. Die anderen Leute bekommt man nicht leicht zu Gesicht, sie sitzen hinter Fassaden, oder, so wie er, in Autos, zwischen zwei Häuserreihen.
Heute wird er in einem besseren Wohnviertel erwartet. In diesem Landstrich gibt es weniger Häuser als in den anderen Flickstücken, aus denen dieses kleine Land besteht. Vorwiegend roter Ziegelstein, man hält es hier einfach. Nur hier und dort eine spanische Hazienda zwischen den Anwesen im Landhausstil, Pagoden wie im Brüsseler Speckgürtel hat er hier noch nicht entdeckt. Die oft als geschmacklos abqualifizierte Kakophonie von Baustilen hat ihn immer auf eine fröhliche Art gerührt: Häuser, die wie die Zwölfjährigen an ihrem ersten Tag in der Mittelschule betreten und erstarrt nebeneinanderstehen, durch Zufall zu einer lang andauernden Nachbarschaft gezwungen. Der Anblick der beiden modernen Häuser, die aus der Einförmigkeit herausstechen, bereitet ihm daher durchaus Freude, als er den Lieferwagen davor parkt.
Er hebt die Kiste mit Schwämmen, Lappen, Rollen und Pinseln aus dem Laderaum und wählt einen der Farbeimer aus, die er zuvor bereitgestellt hat. Pick Nick aus der Kollektion Joie de Vivre, für die größte Küchenwand, sein Vorschlag, ihre Zustimmung.
»Alphonse!«, hört er, als er über die Trittsteine im kurzen Rasen zum Eingang eines der Häuser geht.
Es ist die Frau, die hier wohnt, eine schöne Frau mit einer selbstsicheren Stimme, die er an dem Abend, an dem sie die Farbtöne ausgesucht haben, kennengelernt hat. Ihre Sportkleidung sieht neu aus, am Stoff sind keine Spuren von Anstrengung zu entdecken, der Schweiß perlt nur an ihren Schläfen und entlang ihrer zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare, sie winkt etwas verlegen. Er setzt den Farbeimer ab, damit er ihr die Hand reichen kann.
»Sie warten doch hoffentlich noch nicht lange«, sagt sie. »Mein Mann bringt gerade unsere Tochter zur Schule, und ich dachte, ich könnte noch eben joggen gehen, aber dann stand ein Teil der Strecke unter Wasser und ich habe mich verlaufen.«
»Ich bin gerade gekommen«, sagt er.
Er wird ihre Küche und ihr Wohnzimmer streichen, hat mit drei Tagen gerechnet, vermutet jetzt aber, dass es schneller gehen wird: sie haben sich sorgfältig vorbereitet. Die Gardinen und die Steckdosen wurden schon entfernt. Die Möbel wurden in die Mitte des Zimmers geschoben und mit Laken abgedeckt, die lange Küchentheke ist leer.
Ein schwarzer Hund rennt wie von Sinnen auf ihn zu, stößt mit dem Kopf gegen ein Tischbein, setzt seinen Lauf nicht weniger stürmisch fort.
»Björn!«, ruft die Frau.
»Hallo Björn«, sagt er. Wedelnd beschnüffelt der Hund seine ausgestreckte Hand, lässt einen Furz und dreht sich erschrocken danach um.
Die Frau lacht mit, bis Björn erneut in Raserei verfällt und sie das Tier am Halsband in das angrenzende Zimmer zerrt, wo sie ihn einsperrt. »Ich glaube, er hat eine multiple Persönlichkeit!«, schreit sie über das ratlose Gejaule hinter der Tür hinweg. »Und die Katze fehlt ihm! Benny! Benny und Björn! Wie bei ABBA?!«
Das Aussehen des Hundes erinnert eher an einen Hardrocker aus den späten Siebzigerjahren, findet Alphonse.
»Sie waren unzertrennlich! Wenn Hunde und Katzen zusammen aufwachsen, können sie Freunde werden!«
»Meistens leben Katzen länger als Hunde!«, ruft er zurück.
»Sie wurde ermordet!« Und weil Björn sein Klagelied während dieser Worte eingestellt hat, wiederholt sie es mit leiserer Stimme: »Unsere Katze wurde ermordet.«
Es ist die Pointe einer Geschichte, die sie ihm gerne erzählen möchte, eine lange Geschichte, die hinter ihren Lippen schwelt, doch es ist noch zu früh – als sie das Auto ihres Mannes hört, schluckt sie sie hinunter.
Auch der Mann ist athletisch gebaut, ein Schwimmer.
»Hey, der Fons!«, sagt er, als würden sie sich schon Jahre kennen. Die Stimme seines Herrchens bringt Björn wieder in Gang. Der Mann streckt beide Daumen in die Höhe.
Ihre Vornamen hat er vergessen, die muss er später noch mal raussuchen.
»Bereit für das große Werk? Ich würde dir ja gerne helfen, aber da sind noch Pläne, die ich fertigmachen muss.«
Er ist Architekt, erinnert sich Alphonse, er arbeitet zu Hause.
»Ich habe ihn eingesperrt«, sagt die Frau, als ihr Mann auf die Tür zugeht, hinter der das Gejaule und Gekratze lauter wird.
»Eingesperrt?«, fragt der Mann mit einer kindlichen Stimme. »Hat man Herrchens dicken Freund eingesperrt?«
Hin- und hergerissen zwischen gemischten, aber extremen Gefühlen, tappt Björn über den Fußboden, zitternd vor Unentschlossenheit.
Der Mann hebt ihn hoch. »Es ist ein Portugiesischer Wasserhund«, sagt er, während das Tier versucht, seine Zunge in den sprechenden Mund zu stecken. »Unsere Tochter ist auf die meisten anderen Rassen allergisch.« Er wendet sich wieder mit der Kinderstimme an den strampelnden Hund, während er ihn auf den Boden setzt: »Und wer hat auch einen Portugiesischen Wasserhund? Was sage ich, sogar zwei?«
Für die Antwort blickt er zu Alphonse, seine Hände vollführen eine zierliche, gebende Geste, die in zwei deutende Finger übergeht, zwei Pistolen. »Obama!«
»Also wirklich«, murmelt die Frau. Sie tätschelt kurz und leicht den Unterarm von Alphonse, kündigt an, dass sie duschen geht, und verlässt eilig das Wohnzimmer.
Der Mann krault Björn am Kopf, kniet vor ihm, nimmt den Hund an den Vorderpfoten, schaut ihm tief in die runden Augen und quengelt: »Herrchen hat sich doch gar nichts Böses dabei gedacht.«
»Ich werde dann mal anfangen«, sagt Alphonse.
Els und Dieter heißen sie, so liest er auf dem Kostenvoranschlag. Els hat ihm eine Tasse Kaffee angeboten, bevor sie gegangen ist, und Dieter ist schon seit einigen Stunden oben bei der Arbeit, in seinem Büro auf der anderen Seite des Hauses. Er geht oft auf die Toilette.
Wenn die Bewohner abwesend sind, geben die Häuser Alphonse oft Hinweise auf die Art von Geschichte, die sie ihm erzählen werden. Oder sie führen ihn in die Irre, das kommt auch vor. Ein Papierkorb, darin in kleine Fetzen gerissene Kinderzeichnungen, Hausaltäre, ein Loch in einer kürzlich eingetretenen Gipsplatte.
Das Haus von Els und Dieter gibt wenig preis. Sie haben ihre Sachen ordentlich in fachkundig eingebauten Schränken und Schubladen verstaut, an der Wand hängen Fotos der Familie im Schnee, der Familie in Badeanzügen auf einer Rutschbahn, die Reihe setzt sich thematisch über alle vier Jahreszeiten fort.
Eine ganze Wand des Wohnzimmers besteht aus verschiebbaren Fenstertüren, durch die man in den Garten hinter dem Haus sieht. Verglichen mit der Ordnung im Haus und dem millimeterkurz geschorenen Rasen des Vorgartens macht dieser einen verwahrlosten Eindruck. Die am Holzzaun lehnende Leiter erinnert ihn daran, dass er seine eigene Leiter vergessen hat. Er kann sich mit einem Stuhl behelfen, zieht seine Schuhe aus, um sich daraufzustellen, aber leichter wird die Arbeit dadurch nicht.
Björn leistet ihm Gesellschaft. Er verhält sich ruhig, verfolgt jedoch aufmerksam jede seiner Bewegungen mit dem Blick. Lange Zeit hat Alphonse geglaubt, Hundegebell lasse sich auf die Aussagen »Das darfst du nicht!« oder »Hey!« reduzieren, und dass die Tiere weiter nichts zu verkünden hätten. Björn ist nicht der erste Hund, der ihn daran zweifeln lässt. Er gähnt mit Alphonse mit, als der sich nach dem Abkleben dehnt. Zufall, denkt Alphonse, doch später passiert es noch einmal.
Er erzählt es Dieter, als dieser herunterkommt, um zu sehen, ob alles seine Ordnung hat.
»Das bedeutet, dass er dich mag«, sagt Dieter. »Hunde haben eine große Empathie. Ich habe neulich gelesen, dass sie nicht bellen, um untereinander zu kommunizieren, es ist eine Sprache, die sie entwickelt haben, um mit uns zu sprechen.«
»Ich dachte, nur Menschen würden sich vom Gähnen anstecken lassen.«
»Wir kennen wenige Menschen, die mit uns mitgähnen, nicht wahr, mein Bester?«, jammert Dieter dem Hund vor. Eine nähere Erklärung bleibt aus.
»Ich habe meine Leiter zu Hause vergessen«, sagt Alphonse. »Ich kann sie natürlich holen, aber ich habe gesehen, dass eine Leiter im Garten steht.«
»Könntest du sie dir selbst holen?« Dieter macht sich wieder aus dem Staub.
Draußen ist es noch wärmer geworden. Alphonse bemüht sich, nicht in die Hundehaufen zu treten, als er durch den Garten geht. Wird Björn überhaupt nicht ausgeführt? Als er die Leiter wegnehmen will, stellt er fest, dass auf der anderen Seite des Gartenzauns auch eine steht, sie sind mittels eines abgenutzten violetten Schwimmbretts verbunden. M UND L FOREVER hat jemand mit Filzstift daraufgeschrieben. Es ist eine wackelige Konstruktion, einfach auseinanderzunehmen. Er lehnt das Schwimmbrett an den Gartenzaun und nimmt sich vor, später alles fester miteinander zu verbinden.
Begleitet von dem Geräusch der harten Bürste, die er beim Säubern der Wände im Wohnzimmer benutzt, schläft Björn ein. Die Ammoniak-Lösung, mit der Alphonse die fettigeren Oberflächen in der Küche behandelt, weckt ihn dagegen wieder auf. Er niest und trollt sich mit einem beunruhigten Blick, seine Krallen klackern auf der Treppe. Alphonse öffnet die Schiebetür, um den Geruch zu verjagen.
Als Herrchen wieder herunterkommt, um sich ein Brötchen zu schmieren, bleibt der Hund oben.
»Willst du auch was?«, fragt Dieter, sichtlich mit seinen Gedanken noch ganz woanders.
Alphonse hat seine eigenen belegten Brote, nimmt jedoch gern eine Tasse Kaffee an.
Dieter schaut an ihm vorbei, auf die Leiter, dann aus dem Fenster. Er geht hin und schließt die Schiebetür, langsam.
»Mila hat die Leiter da hingestellt«, sagt er. »Kinder«. Er lächelt entschuldigend, verweist dann auf seine Gewohnheit, vor dem Computerbildschirm zu essen.
Mila ist um die dreizehn Jahre alt und sieht weder Vater noch Mutter ähnlich. Mit einem theatralischen Schwung wirft sie ihren Rucksack ab.
»Hallo«, sagt sie, und dann, entgeistert: »Wieso ist denn meine Leiter hier?«
»Vielleicht könntest du erst mal Alphonse Guten Tag sagen?« Ihre Mutter ist hinter ihr hereingekommen.
»Ich hab Hallo gesagt. Wieso ist meine Leiter hier?«
»Ich habe sie kurz ausgeliehen, weil ich meine vergessen habe. Ich stell sie gleich wieder zurück. Ich werde das Schwimmbrett besser befestigen. Versprochen.«
»Aber ich brauche sie jetzt.«
»Erst die Hausaufgaben«, sagt Els.
»Ich hab keine Hausaufgaben.«
»Das glaube ich nicht.«
Mila stürmt hinaus. Im selben Moment betritt ihr Vater das Zimmer.
»Hallo!«, ruft er ärgerlich. Sie antwortet nicht und rennt die Treppe hinauf.
»Die Pubertät – das bleibt einem nicht erspart«, sagt Dieter schmunzelnd. »Wenn du selber drinsteckst, denkst du natürlich nicht daran, dass dir die eigenen Kinder das alles später auch antun werden.«
»So schlimm ist es nicht«, sagt Els.
Sie erkundigt sich, ob Alphonse auch Kinder hat.
»Ich glaube nicht.«
Sie finden es witzig, und es glimmt etwas in ihren Augen, ein bisschen Neugier, ein bisschen Argwohn. Alphonse nimmt sich vor, den abgestandenen Witz nicht mehr zu machen.
Er holt Kabelbinder aus seinem Lieferwagen. Im Hintergarten verbindet er die beiden Leitern wieder mit dem Schwimmbrett.
»Übrigens werde ich nachher bei euren Nachbarn vorbeischauen«, sagt er, wieder in der Küche.
Els und Dieter starren ihn an, als stecke eine Axt in seinem Schädel. Wieso bei den Nachbarn?, wollen sie wissen. Er erklärt, dass er mit einem Farbfächer zu ihnen gehen will, damit sie eine Farbe aussuchen können – sobald er hier fertig ist, fängt er bei ihnen an.
Dieter fasst sich mit beiden Händen an den Kopf, Els schlägt mit der flachen Hand gegen eine frisch gestrichene Wand. »Scheiße«, sagt sie, schaut von ihrer Pick-Nick-rosa Handfläche auf die Skelettfinger an der Wand. »Tut mir leid.«
Alphonse drückt einen Lappen an die Öffnung einer Terpentinflasche, hält ihre Hand, um sie zu säubern. Für einen Moment steht sie belämmert da wie ein Kind, ihre Finger weit gespreizt, damit er mit seinen gründlichen, väterlichen Bewegungen sämtliche Farbspuren abwischen kann, dann flammt ihr Zorn wieder auf: »Das ist doch krank! Einfach nur krank!«
Er holt eine kleine, neue Rolle aus der Verpackung und lässt sie mit luftigen Bewegungen wie eine leichte Straßenwalze über den Handabdruck fahren. Es funktioniert.
»Alles, was wir machen, wollen sie auch«, erläutert Dieter. »Keine Ahnung, was in den Köpfen dieser Leute herumspukt. Sie haben deinen Lieferwagen vor unserem Haus stehen sehen, und zack, schon braucht ihre Küche auch eine neue Farbe.«
»Ihre Schlafzimmer.« Sie haben ihn nicht gehört.
»Das geht jetzt schon Jahre so. Wir ein Haus, sie ein Haus. Wir ein Kind, sie ein Kind. Wir ein neues Auto oder eine Reise durch die Vereinigten Staaten – sie auch.« Düster entfernt Els Farbreste unter ihren Nägeln. »Was sollen wir machen? Umziehen?«
»Wir ziehen nicht um.« Es ist Milas Stimme. Sie haben nicht gehört, dass sie die Treppe heruntergekommen ist, und während sie das Wohnzimmer durchquert und die gläserne Schiebetür öffnet, starren sie sie schweigend von der Granitarbeitsplatte aus an.
Els wartet, bis Mila draußen ist, bevor sie fortfährt: »Und es geht sogar so weit, dass sie angefangen haben, in unser Leben einzugreifen. Dass sie der Meinung sind, sie könnten bestimmte Anpassungen in unserem Leben vornehmen.«
Dieter will sie unterbrechen. Sein Mund weist in ihre Richtung und seine Lippen schürzen sich wiederholt, unterstützt von einem Zeigefinger, der die Flugbahn eines kraftlosen Insekts beschreibt.
»Das wissen wir nicht«, sagt er schließlich.
»Ich komm morgen wieder«, sagt Alphonse.
Sie danken ihm, etwas erschrocken über das abrupte Ende und einigermaßen entsetzt darüber, was sie alles preisgegeben haben, doch sie sind noch nicht am Ende ihrer Geschichte.
Bevor er in den Flur hinausgeht, sieht er sie auf einem kleinen fliegenden Teppich über dem Gartenzaun schweben. Zwei dreizehnjährige Mädchen, die ihre lachenden Köpfe in den Nacken werfen.
Auch durch das Fenster auf der Rückseite des Nachbarhauses sieht er kurz die beiden Mädchen, bevor er zu einem Sessel geführt wird. Das Ehepaar setzt sich auf zwei getrennte Sessel zu seiner Linken, beide schlagen ein Bein über das andere. Sie sind etwas rundlicher und kleiner als Els und Dieter. Zwischen ihm und dem Ehepaar knistern leise die Luftbläschen in dem Glas Tonic, das sie vor ihn auf den Couchtisch gestellt haben. Zu seinen Füßen keucht ein aufmerksamer kleiner Hund unbestimmter Rasse. Als Alphonse das Glas von der Tischplatte zum Mund führt, scheint das Tier den Atem anzuhalten.
»Wo kommen Sie her?«, erkundigt sich die Frau.
»Aus Brüssel«, sagt er. »Aber ich wohne jetzt seit fast neun Monaten hier.«
»Jaja«, entgegnet die Frau. »Aber wo kommen Sie wirklich her?«
»Aus Brüssel, hat er doch gesagt.« Ihr Mann steht nervös auf. »Möchten Sie Oliven?«, fragt er. »Bisschen Käse?«
»Nein danke. Und sagen Sie ruhig Alphonse. Und du.«
»Wir heißen Sieglinde und Ronny. Ich werde doch mal was holen gehen«, sagt die Frau, als ihr Mann sich wieder gesetzt hat. Sie geht in die Küche, die vom Wohnzimmer abgetrennt ist. Es klingt, als würde sie sämtliche Schränke leer räumen.
»Wie war es bei den Nachbarn?«, fragt der Mann. Man hört heraus, dass er bemüht ist, die Frage so neutral wie möglich auszusprechen.
»Ich denke, dass ich morgen Abend bei ihnen fertig bin.«
»Hat Els nichts gesagt, als sie gehört hat, dass du auch bei uns vorbeikommst?« Sieglinde stellt die Schälchen mit Oliven und Käse ab, Zahnstocher und einen Halter mit Servietten daneben.
Alphonse weiß nicht sogleich, was er darauf antworten soll. »Es schien sie zu interessieren«, sagt er dann.
Ronny schnaubt. »Darauf kannst du Gift nehmen!«, ruft Sieglinde aus. »Sie spinnt total, Alfredo!«
Dass sie so unverblümt redet, kommt unerwartet.
»Alphonse«, verbessert Ronny an seiner Stelle.
»Entschuldigung. Sie erzählt schon seit Jahren jedem, der es hören will, dass wir sie nachmachen. Wir könnten dasselbe über sie sagen, aber das machen wir natürlich nicht, schließlich sind wir noch einigermaßen bei Verstand!«
»Das kam mit einem Mal alles raus, bei einem Fest«, setzt Ronny fort. »Eine Party, und das auch noch bei uns, sie waren unsere Gäste. Zuerst hingen sie aus welchem Grund auch immer miesepetrig in einer Ecke rum …«
»Sie vor allem.«
»Und die beiden haben wie üblich zu viel getrunken, und plötzlich hieß es ›was für ein Zufall‹, dass wir auch einen dunkelblauen Peugeot hätten. Es ist nicht mal dasselbe Modell! Und ›ach, sieh mal, kommt dir die Lampe nicht irgendwie bekannt vor‹, und der Strauch hinten im Garten und was weiß ich noch alles.«
»Das ist ja alles noch gut und schön, aber dass wir Lana in die Welt gesetzt hätten, nur weil sie gerade ein Kind gekriegt hatte, ich bitte dich, Albert, wer kommt denn auf so was?«
»Alphonse.«
»Pardon. Wer kommt denn auf so was? Ich war schon über Mitte zwanzig, jeder aus unserem Umfeld bekam sein erstes Kind damals, ich war schon im vierten Monat, bevor ich überhaupt mitbekam, dass sie auch schwanger war, aber nein: das war alles nur, um es ihnen nachzumachen. Wie selbstverliebt muss man sein, um so was auch nur in Erwägung zu ziehen?«
Im Verlauf ihrer Reden sind Sieglinde und Ronny aufgestanden und haben einen abgehackten Tanz aufgeführt, der bei Ronny nun mit einem Faustschlag auf seinen Oberschenkel endet und in Sieglindes Fall mit dem Zeigefinger verebbt, der wie der Schnabel eines Spechtes an die Mitte ihrer Stirn tippt.
Alphonse lehnt sich in seinem Sessel zurück. Wenn die Beichte so energisch beginnt, dann dauert sie meistens länger.
»Und wenn es nur dabei geblieben wäre, aber nein, nein, es kommt noch absurder.« Sieglinde steht jetzt wie eine Äffin über den Couchtisch gebeugt, gestützt auf ihre Fäuste, Gesäß nach oben gereckt, mit geblähten Nasenflügeln und aufgerissenen Augen hinter den Brillengläsern. »Hat sie etwas über ihre Katze gesagt?«
Alphonse braucht eine Weile, bis die Frage zu ihm durchdringt. »Die ist gestorben, glaube ich?«
»Aber das ist doch bestimmt nicht alles, was sie dazu gesagt hat, oder? Sie behauptet nämlich, dass wir ihre Katze ermordet haben.«
»Ja, und weshalb wir das getan haben sollen, ist noch interessanter. Wir hätten das getan, weil unsere eigene Katze überfahren wurde, und weil sie denken, dass wir denken, dass sie das getan hätten – wir machen uns, ganz nebenbei, überhaupt keine Gedanken, wer dafür verantwortlich ist, wir gehen davon aus, dass es ein Unglück war – und deshalb hätten wir, Auge um Auge …«
»Katze um Katze!«
»… das Tier ermordet, indem wir es – wohlgemerkt – mit einem Pfeil durchbohrt hätten! Ein Pfeil aus einem Blasrohr! Mit einem Giftpfeil sollen wir die Katze erledigt haben!«
»Verstehen Sie, Alphonse? Anscheinend hält man uns für Menschen, die zu so etwas imstande sind!«
»Alphonse«, sagt Ronny.
»Hab ich doch gesagt.«
Für den Plafond in den Schlafzimmern rät er zu Balanced Mood, aus der Kollektion Colores del Mundo. Sie finden das helle Blaugrün, das er aus dem Farbfächer schiebt, ungemein passend.
Auf dem Weg nach Hause kreuzt Alphonse auf schmalen Straßen durch weite Äcker. Die tief stehende Sonne vergoldet die langen Halme des Getreides und weckt eine unbestimmte Sehnsucht. Keiner weiß, dass er morgens, noch empfindlich und ungerichtet nach der Umarmung des Schlafs, selten Musik hört, weil die Unmittelbarkeit für ihn dann kaum zu ertragen ist. Jetzt schaltet er das Radio ein, und als er wieder aufschaut, kommt ihm ein Wagen entgegen, der keine Anstalten macht, abzubremsen. Er selbst fährt seinen Wagen bis dicht an den Rand eines mit Mais bepflanzten Ackers und bleibt stehen, um zuzuhören.
Duke Ellingtons »Caravan«, in einer Version von Dizzy Gillespie, er kennt sie. Kamele ziehen durch die Wüste, doch dann setzt die Trompete Springbrunnen in Gang. Das Wasser fließt an seinen Schultern entlang, über seinen Rücken. Das seltsame Geigensolo auch. Als die Nummer zu Ende ist, schaltet er das Radio ab.
Er isst die Nudeln, die noch vom Vortag übrig sind. Kommt es ihm ruhig oder einfach nur still vor, ohne Kat? Er hofft, dass die Yogawoche ihr das gibt, was sie sich davon erwartet hat, obwohl er nicht genau weiß, was das ist.
Ihr Telefon scheint abgeschaltet zu sein. Er muss Amadou zurückrufen. Warum schiebt er das immer auf? Dass sein Freund nach all den Jahren wieder Kontakt zu ihm aufgenommen hat, hat ihn so gefreut, dass er Amadou spontan für ein paar Tage Urlaub eingeladen hat. Amadou wird seine neue Freundin mitbringen. In weiten Teilen von Alphonses Erinnerungen geht er an seiner Seite. Es gibt keinen Grund, ihm jetzt auszuweichen.
Er könnte auch Skype starten und seine Mutter sehen. Sie ist immer da, in einem vollen Haus, umgeben von Menschen, die ihren Rat benötigen, einfach nur bei ihr sein wollen oder versuchen, einen Vorteil aus ihrer Güte zu ziehen.
Er ist müde und kann die Müdigkeit nicht wegduschen. Was er spürt, lässt sich immer schwerer benennen. Er weiß, was es nicht ist. Es ist nicht etwas, was wehtut. Im Gegenteil. Doch es wartet auf etwas.
Der Klingelton des Telefons, Festnetz diesmal, dringt durch das Wasser in seine Ohren. Er dreht den Hahn zu und wirft sich einen Bademantel über. Er tippt auf Dieter.
»Alphonse?« Es ist Sieglinde.
»Ja«, sagt er.
»Ich wollte mich noch mal melden. Weil wir uns heute doch ziemlich haben gehen lassen und wir darauf nicht besonders stolz sind. Wir wollten dir auch danken, dass du uns zugehört hast.«
»Nicht nötig. Nicht weinen.«
»Es liegt nicht in unserer Hand, verstehst du?«
»Ja.«
»Okay. Entschuldige die Störung. Und schon mal eine gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
29
Am Morgen erreicht er Kat. Sie klingt vergnügt.
»Also fühlst du dich gut?«, fragt er.
»Ja«, sagt sie, möchte jetzt aber nicht weiter darüber reden. »Jetzt muss ich schon wieder los.«
»Wohin?«
»Zum Yoga. Noch vier Tage.«
»Viel Spaß.«
»Tschüss, Alphonse.« Sie hat sich nie einen Kosenamen für ihn ausgedacht, was er zu schätzen weiß. Mit Ausnahme ihrer Eltern wird sie von allen Kat genannt. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie einen bösartigen Tumor. Sie müssen davon ausgehen, dass er nicht wiederkommt.
»Fonsy!«, ruft Dieter. Er trägt einen dunkelblauen Morgenmantel und räumt gerade den Frühstückstisch ab. »Great that you also work on Saturdays.« Manchmal reden Leute plötzlich auf Englisch mit ihm, auch nachdem er schon Gespräche auf Niederländisch mit ihnen geführt hat, und obwohl es vier Sprachen gibt, die er besser beherrscht.
Els, die ihn eingelassen hat, ist zur Tür hinausgejoggt, diesmal mit Björn an der Leine. Im Garten sitzen die Mädchen über ihr Schwimmbrett gebeugt in Anoraks auf den obersten Sprossen ihrer Leitern und schreiben abwechselnd etwas auf ein Blatt Papier oder eine Karte. Als sie ihn hinter dem Fenster stehen sehen, winken sie wie Hofdamen. Er grüßt sie wie ein vorbeifahrender Papst.
Dieters Blick flattert an seiner Schulter vorbei durch das Fenster; eine nervöse Motte, die dem Ruf des Lichts widersteht und rasch wieder ins Halbdunkel zurückkehrt. Er murmelt, dass er sich etwas anziehen will, durchquert das Wohnzimmer bis zum Fuß der Treppe, geht aber nicht weiter, als er hört, dass Alphonse die Schiebetür öffnet. Er ist ein Vater, Dieter, und muss Verdacht schöpfen, wenn ein erwachsener Mann, ein Fremder letzten Endes, mit seiner pubertierenden Tochter und deren Freundin sprechen will und ihn dabei nicht einbezieht, ohne dass es einen erkennbaren Anlass dafür gäbe. Also macht er kehrt, um Wache zu halten, Dieter, er späht in den Garten hinaus, den er in letzter Zeit zunehmend gemieden hat, berührt wie immer von der Eintracht der Mädchen, über die in diesen Wänden nicht mehr gesprochen wird, aus Angst, sie zu beschädigen.
Die Mienen der Kinder werden unsicherer, ernster während des Gesprächs mit Alphonse. Was fragt er sie? Ist es an der Zeit, einzugreifen? Dann wird genickt, die Mädchen nicken, Alphonse nickt, und alle wenden sie die Köpfe zu ihm, schwach lächelnd, meint er.
»Setz dich doch eben mal«, sagt Alphonse, der die Tür hinter sich schließt. Im Hintergrund beugen sich Mila und Lana wieder über ihr gemeinsames Geschreibsel.
Dieter tut, wie ihn Alphonse geheißen hat. Er lässt die Hände auf seinen Oberschenkeln ruhen und schaut zu Boden, bleicher als soeben, der Morgenmantel verleiht ihm nun eine verletzliche Würde.
»Sieglinde und Ronny haben die Katze nicht ermordet.« Alphonse bleibt selbst während des Gesprächs stehen.
»Das habe ich mir gedacht.« Dieter blickt nicht auf. »Wie ist es passiert?«
»Es war ein Freund der Mädchen. Ein Junge aus dem Viertel, der sich seitdem nicht mehr hertraut.«
»Ich weiß, wen sie meinen. Ich habe ihn hier aber nie mit Blasrohr und Pfeilen gesehen.«
»Es war ein Versehen. Der Junge darf dafür nicht bestraft werden. Deine Tochter und ihre Freundin auch nicht.«
Dieter nickt. Und nickt dann noch einmal.
Danach zerfließt der Leim, mit dem das Wohnzimmer während ihres Gesprächs angefüllt zu sein schien. Die Stille wird von Metallgeräuschen vertrieben: das Öffnen und Aufstellen seiner eigenen Leiter, sein Schraubenzieher, der einen Deckel öffnet. Oben lässt Dieter die Badewanne ein.
Den größten Teil des Tages lassen die drei Familienmitglieder ihn in Ruhe malen. Sie schleichen respektvoll vorbei oder äußern sich anerkennend, wenn er sich zu ihnen umdreht. Die Arbeit geht schnell voran. Eine Wand nach der anderen beginnt zu leuchten.
Kurz vor der Mittagsstunde hört er den Klang von Els’ und Dieters Stimmen durch die Decke. Els regt sich über irgendetwas auf, lenkt dann ein. Als sie mittags am Küchentisch essen, wollen sie, dass er sich dazusetzt. Sobald er das getan hat, findet keiner mehr ein Gesprächsthema. Sie legen Käsesorten aus dem Umland auf seinen Teller, geschältes Obst, direkt vom Baum, er soll kosten. Auch Björn wartet seine Reaktion ab.
Als er abends aufräumt, wird das Ehepaar unruhig.
»Gute Arbeit«, findet Els. »Und so schnell.«
»Dass du hier gerade mal zwei Tage gebraucht hast«, sagt Dieter.
Alphonse klopft gegen die Scheibe, Mila und Lana winken zurück. Danach drückt er Els und Dieter die Hand.
»Ich bin nicht weit weg«, sagt er. »Montag fang ich bei den Nachbarn an.«
Sie nicken.
»Hier gibt es auch noch Arbeit.« Panik in ihren Worten.
»Die Zimmer oben könnten dieses Jahr auch noch einen Anstrich vertragen.«
»Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt.«
Sie begleiten ihn durch den Flur, suchen seinen Blick, sobald sich eine Gelegenheit bietet.
Als er sich vom Lieferwagen aus noch einmal zu ihnen umdreht, rennt Björn in vollem Tempo auf ihn zu. Er hebt den strampelnden Hund hoch und trägt ihn zur Haustür, wo er ihn in Els’ Arme legt. Eine Sekunde lang schauen sie Alphonse an, als habe er ihr Baby zur Welt gebracht, dann lachen sie darüber hinweg.
Auf dem Dorfplatz von Watou bestellt er einen Cappuccino auf der leeren Terrasse eines vollen Cafés. Er muss der Besitzerin recht geben: endlich Sommer, aber das Wetter spielt verrückt. Zu sehen sind Motorradfahrer auf der Durchreise, zwei junge Menschen auf schlanken Pferden. Neben der Kirche, vor dem Kirchhof, steht eine Jesusstatue mit ausgebreiteten Armen. In der Mitte des Platzes ein Soldat, an seiner Seite ein Löwe.
Er ist in ein seltsames, schönes Leben geraten. Verlangt er zu wenig? Bekommt er zu viel?
Nachdem er gezahlt hat, auf dem Weg zu seinem Lieferwagen, sieht er das Denkmal von vorne. Der Soldat hält einen Revolver an seine Brust gedrückt, den Lauf von sich weg gerichtet. Die Christusfigur, ein Stück weiter drüben, hält den Kopf gesenkt, es wirkt jetzt so, als seien ihr beim Ausbreiten die Arme eingefroren.
Manche Dinge setzen ihn immer wieder in Erstaunen. Zwanzig Minuten Fahrt für einen Döner.
Es ist ein neuer Laden, mit einem Aushängeschild aus lauter spiegelnden Pailletten, sodass sich die Buchstaben von Pita Merci im Wind bewegen und mit aller Macht das schwache späte Sonnenlicht reflektieren. Drinnen ist es sauber und leer. Linoleum. Mit großer Sorgfalt ordnet der junge Mann neben der Kasse die Rolle Alufolie, die Messer und das große Salzfass. Danach richtet er konzentriert alle Plastikgabeln im Halter aus, sodass die Zinken auf ihn weisen.
»Kardesch«, sagt er fröhlich, als er Alphonse hereinkommen sieht.
Sie kennen sich nicht. Es ist schon lange her, seit ihn jemand so genannt hat, es gefällt ihm.
»Schöner Laden.«
»Merci. Aber eben auch teuer. Arbeit, Arbeit, Arbeit.«
»Das glaube ich. Machst du mir einen großen Döner mit allem und Samurai-Soße, bitte?«
Der Junge lacht. »Also scharf. Wie immer, eben.«
»Bitte?«
»Also, ihr nehmt eben immer scharfe Soßen. Und viel Huhn.«
Obwohl Alphonse sich diesmal für den anderen drehenden Fleischbatzen entschieden hat, stimmt es, dass er viel Huhn isst. Genau wie fast alle Leute, die er kennt. Und in der Tat, er hat eine Vorliebe für scharfe Soßen. Er möchte sich trotzdem nicht fühlen, als sei er bei etwas ertappt worden. »Ich dachte eigentlich, ich hätte meine eigenen, ganz persönlichen Essgewohnheiten.«
»Also, eben nicht«, sagt der Besitzer bestimmt, und dann, plötzlich schelmisch, plötzlich noch jünger: »Zu jedem Döner: eine Gratis-Show!«
Er legt das Brot in den Ofen und beugt sich über sein Smartphone, das er an eine Box angeschlossen hat. Nach einem Fehlstart findet er die richtige Nummer. Zuerst erklingen anschwellende und wieder verebbende Töne, wie Suchlichter über einer dunklen Fläche. Der Besitzer lässt seine Finger eine Art Dehnübung auf der Theke zwischen ihm und Alphonse ausführen, die Arme gestreckt, den Kopf mit den dicken, nach hinten gekämmten Haaren leicht geneigt. Der Blick, den er auf seinen Kunden richtet, ist der eines Falken. Alphonse fragt sich, ob etwas von ihm erwartet wird. Dann bricht ein elektronischer Beat los, darin mengt sich ein oft wiederholtes, orientalisch inspiriertes Motiv. Der Besitzer wendet sich dem Fleischbatzen zu. Wie er das Fleisch abschneidet, kann Alphonse nicht richtig sehen, doch er lässt die beiden Messer, mit denen er hantiert, regelmäßig mit schnellen Würfen von Hand zu Hand wandern, hinter seinem Rücken, über seinem Kopf. Mit einer zierlichen Verbeugung zaubert er anschließend das Brötchen aus dem Ofen und füllt es, mit den Salatlöffeln jonglierend, mit Tomaten, Zwiebeln, Gurke und geriebenen Karotten. An einem bestimmten Punkt saust auch das Salzfass, das er gar nicht benötigt, in Ellipsen durch die Luft. Eine Schale mit Gewürzen setzt zur Verfolgung an und hinterlässt bei jeder Drehung ein rotes Wölkchen. Er setzt sie, wie auch die Löffel, nicht nur mit den Händen in Bewegung, sondern schubst sie auch mit den Ellbogen, Schultern und der linken Hüfte. Als das Salzfass aufrecht auf seinem Kopf landet, bewegt er es wie eine indische Tänzerin von links nach rechts, während er die roten Gewürze in das Brötchen streut. Alphonse klatscht Beifall. Als es mit dem Jonglieren von zwei Messern und einem kleinen Hackebeil weitergeht, weicht er einen Schritt zurück. Wie der Besitzer es schafft, das Fleisch, das noch ein bisschen auf dem Backblech unter den drehenden Batzen simmert, zwischen den Messerwürfen in das Brötchen zu befördern, ist ihm schleierhaft. Klar ist allerdings, dass der junge Mann von einem Augenblick auf den andern vollkommen erstarrt, während die Messer und das Beil um ihn herum auf den Boden scheppern. Mit bebenden Lippen und einem heftig blutenden Ringfingerstumpf dreht er sich zu ihm um.
Alphonse reißt ein Dutzend Servietten aus dem Halter, die der Mann an die Wunde drückt. »Wo ist der Finger?«, fragt er.
Gleichzeitig wenden sie den Kopf zum Backblech, und weil sie ihn dort nicht sehen, spürt Alphonse fast so etwas wie Erleichterung – und sei es auch eine, die Gänsehaut nicht ausschließt –, als er das Körperteil unter seinem Schuh entdeckt. Gerade noch kann er sich zurückhalten, sein Gewicht auf den Fuß zu verlagern. Er hebt sein Bein wieder an, als sei er auf eine Landmine getreten. Die äußerste Hilflosigkeit eines abgetrennten Körperteils, das Unwirkliche daran. Er hebt es mit einer Papierserviette vom Boden auf. Es ist das dritte Mal, dass er so etwas sieht, in den beiden anderen Fällen ging es auch um Finger. Er erinnert sich an einen Unfall mit einer elektrischen Säge in einem Bauunternehmen, bei dem er gearbeitet hat; der Finger stand aufrecht auf dem Boden, als würde jemand aus dem unteren Stockwerk durch die Decke zeigen. Und vor längerer Zeit war es die Zeigefingerkuppe von Aline, seiner Schwester, die in der Küche geholfen hatte, mit einem Messer, das viel zu groß für sie war.
Der dumpfe Aufprall des bewusstlos zusammensackenden Mannes vertreibt die Erinnerungen. Er liegt in einer seltsamen, krummen Haltung auf den bespritzten Fliesen. Das Einzige, was sich an ihm bewegt, ist das Blut, das aus der Wunde strömt. Mit einer Hand legt Alphonse die schweren Füße auf eine umgedrehte Plastikschüssel, danach macht er sich auf die Suche nach einem Tiefkühlschrank. Die meisten Schubladen sind mit Eis überfroren, die erste, die er nach ein wenig Rütteln und Ziehen losbekommt, ist gefüllt mit äußerst detaillierten Eisskulpturen, Figuren in der Größe von Playmobilmännchen, ein Wikinger, ein König, ein orientalischer Krieger, alle mit demselben Gesicht. Es muss das besondere Gesicht des Besitzers sein, des jungen Mannes auf dem Fußboden. Alphonse hat nicht die Zeit, sich das näher anzuschauen, will den Fund nicht für das Stillen der Wunde verwenden. Eine Schublade höher findet er gewöhnliche Eiswürfel.
Er verteilt sie auf zwei Geschirrtücher, in eines der gefüllten Tücher legt er den Finger, das andere legt er auf die Stirn des Jungen. Es dauert eine Weile, bis dieser zu sich kommt, Alphonse will gerade einen Krankenwagen rufen, als der Verletzte die Augen öffnet und ihn voller Angst anschaut.
»Kannst du stehen?«
Der junge Mann nickt und lässt sich auf die Beine helfen.
Er heißt Duran. Während der Fahrt zum Krankenhaus und im Wartezimmer der Notaufnahme wandelt sich seine Miene von erschrockener Verwirrung zu düsterer Resignation. Immer, wenn sein mit einer Mullbinde umwickelter Fingerstumpf niedergeschlagen in den Schoß absinken will, ermahnt ihn Alphonse, ihn wieder neben sein Ohr zu halten, das verringert die Blutung und stärkt die Kampfeslust.
»Also, mein Vater hat gesagt: ›Duran, du wohnst zu weit weg, was willst du in diesem Kaff, deine Familie kann dir nicht helfen mit dem Laden, und du kannst es eben nicht allein, mit deinen Augen.‹ Ich sage: ›Meine Augen sind gut, das war früher‹ – also, ich hatte eben ein faules Auge, ein abgeklebtes Brillenglas, schwierig für ein Kind. ›Du kannst die Schmetterlinge nicht sehen‹, sagt mein Vater – also, bei diesem Test eben, mit den Schmetterlingen und so, die zwischen Flecken versteckt sind, alle haben sie auftauchen sehen, und ich eben nicht. ›Ich brauch die Schmetterlinge nicht zu sehen‹, sag ich. Viel Streit, aber ich hab’s dann eben doch gemacht. Ich dachte: Warte nur ab, Vater, überall sind Flecken, also schau nur hin, bis ich erscheine, du wirst mich schon sehen.«
Er streckt den umwickelten Stumpf voller Entsetzen von sich. Alphonse will ihn gerade wieder ermahnen, seine Hand senkrecht zu halten, als eine vollbusige Ärztin auf dem Flur erscheint. Sie muss Ende vierzig sein und hat orangene, hochgebürstete Haare, was den Eindruck hervorruft, ihr Kopf stünde in Flammen.
»Fingerchen ab?«, fragt sie.
»Ich habe ihn dabei.« Alphonse deutet auf den Plastikbeutel neben ihm. Das Handtuch mit den Eiswürfeln darin ist inzwischen durchgeweicht.
»Darf ich mal sehen?« Sie brennt vor Ungeduld, das ist ihr deutlich anzusehen. Er hofft, sie nicht zu enttäuschen. Den Finger hat er in Frischhaltefolie gewickelt, weil er befürchtete, dass er sonst von der Kälte angegriffen würde. Duran schaut so unauffällig wie möglich weg.
Die Ärztin nimmt den verpackten Finger und klopft ihn sanft gegen die Armlehne des Stuhls. »Gut, nicht gefroren.« Sie lacht kurz vor Begeisterung auf. »Folgen Sie mir!«
»Nun schau doch mal hin! Eine einmalige Gelegenheit, deinen Finger von innen zu sehen.« Die Worte sind an Duran gerichtet, der vermutlich lieber eine Vollnarkose gehabt hätte.
Die Ärztin hört kurz mit dem Nähen auf, um sich an Alphonse zu wenden, der auf einem Stuhl an der Wand Platz genommen hat. »Sie dürfen ruhig etwas näherkommen.« Dass beide Herren ihren freundlichen Aufforderungen nicht nachkommen, scheint sie zu beunruhigen. Sie hat alles, was sie getan hat, sorgfältig beschrieben und benannt, mehr kann ein Patient doch nicht von ihr verlangen?
»Wird er seinen Finger wieder benutzen können?«, fragt Alphonse. Er hat den Eindruck, dass ihre Verständnislosigkeit sich allmählich in Ärger verwandelt.
»Da er von mir wieder angesetzt wurde, höchstwahrscheinlich ja«, sagt sie, defensiv, aber doch vor allem stolz.
Durans Ringfinger ist mit einem Streifen Metall und einem steifen Verband versehen worden. Im Auto nimmt er die Hand aus der Schlinge, die ihm im Krankenhaus um den Hals gehängt worden ist.
»Also ein Ringfinger, das ist eben besser als ein Zeigefinger«, sagt er, fest entschlossen, noch an diesem Nachmittag wieder die Arbeit aufzunehmen. »Und ich bin eben Linkshänder.« Er blickt zur Seite auf den Fahrer.
Merkwürdig, findet Duran, dass dieser Mann der Einzige ist, der ihn je in bewusstlosem Zustand gesehen hat. Er hat ihn nicht alleingelassen, nicht im Laden, und nicht in der Notaufnahme. Es berührt ihn, dass er das normal fand.
»Also, merci eben.«
Alphonse schaut kurz zu ihm und zieht einen Mundwinkel hoch.
»Nee, also echt. Kann ich irgendwas tun, um dir zu danken?«
»Ich wüsste etwas. Die Männchen in deinem Tiefkühlschrank, die würde ich gerne noch mal sehen.«
Manchmal wird die Luft durch ein Gefühl ersetzt. Plötzlich ist das Auto vom Boden bis zum Dach mit Verlegenheit ausgefüllt. Bin ich der Einzige, der seine Eismännchen kennt, fragt sich Alphonse. »Ich fand sie schön. Deshalb würde ich sie gerne noch mal sehen.«
»Also, es ist vielleicht ein komisches Hobby, aber sonst arbeite ich ganz normal. Ich arbeite wirklich hart. Oft vierzehn Stunden am Tag. Und ich gehe auch ins Fitness-Studio.«
Alphonse drängt nicht weiter. Aber er ist einverstanden, dass Duran ihm etwas zu essen macht. Er parkt direkt vor dem Döner-Laden. In diesem Teil des Landes gibt es keinen Mangel an Parkplätzen.
Mit den gesunden Fingern seiner verletzten Hand bewegt Duran einen Teebeutel in einer Tasse heißem Wasser auf und nieder. »Also, du darfst sie dir ansehen«, sagt er. »Aber eben da hinten.«
»Natürlich«, sagt Alphonse. »Sonst schmelzen sie.«
Sie stellen zwei Stühle an den geöffneten Tiefkühlschrank und beugen sich über die Schublade.
»Sie sehen dir alle ähnlich«, sagt Alphonse, auf die Gefahr hin, Durans Schamgefühl erneut zu beleben.
»Und sie heißen eben alle Duran«, sagt Duran. »Der hier ist Duran Khan – mit den Kleidern von Dschingis Khan. Und der hier ist eben Ataduran.«
Der Apfeltee dampft auf einem niedrigen Tischchen neben Alphonses Beinen, die schwitzenden Fleischbatzen haben ihren Derwischtanz wieder aufgenommen, und der Boden ist mit Blut bemalt. Gemütlichkeit hat seltsame Gesichter, denkt Alphonse heiter.
»Hier«, sagt Duran. »Wenn du seinen Namen errätst, darfst du ihn haben.« Er zeigt Alphonse einen mit Stroh und Federn bekleideten Duran, mit einem Lendentuch, einem Speer und einem Schild.
»Shaka Duran?«
»Ja. Der ist also für dich. Aber du darfst ihn niemand zeigen.«
Zu Hause befreit Alphonse das Männchen aus dem Kühlelemente-Häuschen, in das ihn Duran eingesperrt hat. Er steckt Shaka Duran in die kleinste Tiefkühldose, die er findet, und legt ihn zwischen zwei Päckchen Spinat im Gefrierfach seines eigenen Kühlschranks schlafen. Wenn Kat ihn findet, wird er ihr erklären müssen, dass das Geschenk gut gemeint war.
28
Am Sonntag regnet es. Früh am Morgen schleudert der Wind harte Tropfen gegen die Fenster, die Salven halten an, bis Alphonse seinen Kopf vom Kissen hebt.
Er setzt sich auf den Rand des Bettes und begreift, dass das Geräusch des Regens in seinem Traum umgeformt worden ist zum Geknatter von Maschinengewehren, die Uniformierte auf nackte Männer abfeuerten, die an einer Mauer standen. Er war nicht dabei.
Beim Kaffee bekommt er Lust, Kat zu hören, die sich atemlos meldet. Sie hat keine Zeit, steckt mitten in einem Sturm, der aufgekommen war, nachdem sie alle Matten, Kissen und Decken tief in den Wald geschleppt hatten, jetzt bringen sie alles wieder ins Gebäude zurück, die Stimmung hat einen Tiefpunkt erreicht, nicht nur das Wetter, auch der Gastlehrer ist enttäuschend.
Alphonse sagt, sie fehle ihm. Er ihr auch.
Sie hat ihm einmal den Kopfstand beigebracht. Shirshasana soll die Gehirnzellen verjüngen, den Stoffwechsel optimieren und sowohl graue Haare als auch Krampfadern vermindern. Ob er ihn noch kann? Ihm ist bewusst, dass das Vorhaben nicht ganz ohne Gefahr ist, als er eine zusammengefaltete Decke vom Sofa nimmt und auf den Boden legt. Er setzt seine Ellbogen an den Rand, in Schulterbreite, schiebt die Finger ineinander und drückt den Scheitelpunkt seines Kopfes in die Decke, der Hinterkopf ruht in seinen Händen. Es geht darum, die Schultern tief zu halten, erinnert er sich, damit der Hals nicht belastet wird. Dann bewegt er die Zehen mit kleinen Schritten auf sein Gesicht zu, richtet den Rücken gerade, streckt seine Beine. Und er steht. Es ist unwahrscheinlich schön, bis der Wunsch, noch lange weiter so stehen zu bleiben, von der Einsicht verdrängt wird, dass er nicht mehr genau weiß, wie er schmerzfrei wieder herunterkommt. Als er die Beine leicht beugt, um den Abgang einzuleiten, kommt es ihm vor, als würde er auseinanderfallen, daher streckt er sie wieder.
Es klopft an der Haustür, eine Gewohnheit, die er nur von seinem Nachbarn Willem kennt.
»Tür ist offen!«
»Ihr müsst abschließen! Wir sind hier zwar nicht in Brüssel, aber trotzdem!«, ruft Willem vom Flur her, und dann, Auge in Auge mit dem Shirshasana: »Oh je, wie ist denn das passiert?«
»Kannst du mir eben mal helfen?«
»Was soll ich machen?«
»Einfach dagegenhalten. Stützen.«
»Du bist gut. Ich bin beinahe achtzig.« Mit dem Ernst alter Menschen nimmt Willem zuerst eine Gewichtheberpose ein, um anschließend Alphonses Beine wie die Griffe einer Schubkarre festzuhalten. Danach gibt er sich keine Mühe, seinen Stolz zu verbergen. Endsiebziger hilft wesentlich jüngerem Mann aus einer körperlichen Notlage. Mit Erfolg. Er streicht mit den Fingern durch seine graue Mähne und lächelt Alphonse an. Ja, er möchte einen Kaffee.
»Ist Kat noch nicht wach?«, ruft er zur Küche, wo Alphonse ihm eine Tasse einschenkt.
»Die ist auf ihrer Yogawoche.«
»Und deshalb hast du gedacht, du könntest auch ein bisschen auf dem Kopf stehen? Ich habe immer gesagt, dass das gefährlich ist. Kat sollte lieber auch damit aufhören, sie ist sowieso viel zu dünn. Marie-Jeanne hat das auch gesagt. Sie hatte ein Auge für solche Dinge, deshalb hat sie die vielen Kuchen für euch gebacken. Dass ich die nie mehr essen werde.«
Als Marie-Jeanne noch lebte, sprach Willem vorwiegend über die Irritationen, die sie bei ihm auslöste. Weil ihr Anteil bei Gesprächen hauptsächlich aus der Frage »Das ist doch nicht wahr, oder?« bestand. Oder weil sie es nicht genießen konnte, auswärts zu essen. Noch bevor die Rechnung bezahlt war, begann sie, nach Schlüsseln zu kramen, die sie später, zu Hause, an Orten ablegte, wo sie erst nach langen Suchaktionen gefunden wurden. Oft hatte er sich beklagt über ihr mangelndes Interesse an der Bibliothek über den Großen Krieg, die er anlegte, ein Desinteresse, das fast schon Ablehnung war. »Der Erste Weltkrieg ist vorbei!«, hatte Alphonse Marie-Jeanne noch eine Woche vor ihrem Tod wütend schreien gehört. Sie war der Ansicht, dass Garagen für Autos und nicht für Bücher gemacht seien, und Gewächshäuser für Gemüse. Laut Willem hing das mit einem Mangel an Bildung zusammen, ein Unterschied, der oftmals einen Keil zwischen sie getrieben hätte. Aber so hatte er es nur betrachtet, als sie noch lebte. Ihr Tod war sogar den Zeitungen eine Meldung wert gewesen, wegen der Pechsträhne, die ihm vorausgegangen war. Auf dem Weg zum Fischgeschäft war sie das Opfer einiger Geranien geworden, die mitsamt einem Terrakotta-Kasten auf sie niedergegangen waren. Mit einer gebrochenen Schulter und einer ebensolchen Zehe sollte sie mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden, der jedoch unterwegs eine Kurve verpasste, wonach sie mit zwei ebenso heftig streitenden wie blutenden Sanitätern in einen anderen Krankenwagen verlegt werden musste. Nach der Explosion einer Gasflasche im Zimmer eines rauchenden Lungenpatienten in dem Krankenhausflügel, in dem ihre Brüche eingegipst worden waren, dem nachfolgenden Brand und der chaotischen Evakuierung, versagte das eigentlich recht zähe Herz von Marie-Jeanne Maes endgültig seinen Dienst.
Sie waren erst seit ein paar Monaten Nachbarn, als sich diese Tragödie ereignete. Willem hatte sich nach der Beerdigung in seinem Haus eingeschlossen, bis Alphonse und Kat ihn zum Essen eingeladen hatten. Seither kam er mindestens ein Mal pro Woche vorbei. Nachdem er sie mit einer Kiste alter Seife, einem Harlekin von der Größe eines siebenjährigen Kindes, einem tonnenschweren Gerät, um Lebensmittel zu vakuumieren, einer blank geputzten Granatenhülse, die als Regenschirmständer dienen konnte, und dem bemalten Kopf einer Sphinx bedacht hatte, war es Kat gelungen, ihn vorsichtig von der Idee abzubringen, ihnen bei jedem seiner Besuche ein Geschenk mitzubringen.
Diesmal hat Willem ein Buch mitgebracht, bemerkt Alphonse, doch es sieht nicht so aus, als wollte er es herschenken.
»Es gibt keinen boche, keinen deutschen Doktor an den Universitäten von Berlin oder München, der es in Bezug auf Schönheit und grandeur mit einem Senegalesen aufnehmen könnte!«, deklamiert Willem, streckt einen Finger wie einen trockenen Zweig empor und wirft einen bedeutsamen Blick auf das Buch. »Premierminister Clemenceau, 1914. Man kann über Frankreich sagen, was man will, und Kanonenfutter waren die Senegalschützen allemal, aber die Franzosen betrachteten die afrikanischen Soldaten wenigstens als Menschen. Na ja, das ist jedenfalls die eine Seite der Geschichte.«
»Sie hielten ihr Kanonenfutter wenigstens für menschlich«, grinst Alphonse.
Willem nickt. Seit der Ankunft seines neuen Nachbarn hat er sich näher mit dem Schicksal der Senegalschützen im Ersten Weltkrieg befasst, und seit dem Tod seiner Frau sind sie zu einer Obsession geworden.
»Für die Deutschen waren sie Affen, eine Gefahr für weiße Frauen, die aus Mangel an historischem Bewusstsein Interesse an den Kerlen zeigten. Das sagt natürlich auch etwas darüber aus, wie damals die Frauen angesehen wurden. Eine stetige Gefahr für die Gesellschaftsordnung. Sie hatten ganz bestimmt einen niedrigeren Bildungsstand, die Frauen damals, aber Bildungsstand und Intelligenz, das sind zwei Paar Stiefel, nimm nur Marie-Jeanne: die ist nur bis vierzehn zur Schule gegangen, aber was habe ich nicht alles von ihr gelernt?«
Alphonse lehnt sich auf dem Sofa zurück. Willem ist zum Witwer einer Heiligen geworden, und diese Rolle hilft ihm, über den Verlust hinwegzukommen. Seine Empörung über das Schicksal der Afrikaner im Ersten Weltkrieg scheint ihn auf die eine oder andere Art zu trösten, oder wenigstens von seinem Kummer abzulenken. In den ersten Wochen der Trauer vergoss er so viele Tränen, dass Alphonse sich nicht zu helfen wusste, sie waren die Antwort auf alle Fragen, die Reaktion auf jeden Scherz. Jetzt geht es deutlich besser. Außerdem liebt er das gewählte Niederländisch mit dem typisch westflämischen Akzent des betagten Französischlehrers. Nie hat er Mühe, ihn zu verstehen, was bei den Gesprächen mit manchen seiner Kunden immer wieder vorkommt. Willem betont jede Silbe, artikuliert sorgfältig jeden Konsonanten, auch wenn er ihn durch einen anderen ersetzt.
»Die Deutschen hatten natürlich ein großes Interesse daran, die afrikanischen Soldaten zu entmenschlichen, so konnten sie den Franzosen eine unlautere Art der Kriegsführung in die Schuhe schieben. Und die Franzosen mussten ihrerseits ständig wiederholen, wie mutig, stark und loyal die afrikanischen Schützen waren. ›Loyale Kinder‹, als solche wurden sie bezeichnet. Aber das entspricht nun wahrhaftig nicht dem Bild, das die schwarzen Soldaten von sich selbst hatten.«
»Magst du ein Butterbrot mitessen? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Es gibt Rosinenbrot.«
»Von welchem Bäcker?«
»Moeyersons.«
»Dann gerne, in dem von Gaudesaboos ist nicht genug Salz. Und natürlich hat sich auch das Bild, das sie von ihrem Kolonisator hatten, dadurch verändert: sie sahen, dass die Franzosen mit einem Mal einem mächtigeren Gegner gegenüberstanden.« Er späht an Alphonse vorbei, als könne er die Szenerie auf den Äckern hinter den Gardinen verfolgen. »All die jungen Burschen, die davor nur die Sonne gekannt hatten und sich hier die Füße abfrieren mussten für einen Kampf, der sie überhaupt nichts anging. Ich weiß, ich hab schon einmal danach gefragt, aber hättest du nicht mal Lust, mit mir zu den Gräbern der Senegalschützen zu fahren? Auch auf dieser Seite der Grenze gibt es einige davon. Wenn es noch eine Sache gibt, die ich machen will, bevor ich das Zeitliche segne, dann ist es das: ein vollständiges Inventar dieser Gräber und Namen anzulegen.«
»Das lässt sich machen«, sagt Alphonse. »Aber nicht bei diesem Wetter.«
Er hat Lust, den ganzen Tag drinnen zu bleiben. Er ist schon oft umgezogen, doch erst vor Kurzem ging er eines Morgens durch dieses Haus mit dem Gefühl, dass es ein gutes Haus sei, schön und angemessen, und dass er, ohne es zu merken, zu Hause angekommen sei. Seither erfreut er sich an der Tragkraft und Solidität der Mauern, wie sie die Wärme drinnen, den Regen draußen halten.
Er schaltet den Computer ein, öffnet Skype. Seine Mutter scheint online zu sein, er ruft sie an mit einer Art von frohem Heimweh, das ihn dabei jedes Mal überkommt. Das Geräusch, das zur Kontaktaufnahme auf Skype gehört, ist passend gewählt: zunächst ein paar abwartende Töne, die mit einem Fragezeichen enden, dann, wenn auf einem anderen Kontinent jemand auftaucht, so etwas wie aufsteigende Luftblasen. Und da ist Dakar, die Wohnung im Erdgeschoss, wo sie jetzt wohnt.
»Tag Sohn«, sagt sie auf Diola, der Sprache, die er fast nur noch mit ihr und seiner Schwester spricht. »Du wirst langsam dick.«
»Tag Mutter. Das sind Muskeln.«
Er sollte öfters ablehnen, wenn seine Kunden anfangen, ihm den Teller vollzuladen, besonders bei den Kuchenstücken. Ihr roter Kopfputz verrutscht keinen Millimeter, als sie sich heftig schüttelt vor Lachen. Es herrscht viel Lärm um sie herum, wie immer.
»Wirst du wieder von allen um Rat gebeten?«, fragt er.
»Manche sind hier, um Rat zu holen, andere tun nur so, die laufen von der Hintertür zur Vordertür, weil das der schnellste Weg von der einen Straße zur anderen ist. Solange sie zuerst anklopfen, lass ich sie gewähren.«
»Und sonst?«
»Tante Agnes ist gestorben.«
Ihre jüngere Schwester. »Wann ist das passiert?«
»Vor drei Tagen. Wir haben sie noch am selben Tag begraben. Sie war schon eine Zeit lang krank.«
»Du hättest mich doch anrufen können!«
»Was hättest du denn tun können?«
»Geld schicken für Medikamente. Trösten.« Er hat wenig Erinnerungen an diese Schwester seiner Mutter, die in ein Dorf in der Casamance gezogen war und sich vom Rest der Familie fernhielt, oder vielleicht besser gesagt, vom Rest der Menschheit. Agnes’ auffallendste Eigenschaft war, dass sie Schroffheit mit Lebenshunger zu verbinden wusste. Der Eigensinn, der die meisten Mitglieder der Familie kennzeichnet, hatte sich bei ihr zu einem trotzigen Starrsinn ausgeprägt. Sie arbeitete als Imkerin, die einzige Frau in Senegal, die diesen Beruf ausübte, und bei dem einzigen langen Gespräch, das sie mit ihm geführt hatte, ging es ausschließlich um die Bienenzucht. Er musste ihren Honig probieren. Um die sechzehn muss er gewesen sein, seine Tante war damals jünger als er heute.
»Tante ist nicht weg. Die Atome, aus denen ihr Körper bestand, sind jetzt frei. Sie brauchen nicht länger zusammenzuwirken, um diesen Menschen aufrechtzuerhalten, es ist wie beim Aufribbeln eines Pullovers, eine Masche nach der anderen verlässt die Form, in der sie gefangen war. Und all die Milliarden Atome gehen in etwas anderem auf: in dem Haus einer Schnecke, einer Mangoblüte und ihren Bienen. Sie wird sich in Flüsse ergießen und zum Meer fließen, eine glatte Muschel auf den Wellen wird sie sein, die Federn eines aufsteigenden Fischadlers und der Wind, der durch sie hindurchbläst. In ihrer Grenzenlosigkeit ist sie glücklicher, als sie jemals als Mensch gewesen sein kann.«
Seine Mutter kann schöne Geschichten erzählen. Es fällt ihm schwer, Fragen über Ebola daran anzuknüpfen, aber er tut es dennoch. Es gibt nichts Neues. Senegal ist umgeben von Nachbarländern mit einer wachsenden Zahl von Krankheitsfällen, bleibt jedoch bisher davon verschont. Kritische Stimmen flüstern, dass dies nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss.
Die folgenden Stunden verschwinden in Musik. Er greift zum Bass, das vertraute glatte Holz in seinen Händen, die dicken Saiten, die in die Rillen auf seinen harten Fingerkuppen passen. Er stellt sich vor das Fenster und spielt, was ihm in den Sinn kommt, ein tiefes Lied für die grünen und braunen Gewächse, die Schlammspuren auf den Straßen, den glimmenden Wolkenrand, den Flecken Helligkeit. Er drückt das Pedal mit dem Fuß, schickt die Klänge in eine Schleife, die anhält, als er den Bass in den Ständer zurückstellt und die abgerundete Rückseite der Kora auf den Schoß legt. Auf einem Teppich aus Basstönen erzählt die Kora eine mehrstimmige Geschichte über die Schützengrabenfüße der Senegalschützen, die Kuchen von Marie-Jeanne, das Gelächter dreizehnjähriger Töchter, über todgeweihte Kranke in den Straßen Liberias, summende Bienenschwärme und seine tote Tante. Und durch das Fenster die Äcker, immer nur die Äcker, die aufgereihten Bäume, aus dem Boden, zum Himmel empor, er sieht es geschehen, immer wieder aufs Neue.
27
Als Alphonse eintraf, war nur noch Sieglinde zu Hause. Obwohl sie ihn hastig zu den Schlafzimmern hinaufgeführt und schon vor einer Stunde angekündigt hat, zur Arbeit zu müssen, ist sie immer noch da. Sie läuft von einem Zimmer zum anderen, von oben nach unten, das Hündchen auf dem Arm. Er kreuzt sie auf der Treppe und begegnet ihr in der Küche, wo sie, in Gedanken versunken, spitze Küsse auf den kleinen Hundeschädel drückt. Das Tier hält dabei seine Augen auf ihn gerichtet. Er vermeint, ein »sag etwas« darin zu lesen.
»Ça va?«, fragt er.
Ihre Augen hinter den Brillengläsern kommen ihm noch größer und blauer vor als vorhin.
»Hast du eine Familie?«, erkundigt sie sich.
»Eine Freundin. Frau.«
»Keine Kinder?«
»Nein.«
Sie beißt sich auf die Unterlippe, weiß, dass es eine riskante Frage ist, stellt sie dennoch: »Warum nicht?«
»Das hat sich eben so ergeben«, sagt er.
»Willst du noch Kinder haben?«
Er findet es seltsam, dass die meisten Menschen in der Mehrzahl über hypothetische Kinder reden, als träten diese grundsätzlich als Gruppe in Erscheinung. »Ich hätte nichts dagegen. Es muss nicht sein.«
»Es ist dir egal?« Sie gibt sich keine Mühe, ihren Unglauben zu verbergen. »Und wie denkt deine Frau darüber?«
»Im Moment möchte sie sich lieber nicht damit befassen.«
Das kann viel bedeuten. Sie fährt nun auch mit der Zunge über ihre Lippen: noch so ein Tick, der verhindern soll, dass die Neugier in Sprache umgesetzt wird. Dann verhärten sich ihre Züge. »Sie sollte es besser tun. Sich damit befassen.«
»Wir haben noch Zeit.«