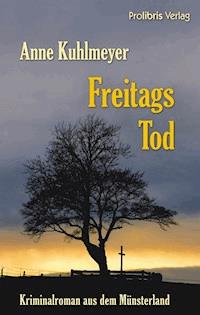8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als sie sich ins Auto setzt und losfährt, will Metha Engelhart nur Urlaub in der Sonne machen. Etwas, das sie seit Jahren, Jahrzehnten nicht getan hat. Doch der Dauerregen sorgt für Vollsperrung der Autobahn, immer mehr Straßen werden unpassierbar. Die Werra tritt über die Ufer. Das Wasser steigt. Und steigt … In einem alten Haus am Hang treffen Fremde aufeinander, die dem Hochwasser vorerst entronnen sind. Metha hat es mit einem Platten gerade noch bis dorthin geschafft. Albrecht Jackwitz, von Beruf Lektor, kommt zu Fuß mit seinem Koffer voller Bücher. Der halbwüchsige Sydney saß in einem Reisebus, als vor ihnen die Straße unterging. Er hat als Einziger den Bus rechtzeitig verlassen. Dann fährt donnernd ein Erdrutsch nieder, und die Fluten steigen noch schneller. Draußen wird es dunkel. Plötzlich taucht der Hausbesitzer auf, ein ruppiger Bauer namens Jan, mit einem Schaf und einer verunglückten jungen Frau im Schlepptau – und nicht gerade glücklich über all die ungebetenen Gäste. Unbeholfen versuchen die vom Wasser Eingeschlossenen, sich miteinander zu arrangieren, um die Sintflut auszusitzen. Doch jede der Personen trägt Bürden mit sich herum. Der belesene Jackwitz verschanzt sich hinter Vergesslichkeit. Der junge Sydney wäre lieber ein Mädchen. Bauer Jan ist wütend auf alles und jeden. Und warum verspürt Metha, die lebenstüchtige Ärztin, oft so eine Todessehnsucht? Anne Kuhlmeyer, Ärztin, Therapeutin und Schriftstellerin mit Hang zum Grenzentesten, erzählt von einer Hochwasserkatastrophe, die nicht nur Landschaften unterspült: Sie enthüllt die Spannung zwischen Vorsatz und Handeln, Deutung und Wirklichkeit. Drift übertritt die Genregrenzen wie der Fluss seine Ufer und schwemmt sie fort. Ein Roman mitten aus der Wirklichkeit, ein Mosaik aus Schuld und Verantwortung, Erfahrung und Erinnerung mit Einblicken in andere Kulturen und sinnlichen, verrückenden Hommagen an mitreißende Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Drift übertritt die Genregrenzen wie der Fluss seine Ufer und schwemmt sie fort. Ein Roman mitten aus der Wirklichkeit, ein Mosaik aus Schuld und Verantwortung, Erfahrung und Erinnerung mit Einblicken in andere Kulturen und sinnlichen, verrückenden Hommagen an mitreißende Literatur.
Als sie sich ins Auto setzt und losfährt, will Metha Engelhart nur Urlaub in der Sonne machen. Etwas, das sie seit Jahren, Jahrzehnten nicht getan hat. Doch der Dauerregen sorgt für Vollsperrung der Autobahn, immer mehr Straßen werden unpassierbar. Die Werra tritt über die Ufer. Das Wasser steigt. Und steigt …
In einem alten Haus am Hang treffen Fremde aufeinander, die dem Hochwasser vorerst entronnen sind. Metha hat es mit einem Platten gerade noch bis dorthin geschafft. Albrecht Jackwitz, von Beruf Lektor, kommt zu Fuß mit seinem Koffer voller Bücher. Der halbwüchsige Sydney saß in einem Reisebus, als vor ihnen die Straße unterging. Er hat als Einziger den Bus rechtzeitig verlassen. Dann fährt donnernd ein Erdrutsch nieder, und die Fluten steigen noch schneller. Draußen wird es dunkel. Plötzlich taucht der Hausbesitzer auf, ein ruppiger Bauer namens Jan, mit einem Schaf und einer verunglückten jungen Frau im Schlepptau – und nicht gerade glücklich über all die ungebetenen Gäste. Unbeholfen versuchen die vom Wasser Eingeschlossenen, sich miteinander zu arrangieren, um die Sintflut auszusitzen. Doch jede der Personen trägt Bürden mit sich herum. Der belesene Jackwitz verschanzt sich hinter Vergesslichkeit. Der junge Sydney wäre lieber ein Mädchen. Bauer Jan ist wütend auf alles und jeden. Und warum verspürt Metha, die lebenstüchtige Ärztin, oft so eine Todessehnsucht?
Anne Kuhlmeyer, Ärztin, Therapeutin und Schriftstellerin mit Hang zum Grenzentesten, erzählt von einer Hochwasserkatastrophe, die nicht nur Landschaften unterspült: Sie enthüllt die Spannung zwischen Vorsatz und Handeln, Deutung und Wirklichkeit.
Über die Autorin
Anne Kuhlmeyer, Jahrgang 1961, studierte Medizin in Leipzig. Nach einigen Stationen als Anästhesistin, Rettungsmedizinerin, Schmerztherapeutin und Mutter von zwei Söhnen lebt sie heute mit ihrer Familie in Coesfeld, ist als ärztliche Psychotherapeutin tätig und schreibt. Sie ist Redakteurin bei CulturMag und Mitglied des kriminalliterarisch-feministischen Netzwerks
Anne Kuhlmeyer
Drift
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2017
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Ariadne Verlag 2017
Lektorat: Else Laudan
Erscheinungsdatum: März 2017
ISBN 978-3-95988-078-7
Vorwort von Else Laudan
Ich lese Drift als Entführung oder Ausflug, ein geschmeidiger Krimi, der mich mitreißt und mitnimmt, dann über die Grenzen des Genres driftet und seine ganz eigene Geschichte erzählt, Methas Geschichte. Die folgt keinem Schema, unterläuft Erwartbarkeiten und geht mir lange nach.
Anne Kuhlmeyer schreibt über die Wirklichkeit, sie spürt sozialen Brüchen und Rissen nach und fördert Geschichte zutage. Rastlos erschafft sie lebensechte moderne Figuren und schickt sie in manchmal surreale, aber höchst weltliche Szenarien. So ist es auch hier in Drift. Straßen und Brücken versinken in schlammigen Fluten. Ein Grüppchen Überlebender sitzt mit knappen Vorräten fest: Fremde, unfreiwillig zusammengepfercht mit ihren Vorgeschichten und Geheimnissen. Die Anordnung stellt geläufige Verhaltensmuster auf den Prüfstand, ein klassisches Spannungsfeld aus Verantwortung und Schuld, Beziehung und Fremdheit, Erinnerung und Verdrängung. Dann übernimmt die Literatur eine navigierende Rolle, und die Membran zwischen Historie und Mythos wird durchlässig – im Bezugssystem des Politkrimis regelwidrig, geläufiger in der Topographie des magischen Realismus. Es entspinnt sich ein mehrstimmiger, abenteuerlicher Trip mit Krimi- und Thriller-Elementen, ein Mosaik aus Geschichte, Gegenwart, Hierzulande und Anderswo.
Schön finde ich das, bereichernd, dieses grenzüberschreitende Erzählen, in dem ganz Vertrautes sich mit Unerklärlichem mischt. Realität, so lese ich dieses Buch, ist das, was wir tun. Wie wir mit anderen umgehen. Wie wir unsere Geschichte in die Welt tragen, so gestalten wir die Wirklichkeit mit. Aber Vorsicht: Die Welt ist nicht in Ordnung. Und Methas Geschichte ist unsere.
Für einen, den ich kannte. Einen mit scharfgrauem Blick, redlichen Falten, solidem Gesicht. Das tauschte er in diesem Sommer
Freitag, 15. Juli
1
Es regnet.
Ich möchte tot sein.
Oder in Amsterdam. Dann weiter ans Meer und die Atlantikküste entlang, dorthin, wo die Sonne scheint und das gute Leben wohnt.
Seit Tagen, vielleicht seit Wochen schon, ich bin nicht sicher, regnet es. Ich habe nicht darauf geachtet. Wetter spielt normalerweise in meinem Leben eine untergeordnete Rolle. Ausgerechnet jetzt regnet es. Ein einziges Mal in all den Jahren, ja Jahrzehnten, fahre ich in Urlaub und es schüttet, als hätte die Atmosphäre sämtliche Wasser über mir versammelt und kippt sie nun auf die Straßen, die ich passiere.
Hinter der Frontscheibe ist es grün – Wald, Mais, dazwischen Weiden, von Regenschleiern verhangen. Das Navigationsgerät zeigt nichts, nur die Himmelsrichtung, vielleicht sind die Gewitter schuld, oder es sind die Wolken. Eine Karte habe ich nicht dabei. Wozu auch? Früher, als ich zu Fortbildungen oder Symposien unterwegs war, bin ich natürlich immer nach Karte gefahren. Heute verlässt man sich auf die Technik, was mir jetzt wirklich leidtut.
Kühl ist es, Herbst im Sommer. Ich stelle die Klimaanlage hoch und die Musik aus. Zwar mag ich den sanften Sound von Ruths CD, doch momentan machen mich alle Geräusche nervös. Das Radio gibt seit einer halben Stunde nur statisches Rauschen von sich, vermutlich ist der Sender weggeschwommen, also empfange ich keine Verkehrsnachrichten. Seit ich wegen einer Vollsperrung die Autobahn verlassen musste, habe ich mich auf Nebenstraßen westlich gehalten.
Zuerst folgte ich einem LKW in der Hoffnung, er fände den Weg zurück auf die Autobahn, bis er abbog, in ein Industriegebiet oder was das war, ich konnte es nicht genau erkennen. Kurz darauf hielt ich an einer Tankstelle, sechs Wagen standen vor meinem. Die Leute befüllten nicht nur ihre Autos, sondern auch mitgebrachte Kanister mit Treibstoff, dessen Preis, während ich wartete, in die Höhe schnellte. Sie kauften Wasser, Chips und was es sonst an Tankstellen gibt, schleppten pralle Plastiktüten in ihre Wagen, als sei der Notstand ausgebrochen, und tuckerten mit besorgten, verwirrten Gesichtern davon.
»Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine Unwetterwarnung herausgegeben. Das Sturmtief Noah erreicht in einigen Regionen Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometer. Besonders betroffen sind die Höhen der Mittelgebirge. Mit Gewittern und Starkregen ist zu rechnen. Es wird empfohlen …« Der Ratschlag verlor sich im Rauschen, als auch das Radio im Verkaufsraum der Tankstelle aufgab. Kurz darauf dudelten Schlager aus den Boxen, für Notfälle konservierte Musik. Möglich, dass die Verkäuferinnen den gereizten Ton der Kundschaft nicht ertrugen, der über den Regalen schwebte, die sich mehr und mehr leerten. Ich bezahlte meine Tankfüllung und floh zurück in die Stille meines Wagens. Nur der Regen prasselte aufs Dach.
Die Straße vor mir ist keine hundert Meter zu sehen, danach verschwindet sie im Regengrau.
Ein Blitz zerreißt für Sekundenbruchteile die kompakte Wolkenmasse, unmittelbar kracht der Donner. Der Tacho zeigt knapp fünfzig Stundenkilometer. Und da, da vorn, zuckt schon wieder Blaulicht. Neben einem Streifenwagen winkt jemand. Ich bremse und halte. Der Polizist schlurft heran, von seiner Uniform, seiner Mütze, seinem Gesicht fließt Wasser. Sein Schnäuzer tropft, als er sich zu mir herunterbeugt. Wasserratte, denke ich kurz und unangebracht. Der arme Mensch im kalten Regen tut seinen ungemütlichen Dienst, während ich in die Sonne darf.
»Sie müssen umkehren«, sagt er in mein Auto. »Hier geht’s nicht weiter.« Er deutet hinter die Absperrung, wo es nichts als Regen gibt.
Ich lächele ihn an. Lächeln ist immer gut. Das mache ich oft. Vielleicht sollte ich das nicht tun, zumindest nicht so oft und nicht jetzt. Dieser Regen ist eine zu ernste Sache.
»Etwas passiert?«
»Kommen Sie vom Mond oder was? Haben Sie kein Radio?«
Bevor ich auf das Rauschen hinweisen kann, sagt er: »Nun hau’n Sie schon ab, wenn Sie keine nassen Füße kriegen wollen, Lady. Wir steh’n hier nich aus Jux.«
»Mein Radio …«, werfe ich nun doch ein. »Gibt es keine freie Straße nach Westen? Ich will in den Urlaub, wissen Sie.«
Erst kräuselt er die Stirn, dann lacht er kratzig. »Verschwinden Sie, bevor Sie das Technische Hilfswerk behindern. Die LKWs von denen brauchen die Straßen. Schalten Sie Ihr verdammtes Radio ein!«
Er tritt einen Schritt zurück, winkt ungeduldig dem nächsten Wagen, hebt die Hand, als sei ihm noch etwas eingefallen. Ehe ich das Seitenfenster schließen kann, sagt er: »Ihr linker Scheinwerfer ist kaputt.«
»Das kann nicht sein. Der Wagen ist neu.« Fast neu jedenfalls. Was sind schon zehn Jahre? Er hätte zur Inspektion gemusst, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Die Leichen stapeln sich bei uns.
Er strafft sich. »Fahrzeugpapiere und Führerschein bitte.«
Ich reiche sie ihm und sehe sie nass werden.
»Metha?«
»Engelhart«, füge ich an. Das ist mir schon öfter passiert. Zu meiner Zeit gab es so viele Methas wie heute Lauras, inzwischen sind sie ausgestorben. Nachdem er sich ausreichend über meinen Vornamen gewundert hat, gibt er mir die Papiere zurück, brummt: »Denken Sie an den Schweinwerfer, Frau Doktor. Fahren Sie weg von der Werra«, und wischt sich das Wasser aus dem Gesicht. Ein dunkler Audi steht an meinem Heck. Ich wende etwas umständlich auf der engen Straße, dabei sehe ich es durch den Regen hindurch jenseits der Böschung: Der Fluss, die Werra offenbar, brodelt und kocht, reißt Holz und Müll mit sich, der Asphalt weiter vorn führt direkt in ihn hinein.
»Danke«, sage ich noch, er hört mich nicht mehr, ist längst bei dem Audi und stoppt mit ausgestrecktem Arm den übernächsten Wagen.
Also muss ich zurück. Was heißt zurück? Zurück nach Leipzig ins Institut? Zu meiner Arbeit? Oder in mein Haus voller Echos?
Ich muss nachdenken. Mit so viel Wasser habe ich nicht gerechnet und nicht damit, dass es meine Pläne durchkreuzt.
Die Heizung hüllt mich in warme Luft. Ruths CD habe ich wieder in den Player geschoben, der weiche Jazz-Sound wiegt mich durch das graugrüne Nass da draußen. Ich will nicht zurück, diesmal nicht. Ich werde mir eine kleine Pension suchen und den Regen abwarten. Hier in Thüringen gibt es sicher irgendwo ein freies Zimmer mit Frühstück, eines mit einem weichen Bett, karierter Bettwäsche und der Toilette auf dem Flur von mir aus. Ich brauche nicht viel. Ich will nur die Toten nicht mehr, die habe ich lange genug gehabt. Längst ist es Zeit für meinen eigenen Tod. Wie lange soll das denn gehen? Jedes Leben muss doch eine vernünftige Struktur haben dürfen. Anfang, Mittelteil, Schluss. Man kann nicht verlangen, dass es gut ausgeht, das gewiss nicht, meiner Erfahrung nach tut es das nie, aber einen Schluss muss es haben. Täglich begegne ich dem Schluss, oder vielmehr dem, was nach dem Schluss kommt. Und ausgerechnet mir soll er verwehrt sein? Ungerecht ist das. Außerdem habe ich Urlaub. In meinem Alter sind die meisten Menschen längst in Rente. Ich blicke in den Rückspiegel und in mein glattes Gesicht. Mir ist zum Heulen. Tot sind sie, die Menschen, die ich kannte, alle außer Ruth. Sie hat mich gewarnt vor der Reise. Metha, hat sie gesagt, fahr nicht.
Aus ihren wimpernlosen Augen blickten Klarheit und Weitsicht. Sonst dämmert sie in ihrem Zimmerchen im Nexö-Heim dahin, bringt alles durcheinander – die Menschen, die Ereignisse, die Zeit. Ich habe sie in dem Altenheim besucht, obwohl es mir das Herz bricht, sie so zu sehen. Ruth war die liebenswerteste Frau, die ich kannte. Lange hat sie mein Haus gesäubert, hat Reinheit und Heiterkeit darin verbreitet, gleichgültig wie sehr sich ihre Hand sträubte, die Lappen zu wringen, oder wie schwer ihr Schmerz wog. Über ihre Hand mit den von Narbenzügen gekrümmten Fingern zog sie den Ärmel ihres Pullovers, wenn ich sie darauf ansprach, drehte sie sich um und ging fort. Dann wurde sie alt. Ruth ist jetzt einundneunzig. Als sie achtzig war, fragte sie mich, wie ich das mache, dass mein Haar glänzend bleibt, meine Taille rank und ich fast keine Falte im Gesicht trage. Ruth versuchte nicht mehr, ihre kranke Hand vor mir zu verstecken, legte das Tuch ab, das ihre narbige Stirn verbarg, zumindest im Haus, manchmal sang sie sogar mit flüsternd rauchiger Stimme. Sie ist die Letzte, die ich noch habe, die Letzte aus meiner Zeit, so ungefähr jedenfalls. Ich konnte ihr nicht sagen, warum ich bin, wie ich bin, kann es selbst nicht verstehen. Stattdessen erzählte ich etwas von Genen und dieser glatten Zeit, vom Sauberen, Geschliffenen, Abgerundeten, Angemessenen. Von Laptops, Autos, Make-up, Möbeln, All-inclusive-sorglos-Paketen. Von den Dingen, die wir kaufen, um sie in den Müll zu werfen, wenn sie die ersten Risse zeigen, damit wir sie durch Blankpoliertes ersetzen können. Von den Implantaten, die sogar meine Leichen glätten, erzählte ich. Sie nahm ihren Wischmopp, brummelte etwas von Sprung in der Schüssel und verfügte sich ins Badezimmer. Längst schrubbte sie nicht mehr die Böden, konnte es nicht mit ihrem Rücken, mit der Hand, sondern trug nur den Wischer durchs Haus und verbreitete Frohsinn. Eines Tages konnte sie auch das nicht mehr.
Bring mich weg, Metha, hat Ruth in einem der seltener werdenden lichten Momente gesagt, und: Ich habe alles arrangiert.
Sie gab mir einen Ordner mit Papieren, und ich habe nach ihrem Willen gehandelt. Nun lebt sie im Nexö-Heim. Die Warnung vor meiner Reise habe ich ihrer Umnachtung zugeschrieben. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob sie nicht einer besonderen Hellsicht entsprang. Doch ich bin keine, die so leicht aufgibt, schon gar nicht wegen des Wetters.
Mein Auto, es ist ein Citroën C5, ich mag die sanfte Art, wie seine hydropneumatische Federung mit den Schlaglöchern umgeht, biegt rechts ab. Soll es. Es hat Urlaub. Einige Kilometer führt die Straße geradeaus, dann schlägt sie einen weiten Bogen, und mir kommt es so vor, als kenne ich den Wald, den Mais und die Weiden schon. Wenn die Wasserratte wieder auftaucht, bin ich im Kreis gefahren. Der Regen verhängt mit dicken Strippen die Sicht. Die Scheibenwischer geben ihr Bestes, doch sie schaffen es nicht, hinterlassen nur kurze wasserfreie Lücken. Inzwischen fahre ich kaum dreißig. Zuweilen glitzert ein Blitz zackige Linien an den Himmel, der Donner grummelt von ferne. Meine Aufmerksamkeit taktet meinen Puls, Schweiß klebt mir die Bluse an die Haut. Jeden Augenblick erwarte ich, dass ein liegengebliebenes Fahrzeug vor mir auftaucht oder eine Kuh, die nicht nach Haus gefunden hat. Eine Kuh würde mich ratlos machen. Ich bin kein Landmensch. Überhaupt habe ich mir Urlaub lustiger vorgestellt. Kurz blicke ich nach links, und da ist der Fluss, die Werra, wie Wasserratte gesagt hat. Links müsste Westen sein, doch die Straße führt mich wieder nach rechts.
Ich fahre, lausche dem Motor, der Musik, fahre, ich weiß nicht, wie weit, die Zeit dehnt sich, da entdecke ich eine Brücke. Schmal spannt sie sich über den Fluss, so weit ich sehen kann.
Geradeaus oder links?
Ich halte einen Augenblick am Brückenkopf, rolle dann langsam weiter, taste mich zwischen den Geländern entlang bis zur Mitte, unter mir tosen die Wasser. Die Werra ist höchstens einen Meter von meinen Reifen entfernt, noch. Noch wütet sie in ihrem Bett.
Fast am anderen Ufer angelangt, sehe ich die Werra im Rückspiegel, wie sie über den Asphalt schwappt und den Weg über den Fluss in Besitz nimmt. Nur ein Wimpernschlag, und die Straße ist weg, Regen schraffiert die Stelle über dem Fluss, an der sie sein müsste. Gerade war da die Brücke, über die ich gefahren bin, nun ist sie weg, einfach weg. Vielleicht irre ich mich.
Denn es regnet und regnet.
2
Es regnet.
Hinter ihnen wälzt sich der Fluss durchs Tal. Die Flut steigt.
Sie haben nichts, nur sich selbst und das Hoffen auf ein gutes Leben, das nun vom Hoffen auf ein Leben abgelöst wird.
PKWs, LKWs, Lieferwagen, dazwischen Polizei und Feuerwehr rollen vorbei, eine endlos dahinschleichende Kolonne. Die enge Straße, die sich sonst verlassen zwischen Wald und Feldern schlängelt, ächzt unter dem Verkehr.
Der Junge friert. Die Frau schmiegt sich an einen Baum und atmet die nasse Luft. Der Mann tastet nach der Pistole im Hosenbund, sie ist noch da.
Wieder warten. Seit sie fort sind, warten sie. Auf Papiere, auf einen Zug, auf Arbeit, damit sie das Geld für einen Zug haben, auf neue Papiere, andere Arbeit, andere Züge. Zuerst in Bulgarien, dann in Ungarn, in Polen, danach in Berlin. Grau war es dort und sie mussten weg. In Burgas hätten sie bleiben wollen, konnten nicht. Dort hatte die Sonne das Schwarze Meer beglänzt.
Den halben Sommer immerhin durften sie ausruhen in diesem Dorf im Werratal. Der Mann reparierte nachts Gartengeräte oder räumte den Keller im Haupthaus des Hofes auf. Die Frau kochte für alle, was Fausto, der sie beherbergte, ihr aus dem Garten brachte, prächtiges Gemüse – Möhren, Bohnen, Tomaten. Abends tranken sie Rum und rauchten, während der Junge neben dem Hund schlief. Der Junge ist still, freundlich und sechs Jahre alt. Er kennt es nicht anders. Die Flucht ist sein Kinderzimmer.
Sie kamen im März und nun müssen sie weiter wegen des Regens.
Geht, sagte Fausto. Geht! Oben am Berg ist ein Haus. Dort könnt ihr bleiben, bis alles vorbei ist.
Die Flut meinte er, die die Helfer nach Falkenheim spült.
Der Mann, die Frau und das Kind lauern auf eine Lücke im Verkehrsstrom. Sie wollten ein gutes Leben, wenigstens ein besseres als das in Skopje und das auf dem Weg in den Norden. Und nun warten sie wieder. Diesmal im Wald, bis sie aus der Deckung treten und die Straße überqueren können. Sie müssen den Berg hinauf, denn hinter ihnen droht der Fluss.
3
Es regnet. Das Wetter macht keine Zugeständnisse.
Albrecht ist nass bis auf die Knochen. Wenn er nur einen Schirm und nicht diesen verdammten Koffer bei sich hätte. Üblicherweise reist er mit leichtem Gepäck oder gar keinem. Er hat alles, was er braucht, dort, wo er es braucht. Hosen und Hemden in Weimar bei Theresa, Anzüge und Sportsachen bei Melanie in Hamburg. Wieso er die vielen Bücher eingepackt hat? Er versucht sich zu erinnern, während er die Landstraße entlangschlurft, es fällt ihm nicht ein. Immer häufiger klaffen Lücken in seinem Alltag, kleine schwarze Löcher, in denen der Schlüssel versteckt ist, die Brieftasche oder was Melanie über die Nachbarin gesagt hat, nichts Wichtiges. Vielleicht würde er sich Sorgen machen, wenn er nicht vergessen würde, an seine Besorgnis zu denken.
Seine Hose heftet sich kalt an die Beine. Die Gedanken nehmen ihren eigenen Weg. Das ist das Gute am Gehen, man kann ihnen nachhängen, sie dahinfließen lassen oder gar nicht denken, nur gehen. Dieser Marsch war allerdings nicht geplant. Albrecht ist nicht sicher, wann er den Abzweig verpasst hat. Ursprünglich wollte er von Weimar nach Hamburg fahren, wie er es die letzten Jahre ein, zwei Mal im Monat getan hat. Die Strecke ist ihm vertraut: von Weimar nach Erfurt mit der Regionalbahn, von Erfurt nach Hamburg mit dem ICE, lesen, während der Zug rollt. Gewöhnlich nutzt er die Wochenenden, um Theresa zu besuchen, nur hat er das in den letzten Monaten immer seltener getan. Theresa, sie ist seine Noch-Ehefrau, hat wieder getrunken, obwohl er ihr gesagt hat, er würde auf dem Absatz umkehren, wenn sie es täte. Die Drohung wirkte den Samstag und die Hälfte vom Sonntag lang. Dann kamen sie auf das Geld zu sprechen, das er ihr monatlich überweist, und am Sonntagabend war sie breit. Er kann ihr nicht mehr schicken, beim besten Willen nicht, nicht einmal seinem schlechten Gewissen zuliebe. Wie soll er sonst leben in Hamburg? Schon die Miete frisst die Hälfte seines Einkommens, zöge er nach Berlin, wäre es nicht besser. Die Menschen strömen in die Städte zurück, nachdem sie sich jahrzehntelang in den Außenbezirken und Speckgürteln der Metropolen eingerichtet hatten. Nun, da die Kinder aus dem Haus sind und sie zu alt werden fürs Landleben, suchen sie sich altersgerechte Wohnungen in den Innenstädten für ihr gutes Leben, zumindest die, die es sich leisten können. Die anderen ziehen nach abseits, wo die Mieten erschwinglich sind. Und dort leben sie dann, im Abseits.
Albrecht würde ja hinaus aufs Land ziehen – gute Luft, Stille und Weite –, aber er kann nicht. Der Arbeitsweg würde den schmalen Rest seiner Zeit fressen, Zeit, die er dann nicht den Papierbergen auf seinem Schreibtisch widmen kann. Außerdem bräuchte er einen Wagen, mit dem er in Staus herumstehen würde, und letztlich blieben ihm weder Geld noch Zeit. Egal wie Theresa ihn beschimpft, sich selbst beschimpft, mit Selbstmord droht, das Geld wird nicht mehr davon. Von irgendetwas muss er schließlich leben.
Er verließ sie, als er Melanie traf. Da trank Theresa schon und hatte aufgehört, Bücher zu schreiben. Nächtelang saß sie am Schreibtisch, ein leeres Blatt vor sich, neben sich die Flasche, die am Morgen ebenso leer war wie das Blatt. Sie weinte nicht mehr, seit sie den Wein entdeckt hatte. Albrecht hatte ihre Tränen gehasst, oder vielmehr sich ihrer geschämt und Theresa für seine Scham gehasst. Und für die Ohnmacht, in die ihr Weinen ihn versetzte.
Ein LKW fährt dicht und viel zu schnell an ihm vorbei, hupt und sprüht einen Tropfennebel über Albrecht. Er ist zu matt zum Fluchen. Fast fünf Stunden lang geht er, geht und geht. Wie konnte das nur passieren?
Er ist einfach weitergelaufen, mit dem Kopf in den tief hängenden Wolken, immer neuen Gedankenketten ist er nachgeeilt, einzelnen Worten, Satzfetzen, Erinnerungsfragmenten, die sich nicht zu einem Erinnern fügen wollten, wenn er stehen blieb, ausruhte, Atem holte.
Heute noch Hamburg zu erreichen, hat er am Ende der zweiten Stunde aufgegeben. Nur irgendwo ankommen, an einer Bushaltestelle, einem Bahnhof, einem Taxihaltestand zum Beispiel wäre schön, oder ein Hotel finden. Warm duschen, sich ausstrecken und schlafen. Natürlich müsste er im Verlag anrufen. Mit Verständnis wird er kaum rechnen können, sein Schreibtisch ist vollgepackt mit Manuskripten, die bearbeitet werden wollen, neue, alte, längst überfällige. Die wenigen freien Tage, die er für Theresa brauchte, haben die Berge von Arbeit auf Zugspitzenniveau anwachsen lassen, er wird die gestohlene Zeit büßen müssen. Über sein Training braucht er sich gar nicht erst den Kopf zu zerbrechen, das fällt definitiv aus, weshalb er sich den Halbmarathon im nächsten Frühjahr abschminken kann. Zwar ist er groß und schwer, etwas zu schwer, aber er hat sich vorgenommen, den Lauf noch einmal zu schaffen, außerdem gesünder zu leben, mit Sport, frischer Kost und ausreichend Schlaf. Albrecht hat die magische Zahl 60 überschritten, hinein ins Alter, da wird es Zeit, etwas für die Gesundheit zu tun. Wer weiß, wie lange das Leben noch reicht. Bisher hat es gelegentlich mit dem Laufen geklappt. Jetzt zum Beispiel geht er, wenn auch unfreiwillig, geleitet von nichts als den Gedanken, von denen sich einer an den anderen reiht, die sich verlieren im Vergessen, sobald sie gedacht sind, wieder heraufgespült werden, ohne zu Ende gedacht zu sein.
Der Schrittzähler, er trägt immer so ein winziges elektronisches Teil bei sich, zeigt 19 Kilometer. Die Fersen schmerzen. Hätte er geahnt, dass er zu Fuß unterwegs sein würde, hätte er Schuhwerk ausgewählt, das den Regen auch wieder herauslässt. Er wollte nicht zu Fuß gehen, er wollte mit dem Zug nach Hamburg. Nur hielt der in Mühlhausen/Thüringen, und es hieß, er würde nicht weiterfahren. Keine weitere Erklärung von der Bahnhofsstimme. Nach einer halben Stunde sickerte durch, dass Bäume aufs Gleisbett gestürzt seien, den Schaden zu beheben könne dauern. Nach und nach verließen die Reisenden das Großraumabteil, Albrecht mit ihnen. Rasch schickte er Melanie eine Nachricht, er hänge fest, es würde später werden. Sie schrieb zurück, er solle sich zum Teufel scheren samt der Tussi, die er gewiss im Schlepptau habe. Er seufzte das Unbehagen weg, das ihre Eifersucht ihm verursachte, und bereute, dass er nicht von vornherein den Fernbus statt des Zuges genommen hatte. Von Nordhausen oder Erfurt aus gab es Verbindungen nach Hamburg, sie waren ihm zu unbequem erschienen. Einen Baum auf den Gleisen hatte er natürlich nicht erwartet. Er hatte einfach keine Zeit, mit Widrigkeiten auf einer lächerlichen Bahnfahrt zu rechnen. Jedenfalls ist er raus aus dem Zug, aus dem Bahnhof, hinaus in den Regen auf der Suche nach dem Busbahnhof, von dem aus doch sicher ein Zubringerbus nach Nordhausen abfahren würde. Vor dem Bahnhof strudelten Wasserströme in die Gullys, die die Massen nicht aufzunehmen vermochten, sondern in einem See sammelten, der sich weit über das Pflaster erstreckte, keine Chance, dem auszuweichen, seitdem schlappt er in nassen Schuhen dahin. Den Busbahnhof hat er nicht gefunden, dabei hatte er im Zug einen Halbsatz aufgeschnappt, dass der unmöglich zu verfehlen sei. Er ist einfach weitergelaufen, menschenleere Straßen entlang, an Plätzen vorüber, immer weiter hinaus, bis die Häuser niedriger, die Fassaden aber nicht weniger trostlos wurden, den Kopf bei seinen Bücherbergen, bei Melanies Eifersucht und Theresas Wein. Immer weiter den Gedanken hinterher, gehen und gehen …
Theresa. Sie okkupiert ganze Regionen seines Hirns mit ihrer Feindseligkeit. Nach der ersten Flasche war sie eingeschlafen, Wein und Valium hatten den Streit ums Geld beigelegt. Als er sie verließ, dämmerte sie mit einem Lächeln im Gesicht auf der Couch vor sich hin, ihre alte Schönheit schimmerte durch die Patina, die die Trunksucht ihr hinterlassen hatte. Er hörte noch das Geräusch des Fernsehers, während er die Tür hinter sich zuzog und erleichtert aufatmete, voller Vorfreude auf Melanies Abendessen. Sie kochte göttlich! Es hatte ja keiner ahnen können, dass es mit dem Essen gar nichts würde.
Die Wolken hängen schwer und schwarz überm Land, lassen kaum Licht auf den Boden. Wie spät ist es eigentlich? Albrechts Armbanduhr hat ihre Tätigkeit eingestellt, und seinem Handy scheint die Nässe ebenso zugesetzt zu haben. Er ist gelaufen und gelaufen, und nun ist er irgendwo. Wald, Mais und Weiden. Kleine Örtchen hat er durchschritten und wäre jetzt froh, wenn er in einem von ihnen ein Nachtquartier erbeten hätte. Weiter unten im Tal rauscht ein Fluss. Die Straße führt bergan. Er lehnt sich einen Moment an ein Verkehrsschild, es schwankt ein wenig.
Wieso ist er hier? Und das noch mit diesem Koffer? Er muss sich besinnen, dann wird es ihm wieder einfallen, bestimmt. Der Griff drückt in seine Finger. Albrecht hofft, dass das Innere des Koffers trocken geblieben ist, die Bücher, die Kleider, die Schuhe. Während er so dasteht und rückwärts und vorwärts denkt, meint er, das Wasser rausche lauter vom Tal herauf. Er hebt den Kopf und späht ins Dämmerlicht. Nichts zu sehen. Der Regen, der Wind im Geäst des Waldes und das Rauschen vom Fluss sind zu hören. Blitze und Donner hat er hinter sich gelassen, weder Licht noch Lärm konnten ihn von seinen Gedanken lösen, Gedanken, die ihm jetzt banal, überflüssig und sinnlos vorkommen, die er nicht mehr nachvollziehen kann, als habe das Wasser ihren Sinn verwaschen. Er steht allein an diesem Verkehrsschild und fragt sich, wie lange er nicht mehr so abgeschieden von allem gewesen ist. Er kann sich nicht erinnern. Überhaupt kann er sich oft nicht erinnern, nur will er gerade jetzt nicht daran denken. Also holt er Luft und geht weiter, den schmerzenden Fersen zum Trotz, eine Straße hinauf, die gerade die Breite eines Lastwagens haben mag. Auf halber Höhe zum Gipfel entdeckt er hinter den Bäumen Mauerwerk. Verengt von jungem Gebüsch führt eine Einfahrt zum Haus. Ein Haus? Wärme und Ausruhen. Albrecht seufzt und spürt den Schmerz in seinen Fersen heftiger. Er biegt ein und tappt durch den Matsch. Die Einfahrt weitet sich zu einem Vorplatz, der Wald tritt zurück, Büsche und Gestrüpp wuchern wild. Die steilen Dachschrägen zeichnen sich gegen den dämmrigen Himmel ab – wie ein Miniaturschloss liegt das Haus umgeben von einer Mulde auf einer Anhöhe. Über die Senke, in der sich Wasser gesammelt hat, führt ein Steg zur Haustür, die eher ein Portal ist. Die Fenster sind dunkel, verlassen wirkt das Gebäude. Hoffentlich findet sich darin ein trockenes Plätzchen zum Ausruhen. Mit seinem Obergeschoss, dem Türmchen auf der rechten Seite und der massiven Tür wirkt es wie eine Art Herrenhaus, nur Stallungen und Scheunen fehlen, stellt Albrecht auf seinem Rundgang fest. Auf der Rückseite jenseits der Senke parkt ein Wagen am Ende eines asphaltierten Weges. Dahin führt ein weiterer Steg, besser gesagt eine richtige Brücke, unter ihr schäumt ein Bach.
Also doch nicht unbewohnt, obwohl der bröcklige Putz, die abweisende Fassade und das rostige Gerümpel, über das er beinahe gestolpert wäre und von dem er nicht weiß, was es einmal war, das nahelegen. Zurück an der Eingangstür findet er seinen Koffer, er muss ihn hier abgestellt haben, kann sich nicht erinnern. Schließlich sucht er nach der Klingel, das Schild darüber ist nicht zu entziffern, die Schrift darauf längst vom Regen verwaschen, drückt den Klingelknopf und hört nichts, nur das Rauschen des Flusses und das des Regens.
»Hallo«, ruft er, klopft gegen die Tür, ruft erneut: »Hallo.« Nichts rührt sich.
Nach einer ganzen Weile, während der er überlegt, was er jetzt machen soll, sagt jemand: »Wer ist da?« Die Stimme ist hinter der Tür.
»Jackwitz«, sagt Albrecht. »Albrecht Jackwitz. Hätten Sie vielleicht einen Busfahrplan zur Hand?«
»Nein«, sagt die Stimme, und Albrecht weiß nicht, wie er auf Busfahrplan kommt und was er weiter sagen soll. Dabei hat er sonst so viele Worte, ein Übermaß an Worten, eine ganze Flut davon. Keines, das er jetzt gebrauchen könnte, um die Stimme hinter der Tür um Einlass zu bitten. Sie ist weiblich.
»Es regnet«, sagt er.
»Ja«, sagt die Stimme.
»Bitte …« Er ist nicht sicher, wann er dieses Wort zuletzt benutzt hat. Normalerweise ist es tief in seinem Wortschatz vergraben. Er muss niemanden um nichts bitten, nie. Es wird am Regen liegen, dass es plötzlich aus der Versenkung auftaucht, und daran, dass seine Füße schmerzen, er hungrig und durstig ist, der Abend hereinbricht, hier draußen im Nirgendwo.
Die Tür öffnet sich einen Spalt, drinnen ist nichts zu erkennen. »Sie sind ja ganz nass«, sagt die Stimme, während die Tür vollständig aufgezogen wird. Albrecht sieht den Umriss einer schlanken hohen Gestalt.
»Danke«, sagt er, auch ein Wort aus den Katakomben seines Wortschatzes.
»Guten Abend, Herr Jackwitz. Treten Sie ein.« Die Frau macht ihm Platz, und er findet sich in einem Raum wieder, dessen Ausmaße er nicht genau ausmachen kann, einer Art Diele vielleicht. »Haben Sie eine Kerze dabei? Oder eine Taschenlampe? Der Strom funktioniert nicht. Einen Sicherungskasten konnte ich nicht finden.«
»Sie wohnen nicht hier?«
Die Frau, deren Gestalt Albrecht nur erahnt, lacht hell und leicht. »Nein.« Sie lacht erneut. Es ist, als ob ihr Lachen Lichtpartikelchen im Raum verstreue, er wird ein wenig heller davon. Ein Raum, in dem man Geweihe und Schwarzwildschädel über den Türen vermuten könnte, doch da sind keine, in der Mitte vier Sessel um ein Tischchen, an der Längsseite ein Kamin. Albrecht wagt sich einige Schritte weiter.
»Wer wohnt hier?«
»Ich weiß es nicht. Gar niemand, nehme ich an. Spüren Sie nicht die Jahre?«
Jetzt, wo sie es sagt, bemerkt er den muffigen Geruch eines unbelebten Hauses. Er sieht sich um, doch das Licht war flüchtig, die Dunkelheit ist kompakt.
»Und Sie? Was führt Sie her, Herr Jackwitz?«
»Dürfte ich mich einen Moment setzen? Ich bin schon eine Weile unterwegs.«
»Selbstverständlich. Verzeihen Sie. Gleich hier in den Sessel. Kommen Sie.« Damit verschwindet sie im Dunkel. »Kommen Sie schon.«
Albrecht folgt ihrer Stimme, den Schritten, die einen leichten Nachhall hinterlassen, stößt schmerzhaft an den Sessel, tastet sich an der Lehne entlang und lässt sich in die Polster fallen. Er streckt sich und seufzt vor Erleichterung. Neben ihm knarren die Federn des anderen Sessels, von draußen gleichmäßiges Rauschen.
»Was ist das für ein Haus?«, fragt er, nachdem er den Impuls, sofort einzuschlafen, niedergekämpft hat. »Und was machen Sie hier, wenn Sie hier nicht wohnen?«
»Ich habe es eben erst gefunden und mich ein wenig umgesehen, solange es noch hell genug war. Die Straße unten im Tal ist gesperrt. Ich musste umkehren. Kurz nachdem ich über eine Brücke gefahren bin, schwappte der Fluss darüber. Plötzlich war sie weg. Einfach weg, eine ganze Brücke. Können Sie sich das vorstellen? Es ist unglaublich schnell gegangen.« Ihre Stimme hat eine feine Rauigkeit bekommen. »Vielleicht ist die Birne kaputt, oder hier gibt es wirklich keinen Strom mehr. Ich hatte gehofft …« Sie hält inne und erklärt ihre Hoffnung nicht. »Was treibt Sie durch dieses scheußliche Wetter?«, fragt sie stattdessen.
»Haben Sie eine ungefähre Ahnung, wo wir hier sind?«
»Sie wissen es nicht?«
»Ich habe mich verlaufen, wenn man so will.« Allmählich kriecht die Kälte aus seinen nassen Schuhen an ihm hoch. Die Bewegung hatte ihn gewärmt, nun zittert er. Langsam gewöhnen sich seine Augen an die Lichtverhältnisse. Er nimmt die Brille ab, putzt sie, und er betrachtet die Frau neben sich. Sie muss jung sein. Gegen ein Fenster, das karges Restlicht hereinlässt, hebt sich ihre Silhouette ab, das Haar trägt sie hochgesteckt.
»Ich müsste eigentlich morgen früh, spätestens, in Hamburg sein. Mein Zug fuhr nicht, kein Bus, nichts. Es ist das reinste Chaos.«
»Ich hatte mir meinen Tag auch anders vorgestellt«, sagt sie.
Plötzlich donnert es. Kein Donner wie bei den Gewittern, die den ganzen Tag über sie hinweggezogen sind, eher ein Grollen, anhaltend, sich steigernd, zu einem Getöse anschwellend, ein Dröhnen, das den Boden unter ihren Füßen vibrieren lässt.
»Was …?«
Sie hebt die Hand, er schweigt, und sie lauschen dem Lärm, angespannt, dreißig Sekunden, eine Minute, bis nur der Regen rauscht.
4
Hinter den Fenstern strömt der Regen, im Bus ist es stickig.
»Was ist denn jetzt schon wieder?« Der dicke Typ neben Sydney schiebt sich aus dem Sitz und geht nach vorn. »Ich frag mal«, sagt er an Sydney gewandt. Er hat ihn die ganze Fahrt lang zugetextet, von irgendwelchen Konzerten gequasselt, die er angeblich besucht hat, von seinen coolen Kumpels, von Zeugs, das Sydney nicht interessierte. Wieso glauben die Typen immer, ihm alles Mögliche erzählen zu müssen? Sydney streckt die Beine aus und atmet auf. Eigentlich benötigt er nicht viel Platz, er ist klein, zu klein für sein Alter. Nur hat der Dicke ihn fast durch die Wand des Busses gedrückt, weitergebrabbelt und vor sich hin geschwitzt. Eine Weile beobachtet er, wie die Tropfen die Scheibe hinabrinnen, dahinter beginnt der Wald, der einen steilen Hang bewuchert. Vages Licht sickert in den Bus, kaum merklich geht der Tag in den Abend über. Vorn beim Fahrer wird es laut.
»Sie sehen doch, dass ich nicht weiterfahren kann.« Der Fahrer, ein Mann mit Glatze und massiver Statur, ist hinterm Lenkrad hervorgeklettert und weist mit dem Arm in Fahrtrichtung. Sydney reckt den Hals und sieht Wasser. Die Straße verschwindet einfach darin. Keine Straßensperre, keine Umleitung, nichts. Umleitungen hatten sie heute schon zwei. Eine wegen eines umgekippten Lasters und eine wegen Straßenbauarbeiten, die bekanntlich pünktlich zum Ferienbeginn aufgenommen werden. Ist ja nicht das erste Mal, dass der Bus nicht geradewegs nach Dortmund durchfahren kann. Ferien haben eine magische Anziehung auf Straßenbaumaßnahmen. Ein Mann und eine Frau mischen sich ein.
»Ich will mein Geld zurück! Sofort!«, sagt die Frau. Sie trägt eine zu knappe Jacke in Leopardenoptik.
»Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, wenn Sie zu Hause sind«, sagt der Busfahrer.
»Ich will aber nicht nach Hause. Ich will nach Dortmund.«
»Dann wenden Sie sich eben in Dortmund an Ihren Anbieter, falls Sie bis dahin kommen. Hier geht’s nämlich erst mal nicht weiter.«
»Stellen Sie sich nicht so an. Die Pfütze werden Sie doch wohl durchfahren können«, sagt der Mann. Sein graues Haar steht vom Kopf ab, als hielte die aufgeladene Atmosphäre es unter Spannung. »Oder soll ich das machen?« Er bewegt sich auf den Fahrersitz zu.
»Finger weg von meinem Bus.« Breitbeinig versperrt der Fahrer dem Mann seinen Hoheitsbereich. Ein Gerangel um den Sitz entsteht, während Sydneys Sitznachbar sich umdreht und den Gang wieder zurückwackelt.
»Geht nicht weiter«, sagt er. »Überschwemmung.«
Sydney liebt es, wenn ihm Leute sagen, was auf der Hand liegt. Das machen sie alle, außer Emily. Als ob er ein kleines Kind wäre. Wenn er Emily doch erreichen könnte. Er hat versucht, sie anzutexten, aber das Funkloch verfolgt sie schon mindestens eine halbe Stunde. Nun probiert er es wieder, ebenso vergebens. Er hätte ein paar Tage bei Emily bleiben sollen, Games spielen, Musik hören, chillen. Ihre Eltern hätten nichts dagegen gehabt. Sie sind zwar komisch, aber anders komisch als seine Alten. Wenn Eltern anfangen, seltsam zu werden, ist das Pubertät. Nur seine sind schon immer so. Ob sie ihn erwarten? Gestern rief seine Mutter an und fragte, wann er käme. Sie hat irgendwas von einer Veranstaltung heute Abend in ihr Phone geblubbert, Sydney hat nicht so genau hingehört. Es geht immer um Veranstaltungen, Reisen, Wichtiges. Nachdem sie aufgelegt hatte, wusste er erst nicht, was er machen sollte. Die meisten waren schon in die Ferien abgedüst, nur Sydney hat im Netz rumgedaddelt und konnte sich zu nichts entschließen. Dann hat er noch eine Weile mit Ali gechattet, der lebt in Marrakesch und lernt Deutsch. Er will auf Deutsch chatten, Sydney auf Arabisch, raus kommt ein Mix, über den sie sich jedes Mal schrottlachen. Macht Spaß mit Ali, obwohl er ihn nicht persönlich kennt, nur über Facebook, aber es ist super, das Arabisch zu benutzen, das er auf dem Internat in diesem Kacknest lernt, Waltershausen-Schnepfental heißt es. Wäre er nicht von seinen Alten in diesem Kacknest ins Internat gesperrt worden, stünde er jetzt nicht hier rum. Seit einer Viertelstunde passiert nichts. Angeblich hat der Fahrer bei seinem Busunternehmen einen Kleinbus bestellt beziehungsweise zwei, damit alle reinpassen, denn wenden kann er auf der engen Straße nicht. Sydney fragt sich, wie er das gemacht haben will. Vielleicht hat er ein anderes Netz. Vielleicht hat er das auch nur so gesagt, damit nicht alle ausflippen.
Der Bus hat ein Stück zurückgesetzt auf der Suche nach einer Wendemöglichkeit, die Abzweigung zum Beispiel, an der sie vorbeigekommen sind, doch auf einmal lag ein Baum im Weg. Zum Glück haben sie den Stamm nicht aufs Dach gekriegt, als er auf die Straße stürzte.
Das Wasser leckt über den Asphalt, steigt, kommt näher. Von wegen Pfütze! Es bildet eine Fläche, deren Grenzen an Wäldern und Weiden verschwimmen. Dabei ist die Werra normalerweise ein friedliches Gewässer.
Nach weiteren zehn Minuten sagt der Busfahrer durchs Mikro: »Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt alle ruhig und geordnet aussteigen und uns den Hang hinaufbegeben.« Dabei starrt er durch die Frontscheibe auf das Wasser. Im Bus hebt Geschrei an. Was für eine Frechheit, sie einfach auf die Straße setzen zu wollen bei einem Unwetter wie diesem. Man wird sich beschweren. So was nennt sich Busfahrer. Wahrscheinlich besoffen. Das kennt man ja aus der Zeitung. Man wird ihn anzeigen und so weiter und so weiter.
Der Graubefluste und die Leopardige krakeelen auf den Fahrer ein. Sie nerven, genauso wie der Dicke neben Sydney, der sagt, er sei doch nicht bekloppt, raus in den Regen zu gehen. Vorhin habe es sogar geblitzt, er sei ja nicht lebensmüde.
Vollhonk, denkt Sydney und sagt: »Lass mich mal durch.«
»Du willst doch nicht etwa da raus? Bist du irre? Keinen Millimeter bewege ich mich hier weg, bis die verdammten Busse da sind.«
»Es wäre aber vielleicht besser, wenn du deinen Hintern heben würdest.« Sydney zeigt auf die Straße, deren Asphaltdecke nur noch ein paar Meter zu sehen ist und danach im Fluss verschwindet. »Das dauert nicht mehr lange und wir saufen ab. Komm lieber mit.« Sydney möchte den Dicken nicht unbedingt bei sich haben, trotzdem muss er es der Dumpfbacke vorschlagen, der rafft ja offenbar gar nichts. Ein bisschen verunsichert ist der Dicke nun schon, fängt aber rasch seinen unsteten Blick ein.
»Die holen uns schon rechtzeitig ab. Mach dir bloß nicht dein Höschen nass, Kleene.«
»Wenn du mich nicht vorbeilässt, muss ich die Scheibe einschlagen.«
»Okay, okay. Mach, was du nicht lassen kannst. Ich hab’s ja nur gut gemeint.« Der Dicke quält sich aus dem Sitz, und Sydney drückt sich an ihm vorbei.
»Willst du nicht doch mit?«
»Guck dich um. Geht einer raus? Die wissen schon, was sie machen.«
»Beeil dich, Junge«, sagt die alte Frau auf dem Platz vor ihnen.
»Und Sie?«
Sie ist sehr blass und wendet den Blick nicht vom Wasser.
»Beeil dich«, wiederholt sie. »Ich kann nicht. Ich bin nicht mehr schnell genug.«
Sydney schluckt und nickt. Mühsam schlägt er sich zum Fahrer durch. Die Stimmen der Leute, es mögen zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig sein, verdichten die Luft. Bleiben oder gehen? Die meisten sind für bleiben. Endlich ist Sydney vorn angekommen. Die Stufen vom Einstieg sind feucht. Der Fahrer hatte die Tür geöffnet und sie, als niemand ausstieg, wieder geschlossen. Nun sitzt er hinterm Lenkrad und starrt dem Unvermeidlichen entgegen, während die Leopardige auf ihn einzetert und der Graubefluste neben ihr die Fäuste ballt.
»Darf ich?«, fragt Sydney und schiebt sich zur Tür. »Wären Sie so nett, zu öffnen?«, ruft er dem Fahrer zu.
»Hier wird gar nichts geöffnet«, schreit die Leopardenfrau. »Wir bleiben! Und zwar alle! Gerade die Kinder. Wo sind eigentlich deine Eltern? Da sieht man es wieder. Den Kindern wird Zucker in den Arsch geblasen, aber wenn die Eltern sich mal kümmern sollen …«
Sydney setzt sein freundlichstes Lächeln auf und legt den Kopf schief. »Wenn Sie nicht wünschen, dass ich Ihnen auf die Pumps pisse, wäre es besser, Sie lassen mich durch.«
Die Frau holt Luft für eine Entgegnung, doch bevor sich ihr Redeschwall über ihn ergießen kann, grinst der Fahrer, und die Tür klappt auf.
»Geh schon, Junge«, sagt er. »Am besten den Berg hoch. Ich seh zu, dass wir alle nachkommen.« Dabei blickt er die Frau an. Sydney hört ihn ins Mikro sprechen beim Aussteigen: »Nun reicht’s. Auch für Sie, Gnädigste. Jetzt mal Klappe halten. Wir begeben uns sofort, und zwar genau jetzt, aus dem Bus und gehen bergauf. Dort sind wir in Sicherheit. Die Busse werden uns von weiter oben abholen. Los geht’s. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Schirme dabei.«
Der Regen trifft Sydney kalt ins Gesicht, er zieht die Kapuze tiefer und stapft los. Es ist kein Problem, den umgestürzten Baum zu überwinden. Wenige Meter dahinter findet er einen befestigten Forstweg. Wasser schießt über den Asphalt talwärts. Es macht ihm nichts. Er trägt seine besten Sportschuhe, außen wasserdicht, innen klimatisiert. Das sind Treter, die nicht jeder hat. An Dingen lassen seine Eltern es ihm nicht fehlen.
Während er den Hang hochwandert, plötzlich Krachen. Mächtig dröhnt, bollert und donnert es. Das ist kein Gewitter. Das ist etwas ganz anderes. Sydney hat es schon einmal auf Youtube gesehen. Und gehört.
Das ist …
Er beginnt zu laufen, bergan, läuft und läuft. Der Rucksack drückt in seine Schultern. Das Getöse hält an. Er weiß, was das ist.
Und er hat Angst, dass … dass die Hölle losbricht. Er läuft, schneller, aufwärts, Hauptsache weg vom Chaos. Seine Jacke lässt keinen Regen durch, trotzdem ist Feuchtigkeit darunter, Schweiß kitzelt auf seinem Rücken. Sydney läuft, läuft. Sein Atem keucht ihm in den Ohren.
Dann plötzlich Stille. Das Getöse hat aufgehört. Aber er kann nicht stehen bleiben, jetzt nicht. Er läuft immer weiter bergauf, Schweiß rinnt. Minuten später öffnet sich der Wald – Sydney eilt über die Lichtung, dreht sich um – und gibt den Blick ins Tal frei. Regen von oben, tief unten Wasser. Nur Wasser, ein Meer. Der Bus mittendrin.
Leute haben sich aufs Dach des Busses geflüchtet, einige wenigstens. Er kann keine Einzelheiten erkennen, aber die Oma, die vor ihm gesessen und ihm einen Schokoriegel angeboten hat, ist gewiss nicht unter ihnen. Er kann nicht wegsehen, kann nicht weiter. Das Wasser. Die Schreie der Leute, die hier oben wie Gewimmer ankommen, verdünnt von Regenrauschen. Eine Minute, zwei, dann schwappt das Wasser über das Dach des Busses und reißt die Menschen mit sich fort. Kein Bus mehr, keine Straße.
Wasser, Wasser, wie ein Ozean.
Sydney setzt sich auf seinen Rucksack und stiert auf die Stelle, wo eben noch der Bus stand und nun Wasser ist. Hier oben ist er ganz alleine. Hier kann er weinen, so viel er will. Die Tränen werden liebevoll vom Regen aufgenommen, fortgespült, die Forststraße hinab zum Fluss, der kein Fluss mehr ist, sondern ein uferloses Monster.
Als er keine Tränen mehr hat, vorerst nicht, schleppt er sich weiter bergauf. Nach einer kurzen Strecke entdeckt er eine Schneise zwischen den Bäumen, ein Weg führt zu einem Gebäude, das finster mitten im Wald kauert. Unterstellen, Hilfe holen. Vielleicht haben die ein Telefon. Obwohl das Quatsch ist. Die Menschen da unten hat der Fluss.
Er platscht die Einfahrt entlang, zwar ist es dunkler geworden, doch mit dem Handy, das er im Ärmel vor der Nässe schützt, beleuchtet er den Weg, einen Steg, die Fassade, soweit das möglich ist. Ein komischer alter Kasten ist das. Hier wohnt keiner mehr, das sieht er sofort. Also kein Telefon. Aber trocken wird es sein, und irgendwo kann er sich bestimmt hinhocken, den Regen abwarten. Er drückt die Klinke, offen, und tritt ein.
»Wer ist da?«, fragt eine Stimme. Sie ist freundlich und weich.
»Entschuldigen Sie. Ich wusste nicht …« Sein Herz schlägt schnell, freudig und bang. Er hört Schritte auf sich zukommen, dann sieht er die Frau im Licht seines Displays.
»Mein Gott. Komm rein, Kind. Was suchst du denn da draußen? Bist du etwa allein? Nein, warte. Du kannst gleich erzählen. Ich bringe dir ein Handtuch. Du wirst dir den Tod holen.« Die Frau nimmt seine Hand, zieht ihn mit sich und drückt ihn in einen Sessel neben einem Mann, der Sydney auf den ersten Blick entgangen ist.
»Das ist Herr Jackwitz. Herr Jackwitz, das ist … Wie heißt du?«
»Sydney.«
»Das ist Sydney. Und weiter?«
»Sydney Nowarra.«
»Freut mich.« Sie drückt ihm die Hand. »Ich bin Metha Engelhart. Verzeihen Sie, Herr Jackwitz. Ich hatte mich Ihnen noch nicht vorgestellt. Moment. Ich habe hier irgendwo meinen Koffer und da ist ein Handtuch drin. Du hattest doch eben etwas zum Leuchten, gibst du es mir mal?«
»Kannst du telefonieren?«, fragt Jackwitz, als Sydney sein Phone rüberreicht.
»Nein.«
»Kannst du Feuer machen?«
»Nun lassen Sie ihn doch. Er soll sich abtrocknen. Wer weiß, wie lange er schon unterwegs ist«, sagt die Frau.
Sydney weint leise mit dem Handtuch im Schoß. »Sie sind tot. Alle.«
»Moment. Wer, Junge, ist tot?« Jackwitz beugt sich zu ihm herüber. Er ist alt. Die Alten verstehen nie richtig.
»Alle. Alle, die im Bus waren.« Mehr kann Sydney nicht sagen wegen der Tränen, die nun doch wieder da sind, nicht da sein dürften, weil Jungs ja nicht weinen, sagt Vater, und Mutter sieht das genauso. Wenn er ein Mädchen wäre … Er wäre gern ein Mädchen, was seine Eltern lächerlich finden, alle für völlig bekloppt halten, alle außer Emily. Ihr ist egal, was er ist. Einmal haben sie geknutscht, da war es ihr lieber, dass er ein Junge ist. Aber sie hätte auch mit ihm geknutscht, wenn er ein Mädchen wäre. Sie ist eben seine Freundin, eine gute, die beste, eine, mit der man Pferde stellen könnte, so man denn welche bräuchte.
Metha Engelhart kramt in ihrem Koffer weiter hinten im Raum und kommt mit einer kleinen Plastikflasche Wasser zurück. Wasser! Ungefährlich in einer Flasche. »Nimm das«, sagt sie und drückt ihm eine Kapsel in die Hand.
»Was ist das?« Jackwitz blinzelt. Sehen kann er offenbar auch nicht gut, obwohl er eine fette Brille aufhat.
»Ein Beruhigungsmittel.«
»Aber Sie können dem Jungen doch nicht …«
»Ich bin Ärztin. Ich habe das Wichtigste dabei. Für meine Reise. Schmerzmittel, etwas gegen Durchfall, ein Antibiotikum. Und ja, auch ein Beruhigungsmittel. So etwas braucht man manchmal, wie man sieht.« Sie setzt sich wieder.
»Wir könnten versuchen, den Kamin anzumachen«, sagt Jackwitz.
»Tun Sie das.« Metha Engelhart rührt sich nicht.
»Ich habe nichts, womit man es anzünden könnte. Sie vielleicht?«
»Holz liegt rechts neben dem Kamin.«
»Feuerzeug? Streichhölzer?«
»Schauen Sie selbst nach, Herr Jackwitz. Ich habe keine.«
»Ich würde ja. Aber …« Der Mann stockt. Sydney hört seinen Atem und das Zittern darin. »Ich würde ja. Ich kann das nur nicht besonders gut. Eigentlich gar nicht. Mein letzter Versuch ist über vierzig Jahre her. Das war ein Fiasko, weil …«
»Das können Sie uns später erzählen. Es ist wirklich kühl hier. Probieren Sie es. So schlimm wird es nicht werden.«
»Ich wollte nach Dortmund zu meinen Eltern über die Ferien. Ob sie mich da haben wollen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es besser, dass es nicht geklappt hat. Sie werden mich noch mehr hassen, wenn sie erfahren, was ich getan habe.«
»Aber was …?« Diese Frau Doktor legt Sydney eine Hand auf die Schulter. Sie fühlt sich warm an.
»Ich hätte sie dazu bringen müssen, aus dem verdammten Bus auszusteigen und mit mir den Berg hochzugehen, hierher.« Er macht eine Pause, die der Regen füllt. »Und nun sind sie tot. Auch die nette Oma. Und der Vollhonk. Man muss doch auch Vollhonks vor dem Tod bewahren, wenn man kann, oder nicht?«
Metha Engelhart und Albrecht Jackwitz schweigen. Jetzt fällt ihnen nichts mehr ein. Gemeinsam lauschen sie hinaus, dahin, wo das Wasser tötet.
5
Der Mann, die Frau und das Kind finden in einem Gebäude, halb Stall, halb Scheune, am Fuße des Berges Unterschlupf, an der Rückseite wuchert der Wald. Sie schütteln sich wie nasse Hunde, stellen ihre Habseligkeiten auf den Boden und sehen sich nach einem Sitzplatz zum Ausruhen um. Zwei Strohballen modern in einer Ecke, gegenüber rostet ein Pflug, zum Balken hinauf führt eine wacklige Leiter, einige Sprossen fehlen, Spinnweben verhängen die Fenster, aufs Dach prasselt der Regen.
Der Junge sieht es zuerst, doch er sagt nichts, ein stilles Kind, das schon viel gesehen hat, da redet man nicht groß über eine kleine Pfütze.
»Komm«, sagt die Frau, legt ihm die Hand auf den Rücken und sucht nach etwas, womit sie sich einrichten können. Es ist ihre Arbeit, das Einrichten. Das Säubern und Sorgen, das Kochen und Ordnen. Das hat sie immer getan. Und tut man nicht, was man zu tun gewohnt ist, wenn das Chaos losbricht? Aber hier ist nichts, womit sie die Ihren versorgen könnte. Da sind nur das Stroh, der Pflug und die Leiter. Und Wasser, das sich von der Tür her über den Boden ausbreitet. Sie haben den Lärm gehört, das Rumpeln von Steinen und Erdmassen, gehofft, sie seien in Sicherheit, als sie die Tür schlossen. Nun kommt das Wasser zu ihnen, erst langsam, rinnt über den Betonboden, schneller, es steigt, steigt, sprudelnd und drohend, bis …
Das erste Fenster splittert.
Der Mann brüllt: »Rauf mit euch! Los, geht da rauf!«
Junge und Frau sehen das zerborstene Fenster, durch das Wasser hereinschießt, sich im Raum verteilt, ihnen um die Füße spült, die neue Freiheit in Besitz nehmend. Die Frau reißt die Habseligkeiten hoch, schiebt den Jungen zur Leiter. Als eine Sprosse bricht, schreit sie, hebt den Fuß auf die nächste, die hält, und treibt den Jungen an. Der Mann folgt ihnen, der schwere Mann, Sprosse für Sprosse, Überwinden der Lücken. Und die leichtere Frau mit dem schweren Gepäck. Sie kämpft sich nach oben, hütet den Jungen. Man muss in die Dinge vertrauen, wenn man keine Wahl hat, sonst ist man tot.