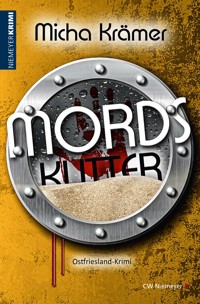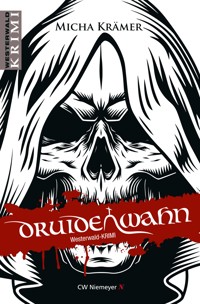
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Westerwald-Krimi
- Sprache: Deutsch
NINA MORETTIS 10. FALL Das Szenario auf dem Platz vor dem Druidenstein, wie die Bewohner der kleinen Siegstadt Kirchen den markanten Gipfel nennen, ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Alles erinnert an die Sagen, die sich um den ehemaligen Opferplatz der Kelten und Germanen ranken und an dem noch heute der Geist der Druidin Herke wandeln soll. Wer ist der geopferte junge Mann? Am folgenden Tag stirbt im örtlichen Klinikum ein Archäologe, der von sich behauptet, er habe einst den Dolch der Herke ausgegraben. In seinen Händen hält der Tote das blutverschmierte Schwert eines Germanenfürsten. Werden Hauptkommissarin Nina Moretti und ihr Team die selbsternannte Druidin rechtzeitig stoppen können, bevor sie erneut tötet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Micha Krämer wurde 1970 in Kausen, einem kleinen 700 Seelen Dorf im nördlichen Westerwald, geboren. Dort lebt er noch heute mit seiner Frau, zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen und seinem Hund. Der regionale Erfolg der beiden Jugendbücher, die er 2009 eigentlich nur für seine eigenen Kinder schrieb, war überwältigend und kam für ihn selbst total überraschend. Einmal Blut geleckt, musste nun ein richtiges Buch her. Im Juni 2010 erschien „KELTENRING“, sein erster Roman für Erwachsene, und zum Ende desselben Jahres folgte sein erster Kriminalroman „Tod im Lokschuppen“, der die Geschichte der jungen Kommissarin Nina Moretti erzählt. Was als eine einmalige Geschichte für das Betzdorfer Krimifestival begann, hat es weit über die Region hinaus zum Kultstatus gebracht. Inzwischen findet man die im Westerwald angesiedelten Kriminalromane in fast jeder Buchhandlung im deutschsprachigen Raum.Neben seiner Familie, dem Beruf und dem Schreiben gehört die Musik zu einer seiner großen Leidenschaften.
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8360-6
Micha KrämerDruidenwahn
Prolog
Als sie das Tor zwischen den Welten durchschritt, wusste sie sofort, dass sie endlich wieder zu Hause war. Alles war mit einem Mal so vertraut. Um sie herum war nur das dichte Grün des Waldes. Sie vernahm den Schrei eines Eichelhähers und das Krächzen seiner schwarzen Artgenossen. Wenn sie den warnenden Ruf der Krähenvögel richtig deutete, so handelte es sich um Totengesänge, die vom baldigen Ableben eines Menschen kündeten.
Tief sog sie die vom Rauch der Kohlenmeiler und Erzöfen geschwängerte Luft ein. Ja, sie war wieder da, wo sie hingehörte, und es fühlte sich an, als sei sie niemals fort gewesen. Natürlich wusste sie, dass sie nicht bleiben konnte. Nein, das war leider nicht möglich. Spätestens in einigen Stunden würde ihr Geist wieder zurück in die andere Welt drängen, die ihr zugegebenermaßen immer gleichgültiger wurde, je öfter sie in die Vergangenheit ihrer Seele zurückreiste. Sie trat aus dem Schatten der Bäume und schlug den Weg zum Dorf ein, das eingebettet zwischen dem Imhäuser Bach und dem Basaltkegel lag, den die Menschen in späteren Jahren den Druidenstein nennen würden.
Der Bach, der das Dorf mit Wasser versorgte, rann in diesem Frühsommer nur kläglich in seinem steinigen Bett in Richtung des Hellertales. Auch die Böden der Felder zeigten tiefe kantige Furchen. Das Getreide und die ansonsten immer sattgrünen Wiesen, auf denen das Vieh weidete, wuchsen nur spärlich. Wenn nicht bald der ersehnte Regen käme, würde der Stamm im nächsten Winter einen ungleichen Kampf gegen den Hunger und die Kälte führen müssen. Für den Wonnemond, wie man den Mai zu dieser Zeit noch nannte, war es eindeutig zu warm und zu trocken.
Belana trat durch eine Öffnung des mannshohen Schutzwalls aus Erde, Pfählen und Dornengestrüpp, der das Dorf umgab, und ging zielsicher auf das mittlere der sechs großen Langhäuser zu, in dem sie und ihre Sippe wohnten. Beißender Gestank, der gleichermaßen von den Ausscheidungen der Schweine und der Menschen stammte, stieg ihr in die Nase. Sie vernahm das Gejohle der Kinder, gepaart mit den hell klingenden Schlägen des Schmiedehammers auf dem Amboss. All dies erschien ihr jedoch nicht als störend oder gar ekelerregend. Nein, auch dies gehörte, genau wie sie, hier an diesen Ort.
„Da bist du ja“, begrüßte Farold, ihr Vater, sie. Wie so oft dieser Tage saß er auf dem zu einem Hocker umfunktionierten Baumstumpf, dessen gekürzte Wurzeln mit kunstvollen Schnitzereien versehen worden waren. In seiner Hand ruhte sein mit silbernen Blechen verziertes Trinkhorn, in dem sich vermutlich, wie so oft in den letzten Jahren, nicht nur Wasser, sondern zu süßem Met vergorener Honig befand.
Belana blieb stehen und betrachtete den Anführer der kleinen Chattensippe. Farold war wahrlich in die Jahre gekommen. Wie alt genau er war, wusste sie nicht. Sie schätzte ihn auf Ende vierzig. Ein stolzes Alter, das nicht viele Menschen in diesen harten Zeiten erreichten. Das Weiße um seine ansonsten strahlend blaue Iris war einem trüben Gelb gewichen. Sein Gang hatte sich in den letzten Monden verlangsamt, und sein Körper wirkte aufgedunsen und schwammig. Von dem großen Chattenfürst, dem stolzen Kämpfer und Bezwinger der Varus-Legionen, war nicht viel mehr übrig geblieben als ein Häufchen Elend. Das edle Schwert zu führen, das neben ihm an der mit Lehm verputzten Wand lehnte, vermochte er schon lange nicht mehr. Farold war alt, schwach und krank. Der böse Geist, der in ihm tobte, würde erst ruhen, wenn das Werk vollendet war und er den Stammesführer in dessen letztem Kampf bezwungen hatte. Lange dauerte es nicht mehr. Die Zeichen, dass Farold den nächsten Winter nicht überstehen würde, waren überdeutlich.
Belanas Blick wanderte zum Himmel. Nicht eine einzige Regenwolke war zu sehen. Lediglich der Rauch der Feuer, ob nun aus den Langhäusern, von den Kohlenmeilern oder von den Schmelzöfen an den Hängen des Tales, stieg in den Himmel und verlor sich in dem tiefen Blau. Sie erblickte eine Handvoll Krähen, die lauernd auf einem der Dächer hockten und das Treiben im Dorf aufmerksam beobachteten. Schlaue Tiere, die den Tod bereits rochen, bevor er die Menschen heimsuchte. Dass er noch in dieser Nacht kommen würde, war gewiss. Und dieses Mal war es noch nicht Farold, den er holen würde. Nein, der Vater war noch nicht an der Reihe, vor ihm würde noch jemand anders gehen müssen.
„Ist alles vorbereitet? Bist du so weit?“, fragte Farold lallend. Seine Zunge schien ihm schwer wie Blei.
„Keine Sorge, Vater, es wird alles getan sein, wenn der Mond über dem Fels im Hain steht“, versprach sie und ging dann ins Haus.
Nachdem sie das Feuer in der Mitte des großen Raumes angeschürt hatte und die Flammen gierig an den Scheiten emporzüngelten, gab sie die Körner für den Brei in eine irdene Schüssel und begann, diese mit einem Mörser zu zermahlen. Roggen aus dem Vorjahr. Eine kleine Handvoll davon würde reichen. Die Ernte war, wegen des feuchten Klimas im letzten Sommer, sehr ausgiebig gewesen. Belana, als Druidin des Stammes, hatte das reine Korn, aus dem sie das Brot buken, nicht interessiert. Nein, um das kümmerten sich die anderen. Ihre Aufgabe innerhalb der Sippe war eine bedeutendere. Sie hatte das herausgesammelt, was die anderen im Dorf verschmähten. Ähren, aus denen ein kleiner dunkler Pilzkeimling wucherte. Ein Korn, das zum einen krank machte oder in der richtigen Dosierung ebenso auch als Medizin zu gebrauchen war. Schlussendlich konnte es aber auch dem Geist dabei helfen, die sterbliche Hülle ohne allzu große Qual zu verlassen. Ob für einen Moment oder für immer, entschied die Menge. In nicht ganz zweitausend Jahren würden die Menschen die Wirkstoffe des Mutterkorns trennen können und den, auf den es ihr ankam, LSD nennen.
Während der Brei köchelte, rührte Belana ihn immer wieder um.
Von draußen hörte sie das Lachen und Schwatzen ihrer beiden jüngeren Schwestern Herke und Iseabail. Belana hielt inne und lauschte, doch die Stimmen entfernten sich wieder. Belanas Finger verkrampften sich um den hölzernen Löffel in ihren Händen. Auch Herke würde eines gewaltsamen Todes sterben müssen. Zumindest stand es in späteren Zeiten so geschrieben. Belana hatte es gesehen. Niemand außer ihr kannte die Welt, wie sie in zweitausend Jahren sein würde. Sie, Belana, war die wahre große Druidin des Dorfes und nicht Herke, nach der man später diesen Ort benennen würde.
Als der Brei fertig war, war das Hämmern des Schmiedes lange verklungen. Baltram, Belanas zweitältester Bruder, hatte ihr einige Talglichter entzündet und dann die Hütte wieder verlassen. Genau wie die anderen würde er sie nicht bei ihrer wichtigen Arbeit stören wollen.
Entschlossen füllte sie den Getreidebrei in eine tönerne Schüssel und süßte ihn noch ein wenig mit Honig. Den Topf in der Linken, eine Talglampe in der Rechten, verließ sie das Langhaus. Die Dunkelheit war über das Imhäusertal hereingebrochen. Durch die Wipfel der Bäume war bereits der volle Mond zu sehen. Nicht mehr lange, und er stand direkt über dem Kegelfelsen. Farold saß noch immer auf seinem Hocker. Seine Augen waren geschlossen, Speichel rann aus dem Winkel seines Mundes. Alle anderen schienen sich bereits um das Feuer in der Mitte des Dorfes eingefunden zu haben.
Im Schutze der Dunkelheit schritt sie auf das gegenüberliegende Langhaus zu. Bevor sie eintrat, hielt sie kurz inne und holte tief Luft. Genau so, wie sie es auch immer beim Bad in der Bachsenke tat, bevor sie mit dem Kopf im Wasser untertauchte. Der Gestank nach Exkrementen und Urin wuchs hier im Haus ins Unerträgliche und war kaum auszuhalten. Die drei Männer, die dort mit aufrechtem Oberkörper an in den Boden gerammten Eichenstämmen vegetierten, blickten sie mit großen Augen an. Beinahe zwei Wochen war es nun her, seit die Krieger der Sippe die drei Legionäre im Wald aufgegriffen hatten. Belana trat zu dem dunkelhaarigen Mann in der Mitte, ging in die Hocke und sah ihm in das schmutzige Gesicht. Weiche Züge umgaben die dunklen hübschen Augen des Jünglings, die sie nun flehend anblickten.
Sie stellte die Talglampe neben sich auf den Boden, hob ihre rechte Hand, strich ihm sanft über die Stirn und lächelte. Ob er wusste, was ihn erwartete? Schwer zu sagen. Sie würde es vermutlich niemals erfahren, da weder sie selbst noch einer aus der Sippe die Sprache der Fremden verstand und sprechen konnte.
Belana hob die Schüssel mit dem Brei, tauchte den Löffel hinein und hielt ihn dem Jüngling hin.
„Muss das wirklich sein?“, hörte sie die Stimme ihrer Schwester Herke hinter sich sagen.
Belana nickte. Ja, es musste sein. Wenn sie nicht alle im nächsten Winter verhungern wollten, gab es keinen anderen Weg, als den Göttern ein Geschenk zu geben. Gib du mir, so gebe ich dir. Die Götter gaben nichts, ohne dass man ihnen etwas gab. Das Leben eines Menschen war eines der größten Geschenke an sie.
„Geh“, wies sie die Schwester an, ohne auf ihre Frage einzugehen.
„Was geschieht mit den anderen beiden?“, wollte Herke wissen.
Belana drehte sich zu ihr um. Herkes Blick hing an dem Legionär links von ihr. Der Mann mit dem blonden Haar war kein Römer, das hatte Belana sofort gesehen. Vermutlich war er ein ehemaliger Sklave Roms. Vielleicht ein gebürtiger Germane. Vielleicht war er sogar einmal ein Chatte wie sie selbst gewesen. Ein germanisches Kind, aus den Händen seines Stammes geraubt und in Rom zu einem Legionär erzogen. Auf jeden Fall war er nun keiner der ihren mehr. Er verstand ja noch nicht einmal mehr ihre Sprache. Belana waren die Blicke Herkes für den Jüngling, seit die Krieger diesen ins Dorf brachten, nicht verborgen geblieben.
„Geh und rufe Baltram und Adalwin. Sag ihnen, ich bin gleich so weit“, wies sie Herke an und hob dann abermals den Löffel mit dem Brei zum Mund des Römers, der sich angewidert davon abwandte.
„Du hast Angst, ich würde dich vergiften“, sprach sie ihm ruhig zu und strich ihm erneut über das kurze, lockige Haar. Natürlich war ihr klar, dass er nicht ein einziges Wort verstand, das sie ihm sagte. Ein schöner Mann war er. Ein würdiges Opfer an Wodan.
Sie fasste sein Kinn, riss es mit einem Ruck zu sich herum und sah ihm in die Augen. Dann nahm sie den Löffel und aß selbst ein wenig davon. Nur so viel, dass es ihr nicht schaden würde.
„Siehst du, mein stolzer römischer Krieger, es wird dich nicht umbringen. Es wird dir helfen“, flüsterte sie beinahe lieblich.
Dann begann er gierig zu essen. Einen Löffel nach dem anderen. Als die Schüssel endlich leer war, verspürte sie bereits an sich, dass das wenige Mutterkorn, das sie selbst zu sich genommen hatte, zu wirken begann. Sie zog den zweischneidigen Dolch aus ihrem Gewand, schlüpfte hinter den Römer, strich ihm noch einmal über das lockige Haar und löste dann die Fesseln. Der Legionär würde nicht mehr weglaufen. Nein, dafür war es jetzt zu spät. Die Menge des Korns war zu groß gewesen. Sie hatte es schon in seinen Augen gesehen. Da, wo sein Geist nun war, würde er nichts mehr spüren. Sie konnte mit der Zeremonie beginnen. Anschließend musste Belana zurück in die andere Welt. Ein Jammer, dass sie nicht einfach hierbleiben konnte, wo sie eigentlich hingehörte. Sie musste zurück zu dem Körper, der ihren Geist in ferner Zukunft beherbergen würde und der gerade vollkommen entspannt in einem bequemen, mit Kunstleder bezogenen Sessel lag.
Kapitel 1
Samstag, 11. Mai 18:13 Uhr Schmitzgasse/Betzdorf-Alsberg
Klaus Schmitz konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal Anfang Mai den Pool hinter der Villa seiner Eltern hatten nutzen können. Es war ein herrlicher Tag, und das nicht nur, weil die Sonne von einem wolkenlosen Himmel auf die kleine Gesellschaft herunterschien. Nein, alles war so, wie es sein sollte und wie er es sich im Grunde schon immer gewünscht hatte. Wobei, hätte ihm vor zehn Jahren jemand erzählt, dass er das ehemalige Haus seines verhassten Vaters einmal „sein Zuhause“ nennen würde, hätte er diesen bestimmt ausgelacht. Nein, in der Achtzigerjahre-Villa wohnten noch heute neben ihm, seiner kleinen Familie und seiner Mutter auch eine Menge unschöne Erinnerungen, die aber täglich mehr und mehr verblassten. Lange hatten er und seine Frau Nina mit sich gehadert, hier auf den Betzdorfer Alsberg zu ziehen. Am Ende war es eine Entscheidung der Vernunft gewesen, die kleine Wohnung unter dem Dach in der Karl-Stangier-Straße aufzugeben und sie gegen das geräumige Domizil zu tauschen, das sein Vater einst erbaut hatte. Ein Vater, dem er, Klaus, es nie hatte recht machen können. Was sein alter Herr wohl sagen würde, wenn er das Treiben in seinem einstigen Garten jetzt sehen könnte? Klaus war sich sicher, dass es ihm gefallen hätte. Ein Familienmensch war der Alte ja schon irgendwie gewesen. Zumindest solange die Familie nach seiner Pfeife tanzte. Klaus war nie der Sohn gewesen, den sein Vater sich gewünscht hatte. Nina, Klaus’ Frau, hingegen hatte sein Vater damals schon gemocht, als sie noch die beste Freundin von Lara, Klaus’ älterer Schwester, war. Er sah zur Terrasse, wo seine Mutter mit Hans Peter Thiel und seiner Schwiegermutter Inge Moretti in der gemütlichen Rattan-Lounge-Ecke saß und sich angeregt unterhielt. Sein Blick wanderte weiter zu Nina und Alexandra Kübler, die mit dem achtjährigen Linus und der fünfjährigen Leah im dank einer Solaranlage 24 Grad warmen Wasser des Schwimmbeckens tobte. Nina hatte sich verändert. Seit der Geburt der Zwillinge heute vor zwei Jahren war sie ruhiger und besonnener geworden. Wobei, nein, der Prozess hatte schon während der Schwangerschaft eingesetzt. Ziemlich genau an dem Tag, als sie wegen einer Schussverletzung ihren Dienst bei der Kriminalpolizei beendet hatte. Der Gedanke, dass sie am kommenden Montag zum ersten Mal wieder zur Arbeit gehen würde, löste in ihm gemischte Gefühle aus. Zum einen freute er sich, weil die Tatsache, dass sie wieder arbeiten ging, im Umkehrschluss hieß, dass Klaus selbst ab Montag zu Hause bei den Kindern bleiben würde. Ein Umstand, der ihm nicht schwerfiel. Sein Job war ihm in den letzten Monaten nur noch wie ein notwendiges Übel vorgekommen. Was Nina anging, war da aber auch die Sorge um sie, die er immer hatte. Er hasste es, wenn sie morgens aufstand, zum Kleiderschrank ging, ihre Pistole aus dem kleinen Safe darin holte, sie einsteckte und mit einer Tasse Kaffee in der Hand in ihren marinablauen VW Käfer stieg, um sich dann den ganzen Tag mit irgendwelchen Gaunern, Psychopathen und Idioten herumzuschlagen. Der Umstand, dass sie bei ihrem letzten Einsatz schwer verletzt worden war, machte es ihm dabei nicht leichter. Andererseits hatte er ihr in den letzten Monaten angemerkt, dass ihr etwas fehlte, dass ihr zu Hause buchstäblich die Decke auf den Kopf fiel. Der Vorschlag, die Rollen zu tauschen, war von ihm gekommen. Wie geahnt hatte er bei ihr damit offene Türen eingerannt. Er bemerkte, wie Chiara, die gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Matteo auf der Decke neben ihm saß, ihn interessiert beobachtete und dabei an dem Ende ihres Malstiftes kaute. Die Zweijährige hatte, soweit man das beurteilen konnte, nichts von Nina. Weder äußerlich noch in ihrem Wesen ähnelte sie ihrer Mutter. Das blonde Haar, die helle Haut – ganz klar eine Schmitz. Ein liebes, sehr ruhiges nachdenkliches Kind, das sich stundenlang mit Malen oder sich selbst beschäftigen konnte. Außerdem hatte er das Gefühl, dass sie sehr musikalisch war, genau wie er selbst. Welche Instrumente sie später wohl einmal spielen würde?
Anders Matteo, in dem eindeutig ein kleiner Italiener steckte. Nina schien ihm nicht nur die dunklen Augen und die Lockenpracht vererbt zu haben, sondern auch das aufbrausende Temperament. Eine, wie Klaus nur zu genau wusste, hochexplosive Mischung. Dass der gerade so ruhig dalag und seiner Schwester zusah, lag vermutlich nur an der Tatsache, dass er in der letzten Nacht so gut wie gar nicht geschlafen hatte. Der Tag gestern war anstrengend gewesen. Nicht nur für die Kinder. Sie hatten die Tage zwischen dem Rollenwechsel, in denen sie beide frei hatten, genutzt, um noch einmal in Urlaub zu fahren. Nach Langeoog, an die Nordsee. Gestern waren sie nach einer katastrophalen Heimfahrt mit einem Stau nach dem anderen wieder nach Hause gekommen. Die A1 von Bremen kommend war ein einziger Krampf gewesen und hatte sie locker fünf Stunden gekostet. Matteo hatte die meiste Zeit verschlafen und war abends zu Hause dementsprechend munter gewesen.
„Puh, ist das warm“, jammerte Thomas Kübler und ließ sich neben Klaus in einen Liegestuhl sinken.
„Wenn es nur fünf Grad kälter wäre, wärst du am Maulen, weil es dir zu kalt ist“, antwortete Klaus und beobachtete, wie der Freund sein vibrierendes Mobiltelefon aus der Brusttasche seines langärmeligen Hemdes fischte und auf das Display sah.
„Ach Mist, was wollen die denn jetzt? Ich hab doch Wochenende“, stöhnte er und meldete sich dann mit: „Kriminaloberkommissar Kübler“.
Klaus beobachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen. Ja, so würde es bei ihnen demnächst auch wieder zugehen. Dann, wenn Ninas Diensttelefon nach nun beinahe zweieinhalb Jahren Funkstille wieder zu den unmöglichsten Zeiten klingelte. Verbrecher kannten weder Wochenende noch Feierabend. Da hatte er als Lehrer es schon besser getroffen. Außer nervigen Eltern rief bei ihm nach Feierabend nur selten jemand an.
„Wo ist das?“, fragte Kübler und nickte dann. „Okay, Helmut, ich komm vorbei.“
Nachdem er aufgelegt hatte, seufzte er theatralisch und blickte Klaus entschuldigend an.
„Sorry, aber ich muss noch mal los.“
„Was ist denn?“, rief Nina vom Rand des Pools. Ihre dunklen, nassen Haare glänzten in der Sonne, und ihre südländischen Augen versprühten den Glanz, der Klaus schon als Jugendlichen, nein sogar schon als Erstklässler in seinen Bann gezogen hatte. Bereits mit sieben hatte er für sich beschlossen, dass er dieses Mädchen irgendwann heiraten würde. Dummerweise hatte es die nächsten zwanzig Jahre dann aber nicht danach ausgesehen, dass aus diesem Vorhaben wirklich einmal etwas werden würde. Nach zahlreichen gescheiterten Beziehungen beiderseits hatte es, als er schon lange nicht mehr daran geglaubt hatte, dann vor acht Jahren doch noch zwischen ihnen gefunkt.
„In Kirchen-Herkersdorf hat es einen Einbruch gegeben. Wie es scheint, hat der Hausbesitzer die Täter überrascht und wurde niedergeschlagen“, berichtete Thomas, und Klaus bemerkte, wie das Funkeln in Ninas Augen sich zu einem freudigen Strahlen auswuchs.
„Tot?“, wollte sie wissen.
Klaus musste schlucken. Er hasste es, wenn sie und Thomas über das Leid und den Tod sprachen wie andere Menschen über das Wetter. Er würde sich nie daran gewöhnen können. Allein der freudige Ausdruck in ihrem Gesicht gerade, in Verbindung mit dem Leid eines Menschen, bereitete ihm schon Bauchschmerzen.
Kübler schüttelte den Kopf.
„Nee, noch nicht. Sieht aber wohl übel aus“, beschied er sie.
„Nimmst du mich mit?“, fragte sie als Nächstes, und Klaus musste gestehen, dass er mit dieser Frage fest gerechnet hatte.
„Ähm, wieso?“, wollte Kübler wissen, während Nina bereits aus dem Wasser stieg und sich ein Handtuch griff.
„Na, weshalb wohl … weil das ab Montag auch wieder mein Fall ist“, antwortete sie und schielte zu ihm herüber. Klaus musste, obwohl er es nicht gerade guthieß, dass Nina die Geburtstagsparty der Zwillinge verlassen wollte, grinsen. Aber da war sie nun wieder, die Kriminalhauptkommissarin Nina Moretti. Und irgendwie hatte er sie beinahe vermisst. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen.
Nina freute sich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Andererseits kam sie sich auch reichlich schäbig vor. Sie fuhren gerade zu einem älteren Herrn, der überfallen und fast totgeschlagen worden war, und sie fand es auch noch toll. So etwas war doch abartig und herzlos. Oder nicht? Sie hatte ihren Beruf immer gemocht. Bereits als Heranwachsende war ihr klar gewesen, dass sie irgendwann Polizistin werden würde. Nun gut, nach ihrem letzten Fall vor zweieinhalb Jahren war es ihr nicht so gut gegangen, und ihr waren erstmals Zweifel an ihrer Berufswahl gekommen. Die Zeit zu Hause mit den Kindern hatte ihr gutgetan. Doch seit einigen Monaten keimte da wieder diese Unruhe in ihr. Die Familie war das eine. Sie liebte ihre Kinder und deren Papa Klaus. Die drei waren das Beste, was ihr passieren konnte. Doch tief in ihr drinnen, da war auch noch die andere Nina Moretti. Dieses aufgekratzte, unruhige Energiebündel – die Kriminalhauptkommissarin.
„Echt, Nina … du hättest wirklich zu Hause bleiben können. Es reicht doch, wenn du am Montag …“, setzte Thomas an, doch Nina fuhr ihm über den Mund.
„Ach, es reicht dir also, wenn ich dir ab Montag wieder auf die Nerven gehe … das ist ja interessant“, bemerkte sie und tat beleidigt.
„Nein, Quatsch, so hab ich das doch nicht gemeint … und auch nicht gesagt“, versuchte er sich zu erklären.
„Ist schon gut, Thomas. Wir wollen hier übrigens nach rechts“, wechselte sie erst einmal das Thema und deutete auf die rechte Fahrspur, wo es in Richtung Alsdorf und Herdorf ging.
„Nee wieso, ich dachte, ich fahre jetzt Richtung Kirchen, durch den Tunnel und dann …“
„Durchs Imhäusertälchen ist es doch viel kürzer“, unterbrach sie ihn und deutete nach rechts. Thomas stöhnte genervt und betätigte den Blinker. Ninas Blick fiel, als sie über die Brücke fuhren, auf den kleinen Fluss Heller. Deutlich war durch das klare Wasser der steinige Boden zu erkennen. Es hatte seit Wochen nicht mehr ordentlich geregnet. Im Radio morgens hatte sie gehört, dass die ersten Bauern wegen der Trockenheit bereits über Einbußen bei der zu erwartenden Ernte klagten und laut über finanzielle Entschädigungen und Hilfen seitens der EU nachdachten … und das bereits im Mai. Als ob die in Brüssel was dafür könnten, dass es nicht regnete. Es war jedes Jahr die gleiche Leier. Entweder war das Frühjahr zu kalt oder zu warm, der Sommer zu feucht oder zu trocken, der Winter zu mild oder zu streng und und und. Nina wurde das Gefühl nicht los, dass man es keinem der Landwirte jemals recht machen könnte. Das optimale Wetter für alle gab es nicht.
Einige Hundert Meter hinter dem Feuerwehrhaus, in Höhe des ehemaligen Cafés Buchenscheit, bogen sie auf den Weg ab, der sich entlang des Imhäuserbachs hinauf nach Herkersdorf schlängelte.
„Wir könnten ja auch noch mal zum Minigolf gehen“, meinte Thomas, als links neben der Straße, hinter einigen Fischteichen, der Minigolfplatz in Sicht kam.
„Ja, wir könnten es aber auch bleiben lassen“, fand Nina, wendete den Blick ab und sah nach rechts, wo dichter Fichtenwald an den steilen Hängen wuchs.
Minigolf war noch nie ihr Ding gewesen. Vielleicht deshalb, weil es ihr einfach nicht lag. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie jemals ein Spiel gewonnen hätte. Im Gegenteil, wenn sie früher gelegentlich mit Freunden auf diesen oder einen anderen Platz gegangen war, hatte Nina immer das Schlusslicht der Rangliste gebildet. Und sie hasste es zu verlieren.
Das Haus von Professor Franz Waldner lag am Ende des Postweges. Thomas parkte den Dienst-Mercedes hinter einem Streifenwagen und einem neueren braun-weißen Opel Corsa in der Einfahrt des Siebzigerjahre-Flachdachhauses, das entfernt an eine wilde Anordnung von Legosteinen erinnerte. Nina betrachtete den Opel einen Moment. Das Ding hatte irgendwas von einem Latte macchiato. Unten herum kackbraun mit einem Häubchen aus Milchschaum obendrauf. Nur dass anstatt eines Kekses auf dessen Dach ein kleines Blaulicht mit Magnetfuß klebte.
„Wem gehört denn die Seifenkiste?“, fragte sie Thomas, der gerade aussteigen wollte.
„Ähm … meinst du den Corsa?“
„Ja, sonst ist ja keine andere Seifenkiste da“, antwortete sie.
„Der gehört Laura“, erklärte er.
„Ahh, Laura“, verstand Nina.
„Ja, Laura Benning, die neue Kollegin aus Mainz“, ging Thomas ins Detail.
„Ich weiß, mein Lieber. Hab schon von ihr gehört“, winkte sie ab und stieg aus.
Sie ging zum Haus, rannte die wenigen Stufen zur Haustür empor und wäre oben beinahe mit Polizeihauptmeister Jürgen Wacker zusammengestoßen.
„Hey, Nina, das ist ja mal ne Überraschung“, freute der sich ehrlich, und bevor Nina sich wehren konnte, hatte er sie gepackt, an sich gezogen und klopfte ihr auf die Schulter.
Nina musste zugeben, dass sie von der Begrüßung des Kollegen irgendwie berührt war.
„Hab gehört, du bist wieder dabei?“, fragte er und nickte dann wissend. „Du, das find ich gut, Nina. Ich hatte dich echt schon vermisst.“
Sie schob ihn von sich und betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen.
„Jetzt tu mal nicht so, als wäre ich gerade vom Nordpol gekommen“, fand sie und ging kopfschüttelnd an ihm vorbei in den Hausflur.
Sachen gab es. Es war noch keine acht Wochen her, dass der sie in der Betzdorfer Kolonie mit der Kelle rausgewunken hatte, um ihr ein Ticket über zwanzig Euro wegen zu schnellen Fahrens zu verpassen. War das jetzt etwa ein verspätetes schlechtes Gewissen?
Nina sah sich um. Die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts waren eine Epoche, die sie prinzipiell mochte. Sei es die Musik, die Autos oder sogar einige der damals modernen Klamotten, die heute teilweise schon wieder in Mode waren. Zum Beispiel besaß sie noch immer diese knöchelhohen Adidas-Turnschuhe, in schlichtem Weiß mit blauen Streifen. Natürlich keine echten, sondern eine Nachfertigung des Herstellers, die es vor einigen Jahren mal gegeben hatte.
Der größte Fehlgriff der Achtziger waren allerdings die Möbel gewesen. Sperrholz furniert in dunkler Eiche. Möbelstücke schwer, wuchtig, kantig und dunkel. Umgangssprachlich auch als Gelsenkirchener Barock bezeichnet.
„Wo ist das Opfer?“, erkundigte sie sich bei Jürgen, während sie die im Flur aufgehängten Fotos betrachtete.
„Der wurde gerade eben mit dem Rettungswagen nach Kirchen ins Krankenhaus gebracht. Aber passiert ist es da drüben im Arbeitszimmer“, antwortete der und wies auf eine Tür am Ende des Korridors, hinter der Nina Stimmen vernahm. Sie sah zurück zum Eingang, wo Thomas gerade das Schloss der Haustür betrachtete.
„Bisher haben wir keinerlei Einbruchsspuren gefunden“, bemerkte Wacker.
„Also war der Einbrecher besonders geschickt oder das Opfer hat ihn selbst hereingelassen“, schlussfolgerte Kübler.
Nina betastete die Taschen ihrer Jeansjacke, in der sich früher ansonsten immer ein Päckchen mit Einweghandschuhen befunden hatte. Das Einzige, was sie ertaste, waren jedoch die beiden in ein Tempo eingewickelten Ersatzschnuller der Zwillinge. Die Dinger könnte sie den beiden mittlerweile auch mal abgewöhnen, ging es ihr durch den Kopf. Auf alle Fälle würde sie aber den Inhalt der Taschen spätestens bis Montag noch ändern müssen.
„Guten Tag“, sagte sie freundlich, als sie das Arbeitszimmer betrat. Die schmächtige junge Frau Mitte zwanzig stand alleine in dem Raum und quatschte auf einen kleinen Tabletcomputer ein, den sie mit beiden Händen vor die Brust hielt. Ninas Augen taxierten sie, von den braunen Entenschuhen bis zu den Stoppelhaaren auf ihrem ziemlich klein wirkenden Kopf. Obwohl die Farben ihrer Klamotten sich in den Grundtönen von Beige und Braun bewegten, würde Nina sie eher als graue Maus bezeichnen. Wären sie hier beim heiteren Beruferaten, käme vermutlich niemand auf die Idee, in dem schmächtigen Küken eine Polizistin zu sehen, sondern vielleicht eher eine Nonne. Ja, eine Nonne würde bestimmt passen. Nina hatte nichts gegen Nonnen.
„Wer sind Sie?“, fragte das Küken nun, wie Nina fand ziemlich unfreundlich, und ließ das Tablet sinken.
„Hauptkommissarin Nina Moretti“, antwortete Nina brav und reichte der neuen Kollegin die Hand. Diese ignorierte die Geste jedoch und nickte nur.
„Darf ich erfahren, wer Sie sind?“, erkundigte Nina sich nach einigen Sekunden lähmender Stille und obwohl sie ganz genau wusste, wer die Kleine war.
„Das ist die neue Kollegin Laura Benning“, mischte Kübler sich ein und trat an ihr vorbei.
Das Gesicht der jungen Polizistin hellte sich auf.
„Hallo, Tom, da bist du ja“, begrüßte sie ihn und konnte jetzt sogar lächeln. Nina sog unhörbar die Luft ein. Mit der Kleinen würde sie vermutlich noch eine Menge Spaß und auch Ärger haben. Wobei die Bezeichnung Spaß hier eher als rein sarkastisch zu deuten war.
„Was machen Sie hier?“, wollte Laura nun wissen.
„Ich?“, fragte Nina erstaunt.
„Ja, Sie.“
„Ähm … ich arbeite hier“, antwortete Nina.
„Ich dachte, Sie seien in Elternzeit“, klang es recht schnippisch zurück.
Hatte dieses kleine Miststück eigentlich eine Ahnung, mit wem sie gerade sprach?
„Nein, seit heute nicht mehr“, antwortete sie kühl und war kurz davor zu explodieren. Dann drehte sie sich um und verließ den Raum. Sie würde sich zuerst einmal die anderen Räume des Hauses ansehen. Die Gefahr, dass sie der grauen Maus hier und jetzt den dürren Hals umdrehte, war einfach zu groß.
„Thomas, hast du noch Handschuhe im Auto?“, erkundigte sie sich deshalb.
„Ähm … ja klar, in der roten Plastikbox im Kofferraum müssten noch welche sein“, beschied er sie. Nina verließ das Haus und ging zum Auto. Das fing ja wirklich schon gut an. Normalerweise war es üblich, dass sich die Kollegen der Kripo untereinander duzten. Bei dem kleinen Fräulein Benning würde dies nicht so sein. Nein, der würde Nina bestimmt nicht das Du anbieten. Und überhaupt, eine innere Stimme sagte ihr klar und deutlich, dass es besser war, die Kleine auf Distanz zu halten. Die war eine, die einem Kollegen ohne zu zögern ein Messer in den Rücken rammen würde, wenn sie selbst dadurch einen Vorteil hätte.
Als Nina zurück ins Haus kam, war das Arbeitszimmer verlassen. Dafür hörte sie im Vorbeigehen Stimmen aus dem Keller, dessen Tür mit der Treppe dahinter nur angelehnt war. Sie widerstand der Versuchung zu lauschen, was Thomas, Wacker und die Neue da unten zu bequatschen hatten. Stattdessen ging sie zu dem großen Schreibtisch, setzte sich dahinter in den wirklich sehr bequemen Bürostuhl aus dickem braunen Leder und sah sich um.
Was dieser Herr Professor wohl für ein Professor gewesen war … wobei „gewesen“ jetzt ja nicht wirklich richtig war. Noch lebte der Mann ja.
Ninas Blick glitt über die auf dem Boden verstreuten Akten und Bücher zu den Bücherregalen, die außer da, wo sich das Fenster und die Türe befanden, die komplette Wandfläche einnahmen. Das mussten einige Tausend Bände sein. Teils alt bis sehr alt. Aber auch neuere Exemplare befanden sich darunter. Nina bezweifelte jedoch, dass jemand die alle in einem einzigen Leben lesen konnte. Nein, das war beim besten Willen nicht möglich. Außer derjenige würde gänzlich auf Schlaf und sonstige Annehmlichkeiten verzichten. Es stellte sich nun die Frage, warum irgendwer Dutzende dieser Bücher aus den Regalen gerissen und zu Boden geworfen hatte. Naheliegend war, dass derjenige etwas gesucht hatte. Natürlich könnte es auch sein, dass der Professor das Chaos hier selbst angerichtet hatte. Nina zog die Schubladen des Schreibtisches auf und begann in deren Inhalt zu wühlen. Sie musste gestehen, dass diese Tätigkeit sie schon immer fasziniert hatte. Es machte schon einen Heidenspaß, ungestört in dem Zeug anderer Leute zu kramen. Umgekehrt war dies natürlich nicht so schön. Als die Kollegen vor zweieinhalb Jahren einmal bei ihr zu Hause sogar die Mülltonnen auf links gedreht hatten, war ihr dies doch sehr unangenehm gewesen. Aber was sollte es. Dieser Herr Professor bekam ja derzeit überhaupt nicht mit, dass sie in seinem Leben herumstöberte. Bevor sie etwas in den Schubladen veränderte, machte sie Fotos von den Gegenständen. Es hatte sich bewährt, nachher noch zu wissen, was wie wo gelegen hatte. Nach noch nicht einmal einer Minute stand bereits fest, dass Professor Franz Waldner irgendetwas mit Archäologie, Geschichte und Kunst zu tun hatte. Sämtliche Unterlagen, Fotos und Fundstücke hatten irgendetwas mit Forschung und Ausgrabungen zu tun. Wie es schien, war die Zeit um Christi Geburt, plus/minus ein paar Hundert Jahre, sein Hauptgebiet gewesen. Es ging um Römer, Germanen, Kelten und Stämme, von denen Nina noch nie zuvor gehört hatte. Alemannen und Langobarden, Cherusker … von denen hatte sie schon einmal gehört, konnte aber beim besten Willen nicht sagen, wo die einst zu Hause gewesen waren. Was Chatten waren, wusste sie überhaupt nicht. Das Wort war ihr nur in Verbindung mit der Kommunikation im Internet bekannt, hatte aber vermutlich hier eine ganz andere Bedeutung. Auf alle Fälle handelten die meisten der Manuskripte und Papiere von diesen Chatten.
Nina hörte Schritte und Stimmen. Eine Tür fiel ins Schloss. Dann kam Kübler in den Raum.
„Du, Nina, ich denke, wir sind hier fürs Erste fertig“, fand er.
„Wer sagt das?“, erkundigte sie sich.
„Ähm … ja, ich … und Laura“, antwortete er.
„Aha“, meinte sie bloß und deutete dann auf eine Art Manuskript vor ihr auf dem Tisch, in dem es um die Ausgrabung einer Chattensiedlung ging.
„Sag mal, weißt du, was Chatten sind?“, wollte sie wissen.
„Chatten?“, er sprach das ch sehr scharf, beinahe wie ein K aus. „Das ist ein Volk, das hier in der Gegend früher mal gelebt hat. So eine Art Germanenstamm. Also, ich meine … die Germanen als solche … das ist ja eher nur so ein Überbegriff.“
„Du meinst, so wie die Hessen, die Schwaben oder die Bayern?“, versuchte sie es.
„Ähm … ja. Ganz vereinfacht ausgedrückt könnte man das so sagen. Es heißt sogar, dass aus den Chatten die heutigen Hessen geworden sind“, stimmte er ihr zu.
„Alle Achtung, Kübler. Woher weißt du so was?“, war Nina nun doch über den Wissensstand des Kollegen überrascht.
„So etwas weiß man, wenn man in der Schule aufgepasst und nicht nur wie du aus dem Fenster geguckt hat“, konterte er.
„Ach so. Meinst du das?“
Thomas antwortete nicht, sondern verdrehte nur wieder die Augen.
„Sag mal, warum bist du denn so gehetzt? Hast du noch was vor?“, erkundigte sie sich, da es ihr wirklich gerade so vorkam.
„Wir wollten gemeinsam grillen. Deine Zwillinge haben Geburtstag. Außerdem haben Laura und Jürgen hier eh schon alles aufgenommen“, knirschte er und sah auf seine Armbanduhr.
Nina seufzte. Warum war dieser Typ eigentlich immer so nervös? Und warum mochte sie ihn trotzdem?
„Okay. Wir versiegeln die Bude und schauen uns das am Montag noch einmal in Ruhe an“, beschloss sie. Sie kannte Kübler. Wenn der einmal anfing zu quengeln, hielt er sowieso keine Ruhe mehr.
„Und, was hältst du von Laura?“, wollte er wissen, als sie vorbei am Minigolfplatz zurück durch das Imhäusertälchen fuhren.
„Du meinst Frau Benning?“, erkundigte sie sich, nicht weil sie nicht wusste, wen Kübler meinte. Nein, sie wollte nur klarstellen, dass es für sie keine Laura, sondern nur eine Frau Benning gab. Genauso, wie es im Umkehrschluss für Frau Benning nur eine ihr vorgesetzte Frau Kriminalhauptkommissarin Moretti gab.
„Die ist doch nett. Oder?“, fand Kübler.
„Ja … Pest und Cholera sind aber auch nicht zu verachten. Oder?“, antwortete sie und sah hinaus in den dichten Wald.
„Du magst sie also nicht“, kombinierte Kübler.
„Wen meinst du jetzt – die Pest oder die Cholera?“, entgegnete Nina und schaltete dann das Radio an.
Kapitel 2
Montag, 13. Mai 2019 7:22 Uhr Schmitzgasse/Betzdorf-Alsberg
Es regnete nicht, als Nina an diesem Morgen zum ersten Mal nach zweieinhalb Jahren wieder zur Arbeit fuhr. Nein, es goss wie aus Kübeln. Geduckt, als ob das etwas nutzte und sie so unter dem Regen förmlich drunter hindurchschlüpfen könnte, rannte sie zu der großen frei stehenden Garage schräg gegenüber der Haustüre. In dem geräumigen Fahrzeugdomizil parkten neben Maggiolino, Ninas Käfer, auch Sunny, der orangefarbene Familienbulli, und das Mercedes-Cabriolet ihrer Schwiegermutter, das diese nur benutzte, wenn sie denn mal in Deutschland weilte. Kurz nachdem Nina und Klaus vor etwa zwei Jahren beschlossen hatten, in die geräumige Villa der Familie Schmitz zu ziehen, war ihre Schwiegermutter ziemlich plötzlich und zügig ausgezogen. Wobei ausgezogen nicht wirklich richtig war, da sie offiziell noch immer hier bei ihnen gemeldet war. Den größten Teil des Jahres verbrachte sie nun allerdings in einer, für ihre Maßstäbe kleinen, Eigentumswohnung auf Mallorca mit Blick auf das Meer. Ein Umstand, der das Zusammenleben mit ihr doch sehr erleichterte. Wobei Nina nichts gegen ihre Schwiegermutter hatte. Im Gegenteil, sie mochte sie sogar. Dennoch war es irgendwie merkwürdig, wenn sie dann alle paar Monate mal zu Besuch kam. Klaus hatte sie vorletzte Woche Donnerstag, einen Tag bevor er und Nina in den Urlaub fuhren, am Airport in Köln/Bonn abgeholt. Bereits an diesem Donnerstag, nach nur zwei Wochen Heimaturlaub, würde er sie wieder dorthin bringen, da dann ihr Flieger zurück nach Malle ging.
Nina hegte den Verdacht, dass die rüstige Rentnerin nicht nur wegen des schönen Wetters so schnell wieder nach Spanien wollte. Nein, sie vermutete eher, dass da wohl ein Mann dahintersteckte. Warum auch nicht, Isabell war gerade einmal Ende fünfzig und seit acht Jahren Witwe. Nina rechnete es ihr hoch an, dass sie extra um das Haus zu hüten und wegen der Geburtstagsfeier ihrer beiden Enkel auf Besuch nach Deutschland gekommen war.
Sie öffnete die Tür des betagten marinablauen Volkswagens, warf ihre Handtasche auf den Sitz und startete den Motor. Die Villa Schmitz lag etwas außerhalb von Betzdorf, am Rande des in den frühen Achtzigern neu erschlossenen Wohngebietes Alsberg. Bis zum Zentrum der kleinen Siegstadt am Rande des Westerwalds waren es keine drei Kilometer. Dennoch betrug der Höhenunterschied auf der kurzen Distanz schon einige Hundert Meter. Wenn es im Winter in der Betzdorfer Innenstadt wie so oft lediglich regnete, konnte es sein, dass Nina und Klaus bereits die Schneeschaufel auspacken mussten, um die Einfahrt vom Schnee zu befreien. Die Fahrt die Steinerother Straße hinunter war um diese Uhrzeit nervig. Bereits in der lang gezogenen S-Kurve hundert Meter vor dem Betzdorfer Ortsschild stand sie im Stau. Ein Blick auf die Uhr beruhigte Nina. Sie hatte noch Zeit. Arbeitsbeginn war erst um acht. Das würde sie locker schaffen. Ein eher ungewöhnlicher Umstand. Früher war sie öfter … oder eigentlich immer … erst auf den letzten Drücker zur Arbeit gefahren. Heute Morgen hatte sie hingegen sogar noch Zeit gehabt, in aller Ruhe einen Kaffee zu trinken. Überhaupt hatte sich viel verändert, seit die Zwillinge da waren. Okay, die beiden waren schon mal tierisch stressig. In den ersten Monaten wäre sie beinahe an der Aufgabe verzweifelt. Besonders nachts, wenn die beiden sich beim Schreien abgewechselt hatten. Kaum war die eine ruhig, fing der andere an. Zum Glück hatten ihre Mama Inge und deren Lebensgefährte Hans Peter Thiel sie nach Kräften unterstützt. Ja, aus dem einst so garstigen Bullen Hans Peter war so ein richtiger netter Opi geworden. Zumindest zu Hause hinter verschlossenen Türen. Die Menschen draußen, außerhalb der Familie, hielten ihn vermutlich immer noch für ein Arschloch.
Um ziemlich genau zehn vor acht rollte Nina auf den Parkplatz hinter dem Polizeigebäude in der Friedrichstraße. Sie stellte den Käfer ab, stieg aus und betrachtete die anderen parkenden Wagen. Die meisten davon kannte sie. Unter anderem standen da der feuerrote Dienst-Mercedes von Kübler, der BMW von Staatsanwalt Lambrecht und auch der kackbraune Opel mit dem Sahnehäubchen der neuen Kollegin. Nina musste, jetzt wo sie die Seifenkiste sah, wieder an die erste Begegnung mit der Neuen denken. So verhielt sich doch kein normaler Mensch. Bei der musste doch irgendetwas schiefgelaufen sein in der Kindheit. Am Sonntag war Klaus mit den Kindern und seiner Mutter nach Köln in den Zoo gefahren. Nina hatte die Zeit genutzt und in dem neuen Fall recherchiert. Natürlich nicht direkt. Nein, vielmehr hatte es sie interessiert, was dieser Professor gearbeitet hatte. Das Thema mit diesen Germanen war interessanter, als sie anfangs gedacht hatte. Abends, als die Kinder schliefen, hatte sie sogar noch gemeinsam mit Klaus eine Doku-Reihe über den Widerstand der Germanen gegen Rom und im Speziellen über die Varusschlacht angesehen. Hochinteressant das alles.
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, rannte sie die Treppe hinauf in den zweiten Stock der ehemaligen Bergbauverwaltung und ging wie selbstverständlich und in Gedanken versunken zu ihrem Büro. Es war ihr, als wäre sie erst gestern das letzte Mal hier gewesen.
Dass sich dennoch etwas grundlegend geändert hatte, bemerkte sie erst, als sie die Tür öffnete und den Raum betrat.
Irritiert betrachtete sie die beiden Schreibtische, die sich, vor dem Fenster zum Hof, gegenüberstanden.
„Hey, guten Morgen, Nina“, begrüßte Kübler sie überschwänglich freundlich, während die graue Maus Laura Benning nur kurz aufsah und sich dann wieder ihrem Computer widmete. Ninas Blick flog durch den Raum. Der Schrank, Thiels alter Kühlschrank, selbst die Karte an der Wand, waren so, wie es sein sollte. Sie hatte sich nicht in der Türe geirrt. Lediglich die beiden Gestalten und einer der Schreibtische waren hier zu viel. Auch die Kaffeemaschine, eines dieser neumodischen Dinger mit Mahlwerk, gehörte nicht auf den Kühlschrank. Da müsste nämlich die gute alte Filterkaffeemaschine darauf stehen, die sie ebenfalls von Hans Peter geerbt hatte, als der in den Ruhestand ging.
„Hast du mal einen Moment?“, fragte sie an Kübler gewandt und gab ihm einen Wink, ihr nach draußen zu folgen.
„Ja, was gibt es denn?“, fragte der jetzt auch noch blöde, als sie auf dem Flur standen.
„Was soll das?“, erkundigte sie sich.
„Was soll was?“
„Warum sitzt ihr beiden da in meinem Büro, und wo ist meine Kaffeemaschine?“, zischte sie.
„Ähm … wie, dein Büro? Das ist seit fast zwei Jahren das Büro von Laura und mir. Wobei Laura ja erst seit Januar … die ist ja noch quasi neu hier“, stammelte er.
„Ach? Und wo sitze ich?“
„Na, was weiß ich?“, wurde er jetzt sogar pampig.
„Ach, guten Morgen, Nina, da sind Sie ja“, donnerte die Stimme von Kriminalrat Dirken über den Korridor. Der ältere Polizist kam strahlend mit seiner braunen antik wirkenden Ledertasche, die er vermutlich schon in der Grundschule als Ranzen benutzt hatte, über den Flur auf sie zu gehinkt. Dass ihr Chef sein Bein nachzog, war Nina neu. Als sie ihn zuletzt vor einigen Wochen besucht hatte, schien dies auch nicht der Fall gewesen zu sein. Wobei, wenn sie es recht überlegte, hatte er damals auch die ganze Zeit hinter seinem Schreibtisch gesessen und war nicht ein einziges Mal aufgestanden. Dirken schien Ninas Blick auf sein offensichtlich verletztes Bein aufgefallen zu sein. Er lächelte.
„Das ist nichts. Die Außenbänder sind leicht lädiert. Meine Frau hat gemeint, ich sollte mal wieder joggen gehen. Zweimal ist es gut gegangen. Beim dritten Mal bin ich umgeknickt und gestürzt“, erklärte er ungefragt und schien dies gar nicht so tragisch zu finden.
„Ähm, Chef, wo soll Frau Moretti denn sitzen?“, mischte Kübler sich ein.
„Ich denke, vorerst, solange Frau Kriminalhauptkommissarin Liebig-Friedrichs sich im Krankenstand befindet, werden wir sie dort einquartieren“, entschied er und deutete auf die nächste Türe. „Der Kollege Liebig war am Freitag bereits so nett, die persönlichen Gegenstände seiner Gattin zusammenzupacken“, erklärte er.
Nina überlegte kurz. Erst in der Woche vor ihrem Nordseeurlaub hatte sie Heike zu Hause besucht. Obwohl sie beide dienstlich in den letzten Jahren nicht immer einer Meinung gewesen waren, mochte sie die Kollegin doch sehr. Auf Heike war Verlass. Sie war und würde für Nina immer eine gute Freundin bleiben. Allerdings glaubte Nina nicht, dass Heike überhaupt jemals wieder in den Polizeidienst zurückkehren würde.
Sie war in den letzten Jahren immer wieder wochenlang krankgeschrieben gewesen. Zwischendurch hatte sie aber auch regelmäßig versucht, wieder zu arbeiten. Körperlich war sie in Topform. Doch leider reichte das nicht. Eine Polizistin musste auch mental und psychisch in Bestform sein. Heike war seit einem Vorfall vor drei Jahren, bei dem sie und ihre kleine Tochter beinahe gestorben wären, ein seelisches Wrack. Daran hatten auch die Besuche bei den diversen Psychoonkels und eine Kur nichts geändert. Im Gegenteil, während der Kur war sie total durchgedreht. Heike bekam, wenn sie nicht wusste, wo sich ihre Kinder befanden, Panikattacken. Die elfjährige Florentina und der kleine Louis konnten einem fast leidtun, so wie ihre Mutter um sie herumgluckte. Und Nina befürchtete, dass die Situation, wenn die Kinder älter wurden, nicht unbedingt besser werden würde. Was, wenn Florentina mal einen Freund hatte und mit diesem abends ins Kino oder sonst wo hinwollte?
„Ich denke, das ist so auch in Ihrem Sinne, Nina?“, fragte Dirken und sah auf seine Armbanduhr.
„Jaja, passt schon“, beeilte Nina sich zu sagen.
„Gut, dann sehen wir uns später im Besprechungsraum“, meinte Dirken und eilte hinkend weiter.
„Na, siehst du? Ist doch alles bestens“, fand Kübler, als der Chef außer Reichweite war.
„Ja, sobald du mir meinen Kühlschrank und meine Kaffeemaschine rübergebracht hast“, erwiderte sie.
„Wie jetzt?“
„Das ist mein Kühlschrank. In den gehört die Milch für meinen Kaffee. Den Kaffee aus der Maschine, die immer obendrauf gestanden hat. Klingelt es?“, half sie ihm auf die Sprünge.
Thomas verdrehte die Augen.
„Wenn du Kaffee willst, kannst du doch auch rüberkommen und dich bei uns bedienen. Laura hat extra diesen superteuren Kaffeeautomaten besorgt. Da kannst du sogar Milch mit aufschäumen“, schwärmte er.
Nina ballte die Faust.
„Kübler, ich gebe dir eine Stunde, dann hast du mir mein Zeug gebracht“, beschloss sie und stapfte dann zu ihrem neuen Domizil. Im Grunde war ihr dieser blöde Kühlschrank piepegal. Es machte ihr auch nichts aus, Kaffee mit Milchschaum zu trinken. Nein, sie mochte den sogar. Aber es ging nun mal auch ums Prinzip. Und aus einem Kaffeeautomaten, den diese blöde Schnepfe Laura Benning gekauft hatte, würde sie keinen Kaffee trinken. So einfach war das.
So ein Hund musste auch Gassi gehen, wenn es in Strömen regnete. Außerdem hieß es doch auch immer, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gab. So kam es, dass Hans Walter Solms sich heute Morgen, wie auch an jedem anderen Tag, sein Ölzeug übergeworfen hatte, um gemeinsam mit seinem Dackel Waldi seine übliche Runde zu drehen. Waldi und er waren ein eingespieltes Team, und seit seine Frau vor zwei Jahren plötzlich verstorben war, war der nun fast fünfzehnjährige Dackel das Einzige, das er noch hatte. Nach Heidemaries Tod hat sich viel geändert. Freunde, die früher regelmäßig zu Besuch gekommen waren, hatten sich von ihm abgewandt. Aber, wenn er es recht überlegte, war das auch gar nicht so schlimm. Er brauchte niemanden und niemand brauchte ihn. Dies war nicht schön, aber leider auch nicht mehr zu ändern. Im Gegenteil, er war ganz froh, dass man ihn einfach in Ruhe ließ.
Seine morgendliche Runde führte ihn seit Jahren an den dreizehn Stationen des Kreuzweges vorbei bis hinauf zum Druidenstein, wo er sich dann bei schönem Wetter auf eine der Bänke setzte, seine Pfeife stopfte und die Ruhe des Ortes genoss. Hans Walter hätte nicht sagen können, was es war, was den Fels im Wald umgab. Vielleicht irgendeine Kraft oder eine Art von Magie. Vielleicht verliefen hier irgendwelche Erdstrahlen oder unterirdische Wasseradern. Die Einzige, mit der er je darüber gesprochen hatte, war seine verstorbene Frau. Doch die hatte nur gelacht und gemeint, er würde sich das einbilden. Heidemarie hatte sich aber auch nie die Zeit genommen, oben an dem Stein zu verweilen und genau hinzuhören, was der Ort dem aufmerksamen Zuhörer erzählen wollte.
Dass heute etwas anders war als sonst, bemerkte er schon, als er aus dem Schatten der Bäume auf die Lichtung vor dem Fels trat. Gleich ein ganzer Schwarm Krähen flog auf, als Waldi laut kläffend auf diese zu stürzte. Was Hans Walter dann sah, würde er für den Rest seines Lebens vermutlich nie mehr vergessen. Der Körper des jungen Mannes, der da mit ausgestreckten Armen und Beinen auf der Wiese lag, sah aus, als wäre er förmlich explodiert.
Thomas Kübler hätte platzen können. Er war so ein Idiot. Tagelang hatte er sich darauf gefreut, dass Nina endlich aus der Elternzeit zurückkam. Und jetzt, wo sie noch keine halbe Stunde da war, könnte er ihr bereits mit bloßen Händen den Hals herumdrehen.
„Du willst ihr nicht wirklich diesen Kühlschrank rüberschleppen“, zischte Laura böse und stemmte die Hände in die Seiten.
„Doch, will ich. Sonst hält die nämlich nie Ruh“, keuchte er und wuchtete das Gerät auf das Brett mit den vier kleinen Lenkrollen, das er extra zu diesem Zweck aus dem Keller der Wache geholt hatte.
„Also, wenn du mich fragst, hat die sie nicht alle“, fand Laura.
„Dich fragt aber keiner“, brummte er, öffnete die Tür und schob seine Fracht über den Flur eine Tür weiter.
„Bitte schön, da hast du das Mistding“, keuchte er und stellte ihr den Kühlschrank direkt vor den Schreibtisch.
„Danke. Fehlt nur noch die Kaffeemaschine“, antwortete sie ruhig.
„Die ist nicht mehr da.“
Ihr Kopf wirbelte herum. „Was heißt, die ist nicht mehr da?“
„Na, das, was es heißt. Das Ding war irgendwann kaputt und wurde, wie es sich gehört, entsorgt“, log er, da er genau wusste, dass Laura das Gerät entsorgt hatte, weil sie es alt, spießig und für überhaupt nicht mehr hip hielt.
Nina schien zu überlegen.
„Okay, ich glaube, wir haben zu Hause oder in unserer ehemaligen Wohnung noch eine, die so ähnlich ist. Dann bring ich die eben morgen mit“, sagte sie so ruhig, dass Thomas es gar nicht glauben wollte. Er hätte wetten können, dass Nina wieder irgendetwas zu meckern gehabt hätte. Stattdessen erhob sie sich, schnappte sich ihre Handtasche und ging an ihm vorbei zur Tür.