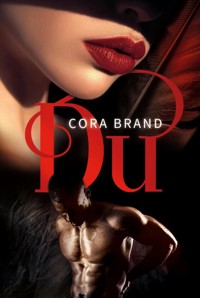
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Herz ist keine wilde Frucht zum Verzehren" Sofia Sanders weiß eine Menge über Liebe – vor allem, wie man ohne sie lebt. Die Bildhauerin lebt mit ihrem Sohn abgeschieden auf einer Ranch am Rande Böblingens. Mit ihren bloßen Händen erschafft sie riesenhafte Greifvögel. Doch die Leere in ihrem Innern vermag die Arbeit nicht auszufüllen. Als sie dem charismatischen Afro-Amerikaner Jeff Runner begegnet, einem Ex-Soldaten, spürt sie diese Leere mehr denn je. Sofia beschließt, sich auf ein Abenteuer mit Jeff einzulassen, doch ihr Herz will bald mehr. Dann verschwindet Jeff und Sofias Welt spaltet sich. Um daran nicht zu zerbrechen, kämpft sie mit aller Kraft dagegen an und driftet unaufhaltsam in eine zügellose und zwielichtige Welt ab, die sie zu verschlucken droht. – Ein erotisches Buch mit Herz – Wo auch immer Sie dieses Buch lesen – falls Sie ein Kribbeln oder Herzklopfen verspüren: Keine Sorge! Dies kann an der Lektüre liegen. Lassen Sie es geschehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Ohne Titel
Impressum
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Danksagung
Über die Autorin
© 2021 Sigrid Haezeleer
Pfauhauser Str. 17
73240 Wendlingen
Facebook: https://fb.me/storys.vonbrand
Covergestaltung: Manu Ancutici, Stuttgart, unter Verwendung folgender Bilder: Frau: Volodymyr – stock.adobe.com; Feder: svetazi – stock.adobe.com; Mann: MichaelSvoboda – iStockphoto
Korrektorat: J. E. Siemens, Berlin
Satz: Claudia Pietschmann, Halle
Druck: Amazon Media EU. S. à. r l., 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
ISBN Paperback: 978-3-949485-00-8
ISBN E-Book: 978-3-949485-01-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Danksagung
Über die Autorin
1
E
in Steinadler kreist majestätisch über dem Gipfel des Teufelskopfs.
Ich reiße die Arme nach oben, öffne die Hände und schaue den Schnipseln meines Textes hinterher.
Briefe, unter Tränen geschrieben. Briefe, die nie abgeschickt wurden. Nun tanzen sie ihren letzten Walzer im Wind und schweben einen Augenblick später ins Tal. Es hat sich ausgetanzt.
Der Januarwind bläst eisig in dieser Höhe, und ich ziehe die Daunenjacke noch enger zusammen.
Ich fühle mich gut. Leer, aber gut. Dafür bin ich dankbar.
»Sofia! Wir sollten aufbrechen.« Gerrit zeigt nach oben. Eine dunkelgraue Wolkendecke schiebt sich wie eine Schieferplatte über den Himmel. »Komme gleich!« Ich greife zur Kamera, die an meinem Hals baumelt und folge der Flugbahn des Adlers, einem männlichen Prachtexemplar mit einer Spannweite von schätzungsweise zwei Metern. »Du bist beneidenswert, Freundchen. Frei, obwohl du in Einehe lebst, bis zu deinem Ende.« Ich verstaue die Kamera im Rucksack und kehre zu Gerrit zurück.
Der Himmel über uns grollt, trotzdem gönnen wir uns während des Abstiegs eine zehnminütige Rast und vespern kräftiges Roggenbrot mit handgemachtem Almkäse.
Nach guten fünf Stunden sind wir im Tal und verfrachten die Schneeschuhe, Steighilfen und Rucksäcke auf der Ladefläche des Pick-ups. Gerrit verlässt den Parkplatz des Wintergeheges im Nationalpark, um mich ins Hotel zu bringen, das nur ein paar Kilometer von Berchtesgaden entfernt liegt.
»Mit etwas Glück hätten Sie in zwei Wochen einen Girlandenflug filmen können, da ist die Balz in vollem Gange.«
»Eigentlich wollte ich nur etwas loswerden. Die Bilder sind quasi Zugabe.«
»Verstehe.« Gerrit nickt. »Meistens sind es ganz andere Dinge, die einen umtreiben. Wenn ich einen freien Kopf will, geh ich auch immer auf den Berg.«
»Steht es mir so sehr auf der Stirn geschrieben?«
»Das nicht, aber ich kenne Sie jetzt schon seit … seit fünf Jahren?« Er wirft mir einen fragenden Blick zu. »Außerdem hab ich ’nen recht guten Instinkt.«
Der hölzerne Adler an seinem Rückspiegel baumelt hin und her, als Gerrit über die Bahngleise fährt und links in die Weidestraße abbiegt, die kontinuierlich ansteigt. Auf der Anhöhe liegt das Hotel ›Morgenröte‹ mit herrlichem Ausblick auf das Tal. Gerrit lenkt den Pick-up auf den Parkplatz. »Da wären wir. Morgen um sieben?«
»Das ist okay.« Ich steige aus und nehme meinen Rucksack von der Ladefläche. Nachdem Gerrit vom Platz gefahren ist, atme ich einmal durch. Ich habe das Gefühl, einen Abschluss gefunden zu haben – einen Fehler getilgt.
»Gleis drei«, sagt Gerrit, löst seinen Blick von der Anzeigetafel und eilt mit meinem Koffer davon.
Der Zug ist bereits eingefahren.
»Vielen Dank für alles.« Ich reiche ihm zum Abschied die Hand.
»Bevor Sie gehen – ich hab da noch was.« Er zieht den Reißverschluss seiner Jacke auf und schiebt seine Hand hinein. Mit der Feder eines Adlers kommt sie wieder zum Vorschein. Er streckt sie mir hin, wie eine Blume.
»Eine Stoßfeder?«
»Sie verleiht Kraft.«
»Aber die kann ich unmöglich annehmen.«
»Doch. Wenn Sie es nicht tun, bin ich beleidigt und Sie werden nie wieder eine Führung von mir bekommen. Darauf gebe ich Ihnen mein wildes Ehrenwort.« Gerrit drückt seine Augen aus den Höhlen. »Nie. Wieder.«
Mit einem Anflug von Ehrfurcht ergreife ich die kostbare Feder an ihrem Kiel.
»Außerdem hätte ich gern eine Einladung zu Ihrer nächsten Ausstellung.«
»Wir stellen nur in der Mühle aus, aber falls doch einmal etwas Größeres geplant wird, werden Sie und Ihre Freundin die Ersten sein, die ich einlade. Großes Ehrenwort.« Ich drehe mich nach der Bahnhofsuhr um. »Es wird Zeit. Vielen Dank nochmal für alles.«
»Similia similibus curentur. Ähnliches durch Ähnliches heilen.«
Hat Fred das nicht auch einmal gesagt?»Ist das nicht das Motto der Homöopathie?«
»So ist es.« Er legt die Hand auf seine Brust. »Das gilt für alles.«
»Ich werde dran arbeiten.«
»Darf ich?«
Ich löse meinen Blick von der schneeweißen Landschaft, die am Fenster vorbeizieht, und schaue in ein gebräuntes Gesicht, aus dem mich zwei blaue Augen anstrahlen. Sie glitzern wie die Oberfläche eines Eissees an einem sonnigen Wintertag. Der Besitzer dieser Augen sieht in seinem Tweed-Sakko und der Fliege am Hemdkragen wie ein zu junger Professor aus.
»Natürlich«, antworte ich.
Der Pseudoprofessor hievt seine abgewetzte Lederreisetasche auf die Gepäckablage und nimmt mir gegenüber Platz. »Als Geologe bin ich es gewohnt, bei jedem Wetter draußen zu sein, aber es ist schon verflucht kalt.« Er reibt sich die Hände und streckt mir eine davon entgegen. »Larson Lindqvist.«
»Sofia Sanders.«
»Und ich weiß, woran Sie jetzt denken.«
Verblüfft schaue ich ihn an.
»An Schokolade, nicht wahr?« Er lässt meine Hand los, und ich muss lächeln, denn er hat recht.
Und ich weiß, woran Sie denken, Herr Lindqvist.Ich lehne mich wieder in den Sitz zurück und ziehe das Handy aus meiner Handtasche, um mir noch einmal die Bilder des ersten Tages anzuschauen. Die Kinder werden sich freuen.
Ein anderer Zug rast an uns vorbei und ich schrecke zusammen.
»Frau Sanders, haben Sie mich nicht gehört?«
»Sorry, haben Sie etwas gesagt?«
»Allerdings. Was führt Sie hierher? Geschäft oder Vergnügen, wenn ich fragen darf?«
»Beides. Meine Arbeit ist für mich Vergnügen.«
»Sind Sie in der Touristikbranche?«
Ich überlege, wie ich antworten soll, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses oder überhaupt ein Gespräch führen will. »Nein. Ich bin Töpferin. Ich fertige Skulpturen, hauptsächlich Greifvögel, vor allem aber Adler.«
»Kunsthandwerk, interessant. Mhm. Und Ihr Mann lässt Sie hier in der Wildnis ganz allein herumspringen?«
Jetzt weiß ich, dass ich dieses Gespräch nicht führen will, und schwenke den Blick hinaus auf die Landschaft.
»Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.« Er korrigiert die Position seiner Fliege.
Abermals greife ich in die Handtasche, diesmal aus purer Verlegenheit, und ziehe den ausgedruckten Fahrplan heraus: Noch vier Stunden bis Stuttgart, ohne umsteigen.
Stille breitet sich im Abteil aus, und wo immer ich auch hinschaue, fühle ich seine Blicke wie heiße Strahler auf mir. Auf meinem Gesicht, meinen Brüsten, meinen Knien und dazwischen.
Durch die Lautsprecher wird Prien am Chiemsee angesagt und kurz darauf beginnt der Eurocity mit dem Bremsmanöver.
»Oh! Hier muss ich umsteigen!« Ich schieße wie eine Rakete hoch und stoße dabei meine Handtasche vom Sitz. Der gesamte Inhalt purzelt auf den Boden: Lippenstift, ein kleiner Kosmetikspiegel, Geldbörse, Handgel zum Desinfizieren und meine Hausschlüssel.
Sofort ist der Prof neben mir auf den Knien und recht mit den Fingern meine Sachen zusammen.
»Danke«, nuschle ich und stopfe alles zurück in die Tasche. »Und noch eine gute Reise, Herr Lindqvist.« Ich stehe auf und nehme meine Jacke vom Haken.
»Haben Sie nicht etwas vergessen?« Er greift mit der Hand an mir vorbei und präsentiert mir mein Handy. »Sie könnten es hier vergessen haben, und ich würde mich in drei Tagen mit Ihnen treffen, um es Ihnen wiederzugeben.«
Als ich es nehmen will, zieht er seine Hand zurück und fixiert mich. »Manche Begegnungen sind zu kostbar, um sie achtlos liegen zu lassen. Ich denke, diese gehört dazu.«
»Guter Einfall, sehr kreativ.« Ich nehme das Handy, als würden Flammen daran züngeln. »Gefällt mir, aber heute nicht, vielen Dank.« Und auch morgen und übermorgen nicht.
Seine Augen verdunkeln sich.
Ich beiße die Zähne zusammen und flüchte aus dem Abteil, durch den Speisewagen und drei weiteren Waggons, bis ich schließlich ein leeres Abteil in der zweiten Klasse gefunden habe. Ich dränge mich in die Ecke des Sitzes, atme tief durch und schließe die Augen.
Den wärmenden Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht verdanke ich es einzunicken, obwohl ich mich in die entgegengesetzte Fahrtrichtung gesetzt habe. Ich sehe die Schnipsel im Wind tanzen. Ja, es hat sich ausgetanzt und es fühlt sich an wie kostbare Freiheit.
Mit nur wenigen Minuten Verspätung erreicht der Zug den Stuttgarter Hauptbahnhof, die zweitgrößte Baustelle Deutschlands. Ich begebe mich zum Taxistand auf der Ostseite des Gebäudes.
Die Taxifahrer sind alle mehr oder weniger stark mit ihren Handys beschäftigt. Nur einer lehnt lässig an seinem Mercedes wie ein Cowboy vor einem Saloon und stößt Rauchwolken aus.
Mein Handy klingelt und auf dem Display grinst mich Charlotte an. Ich streiche über das grüne Hörersymbol.
»Wir müssen reden. Hier ist eben eine halbe Tonne Ton geliefert worden. Die Bestellung kam von dir!«
»Vielen Dank! Ich hatte eine gute Reise. Und wie geht’s dir?«
»Mach keine Witze!«
»Es ist durchaus möglich, dass mir ein klitzekleines Fehlerchen unterlaufen ist.«
Sie ächzt. »Wann kommst du?«
»Heute nicht mehr. Mach dir keine Sorgen. Ich lasse es wieder abholen.«
Charlotte schweigt, und ich füge hinzu: »Dann lass ich es zu den Ställen bringen, die sind doch als Lager gut geeignet.«
»Mhm. Die Idee ist gar nicht so blöd. Okay. Wie war deine Reise?«
»Scherzkeksin. Wir sehen uns morgen Nachmittag.« Ich lege auf.
»Wohin darf ich Sie bringen?« Der Taxifahrer nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette, die er zwischen Daumen und Zeigefinger hält, lässt sie fallen und tritt sie mit der Spitze seines Cowboystiefels aus.
»Nach Waldenbuch, bitte.«
Während er meine Reisetasche im Kofferraum verstaut, steige ich ein und schmiege mich in den beheizten Sitz. Im Wageninnern riecht es nach Orange und Leder, bis sich der Cowboy mitsamt seiner Duftwolke aus Zigarettenrauch und herbem Aftershave hinters Steuer setzt. Er legt seine Fingerspitzen auf den Zündschlüssel und schaut mich an.
»Es liegt ein bisschen versteckt, im Wald. Ihr Navi wird das Signal verlieren, weil wir einen Schleichweg nehmen werden.«
»Das ist Ihre Fahrt, Lady. Sie sagen mir, wo’s langgeht. Und nennen Sie mich doch Wayne. Ich bin ein großer Fan von John Wayne, wissen Sie?« Er schenkt mir ein extra cooles Cowboy-Lächeln.
Einen Kilometer vor dem Ziel verliert das Navigationsgerät das Signal, und ich navigiere Wayne auf der schmalen Straße zwischen schneebestäubten Wiesen hindurch zur Ranch.
Er fährt im Schritttempo durch das Holztor, die schnurgerade Auffahrt entlang. »Wow, das ist ja eine richtige Ranch!« Er hält dicht vor den Treppen der Veranda und reibt seine Fingerknöchel an den Bartstoppeln seines Kinns. »War das nicht mal ein Poloplatz? Wissen Sie, ich interessiere mich sehr für Pferde und alles, was damit zu tun hat.«
»Das ist schon lange her.« Ich lege siebzig Euro auf die Konsole. »Stimmt so.«
»Oh! Vielen Dank! Warten Sie, ich helfe Ihnen mit dem Gepäck.«
Wayne holt die Reisetasche aus dem Kofferraum und hechtet die vier Verandastufen nach oben. Es sieht tatsächlich so aus, als würde er galoppieren. An der letzten Stufe stolpert er beinahe.
»Tut mir leid«, rufe ich ihm zu, »die oberste Stufe ist ein bisschen höher.«
»Kein Problem.« Er trippelt auf der Stelle hin und her, und es hat den Anschein, als wolle er noch etwas sagen, aber er horcht nur auf, denn hinter der Haustüre hört man Rammstein grölen. Er lupft einen imaginären Hut und grinst über das ganze Gesicht. »Einen schönen Tag noch, Ma'am.« Mit einem Satz hopst er die Stufen hinunter, steigt in seinen Wagen und braust davon.
Ich drücke die Klingel. Rammstein verstummt und Fred steckt seinen Kopf heraus. »Hi Mom, hast du deine Schlüssel verloren? Aber ich hab noch nicht aufgeräumt. Musste lernen. War die Reise gut?« Er lässt mich ein und huscht davon.
Ich hänge meine Daunenjacke in der Garderobe auf und schleiche durch die Diele, als würde ein Unheil auf mich warten.
Fred ist in der Küche und räumt in aller Eile die Teller in die Spülmaschine.
»Warum trägst du Badeschlappen?«
»Das sind Spezialschuhe, mit Magnetfeldern und Fußreflexgedönse, fördern die Konzentration. Wir schreiben bald eine Arbeit in Physikalische Chemie. Hab total viel gelernt. Deshalb sieht es hier auch so aus.«
»Sonst irgendwelche Vorkommnisse, Katastrophen, von denen ich wissen sollte?« Ich schaue mich nach allen Seiten um und entdecke auf dem Esstisch einen Berg von Zeitschriften und Flugblättern, der bereits die Höhe des Watzmann erreicht hat.
»Nee, alles gut.« Fred hackt das Besteck in den Besteckkorb. »Hast du gesehen, wie sie sich begatten?« Er hält in seinen Bewegungen inne und sieht mich an. »Das Adlerpärchen. Hast du gesehen, wie sie es getrieben haben?«
Ich lache. »Nein, das ist zu früh, aber er ist herrlich gesegelt und ich habe ein paar tolle Aufnahmen machen können.« Ich schlendere zum Esstisch und sichte die Post ohne Begeisterung. »Uff. Wieder eine Einladung von Flemming Stutenberg, und wieder werde ich dankend absagen.«
»Warum? Mach doch mal eine Ausstellung dort. Ich würde dir auch helfen bei der Logistik und so. Ich war noch nie in Amsterdam.« Er flackert mit den Augenbrauen.
»Keine Drogen.«
»Ohne Scheiß, warum lässt du’s nicht mal krachen?«
»Weil ich dieses ganze Tamtam nicht gebrauchen kann. Ich will meinen Frieden. Vielleicht werde ich mit den Kiddies was auf die Beine stellen. Das müsste allerdings von langer Hand geplant werden. Frau Armbruster ist stockkonservativ.«
»Sie sind spät dran, Frau Sanders!«, tönt es tags darauf aus dem schuhkartongroßen Büro.
Der Versuch, mich an ihr vorbeizuschleichen, scheitert kläglich. »Ich hatte Probleme mit der Übertragung der Bilder von –«
Frau Armbruster schaut mich mit übler Montagmorgenlaune an, und ich winke ab. »Also mit der Technik … Entschuldigung.«
»Sie wissen, dass Sie nicht jedes Mal überziehen können.« Die Zungenspitze der Heimleiterin blitzt aus ihrem Mundwinkel hervor wie der Schlangenkopf aus einer Felsritze.
Drei Jahre habe ich gebraucht, ihren bissigen Ton einzuordnen. Er dient als Schutzschild, denn im Innern ihrer Seele ist sie höchst verletzlich, na ja, zumindest nehme ich das an. Außerdem will sie Autorität demonstrieren.
»Frau Sandäääärs!« Die Kinder schreien und klatschen in ihre Händchen, als ich den Werkraum betrete. Die meisten haben schon ihre Schürzen an und hopsen vergnügt im Kreis. Nur Saras Gesicht wirkt trotzig.
»Wir machen heute etwas ganz Neues.« Ich zeige die Bilder sowie eine Videoaufnahme des Adlers. Zwanzig Augen verfolgen seinen Flug.
»So einen werden wir machen, in ganz einfacher Form.« Ich lege das Tablet zur Seite und wickle die Feder aus dem Pergamentpapier. »Das hier ist eine ganz besondere Feder, eine Stoßfeder. Wenn ein Indianer im Kampf sehr mutig war, durfte er so eine in seinem Kopfschmuck haben. Manchmal müssen wir auch kämpfen, wie ein Indianer. Der schlimmste Kampf aber ist immer der, den man gegen sich selbst führt. Zum Glück steckt in jedem von uns ein Adler.«
Mit Riesenaugen schauen sie mich an und ich reiche die Feder herum.
»Wir sind keine quakenden Frösche, nicht wahr?«
»Nein, nein! Keine Frösche, keine Frösche!« Die Kinder jubeln und breiten die Arme aus, hüpfen und quaken.
Es wärmt mir das Herz, sie so ausgelassen zu sehen. »Lasst uns anfangen.« Ich klatsche in die Hände. »Wir haben noch viel zu tun und die Zeit hat auch Flügel, wisst ihr? Immer dann, wenn man sie am meisten braucht, flattert sie davon.«
Es sollte sich bewahrheiten und ich tue genau das, was ich nicht tun sollte, nämlich überziehen.
Ich stecke meinen Kopf, mitsamt schlechtem Gewissen in Frau Armbrusters Büro, um mich rasch zu verabschieden.
»Auf ein Wort, Frau Sanders.« Ihre knochige Stimme geht mir durch Mark und Bein. Mit theatralischem Blick späht sie auf die Uhr an der Wand. »Es ist 12.08 Uhr. Zum einen. Zum anderen: Sie wissen, wie sehr wir Ihr Engagement und Ihre Unterstützung wertschätzen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich Ihre … Ihre Ideen finden soll.« Bei ›Ideen‹ verzieht sie ihren Mund, als würde etwas Ekliges auf ihrer Zunge kleben. »Sie überfordern die Kinder und setzen ihnen Flausen in den Kopf. Dies ist ein Kinderheim und kein Motivationsworkshop.«
»Die Kids brauchen das aber.« Ich richte mich gerade auf. »Stärke und Unabhängigkeit sind tragende Pfeiler in einem Leben, und wie Sie schon angemerkt haben, ist es kein Zuckerschlecken. Man kann nicht früh genug damit beginnen.«
Frau Armbrusters Miene versteinert sich wie üblich, doch der erwartete Widerspruch bleibt diesmal aus. »Auf Wiedersehen, Frau Sanders. Bis nächste Woche.«
Rechts und links von mir wiegen sich die mit Schnee befrachteten Tannenzweige, und das Liliputsträßchen gräbt sich wie ein Korkenzieher in die bewaldete Talsenke zum Kleinod unseres Schaffens: der Zachersmühle. Sie wurde von Charlottes Mann in jahrelanger Kleinarbeit und mit viel Liebe umgebaut.
Charlotte steht in gebeugter Haltung vor der geöffneten Tür des Brennofens. Er steht in der Küche, die dadurch ständig überhitzt ist, im Winter ein durchaus willkommener Nebeneffekt.
Ihre Mähne fällt wie ein üppiger Vorhang vor ihr Profil. Heute keine ›Pocahontas-Zöpfe‹, wie sie diese gerne, trotz blonder Haare, bezeichnet.
»Guten Morgen, meine Liebe. Kann man den Ofen schon ausräumen? Hab zwei Kisten Schrühbrand im Auto, vom Kinderkurs.«
»Hallo. Kann man.« Sie richtet sich auf, und obwohl ich nicht klein bin, überragt sie mich noch um einen halben Kopf. »Wie war deine Exkursion? Ist alles nach Plan gelaufen?«
»Bestens. In zwei Tagen wird übrigens der Ton abgeholt.«
»Hast du auch einen Adler gesehen? Und … hat er dich gesehen?«
»Sehr witzig. Ich hab tolle Bilder gemacht und sogar einen Film, na ja, Filmchen. Aber hier …« Ich greife in meine Handtasche, hole die Holzschatulle heraus und öffne sie.
»Okay? Hast du die von dem Vogel persönlich bekommen oder von einem neuen Verehrer?«
»Gerrit hat sie mir geschenkt.«
Sie schlendert zur Spüle, dreht den Wasserhahn auf und wäscht sich die Hände.
»Der Wildführer, du weißt schon.«
»Wie wild genau ist er eigentlich? Hat er –?«
»Nein. Nein. Nein.« Bei jedem ›Nein‹ schüttle ich den Kopf.
Sie dreht das Wasser ab, nimmt das Handtuch vom Haken und trocknet sich gründlich die Hände. »Aber gegen flirten ist doch nichts einzuwenden, oder willst du dir das jetzt auch noch abgewöhnen?«
»Nein, Charlie, ich will mir gar nichts abgewöhnen, aber für Beziehungskram habe ich weder Nerven noch Zeit. Und nur mal so gefragt: Wann feiert ihr eigentlich silberne Hochzeit? Ich mein ja nur.«
Charlotte tritt ganz nah an mich heran. »Das ist genau der Punkt. Selbst ich flirte mehr als du.«
»Und was soll das bringen?«
»Es ist ein harmloses Spiel. Nett, aber ohne Bedeutung.«
»Nichts ist ohne Bedeutung unter diesem Himmel. Alles, was du tust, zählt. Alles, was du nicht tust, übrigens auch. Vielleicht zählt das sogar noch mehr.«
»Du solltest dringend lockerer werden.«
»Ich bin locker. Sogar sehr locker.«
Charlotte verdreht die Augen und stapft aus der Küche in die Werkstatt, und ich rufe ihr hinterher: »Du findest niemanden, der so locker ist wie ich. Niemanden! Hörst du?«
»Du wirst perfekt werden«, sage ich zu Amonia, und der warme Tonschlicker tropft wie Blut von meinem Finger, hinein in den Spalt zwischen Flügel und Körper. »Der wird nicht mehr abbrechen. Außerdem wirst du noch ein Männchen bekommen, meine Liebe. So ein majestätisches Exemplar, wie ich es auf dem Teufelskopf gesehen habe.«
Entgegen meiner Gewohnheit habe ich Arbeit mit nach Hause genommen. Somit kann ich das Trocknen der Tonschichten überwachen und Sorge tragen, dass der Flügel nicht wieder abbricht.
Ich blicke auf die Uhr: Mist. Hastig decke ich das riesige Adlerweibchen mit Folie ab und wusche ins Bad, um mein Make-up aufzufrischen. Anschließend suche ich mehrere Minuten vergeblich nach dem Autoschlüssel. Fred. Er hat wohl Wagen gekapert und sich über die westliche Veranda herausgeschlichen.
Ich schlüpfe in den gefütterten, sandfarbenen Wildledermantel und die dazu passenden Stiefel und trete hinaus auf die östliche Veranda.
Die Morgensonne lugt gerade über die Baumspitzen und blendet mich. Ich schirme die Augen mit der Hand ab. Keine Spur vom Auto oder von Fred. Ich trappe die Stufen hinunter und überlege, den Rover zu nehmen. Genau in diesem Moment taucht der Skyliner hinter den ehemaligen Ställen auf. Er braust auf mich zu und kommt einen Meter vor meinen Füßen zum Stillstand. Fred streckt den Kopf zum Fenster hinaus und grinst mich frech an.
»Das ist kein Rennwagen«, sage ich, »darüber werden wir uns noch unterhalten.« Natürlich wissen wir beide, dass diese Unterhaltung niemals stattfinden wird. »Steig bitte aus, ich muss los. Hardy hasst Unpünktlichkeit, du kennst ihn doch.«
»Okay, aber bist du wieder da, bevor es dunkel wird?«
»Wohl kaum.« Ich taste nach dem Hebel, um den Sitz zu verstellen und steige ein.
»Schade. Ich wollte noch eine Runde mit Richie drehen.«
»Nehm doch den Rover.«
»Der ist aber langweilig. Willst du deine Handtasche auf dem Dach lassen?« Fred reicht sie mir durch das Fenster. »Und kannst du noch irgendwo Eier und Bananen besorgen? Das hast du gestern vergessen und morgen ist Sonntag. Du weißt schon, damit ich groß und stark werde.« Fred hebt seinen Arm und küsst seinen Bizeps.
»Meinetwegen. Und ich weiß, dass morgen Sonntag ist.«
Der Schnee stiebt hinter mir auf, als ich das Gaspedal durchtrete.
2
I
m Stechschritt eile ich auf den Ausgang des Einkaufszentrums zu, Eier und Bananen unter den Arm geklemmt. Ziemlich sicher werde ich zu spät zur Verabredung mit Hardy kommen, und trotzdem drossle ich mein Tempo, denn da ist diese Gestalt an der Delikatessentheke.
Er starrt auf die Oliven hinter der gewölbten Glasscheibe. Er trägt einen anthrazitfarbenen Wollmantel und aus seiner linken Faust baumeln die Finger eines Lederhandschuhs. Auf dem tiefen Braun seiner Haut liegt ein goldener Schatten; sein Haar ist kurzgeschoren, als wäre er beim Militär. Er ist hochgewachsen. Wie sind wohl seine Augen? Bernsteinfarben wie Tigeraugen? Ich werde langsamer. Was soll das, Sofia!
Er dreht sich um. Unsere Blicke treffen sich und aus dem Ozean der Zeit löst sich die eine Sekunde, die alles verändern wird.
Ein gleißender Strahl dringt in mich und bringt Licht in die Dunkelheit meiner Seele, die ich in diesem Augenblick spüre wie seit Ewigkeiten nicht mehr.
Das ist nicht gut. Gar nicht gut.
Er blickt mich vollkommen ernst an und strahlt zugleich eine unbezähmbare Energie aus. Seine Augen schreien.
In der ersten Sekunde dringt sein Blick tief in mich hinein, bis in den hintersten Winkel meiner Kammer, in dem die Sehnsucht hockt, bewacht von Angst.
Ich sollte wegschauen, stattdessen erwidere ich seinen Blick und sehe darin einen wunderschönen Abgrund – einen, der mich willkommen heißt.
In der zweiten Sekunde verschmelzen der Fremde und ich. Ich bin chancenlos. Meine Kopfhaut prickelt. Meine Lippen glühen.
Ich sehe ihn über mir, spüre seinen Atem auf meiner Haut. Seine Zunge leckt um meinen Nabel, schlürft mir einen Tropfen Sehnsucht daraus und füttert mich wieder damit. In dem Dunkel meiner Kammer wächst eine Blume. Ihr Duft raubt mir den Verstand.
In der dritten Sekunde fühle ich mich berauscht. Es ist eine Sünde, an ihm vorbeizugehen. Aber es wird doch nicht mehr getanzt, nicht wahr? Nicht wahr, Sofia? Hörst du? Die Absätze meiner Stiefel hallen wie Hilfeschreie auf dem Boden.
Es sind nur noch wenige Schritte zum Ausgang.
Gleich ist es vorbei. Gleich ist es vergessen.
Die doppelte Glastüre wird sich in der Mitte spalten und zwei Welten voneinander trennen, sobald sie sich hinter mir wieder schließt.
Die Lichtschranke über der Tür erfasst mich. Ich bleibe stehen und drehe mich ein letztes Mal um.
Sein Blick schießt wie zwei Harpunenspitzen durch die Narben uralter Wunden, meiner Wunden, und ich fühle einen heißen Stich.
Die zweite Tür öffnet sich. Jemand rempelt mich an und eine Bassstimme dröhnt über mir: »Passen Sie doch auf!«
Das alles muss nicht passieren, rede ich mir ein, eile hinaus ins Freie, auf den Parkplatz und zu meinem Auto, das mir wie eine Rettung erscheint. Obwohl ich sprinte, ist mir, als falle ich in die Tiefe. ›To fall in love‹, genauso ist es.
Ich stelle den Einkauf auf den Boden neben das Auto und öffne die Beifahrertür. In meiner Brust hämmert es. Kehr um. Kehr um. Und eine seidenfeine Stimme flüstert: ›Steig ein‹. Sie sagt: ›Fahr weg‹.
Doch jetzt sagt sie nichts mehr, denn ich fege sie beiseite, wie alles andere auf dem Beifahrersitz: Kräuterbonbons, Kleingeld, Tankbelege, Büroklammern, ein einzelner Ohrring. Ich klappe das Handschuhfach auf und finde einen Kuli. Auf einem Kassenbon notiere ich meinen Namen und meine Telefonnummer und: ›Do you like coffee?‹
Mit Riesenschritten strebe ich wieder zurück Richtung Markt und erstarre, als er mir entgegenkommt.
Er trägt keine Uniform, bewegt sich aber genauso, nur geschmeidiger. Bei jedem seiner weiten Schritte weht sein Mantel auf. Mit der blaugetönten Nickelbrille, mit der er seine Augen verhüllt hat, sieht er verboten gut aus.
Er bleibt vor mir stehen und nimmt sich in einer nonchalanten Bewegung die Brille von der Nase.
In diesem Moment perlt die Aufregung wie von einem Schirm von mir ab. Ich hebe meinen Blick.
Sein Gesicht zeigt keine Gefühlsregung, doch seine Augen schimmern wie dunkler Whisky vor einem Kaminfeuer.
Ich liebe Feuer. Ich liebe Whisky.
Wieder dringt sein Blick in meine Welt, und er sinkt wie ein Anker tief und tiefer – ins Supertief.
Die Zeit dehnt sich wie ein endloses Aum und schrumpft einen Moment später auf einen winzigen Punkt zusammen: diesen Augenblick.
»Das hast du verloren«, sagt er auf Englisch und reicht mir meinen Lederhandschuh. »Du hattest es ziemlich eilig.« Seine Stimme ist tief und samtig weich.
»Oh. Danke«, antworte ich, ebenfalls auf Englisch, und nehme den Handschuh so, dass ich seinen Daumen und Zeigefinger berühre.
Er streckt mir seine Hand entgegen. »Jeff Runner, how do you do?«
Ich lege meine Hand in seine. »Sofia Sanders. How do you do?«
Sein nicht überschwängliches Lächeln wirkt unterkühlt, jedoch grandios auf seinen Lippen, die mich an reife Kirschen erinnern. Süße Kirschen, zum Hineinbeißen.
Knallrot leuchtende Buchstaben tauchen vor mir auf: K u s s. Ich lecke mir über die Lippen. Mein Mundraum ist ausgetrocknet und heiß wie im Innern eines Ofens.
Er löst seine Hand, und sofort fehlt sie mir.
Schließlich sprudeln die Worte heraus, als hätte jemand zwei Hähne gleichzeitig aufgedreht.
»Möchtest du –«, beginnt er.
»Ja, ich wollte dir eben –« Ich fummle den Zettel aus der Jackentasche und reiche ihn ihm.
Er betrachtet ihn und ich sehe, wie das Stück Papier in seinen Fingern flattert.
Als er wieder hochsieht und sich unsere Blicke treffen, ist der Glanz aus seinen Augen verschwunden. Ich schlucke.
»Vielleicht hast du ein paar Minuten Zeit für –«, sagt er.
»Ich bin verabredet … zur Messe … leider.« Ich wedle mit dem Arm in nördliche Richtung und ein Teil meiner Ruhe verfliegt mit dieser Geste. »Vielleicht morgen?«
»Morgen habe ich Dienst. Ich arbeite in den Kelleys.« Er deutet zum Flughafen, jenseits dessen sich die Kelley Barracks befinden, Militärstützpunkt der US-Streitkräfte. »Aber am Montag hab ich frei.«
Bevor ich antworte, zähle ich im Geiste von einundzwanzig bis dreiundzwanzig. »Montag … sollte klappen.« Ja, denn ich würde alles absagen am Montag, selbst ein Rendezvous mit dem Ex-Präsidenten Obama. »Jetzt muss ich aber los, sonst komm ich zu spät.«
»Ich ruf dich an.« Er reicht mir seine Hand zum Abschied.
»Okay, Mister Runner.« Ich drehe mich um und wandle wie benommen zu meinem Auto zurück. Immer wieder murmle ich seinen Namen. Jeff-Jeff-Jeff. Er klebt wie Karamell auf meiner Zunge. Noch einmal drehe ich mich um. Er steht immer noch da und lächelt wundersüß.
Es war eine gute Idee, rückwärts eingeparkt zu haben; es erlaubt mir jetzt, mit Eleganz aus der Parklücke zu stoßen. Ich steige ein und starte den Motor; er schnurrt sexy, bis ich ihn beim Anfahren abwürge. Mit einem verbissenen Lächeln starte ich ihn erneut und fahre schwungvoll aus der Parkbucht.
Dass die Leute sich nach meinem Wagen den Kopf verdrehen, bin ich gewohnt. Viele heben den Daumen nach oben oder winken. Manche fuchteln ganz wild und wollen mir dadurch zu verstehen geben, dass sie mitfahren möchten. Einen schneeweißen Ford Galaxy Skyliner, Baujahr 1959, noch dazu mit roten Ledersitzen, sieht man nicht allzu häufig. mehr hoffe ich, Jeffs bewundernder Blick gilt nur mir allein und nicht dem Wagen.
Er hebt seine Hand zum Gruß, als ich an ihm vorbeituckere, und ich nicke ihm zu. Mein Gesicht wird warm und ein Zittern fährt durch meinen Leib. Die ersten Minuten meines Lieblingslebens haben soeben begonnen.
Wie auf einem Luftkissen schwebt der Skyliner auf dem Flüsterasphalt Richtung Echterdingen, entlang des Flughafengeländes und vorbei an der US Air Base. Am Kreisverkehr in Echterdingen fahre ich rechts in das östliche Industriegebiet.
Hardy steht mitten auf der Stadionstraße und trippelt hin und her. Ob es vor Kälte oder Ungeduld ist, lässt sich schlecht sagen, denn er ist permanent in Bewegung. Schließlich haben zwanzig Jahre Tennissport ihre Spuren hinterlassen.
Die Art und Weise, wie er mich an sich drückt und mich busselt, verrät mir, dass er auf Entzug ist – von menschlicher Wärme.
»Nur sieben Minuten zu spät. Ein neuer Rekord.«
»Sorry, aber ich musste noch etwas –« Ich reiße mich von ihm los und beuge mich ins Auto. Nach wilder, aber erfolgloser Suche schäle ich mich wieder heraus und klatsche mir auf die Stirn. »Nein! Ich bin über die Eier und die Bananen gefahren.«
»Du bist waaas?« Hardy hebt seine buschigen Augenbrauen und lacht erbarmungslos, dabei schlägt er sich immer wieder mit der Hand aufs Knie.
Ich lehne mich mit verschränkten Armen gegen die Autotür. »Wenn du fertig bist, können wir ja losgehen.«
Hardys Lachen verebbt in krähenartigen Lauten. »Okay, Frau Oberschussel.« Er bietet mir einen Arm zum Unterhaken an und wir marschieren zum Ende der Straße, durch die Unterführung der B27 auf den verschneiten Feldweg, der zum Messegelände führt.
Der Himmel über uns spannt sich wie ein Satintuch, in glänzendem Blau – ein Himmel mit unbegrenzten Möglichkeiten.
»Sobald es wärmer wird, musst du mit mir auf die Driving Range«, sagt Hardy.
Hab ich meine Telefonnummer auch richtig aufgeschrieben?
Hardy schüttelt meinen Arm. »Ach, bevor ich’s vergesse: Habt ihr einen Termin gefunden?«
»Ja. Am Montag.«
»Am Montag? Willst du mich veräppeln? Allein die Vorbereitung braucht doch Monate.«
Erst nach fünf Schritten dämmert mir, wovon Hardy spricht.
»Oh, du meinst die Ausstellung. Hab das Angebot nicht angenommen. Mal sehen, vielleicht im Herbst.«
Hardy seufzt. »Diese Leute lassen sich nicht ständig abweisen.«
Der hard’sche Ex-Tennislehrer-Schulmeisterton wirkt wie ein puhlender Finger in meinem Gewissen. »Ich kann das einfach nicht haben.«
»Soll ich dir sagen, was ich davon halte?«
»Nein.« Nach zwei Schritten füge ich hinzu: »Die Zeit ist noch nicht reif.«
»Die Zeit hat damit gar nichts zu tun.« Hardy stellt sich vor mich und legt beide Hände auf meine Schultern. »Du musst zu dem stehen, was in dir steckt.«
»Ich will diesen ganzen Rummel nicht. Mein Leben soll leise sein.«
»Du bist das dem Namen Sanders schuldig, meinst du nicht auch?«
»Hardy, wir wollten nur auf die Touristikmesse gehen, schon vergessen?«
»Es tut dir nicht gut –«
»Ich weiß schon, was mir guttut, vielen Dank.« Hardy und seine fürsorgliche Seite.
Nachdem Mercedés auf einem Golfplatz von einem Blitz tödlich getroffen wurde, ist er ein anderer Mensch geworden. Er hat die Tennisanlage verkauft und ist zum eingefleischten ›Alleinbleiber‹ geworden. Jetzt golft er wie ein Besessener und ihn interessiert nur noch, ob in seinem Flight jemand ein einstelliges Handicap hat und wann und wo das nächste Golfturnier stattfindet.
Wenn man etwas verliert, was man liebt, wird man eben anders.
Nach der Messe lasse ich mir ein heißes Bad ein. Die Rhythmen des Bossa nova rauschen durch das Badezimmer und es tut unendlich gut, zuerst die Zehenspitzen, den Fuß, das Bein und schließlich den ganzen Körper in das Nass zu tauchen.
Meine Brüste ragen wie zwei Bojen über der zart schäumenden Wasseroberfläche und die Flämmchen der Teelichter auf dem Wannenrand flackern hin und her, kleine zappelige Minifreudenfeuer.
Ich lausche dem samtigen Sound des Baritonsaxofons von Stan Getz, kämme mit den Fingern durch das Wasser und setze so kleine Sorgloswellen in Gang. Über alldem schwebt der Duft von Rosenholz- und Sandelholzöl und ich inhaliere ihn mit vollen Zügen. Schließlich klappen meine Lider nach unten und sein Gesicht taucht vor mir auf.
›My name is Jeff and I like coffee.‹ Seine Lippen öffnen sich, rot und prall wie reife Kirschen, zum Küssen gemacht und verlockend nah. K u s s … Buchstaben tauchen vor mir auf, sie schillern wie Seifenblasen. K u s s … sie zerplatzen mit einem Plopp und bilden sich aufs Neue.
Sein Lächeln war kühl, aber hinter seinen Augen verbarg sich etwas – war es Schmerz? Er wird wohl in der Army sein, wenn er in den Kelley Barracks arbeitet. War er im Krieg? In Afghanistan, Irak, Syrien? Hat er all das Schreckliche erlebt, was man in den Nachrichten hört? Er ist schwarz. Bekommt er das zu spüren? Ob er schon eine weiße Frau hatte? Vielleicht wäre ich die Erste. Oh, là, là …
Mit den Zehen greife ich nach dem harten Naturbadeschwamm auf dem Wannenrand und schaukle mit dem Körper vor und zurück, bis die Wellen ihn zu mir gespült haben. Ich drücke ihn über meinem Gesicht aus und der Wasserstrahl rinnt mir über Stirn, Augen, Nase und Lippen. Lippen, die geküsst werden möchten. Meine Hände gleiten schwerelos über die aufgestellten Brustspitzen hinunter zum Bauchnabel. In meiner Vorstellung jedoch sind es nicht meine, sondern seine Hände. Es waren große Hände. Ich rutsche so tief in die Badewanne, bis die Ohren unter Wasser sind und die Haare wie Tang auf der Wasseroberfläche schwimmen. Astrud Gilberto singt mit ihrer kindlichen Stimme brav ihren »Summer Samba«; es klingt weit entfernt, wie ein leiser Sommertraum, geträumt an einem Winterabend.
Das Brummen des Handys auf dem Waschtisch durchkreuzt meine Fantasien. Ich schnelle hoch, als hätte mich eine Qualle verbrannt, reiße das Frottierhandtuch von der Stange und tupfe mir das rechte Ohr trocken. Als ich mich nach dem Telefon strecke, rutscht das Handtuch in die Badewanne, saugt sich mit Wasser voll und versinkt.
Auf dem Display leuchtet der herrlichste fremde Zahlenstrang, den ich je gesehen habe. Ich konzentriere mich darauf, extrem entspannt zu klingen, bevor ich »Sofia Sanders« in den Lautsprecher hineinhauche.
»Hi, ich bin’s.« Sein Begrüßungssingsang kribbelt wie ein feiner Strom direkt zwischen meine Schenkel. Er muss ein Stimmbildungstraining oder etwas Ähnliches hinter sich haben.
»Schön, dich zu hören«, flöte ich, was die Untertreibung des Jahrhunderts ist. Zufrieden gleite ich wieder ins Wasser und spüre sogleich auch eine lächerliche Angst, er könne meine Gedanken durch den Hörer wahrnehmen, inklusive jener, die ich bereits gedacht habe.
»Wie war es auf der Messe?«
»Ganz interessant.« Deine Whiskyaugen waren überall, denke ich.
»Übrigens war es reiner Zufall, dass wir uns getroffen haben. Hätten sie eine Stunde vorher das gehabt, was ich wollte, wäre ich gar nicht dort gewesen.«
»Somit war es doppelter Zufall. Ich war auch nur dort, weil ich … etwas vergessen hatte.« Es war Bestimmung.
»Wo bist du, Sofia, es klingt so –«
»In der Badewanne«, antworte ich wahrheitsgetreu. Die Kombination ›Badewanne-Sofia‹ muss wohl seine Fantasie beflügeln. Für einige Sekunden herrscht absolute Stille. Schließlich haucht er ein »Schööön!« in den Hörer und es verursacht ein Seebeben mittlerer Stärke in meinem Unterleib.
»Das viele Laufen auf der Messe … meine Füße … äh, du verstehst.« Mein Gott, krieg ich keinen vernünftigen Satz hin?
»Ich verstehe. Dann stör ich dich nicht weiter. Ich ruf dich morgen wieder an, wenn’s dir recht ist.«
»Gut. Bis dahin.« Widerwillig lege ich auf und strample mit den Beinen im Wasser.
Morgen werde ich ihn wiedersehen! Am liebsten würde ich einen Köpfer in die Badewanne machen oder von einem Zehn-Meter-Brett springen.
Das Leben ist doch gerecht.
Als Treffpunkt hatte ich das Industriegebiet im Westen Echterdingens vorgeschlagen, das mit vorzüglicher Parkmöglichkeit ausgestattet ist.
Instinktiv suche ich nach einem sportlichen Fahrzeug wie das auf der anderen Straßenseite: Es ähnelt einem 911er Porsche und die Person darin lacht mir zu.
Ich parke in einer riesigen Parklücke, drei Autos vor ihm.
Jeff öffnet mir die Tür. Ich schwenke die Beine hinaus und ergreife die mir dargebotene Hand. Es gibt kein Küsschen auf die Wange.
»Das ist ein erlesenes Automobil.«
»Hallo Jeff. Danke, das ist es. Baujahr ’59, gehörte meiner Mutter. Äußerlich ein Oldtimer, technisch aber auf dem neuesten Stand. Es ist Liebe pur.« Ganz bewusst schaue ich nicht ihn an, sondern das Auto. Ein Lächeln kann ich mir jedoch nicht verkneifen.
»Das verstehe ich. Es ist leicht, sich darin zu verlieben.« Jeff schwenkt seinen Blick zu mir.
Ich schaue zur Seite wie ein siebenunddreißigjähriges Schulmädchen.
Wir fahren mit seinem Wagen zum ›Chez Amis‹, einem Lokal im Ortskern. Der Loungebereich im unteren Teil des Gebäudes ist montags geschlossen und so müssen wir mit dem Bistrobereich vorliebnehmen. Bereits auf den Stufen zum Eingang hört man jemanden brüllen wie ein Feldwebel, der seinen Rekruten die Leviten liest. Nach kurzer Stille folgt mehrstimmiges Gegröle.
Jeff öffnet die Tür, eine Serviette fliegt von der Theke. Alle verstummen und vier Köpfe drehen sich wie auf Kommando zu uns herum und starren Jeff wie einen Außerirdischen an. Einer wischt sich mit dem Handrücken den Schaum von den Lippen.
Dann starren sie mich an. Aus dem Lautsprecher plärrt eine blecherne Stimme irgendeinen Song aus den Achtzigern. Doch schließlich, als hätten sie ein Signal empfangen, hebt einer der Gäste sein Bierglas. »Und wisst ihr, was ich gemacht habe?«
Jeff und ich nehmen an einem Ecktisch Platz und er bestellt beim Kellner die Getränke. Er tut es auf Deutsch, mit einem weichen ›r‹.
»Mein Deutsch ist nicht so gut.« Er lacht und seine elfenbeinfarbenen Zähne schimmern in dem dunklen Gesicht.
»Ich finde es schön.« Und ungemein sexy.
»Danke, aber besser, wir bleiben beim Englisch. Du sprichst übrigens ausgezeichnet. Das ist auch gut, sonst hätten wir ein Problem.«
Er spricht in der Wir-Form.
»Warst du schon mal in den Staaten?«
»Leider nicht. Dazu müsste ich in ein Flugzeug steigen.«
»Du hast Flugangst? Meine Mutter auch.« Aus seinem Mund klingt es wie ein neuer Volkssport.
»Wirklich? Deine Mutter ist mir sympathisch. Wo lebt sie?«
»North Carolina.«
Der Kellner bringt die Getränke und zündet die Kerze auf dem Tisch an.
»Jetzt wird es noch richtig romantisch.« Ich balle die Hände unter dem Tisch zu Fäusten und denke dabei an die progressive Muskelentspannung von Jacobson. Anspannen – loslassen – anspannen – loslassen.
Jeff betrachtet mich mit diesem melancholischen Whiskyblick und mir wird ganz warm ums Herz. Jetzt fällt mir auch eine zwei Zentimeter lange Narbe über seiner rechten Augenbraue auf, die ein paar Nuancen heller ist als die übrige Haut. Ihr Ende verläuft im äußeren Teil der Augenbraue.
»Wie lange bist du schon in Deutschland?«, frage ich.
»Sieben Jahre. Ich liebe Stuttgart.«
Oh, là, là … ›ich liebe‹ aus seinem Mund zu hören, klingt gruselig schön. Sag‘s noch einmal.
»Und du?«
»In Waldenbuch.«
»Alleine?«
Ich schmunzle. »Mit meinem Sohn. Er ist achtzehn.«
»Du bist also nicht verheiratet?«
»Oh nein. Nein. Nein.« Ich winke ab, als wäre dieser Gedanke völlig abwegig. »Das ist schon lange her.«
»Ich war auch mal verheiratet.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Aber Soldatenehen sind schwierig.«
»Andere auch. Kinder?«
Er schüttelt den Kopf. »Mittlerweile bin ich zu alt dafür. Dieses Jahr werde ich vierzig.«
Wer hat diesen Mann gehen lassen? Wer auch immer es war: Die muss bescheuert gewesen sein. Aber gut für mich. ›Ladys, das Spiel ist aus! Sie können alle auf der Stelle nach Hause gehen. Der Gewinner dieses einzigartigen Mannes ist: Sofia Sanders. Applaus! Applaus!‹
Jeff hat offensichtlich nicht die Absicht, das Thema weiter zu vertiefen.
»Was machst du bei der Army?«
»Ich bin so etwas wie James Bond für Maschinen. Ich organisiere und überwache Transporte für Special Operations. Alles, was sich nicht bewegt, bewege ich beziehungsweise sorge dafür, dass es sich bewegt.«
»Ich liebe James Bond«, knallt es wie ein Pistolenschuss aus meinem Mund. »Meine Freundin und ich haben eine Töpferwerkstatt.«
Er sieht mich an wie ein U-Boot. »Und was macht man da?«
»Skulpturen. Charlotte modelliert riesige Insekten und ich Greifvögel. Adler sind meine Favoriten.«
»Das Symbol der Unabhängigkeit. Wunderbar. Sitze ich vielleicht mit einer berühmten Künstlerin zusammen und weiß nichts davon? Sanders … Sofia Sanders …« Er schwenkt den Namen im Mund hin und her wie einen Schluck Wein. »Mit so einem Namen musst du berühmt werden.«
»Meine Mutter war es. Aber ich sehe mich nicht so. Ich muss nicht berühmt sein. Alles hat seinen Preis, weißt du?«
»Hm, aber du stellst aus, oder?«
»Nur in der Mühle, in der wir auch arbeiten. Dort gibt es zwei Ebenen dafür.«
»Nicht in einer Galerie oder einem Museum?«
»Ich operiere undercover sozusagen, so wie du.«
»Mein Großvater sagte immer, eine Gabe ist auch eine Verpflichtung.« Er hebt sein Glas und wir stoßen an. Der Orangensaft rinnt mir rasant die Kehle hinunter.
»Du bist also Soldat?«
»Nicht mehr. Im Oktober bin ich offiziell aus der Army ausgeschieden. Vor einigen Wochen habe ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ich werde weiterhin für das US-Government arbeiten, aber als Zivilperson und in Belgien.«
Wie? Belgien für zwei Jahre? Mir ist, als würde ein Jagdflieger durch meine Schäfchenwolken schießen: Meine Hoffnung faltet sich zusammen wie ein Umzugskarton von Ikea. Klapp. Klapp. Klapp. Scheiße! Scheiße! Scheiße!
»Aber an den Wochenenden werde ich öfter zurückkehren.«
»Wozu?« Ich lege die Hand in den Schoß und grabe die Fingernägel in den Handballen.
»Ich vermisse Stuttgart schon jetzt.« Sein Blick ist undurchdringlich wie ein Dschungel, aber etwas verbirgt sich darin. Und dieses ›Etwas‹ verbindet uns.
»Wo genau wird das sein?«
»SHAPE, nicht weit von Brüssel. Ich weiß noch nicht, welches Haus ich nehmen soll. Es gibt drei zur Auswahl.«
»SHAPE? Was ist das?«
»Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa.« Er konzentriert sich auf jedes Wort und starrt in den Orangensaft. »Ich hoffe, wir sehen uns noch einmal, bevor ich abreise.«
Nein, nein! Ich will die Geschichte dieser Narbe kennenlernen und deine Lippen auf meinen spüren.
K u s s … die Buchstaben schweben aus seinem Mund, und ich lecke jeden einzelnen mit der Zungenspitze ab.
»Wann gehst du denn?«, frage ich, obwohl ich von abreisen überhaupt nichts hören will.
Sein Gesichtsausdruck ist noch trostloser als vor der Diagnose ›Wochenendbeziehung‹. »Am Samstag.«
»Am Samstag? Welchen?«
»Kommenden.«
Nein!Die Antwort trifft mich wie ein Geschoss mitten ins Gesicht und ich schaue zur Seite, um meine maßlose Enttäuschung zu verbergen.
Außer dem Gleiten der Scheibenwischergummis ist im Wageninnern nichts zu hören. Schneeflöckchen schweben wie weiße Ministerne vom Himmel. Will er bloß einen fünftägigen One-Night-Stand? Falls ja, wäre bis zu meinem Auto ausreichend Zeit, um die Frage zu stellen.
Jeff schaut mich von der Seite an, und ich bin mir sicher, dass hinter seiner Stirn etwas vorgeht, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was es ist.
Ich schenke ihm ein unschuldiges Doris-Day-Lächeln und atme gleichmäßig ein und aus. Es heißt doch immer, man soll sich auf das Atmen konzentrieren. Bitte schön: Das hilft überhaupt nichts!
Jeff biegt in die Fabrikstraße und hält hinter dem Ford. Was werde ich antworten, falls er mich fragt: ›Willst du noch mit zu mir und etwas trinken?‹ – ›Ja, aber nur mit Gummi?‹, oder: ›Erst, wenn ich die Geschichte deiner Narbe kenne?‹
Jeff öffnet mir die Wagentüre und ich steige aus. Er sieht mich an, ohne einen Piep von sich zu geben. Er öffnet seinen Mund. Kältewölkchen strömen heraus, sonst nichts. War’s das jetzt?
Ich lasse die Riemen meiner Handtasche von der Schulter gleiten, um nach den Schlüsseln zu suchen. Unter meinem Wollmantel donnert mein Herz.
»Danke für den schönen Abend«, sagt er.
»Magst du Jazz?«, höre ich mich fragen.
»Ob ich Jazz mag?« Er zieht eine Augenbraue nach oben, die mit der Narbe.
»Es gibt da ein Jazzlokal in Stuttgart, ›BIX‹, vielleicht kennst du es? Hättest du Lust, am Mittwoch dorthin zu gehen?«
Die Überraschung ist noch nicht aus seinen Zügen gewichen, als er mit einem »Ja, gerne« antwortet. Süße Hormone durchfluten mich.
Er beugt sich zu mir herunter. Sein Blick taucht in meine Augen wie ein Lot, das man ins Wasser lässt, um die Tiefe zu messen. Ich nehme sein Rasierwasser wahr – ein leichtes Kokosaroma. Er kommt noch näher. Seine Lippen berühren meine rechte Wange, und ich recke meinen Hals, um es noch ein wenig länger auskosten zu können; doch der Moment schmilzt dahin wie ein Eiskristall in einem zauberhaften Winternachtstraum.
3
E
in Strom aus Energie bahnt sich seinen Weg von der Fußspitze bis unter meine Kopfhaut. Sie prickelt, als trüge ich eine Mütze, durch deren Maschen Tausende von Volt fließen. Mit einem Mal bin ich hellwach.
Aus allen Richtungen kommen Puzzleteilchen in Windeseile angeflogen und vereinen sich zu einem faszinierenden Bild: Jeffs Antlitz.
Ich stehe auf, koche mir eine Familienportion Espresso und setze mich in meinen Schaukelstuhl auf die östliche Terrasse. Eingehüllt in die Weichheit und Wärme meiner Decke aus Yakwolle strotze ich minus vier Grad.
Die Sonne kriecht hinter der scharfen Linie des Horizonts hervor, bis sie schließlich wie ein flambierter Pfirsich darüber schwebt. Dort verweilt sie, als wäre sie zu erschöpft, um weiter zu steigen, und verteilt ihr Feuer zu allen Seiten.
Ein neuer Tag, ein neuer Anfang.
An wie vielen brennenden Sonnenaufgängen habe ich schon hier gesessen, mit den falschen Träumen? Will ich mich wirklich mit ihm einlassen? Aber was soll schon passieren? Der anfängliche Zauber wird sich bald verflüchtigt haben. Er wird weit weg sein. Da wird es unmöglich, Nähe aufzubauen. In gewissem Sinne ist das perfekt. Eine Art ›Special Operation‹. Alles wird locker und leicht sein, niemand wird leiden. Ich will nicht leiden. »Okay, Mister Bond«, sage ich laut und reibe mir die Hände.
Es gibt keinen Grund, durch den Ausstellungsraum zu schleichen und auf Samtpfoten die Holzstufen in die Werkstatt zu tapsen, außer dem, Charlotte zu überraschen.
Sie steht, mir den Rücken zugewandt, in der Küche und gießt Kaffee in die Thermoskanne. Ich trete lautlos an sie heran und wedle mit der Papiertüte dicht an ihrem Ohr.
»Huch, ich hab dich gar nicht gehört.«
»Das will ich hoffen.«
»Mhmm, riecht pfundig.«
»Apfelstrudel, noch warm.«
Mein Grinsen muss wie Vanillesoße über mein Gesicht laufen, denn Charlotte sagt nur: »Nein.« Sie ohrfeigt mich, springt zum Holzbüfett und reißt eine Schublade nach der anderen auf.
»Hey!« Ich reibe mir die Wange. »Was soll denn das?«
»Es ist Gefahr im Verzug ist. Das lässt sich ganz bequem in deinem Gesicht ablesen und du sagtest einmal, wenn das der Fall sein sollte, soll ich dir eine knallen.« Sie streckt mir ein DIN-A4-Blatt hin. »Komm. Nimm es.«
Ich lege meinen Kopf schief und lese die Überschrift ›AFP‹, darunter ›Anti-Frustrations-Programm‹. »Ich bitte dich. Ich war nicht zurechnungsfähig als ich das verfasst habe.«
»Das bist du jetzt auch nicht. Du wolltest ein Sabbatjahr einlegen, innerlich wachsen, dich mit niemandem einlassen und schon gar nicht verknallen. Ich les mal vor. Notfallmaßnahmen: Anmeldung für zwei Golfturniere mit Ziel Handicap vierunddreißig, Anmeldung für den Marathon in Berlin –«
»An meinem Handicap arbeite ich schon, das kann man streichen.«
»Keinen Alkohol, keine traurige Musik. Zwei Wochen lang um sechs –«
Ich reiße ihr den Zettel aus der Hand, zerrupfe ihn und werfe die Schnipsel in die Luft. »Das ist ja peinlich.«
»Hey! Das Wichtigste stand unten –«
»Sich durch Regeln einzuengen, wie dumm ist das denn! Ich habe meine Einstellung modernisiert, sozusagen.«
Charlottes eisblaue Augen verengen sich. »Musst du auch die Freiheit und den inneren Frieden modernisieren, die dir so wichtig waren?«
»Nein, aber ich muss dazu nicht wie eine Nonne leben, oder? Regelmäßiger befriedigender Koitus fördert das innere Gleichgewicht und gehört zur Gesundheitsvorsorge einer modernen Frau.« Ich nehme zwei Kuchenteller mit Zwiebelmuster aus dem Büfett, stelle sie auf den Tisch und lege die Apfelstrudel darauf.
»Bevor du auf deinen komischen Berg gegangen bist, wolltest du aber genau das tun.«
»So ist das halt, Charlie, wenn man Dinge überdenkt.« Ich lege die Apfelstrudel auf die Teller. »Und jetzt setz dich.«
»Gut, wie du meinst. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Jetzt erzähl mal.« Charlotte weiß, wenn ich sie Charlie nenne, werde ich langsam mürrisch. Sie schenkt uns Kaffee ein.
»Wir waren beide in einer Superposition.«
Charlotte verdreht die Augen.
»Das ist ein Begriff aus der Quantenphysik. Fred muss darüber referieren, sonst wüsste ich das auch nicht. Das ist eine Überlagerung zweier –«
»Eine Indianerweisheit lautet: Alles, was einmal war, ist immer noch, nur in einer anderen Form.«
Ich überlege. »Diesmal ist es anders. Aber egal, dem Ganzen sind ohnehin Grenzen gesetzt. Denn er wird am Samstag das Land verlassen.«
»Das Land verlassen? Ist er ein Krimineller?«
»Nein, aber diesen Satz wollte ich schon immer mal aussprechen. Wir werden am Mittwoch unser erstes offizielles Date haben.« Ich quetsche ein Stück vom Strudel ab.
»Wie ist er denn so?«
»Imposante Erscheinung, unterkühlter Charme, eine Stimme wie Nougat und dieser Blick, mhmm … Außerdem hilft er einem aus dem Mantel.«
»Das ändert natürlich alles. Sein Name ist aber nicht Superman, oder?«
»Nein, Batman.« Ich lache. »Er ist schwarz.«
»Afrikaner?«
»Amerikaner und seine Haut hat in etwa diese Farbe.« Ich zeige in ihren Kaffee, in dem die Milch, die sie eben hineingegossen hat, sich wie eine Milchstraße in einem Universum spiralförmig ausbreitet.
»Wie alt?«
»Fast vierzig.«
»Nicht zwanzig Jahre älter als du?«
»No, Ma'am.«
»Und was ist nun dein Plan, du hast doch sicher einen, oder?«
»Ich werde im Lager noch einen Brocken Ton holen. Amonia kriegt ein Männchen.«
»Das hab ich nicht gemeint.«
»Ich weiß. Ich werde einen kühlen Kopf bewahren und leise und leicht wie eine Sommerbrise sein.«
Das Lokal im Ambiente der Siebziger schwimmt in einem Meer aus bronzefarbenem Licht und das Stimmengemurmel liegt wie Gischt darüber. Wellenförmige Schablonen ziehen sich quer über die rechte Wand und werden von der Rückseite her bestrahlt.
Ein hagerer Mann, der mit einem Karl-Lagerfeld-Pferdeschwänzchen nur ein Kunststudent sein kann, lotst uns zu einem Tisch im Randbereich. Die Gäste hätten eben abgesagt. Glück für uns.
Jeff hilft mir aus dem Mantel. Bewunderung wäre etwas zu hoch gegriffen, aber die Bände, die sein Gesicht spricht, genieße ich.
Er durchquert den Raum in Richtung Garderobe. Seine Art zu gehen ist Musik für meine Augen.
»Gefällt dir, wo du bist?«, frage ich ihn, nachdem er zurück ist und mir gegenüber Platz genommen hat.
»Dein Geschmack ist exquisit. Und ich bin traurig.«
Hab ich richtig gehört? Traurig? Ich gebe mir keine Mühe, meine Überraschung zu verbergen, denn die Dunkelheit ist auf meiner Seite. »Warum?«
»Seit sieben Jahren bin ich in Stuttgart«, er schüttelt den Kopf, »offensichtlich habe ich was verpasst.«
Es wäre gelogen zu behaupten, es würde mich nicht freuen, das zu hören. Am liebsten würde ich über den Tisch hechten, direkt in seine Arme.
Der Kellner kommt. Jeff bestellt eine Piña Colada und einen Pinot Noir für mich. Die Beleuchtung wird gedimmt und eine fünfköpfige Band betritt die Bühne. Sie beginnen ohne Vorreden mit dem fetzigen Stück ›A Night In Tunisia‹. Der Herr am Nebentisch rutscht auf seinem Sessel hin und her, als säße er auf Hornissen. Seine Freundin daneben stampft zur Unterstützung der Base mit ihren Stiefelhacken auf den Boden.
Mein Blick gleitet zu Jeff, heimlich und leise.
An ihm ist alles zauberhaft: der goldene Glanz auf seinen Gesichtszügen, die feinen Schattierungen um die Nasenflügel, die geschwungenen, dichten Wimpern, die wie Flügel schlagen, wenn er blinzelt. Er strahlt unendliche Ruhe aus. Meine ist dahin. Als er sich die Lippen benässt, verglühe ich.
Unsere Getränke werden serviert. Jeff greift nach seinem Longdrinkglas, als wäre es der heilige Gral, und wir trinken uns zu. Er nippt unbeteiligt daran; seine Körperhaltung ist steif. Ich schlinge meine Finger um den Bauch des Weinglases, nehme einen Riesenschluck daraus und wende meinen Blick zur Bühne, ohne hinzuschauen.
Hinter seiner Facette tobt ein Meer der Gefühle, das fühle ich. Heute Nacht möchte ich seine Lippen zwischen meinen Schenkeln spüren, sein Gewicht auf mir und seinen Namen schreien, wenn ich komme. Ich will in seinem Meer ertrinken.
Ich drehe meinen Kopf zu ihm, und sein Blick durchbohrt mich wie eine Lanze. Ob er weiß, dass ich nach ihm lechze? Bestimmt. Wahrscheinlich wusste er es schon in der Sekunde, als sich unsere Blicke das erste Mal trafen.
Nun sitzen wir uns noch immer gegenüber wie zwei Fremde, und in ein paar Tagen ist er weg! Die Uhr läuft! Ticktack-ticktack-ticktack! Warum zum Geier macht er mir keinerlei Avancen? Irgendwas läuft hier falsch. Doch aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sein Blick über mich gleitet, als täte er etwas Verbotenes.
Nach der Zugabe der Band klatsche ich, bis meine Hände brennen wie Feuer.
Jeff lacht mir zu, völlig unbekümmert, als hätten wir noch alle Zeit der Welt.
Es ist dreiundzwanzig Uhr, als wir das Lokal verlassen. Die Absätze meiner Stiefel hallen auf dem nackten Betonboden des Parkhauses. Es sind nur noch wenige Schritte zum Auto und ich beiße mir auf die Zunge, um nicht die Frage zu stellen.
Jeff bleibt vor der Beifahrertür stehen, greift in die Innentasche seines Mantels und zieht den Autoschlüssel heraus. Wir schauen einander schweigend an: ein Augenblick voller Intimität. Meine Augen brüllen nach einem Kuss. Meine Lippen brüllen nach einem Kuss.
Blutrote Lettern pulsieren zwischen uns. Er muss sie sehen: K u s s K u s s K u s s.
Doch sein Mund öffnet sich keinen Spalt.
Mein Gott, küss mich doch endlich. Tu es. Bitte!
Er blickt hinunter auf den Schlüssel in seiner Hand, hebt seinen Blick und schaut mir in die Augen. Im nächsten Moment höre ich das ›Klack‹, mit dem sich die verfluchten Türen öffnen.
Die blutroten Lettern lösen sich auf und mit ihnen die Intimität, die uns wie ein elektrisch aufgeladenes Feld umgeben hatte. Der Raum zwischen uns füllt sich mit Einsamkeit und in meinem Mund bleibt ein metallisch-bitterer Geschmack zurück.
Was ist nur los mit dem Mann? Trage ich ein Schild um den Hals: ›Anfassen verboten‹, oder sollte ich den ersten Schritt machen?
›Ey Mann, ich bin bereit, Mann! Congratulations! Du hast mich gargekocht, lass uns mal ein Nümmerchen schieben, oder besser eine große Nummer. Was sagste, ey?‹
Er hält mir die Tür auf und ich steige ein. Das dumpfe ›Whuuumm‹, als er sie zuschlägt, erschüttert mich wie ein Beben. Jeff fährt aus dem Parkhaus und verlässt die Stadt über den Westen: durch den Heslacher Tunnel, die Serpentinen, die sich wie eine Viper am Waldfriedhof vorbeischlängeln, Friedhof wie aus, vorbei, tot.
Außer banalen Bemerkungen deutet nichts darauf hin, dass er andere Absichten verfolgt als die, die Nacht allein in seinem Bett zu verbringen.
Mit einhundertzwanzig Stundenkilometern rast er auf der B27, vorbei am Hotel ›Dormero‹, das jenseits der Windschutzscheibe erleuchtet auftaucht. Jeff fragt mich, ob die Temperatur angenehm sei. Obwohl die Klimaanlage zweiundzwanzig Grad anzeigt, fröstelt es mich. Mein ganzer Körper ist ein einziger verspannter Muskelstrang. Er nimmt die Ausfahrt Echterdingen und fährt ebenso am ›Holiday Inn‹ vorbei.
Wie gern wäre ich ihm nahe, so nah wie möglich. Aber ich will nicht wie ein Sexluder wirken und bekomme meinen Mund nicht auf. Dafür hasse ich mich.
Er biegt brav in die Fabrikstraße ab und hält hinter meinem Wagen. Wird er sich jetzt bei laufendem Motor verabschieden? ›Ciao, war nett. Ich verschwinde dann mal aus deinem Leben.‹
Was bleibt von dem Zauber? Der Duft seines Rasierwassers, das mich an Irland, Hochmoore und die Riffs erinnert, an schäumende Wellen, die sich gegen sie werfen und Unmengen von Energien freisetzen und sich schließlich zurückziehen, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Wie in den brandenden Wellen, so schäumt es auch in mir.
Aber, welch Wunder: Er stellt den Motor ab.
Ich reibe an meinem Ohr, aus Nervosität. Die Sekunden zischeln wie an einer Zündschnur. Gleich wird alles vorbei sein.
Herr Runner steigt aus, umrundet das Auto, öffnet die Tür und reicht mir seine Hand. Ich setze erst den rechten, dann den linken Fuß in die frostige und abweisende Nacht.
Jeff lächelt das Lächeln eines Zufriedenen und hebt seinen Arm, damit ich mich einhaken kann. Mit getragenen Schritten geleitet er mich zu meinem Auto, als wären wir auf einer Beerdigung.
Ich fuhrwerke absichtlich umständlich in der Handtasche nach dem Autoschlüssel. In der Ferne heult eine Sirene und ich will schreien: ›Hierher! Kommen Sie, verhaften Sie diesen Mann!‹
Ein Manöver des letzten Augenblicks wäre jetzt nötig, um das Ende abzuwenden und den Anfang von etwas Neuem zu schaffen. Immer noch krame ich in der Handtasche und befürchte, es beginnt suspekt zu wirken.
»Danke für den schönen Abend, Sofia. Ich habe ihn sehr genossen«, höre ich ihn sagen.
Danke! Das kommt einer schallenden Ohrfeige gleich und ich mache mir ernsthaft Gedanken über mein Manöver und blicke ihn an, in dieser speziellen Art, die ein Mann nicht missdeuten kann.
»Du musst vorsichtig fahren, die Straßen sind rutschig.«
Ich senke den Kopf. Auf seinen glänzend polierten Lederschuhen spiegelt sich die traurige Wahrheit: Er verschmäht mich.
Aber ich spüre diese starke Verbindung. Sollte ich mich so täuschen? Traut er sich nicht – wegen der Hautfarbe?
Entschlossen, das Manöver des letzten Augenblicks einzuleiten, öffne ich die Lippen einen Spalt, zu unbedeutend noch, als für die Forderung eines Kusses gehalten zu werden, aber doch einladend genug.
Unsere Blicke treffen sich. Seine Augen schimmern wie die Oberfläche eines tiefen Sees in einer kristallklaren Winternacht, auf der sich das Mondlicht spiegelt. Da gibt es keine Wellen, die sich irgendwo hineinstürzen.
Der Mann, den ich nicht mehr wiedersehen werde, küsst mich auf die Wange, als wäre ich seine Schwester. Ich schäme mich für meine Gedanken und komme mir verdorben vor.
Die Minuten sind abgebrannt.
Das war’s. Ende.
Ich steige in mein Auto und hinter meinen Augäpfeln bildet sich ein Meer von Tränen. Ich starte den Motor und rüttle an dem Schaltknüppel. Wo ist denn dieser scheiß Rückwärtsgang? Und warum zum Henker grinst Jeff so? Verdammt! Ich reiße den Hebel in die richtige Position, stoße einen Meter zurück und höre das verzweifelte Quietschen des Gummis am Randstein. Endlich und absichtlich langsam fahre ich aus der Parklücke, vielleicht würde er mich noch aufhalten wollen. Aber nein. Er steht nur da, mit diesem buddhaähnlichen Lächeln.
Mein Herz will bersten und durch die Windschutzscheibe springen, zu ihm – in seine Arme. Er winkt mir zu, und ich entferne mich von ihm, Meter um Meter, bis er im Rückspiegel auf die Größe eines Mensch-ärgere-Dich-nicht-Männchens geschrumpft ist.
Aaah! Am liebsten würde ich ein Stück aus dem Lenkrad beißen. Danach folgt etwas sehr Simples: Das Gefühl, nicht begehrt zu sein, unwichtig zu sein.
Die bleich beleuchtete Straße, gesäumt von schattenhaften Bäumen, die Nachtwache halten und ihre knochigen Äste ins schwarze Nichts strecken, rollt sich wie eine Trauerschärpe vor den Lichtkegeln aus und gibt mir den Rest. Ich lasse den Tränen freien Lauf und trete das Gaspedal durch.
Dicke, fröhliche Flocken schneien aus dem Himmel und ich hasse jede einzelne davon. Schlimmer ist nur noch die knallgute Laune von Charlotte. Wenn sie mit einem Trällern auf den Lippen in der Werkstatt erscheint, hat es nicht nur saure Gurken zum Frühstück gegeben.
»Hallolele«, flötet sie, doch als ich mich umdrehe, versiegt ihr Lachen. »Sag mir sofort, dass du deshalb so aussiehst, weil er dich nicht hat schlafen lassen.«
»Nun, in gewisser Weise stimmt das, aber ich will nicht darüber reden.« Ich drehe mich weg, schwenke zurück. »Okay. Was willst du wissen.«
ach einer knappen Schilderung der Ereignisse, vor allem derer, die nicht vorgefallen sind, verschwindet sie aus der Werkstattküche mit einem ›Ojemine …‹, in der Umkleidekammer. Unterdessen hole ich aus dem Gewölbekeller, eine Ebene tiefer, einen Zehn-Kilo-Brocken braunen, schamottierten Tons. Als ich wieder hochkomme, hockt Charlotte bereits breitbeinig auf ihrem Schemel und knetet einen Strang Ton für den Schwanz des Erdmännchens, das sie vor drei Tagen begonnen hat.
Ich wuchte den Ton auf die Töpferscheibe.
»Hm, schwul wird er ja wohl nicht sein, oder?«
»Charlotte!«
»Vielleicht hat er einen Schuss weg? Ich hab mal eine Doku gesehen über ehemalige Soldaten.«
»Das heißt Veteranen.«
»Meinetwegen. Manche drehen durch und –«





























