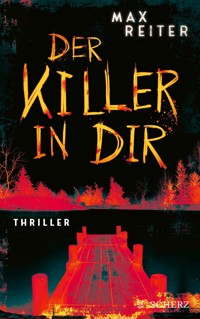14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ihr Leben gehört ihr nicht mehr. Aber sie wehrt sich. Bis zum Letzten. Annika ist sympathisch, attraktiv und beruflich erfolgreich. Aber jeder, der ihr begegnet, spürt: Sie lässt absolut niemanden an sich ran. Warum? Annika musste eine schreckliche Lektion lernen: Alle, die ihr nahe waren – der geliebte Mann, den sie gerade geheiratet hatte, ihre beste Freundin –, sind tot. Ermordet. Sie mussten sterben. Denn ein Unbekannter kontrolliert unerbittlich Annikas ganzes Leben. Wie kann sie dieser Falle entkommen? Verzweifelt beginnt sie ein manipulatives Spiel. Es kann ihr Freiheit bringen – oder den Tod. Zum Eintauchen: subtile Psychospannung, die berührt und unter die Haut geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Max Reiter
Du gehörst mir
Psychothriller
Über dieses Buch
Sie haben ihr ganzes gemeinsames Leben vor sich: Als Annika und Loris auf Hochzeitsreise nach Asien gehen, erscheint die Zukunft offen und voller Glück. Doch auf der Reise geschieht das Unvorstellbare: Loris wird ermordet. Annika kommt zutiefst verstört zurück nach Hamburg. Jetzt ist ihr einziger Halt Emily, ihre beste Freundin. Als auch sie stirbt, muss Annika erkennen, dass sie von einem Stalker verfolgt wird. Einem Mann, der sie beobachtet, beherrscht, bewacht. Er rührt sie nicht an, aber sie ist seine Gefangene. Annika zieht nach München, aber ihr Leben gehört ihr nicht. Bis sie eines Tages den Journalisten Marvin kennenlernt…
Weitere Titel von Max Reiter:
»Erinnere dich!«
»Der Killer in dir«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Das Unbekannte in uns, die Abgründe ganz normaler Menschen haben Thrillerautor Max Reiter schon lange fasziniert. In »Erinnere dich!« ging es ihm um die Art, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. In »Der Killer in dir« folgt er dem Bösen im Alltäglichen mit höchster Thrillerspannung. Dies spielt auch in seinen Kriminalromanen aus dem München der 1950er Jahre, die er unter seinem richtigen Namen Andreas Götz veröffentlicht hat, eine wichtige Rolle. Sein Psychothriller »Du gehörst mir« führt uns in ein Stalker-Szenario, das unter die Haut geht.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Andreas Götz
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Ilse Wagner
Covergestaltung: Johannes Wiebel|punchdesign
Coverabbildung: Johannes Wiebel unter Verwendung eines Motivs von AdobeStock
ISBN 978-3-10-492058-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Luzern, Schweiz, 2023
1. Kapitel
Hamburg, 2016
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
München, 2023
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Hamburg, 2016
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
München, 2023
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Hamburg, 2016
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
München, 2023
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
München, 2018
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
München, 2023
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
München/Hamburg, 2019
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
München, 2023
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
In den Schweizer Bergen, 2023
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
Hamburg, 2024
60. Kapitel
Luzern, Schweiz, 2023
1
Keine besonderen Vorkommnisse. Das sah sich der Luzerner Polizist Beat Bürgli schon in seinen Einsatzbericht schreiben, wenn er nachher auf die Wache kam und die Nachtschicht beendete. Er und sein Kollege Mesut Öztürk hatten den Streit zweier Betrunkener geschlichtet, einem verirrten Touristenpärchen Orientierung gegeben und ein paar Strafzettel wegen Falschparkens geschrieben. Die restliche Zeit hatten sie ihre Runden gedreht und an den üblichen Brennpunkten einfach die Augen offengehalten. Aber solange die dicke Frau singt, ist die Oper nicht zu Ende, hatte sein alter Herr, ebenfalls Polizist, stets gesagt. Und er sollte recht behalten, denn während Bürgli gedanklich schon auf der Wache weilte, stieß Kollege Öztürk ihn mit dem Ellbogen in die Seite.
»Guck dir den da vorn mal an«, sagte er. »Da stimmt doch was nicht.«
Damit konnte Mesut recht haben, fand Bürgli. Ein schwarzer Mini stand mitten auf der Gegenspur, die Scheinwerfer waren eingeschaltet. Drinnen saß eine Frau und starrte vor sich hin.
Öztürk stoppte den Streifenwagen in einem Sicherheitsabstand von ungefähr fünfzehn Metern.
»Bleib am Funk«, sagte Bürgli. »Ich schau mir das mal aus der Nähe an.« Bevor er aussteigen konnte, ging die Tür des Mini auf, und die Fahrerin trat auf die Straße. Sie wirkte wie in Trance. Oder im Drogenrausch. Doch es war nicht das, was Bürgli erschreckte und ihn flüstern ließ: »Heilige Muttergottes …« Die Kleidung der Frau war voller Blut. War das ihr Blut? Oder das eines anderen? In der Hand hielt sie ein Messer. Ebenfalls blutverschmiert.
Bürgli sprang aus dem Streifenwagen, zog und entsicherte die Waffe. »Bleiben Sie, wo Sie sind!«, rief er über die Straße. »Und werfen Sie das Messer weg! Sofort!«
Die Frau blieb stehen und schaute das Messer an, als falle ihr erst jetzt auf, dass sie es in der Hand hielt.
Vorsichtig näherte sich Bürgli. Eine Verrückte, dachte er. Zweifellos eine Verrückte.
»Sind Sie verletzt?«, fragte er. »Oder ist jemand anders verletzt?«
Die Frau ließ das Messer fallen.
»Ja«, sagte sie nur.
Hamburg, 2016
2
»Wer einen Grund vorbringen kann, warum dieses Paar nicht den Bund der Ehe eingehen soll«, sagte der Priester und schaute in die Runde der versammelten Hochzeitsgäste, »der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen.«
Annika hielt den Atem an. Sie war schon bei vielen Hochzeiten gewesen, und niemand erwartete je ernsthaft, dass sich in der Stille, die diesen Priesterworten folgte, jemand unter den Verwandten und Freunden erhob oder gar eine mysteriöse Gestalt wirkungsvoll aus dem Halbdunkel unter der Empore hervortrat, die Faust gen Himmel streckte und schallend durch die Kirche rief: Ich habe einen Grund!, um danach ein schreckliches Geheimnis zu enthüllen, das die Ehe verhinderte (die Brautleute seien in Wahrheit verwandt, einer von beiden längst anderweitig vermählt oder ähnlich). Trotzdem war da doch jedes Mal dieser Moment der Anspannung und der Ungewissheit, so als könne etwas ans Licht kommen, das selbst den Betroffenen nicht bewusst war. Das ihnen die Eltern verschwiegen hatten. Oder das sie verdrängt hatten. Heute spürte Annika diese Anspannung deutlicher denn je, schließlich war die Frau in dem pompösen Kleid aus Seide, Tüll und Spitze und der voluminösen Hochsteckfrisur niemand anders als sie selbst.
Wenn es aus Annikas Sicht etwas gab, das gegen die Ehe mit Loris sprach, dann war es genau das, was aus der Sicht aller anderen, vor allem ihrer Eltern, dafürsprach: Loris’ Familie war reich und höchst angesehen, skandalfreier Hamburger Geldadel seit mehreren Generationen. Obwohl alle in Loris’ Familie großzügig, offen und zugetan waren, schnürte der bloße Gedanke daran, weiter in diesen Kreisen zu verkehren, Annika manchmal den Atem ab. Sie stammte selbst aus wohlhabendem Haus und hatte genau das hinter sich lassen wollen. Dabei hatte sie nichts gegen Geld und schöne Dinge. Nur die Art, wie reiche Leute die ererbten Annehmlichkeiten, die sie genossen, für selbstverständlich nahmen, ja sogar dachten, sie hätten sie sich verdient, stieß sie ab. Und noch mehr, wie sie auf Leute herabblickten, die weniger hatten als sie, und überhaupt alles und jeden danach bewerteten, was er oder sie besaß, obwohl natürlich niemand je über Geld sprach, denn das galt als unfein. Eine Ausnahme von letzterer Regel war Annikas Mutter, die, zumindest wenn sie unter sich waren, selten ein Blatt vor den Mund nahm. Annika wollte ein einfaches Leben, in dem nicht schon immer alles wie von selbst da war. Niemand sollte zu ihr aufschauen, nur weil sie einen bestimmten Namen trug. Niemand sollte ihre Nähe und Freundschaft suchen, nur weil er oder sie sich etwas davon erhoffte. Würde Loris ihr so ein Leben bieten? Nur wenn er mit seiner Familie brach, so wie sie, zumindest innerlich, mit der ihren längst gebrochen hatte. Doch das konnte sie nicht von ihm verlangen. Er hing an seinen Lieben. Sollte sie also selbst die Hand heben und rufen: Ich habe einen Grund!
Wie könnte sie! Sie liebte Loris, wie sie nie zuvor einen Menschen geliebt hatte. Er war sanft, treu und voller Humor und hatte damit so ziemlich alles, was sie sich von dem Mann, mit dem sie ihr Leben teilen wollte, erhoffte. Keine Reiche-Leute-Allüren, keine Jacht im Hafen, keine teuren Sportwagen in der Garage. Auch kein abfälliges Gerede über andere Leute, stattdessen viel Selbstironie und spontane Wärme. Bis jetzt hatte Loris ihr noch keinen einzigen Grund gegeben, ihn nicht zu lieben, wenn man von seiner Angewohnheit, im Bett Socken zu tragen, einmal absah. In der Vergangenheit hatte dieses bis jetzt schwer auf der Waage des Für und Wider gewogen. An Loris‘ zahlreichen Vorgängern hatte Annika noch jedes Mal über kurz oder lang etwas gefunden, das sie störte. Erst nur ein bisschen. Bald etwas mehr. Und dann war dies und jenes dazugekommen, bis es zu viel wurde und sie spürte, dass es eben nicht die Liebe war, die sie sich vorstellte. Das war der Punkt, an dem sie die Beziehung für gewöhnlich abbrach. Bei Loris hatte es diesen Punkt bis jetzt nicht gegeben. Er war der Richtige, einfach perfekt. Und er würde es bleiben, für immer und ewig. Glaubst du das wirklich?, flüsterte die Stimme in ihrem Kopf. Statt die Hand zu heben, umfasste Annika den Brautstrauß noch ein wenig fester. Da sich auch sonst niemand erhob, keine mysteriöse Gestalt aus dem Halbdunkel unter der Empore hervortrat und die Faust gen Himmel streckte, um schreckliche Geheimnisse zu enthüllen, fuhr der Priester in der Zeremonie fort und lotste Annika und Loris sicher in den Hafen der Ehe. Das Jawort wurde gegeben, die Ringe wurden getauscht, der Bund fürs Leben gesegnet.
»Sie dürfen die Braut jetzt küssen.«
Ein eher schüchterner Kuss besiegelte die Ehe. Annika zwinkerte Loris zu, und er verstand, was sie meinte, und lächelte fein. Das Küssen konnten sie beide besser, aber es musste ja nicht vor den Augen der versammelten Verwandtschaft sein. Unter dem Getöse der Orgel schritten sie aus der Kirche, ließen sich auf dem Vorplatz mit Reis und Rosenblättern bewerfen und nahmen die Glückwünsche der Gäste entgegen. Eine weiße, von zwei Schimmeln gezogene Kutsche wartete schon darauf, sie in den blumengeschmückten Festsaal zu bringen. Annika hatte sich bei der Vorbereitung einen Spaß daraus gemacht, angefangen vom Hochzeitskleid über die Kutsche bis hin zur Musikauswahl, bei der Feier kein einziges Hochzeitsklischee auszulassen – wennschon, dennschon! Die Hochzeitstorte, groß genug, den Hunger der Welt zu stillen, war legendär! Diese ironische Übererfüllung der romantischen Erwartungen war ihre Art, sich vor der befürchteten Enttäuschung zu schützen. Nun aber ging Annika all das doch mehr ans Herz, als sie erwartet hatte. Das, was hier passierte, war kein Spaß. Und auch mehr als bloß eine Formalität. Es war ernst und bedeutete etwas. Sie war verheiratet! Sie war nicht mehr allein. Sie, die sich ihr ganzes Leben lang allein gefühlt hatte – in der Familie, in Beziehungen. Selbst ihre beste Freundin Emily hatte, so nahe sie sich auch standen, diese Leere nicht ganz ausfüllen können. Nicht so, wie Loris es konnte. Bis jetzt.
»Drücken die Schuhe sehr?«, fragte Annika ihn in der Kutsche, über das laute Hufgeklapper der Pferde hinweg.
»Wie die Hölle.« Er stöhnte und erlaubte sich zum ersten Mal ein schmerzverzerrtes Gesicht. Der Ärmste! Er war so tapfer! Das musste belohnt werden. Mit einem Kuss. Einem richtigen Kuss. Sie beugte sich über ihn, berührte erst seine Lippen sanft mit den ihren, ehe sie ihren Mund öffnete und sich ihre Zunge in seinen Mund vortastete. Loris’ Zunge nahm die Aufforderung zum Tanz an, und je länger und lauter die Musik spielte, desto heftiger und leidenschaftlicher wurde der Tanz.
»Ich wünschte, wir könnten jetzt ohne Umweg nach Hause fahren«, sagte Loris, nachdem sie sich voneinander gelöst hatten. »Ich bin so heiß auf dich …«
»Ich hätte das alles nicht gebraucht.« Annika wischte ihm die Lippenstiftspuren aus dem Mundwinkel.
»Ich doch auch nicht. Wir tun das nicht für uns, sondern für Familie und Freunde. Niemand ist eine Insel. Auch ein Ehepaar nicht, bei aller Liebe.«
Das hatte er jedes Mal gesagt, wenn sie sich über den Aufwand beklagt hatte. »Weiß ich doch.«
Wäre es nach Annika gegangen, hätten sie die Hochzeit – wenn überhaupt – im kleinen Rahmen gefeiert. Ein paar enge Freunde, Menschen, die ihnen beiden etwas bedeuteten, im Nebenraum ihrer Lieblingspizzeria, mehr nicht. Loris hatte sie davon überzeugt, dass das egoistisch wäre, schließlich gab es so viele Menschen, ohne die sie nicht die wären, die sie waren. Sie hatten ein Recht darauf, diesen Tag mitzufeiern. »Okay, okay.« Annika hatte sich geschlagen gegeben. Die Familie musste man also einladen (obwohl Annika auf ihre snobistischen Eltern gern verzichtet hätte), aber wo hörte die familiäre Verpflichtung auf? Welchen Onkel, welche Tante, welchen Cousin und welche Cousine konnte man weglassen, ohne eine lebenslange Fehde zu riskieren? Wie war es mit Freunden? Da sie niemanden vor den Kopf stoßen wollte, lud Annika eben alle ein. Und Loris machte es genauso. Als sie die Liste, die mehrere DIN-A4-Seiten füllte, vor sich sahen, zuckte Loris schicksalsergeben mit den Schultern und meinte: »Scheiß drauf. Am Tag danach liegen wir auf den Malediven am Strand, schlürfen Mai-Tais und erholen uns von dem Zirkus.«
Emily war nicht nur Annikas beste Freundin, sie war die Schwester, die Annika nie hatte. Und umgekehrt. Obwohl Emily eigentlich eine Schwester hatte. Sogar zwei. Dass sie mit keiner von ihren echten Schwestern so eng verbunden war wie mit ihrer Seelenschwester Annika, das machte diese stolz. Sie kannte Emily seit dem Kindergarten und war nie länger als ein oder zwei Tage ohne Kontakt zu ihr gewesen (und seit sie Smartphones besaßen, keine drei oder vier Stunden). Annika konnte lediglich mit einem blutsverwandten Bruder aufwarten, einem Ekelpaket namens Roland, der dreißig und damit knapp vier Jahre älter war als sie, zum Glück weit weg in London lebte und den Erwartungen insofern gerecht geworden war, als dass er drei Tage vor der Hochzeit die Reise über den Ärmelkanal mit einer schnöden WhatsApp-Nachricht absagte. Angeblich eine Sportverletzung, die er sich beim Joggen zugezogen hatte. Sprunggelenk oder so. Sorry, Schwesterherz! Bei deiner nächsten Hochzeit bin ich dabei. Versprochen ;-) Nicht, dass Annika ihn vermisst hätte. Aber die faule Ausrede nahm sie ihm übel. Wieso sagte er nicht einfach, dass er keine Lust hatte? Sicher nicht aus Rücksicht auf ihre Gefühle. Er fürchtete wohl eher, dass die standesbewussten Eltern ihm den fehlenden Familiensinn übelnehmen würden. Und sie zu verstimmen, konnte den Geldfluss zwischen Alster und Themse ins Stocken bringen. Emily nahm Roland in Schutz. »Du bist nicht die Einzige, die unter euren kaltherzigen Eltern zu leiden hatte«, sagte sie. »Für Roland war es sicher auch nicht leicht.«
Annika hatte Emily nicht nur die Gunst erwiesen, als Trauzeugin fungieren zu dürfen, sie hatte ihr auch das ehrenvolle Amt übertragen, ihr bei jedem Toilettengang mit dem Kleid zu helfen. Die beiden dehnten die kleinen Auszeiten vom Feiertrubel stets so lange, wie die Abwesenheit der Braut gerade noch vertretbar war, schlürften an den Waschbecken Champagner, den Emily, ein nicht unwesentlicher Teil ihrer Verpflichtung, aus dem Festsaal mitzubringen hatte.
»Bereust du es schon?«, fragte Emily, nachdem sie Annika als Braut wiederhergestellt hatte. Aus dem Saal drang die Musik der Liveband Titel aus den Achtzigern und Neunzigern. Ein Tribut an die älteren Semester unter den Gästen.
»Es ist das Richtige«, sagte Annika. »Er ist der Richtige.« Sie sah sich im Spiegel zu, wie sie einen Schluck Champagner nahm, und obwohl ihr die brünette Frau mit den großen bernsteinfarbenen Augen, die sie dort sah, gefiel, fügte sie hinzu: »Brief und Siegel hätte ich trotzdem nicht gebraucht. Aber Loris ist nun mal Jurist. Für ihn muss es was Formelles sein. Wird wohl irgendwann zu einer Art Fetisch, wenn man den ganzen Tag Akten und Gesetzbücher wälzt.«
Emily zog eine Augenbraue hoch. »Siehst du. Es fängt schon an.«
»Was?«, fragte Annika, obwohl sie wusste, was Emily meinte. Sie hatten in langen Abenden ausgiebig darüber diskutiert. Hin und her. Her und hin.
»Du tust Dinge, die du eigentlich nicht tun willst. Ihm zuliebe. Das heißt, er bestimmt über dich.«
»Heißt es nicht. Für jemanden etwas zu tun bedeutet nicht automatisch, von jemandem bestimmt zu werden. Nicht zwangsläufig. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass so ein Tag wie dieser, so eine Feier mit Gelöbnis und Versprechen und allem … dass das doch etwas mit einem macht. Ich bin froh, dass wir es getan haben. Glaub es oder nicht: Ich habe Spaß und würde es nicht mehr anders wollen.«
Emily biss sich auf die Unterlippe. Annika wusste, was das bedeutete. Sie war ihr dankbar, dass sie sich jede weitere Diskussion verkniff, obwohl sie tausend Gegenargumente und Widerworte abrufbereit im Kopf hatte, die Annika sich in ihrem eigenen inneren Zwist tausendmal gesagt hatte und die immer noch in ihren Gedanken herumgeisterten. Denn Emilys Einwände waren ihre eigenen Einwände gewesen. Sie waren sich einig gewesen, dass sie freie Frauen waren, die sich von keinem Mann etwas sagen ließen. Die sich nicht fesseln ließen, auch nicht durch Gefühle, denn welches Gefühl währte schon ewig? Weil Annika sich nun doch an jemanden band, aufgrund eines Gefühls, fühlte sie sich wie eine Verräterin. Obwohl Emily sie nie so genannt hatte.
»Ich mag Loris echt«, sagte Emily nun versöhnlich. »Er ist ein toller Kerl, sieht zwar nur durchschnittlich aus, hat aber einen guten Charakter und beste berufliche Aussichten. Und das Wichtigste: Er wird dich glücklich machen. So glücklich, wie man in einem goldenen Käfig eben sein kann. Und sollte er dich nicht glücklich machen, kannst du dich ja jederzeit wieder scheiden lassen.« Emily zwinkerte.
Darauf ließen sie die Gläser klingen und den Champagner ihre Kehlen hinabfließen. Dass Emily Loris nur durchschnittliches Aussehen bescheinigte, ließ Annika unwidersprochen. Objektiv betrachtet hatte sie vielleicht recht, und deshalb sollte sie es ruhig aussprechen. Objektiv betrachtet war Loris eine Fünf, bestenfalls eine Sechs. Aber anders als Emily war Annika nicht objektiv. Sie fand nichts an Loris, das sie nicht schön gefunden hätte. Liebe machte manchmal blind, aber viel öfter öffnete sie einem auch erst die Augen für die wahre Schönheit eines Menschen.
Die Auszeit von Braut und Trauzeugin endete abrupt, als eine von Annikas Cousinen hereinkam und, deutlich angeschickert, verkündete: »Da draußen sucht ein herrenloser Bräutigam verzweifelt seine Braut.«
Als alle Gläser geleert, alle Tänze getanzt und alle Glückwünsche mehrfach tränen- und kussreich ausgesprochen waren, war die Zeit für Annika und Loris gekommen, sich zurückzuziehen. Die Lichter im Saal wurden heruntergedimmt, die Musikkapelle stimmte Dolly Partons »I Will Always Love You« an, und die Gäste standen mit funkensprühenden Wunderkerzen Spalier für den feierlichen Auszug des Brautpaares. Bis jetzt hatte Annika noch kaum Gelegenheit gehabt, sich romantischen Gefühlen hinzugeben, bei all dem Trubel um sie herum, doch nun war es um sie geschehen. Tränen stiegen ihr in die Augen, sie hakte sich bei Loris unter und bemerkte auch in seinen Augen ein Glitzern. Von der gesamten Hochzeitsgesellschaft liebevoll geleitet, schritten sie durch das Spalier aus dem Saal.
An der Straße wartete schon der Wagen. Ein gemieteter Bentley mit Chauffeur, darunter machte es ihr Papa nicht. Ihr war seine Protzsucht zuwider. Er leistete sich die Dinge nicht, um sie zu genießen, sondern um etwas zu demonstrieren. Hatte er das Eine, wollte er schon das Nächste. Und nur, um vor anderen zu glänzen. Es gab wenig, das ihm wirklich etwas bedeutete, das hatte Annika schon früh gespürt. Ein Bentley für eine kurze Fahrt durchs nächtliche Hamburg – ging es nicht eine Nummer kleiner? Aber es half nichts, in den Augen ihres Vaters war es eine schlichte Notwendigkeit, schließlich waren sie die Burghardts, eine Kaufmannsfamilie seit mehreren Generationen, die einen Ruf zu verteidigen hatte, auch wenn sich die Familie längst vom aktiven Geschäft verabschiedet hatte und nur noch im Hintergrund agierte. Die Burghardts waren heutzutage nur deshalb noch reich, weil sie schon immer reich gewesen waren.
Die Eltern des Brautpaares und die Trauzeugen brachten die Frischvermählten zum Wagen, um sich dort ein letztes Mal und jetzt endgültig zu verabschieden. Annika war ihrer Mutter den ganzen Tag so gut wie möglich aus dem Weg gegangen. Sie ertrug ihren selbstzufriedenen Blick nicht, der sagte: Bist du doch noch vernünftig geworden und hast dir eine gute Partie geangelt. Für ihre Mutter war diese Heirat ein Sieg auf ganzer Linie. Wie sie Loris und seine Eltern umschmeichelte und sich gleichzeitig in ihrer typischen Art ständig in den Vordergrund spielte, war geradezu peinlich. Doch davon hatte Annika sich nicht den Tag verderben lassen. Jetzt freute sie sich darauf, endlich Ruhe vor ihrer Mutter zu haben. Sie ließ sich erst von ihrem Vater, dann von ihrer Mutter umarmen. Als ihre Mutter sich schließlich löste, hatte sie feuchte Augen und sagte mit zittriger Stimme: »Du hast mich heute zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht.«
Annika, die schon während der befremdlichen Umarmung innerlich erstarrt war, traute ihren Ohren kaum. Dann sagte sie mit spitzer Stimme: »Vergiss nicht, dass ich heute geheiratet habe, Mama, nicht du.«
Annika wandte sich ab, und da fiel ihr Blick über das Autodach hinweg auf die andere Straßenseite, wo im Schein der Straßenlaterne ein Mann stand und die Abschiedsszene aufmerksam beobachtete. Er kam ihr bekannt vor, doch von woher?
Als die Autotüren endlich zufielen und der Wagen sich langsam in Bewegung setzte, sanken Annika und Loris zurück in die Ledersitze, die mit einem kaum hörbaren Seufzen dem Druck der Körper nachgaben.
»Geschafft«, sagte Loris.
»Geschafft«, sagte Annika.
Sie schwiegen eine Weile, genossen die Ruhe, die vom gleichförmigen Summen des Motors grundiert wurde.
»Du warst wunderbar«, brach Loris nach einer Weile das Schweigen.
»Du auch. Wenn ich noch einmal heiraten sollte, dann nur dich.«
»Unglaublich. Du hast mit allen getanzt.«
»Meine Beine fühlen sich an, als hätte ich den Mount Everest bestiegen.«
»Sogar mit meinen nervigen Juristenfreunden hast du getanzt.«
»Yes, Sir. Bis auf den einen, der nie tanzt.«
»Holger?« Loris grinste. »Der ist heimlich in dich verliebt, und es würde ihm wahrscheinlich das Herz brechen, dich im Arm zu halten, aber nicht haben zu können. Stille Wasser sind bekanntlich tief.«
Annika schoss ein Gedanke in den Kopf. »Jetzt weiß ich’s!«, rief sie aus.
»War nur ein Witz«, wiegelte Loris ab. »Holger ist nicht verliebt. Er ist einfach nur ein mieser Tänzer, total verklemmt und außerdem ein Langweiler vor dem Herrn. Ich musste ihn einladen, weil …«
»Ich meine nicht diesen Holger«, unterbrach Annika ihn. »Der Typ, der uns vorhin von der anderen Straßenseite aus beobachtet hat.«
»War da jemand? Ist mir nicht aufgefallen.«
»Das war Justus Korn. Er war mit mir in der Schule. Letzte Reihe, Fensterplatz. Hat mich angehimmelt, aber nie ein Wort gesagt. Und wenn jemand ihn ansprach, wurde er sofort knallrot. Wir nannten ihn Feuermelder. Mir hat er leidgetan. Und eben wieder, als er da so stand. Armer Kerl.«
»Sein Problem«, sagte Loris. »Du solltest dich lieber mit meinen Problemen beschäftigen.« Er legte seine Hand in Annikas Nacken und zog sie zu sich heran.
»Und welche Probleme wären das?«, fragte sie.
»Zum Beispiel, wie ich dich nachher aus diesem Kleid rauskriege …«
3
Seit er sie in ihrem Brautkleid gesehen hatte, konnte er an nichts anderes mehr denken als an sie. Obwohl sie ihm schon viel länger durch den Kopf spukte. Obwohl ihm schon viel länger klar war, dass er sie haben musste. Nur das Wie war noch nicht entschieden. Wollte er sie so haben wie all die anderen vor ihr? Die Frauen und Männer, die Jungen und Alten, an denen er seit Jahren seine sehr speziellen Phantasien ausgelebt hatte? Oder sollte er etwas völlig anderes versuchen? Die Zeit für eine Veränderung war gekommen, er spürte es schon lange, und das hatte nichts mit Annika zu tun. Er hatte eine Idee für dieses Neue in seinem Leben, fragte sich jedoch, ob sie durchführbar war. Und ob sie ihm die Befriedigung bringen würde, die er sich erhoffte. Die er brauchte.
Unruhe kam in die Menge der Wartenden am Gate. Das Boarding für den Flug der Air France nach Paris begann. Er betrachtete seine Mitreisenden, die sich in einer Reihe vor dem Schalter aufstellten. Ein Liebespärchen gewann seine besondere Aufmerksamkeit. Sie konnten kaum aufhören, sich zu küssen, zu befummeln, zu liebkosen. Ob sie sehr viel von Paris, der Stadt der Liebe, sehen würden? Oder die Zeit nicht eher im Hotelbett verbringen würden? Vielleicht war es ihre Hochzeitsreise. Er hatte solchem Turteln noch nie etwas abgewinnen können. So wenig wie allen anderen Formen, in denen die Menschen sich ihre Zuneigung, ihre Liebe zeigten. Nicht einmal Sex hatte ihn jemals wirklich interessiert, zumindest nicht so, wie ihn die meisten Menschen auslebten. Das kam ihm alles so banal vor. Kleingeld in der Währung der Lüste, wo er mit großen Scheinen zahlte. Doch neuerdings hatte sich etwas in ihm geändert. Etwas Grundlegendes. Und darauf musste er reagieren.
Als das Gedränge vor dem Schalter nachließ, erhob er sich und ging hinüber. Die Frau, die dort ihren Dienst tat, begrüßte ihn mit einem Lächeln, zog seine Boardingkarte über den Scanner und wünschte einen guten Flug. Genau wie die Flugbegleiter, die ihn wenig später am Eingang der Maschine begrüßten, ein Mann und eine Frau, beide adrett. Die Frau hatte große blaue Augen. Wie Murmeln. Er spielte gern mit Murmeln. Und der Rest von ihr war auch reizvoll. So viele Möglichkeiten. Doch keine einzige, die er nicht schon durchgespielt hatte. Mehrfach.
Seine Sitznachbarin gefiel ihm weniger. Sie war eine von den Menschen, die glaubten, man müsse miteinander reden, nur weil einem das Schicksal in Form eines elektronischen Boardingsystems nebeneinanderliegende Sitze zugewiesen hatte. Er spielte die Rolle des umgänglichen Zeitgenossen, die er als junger Mann mühsam erlernt hatte, um nicht als der verschrobene, tief gestörte Psychopath erkannt zu werden, der er in Wirklichkeit war. Erzählte von seiner Airbnb-Wohnung mitten in Paris, von seinen Plänen, gab sich als Kunstfreund und Gourmet aus. Alles gelogen, bis auf die Wohnung, die er tatsächlich gemietet hatte. Doch nur zur Tarnung. Sollte irgendwann jemand auf die abwegige Idee kommen, seine Flugbewegungen der letzten Jahre mit gewissen schrecklich verstümmelten Leichen in Mumbai in Verbindung zu bringen, durfte diese Suche zu nichts führen. Er war jedes Mal nachweislich an einem ganz anderen Ort. Doch auch dieses Mal würde er am nächsten Tag unter einem anderen Namen in einem Flieger nach Mumbai sitzen, wo die wahren Freuden auf ihn warteten. Vorsicht war sein zweiter Vorname, Übervorsicht seine Natur. Es reichte nicht, nur das Unwahrscheinliche zu bedenken, man musste auch das schier Unmögliche ins Kalkül ziehen. Nur dann war man wirklich sicher. Nur dann bescherte einem ein gnädiges Schicksal glückliche Zufälle wie den, dass Annikas und Loris’ Hochzeitsreise ebenfalls in diese Ecke der Welt führen würde.
4
Nach den zehn Luxustagen auf den Malediven – Bungalow mit eigenem Pool und exklusivem Zugang zum Meer –, all dem Schnorcheln und Tauchen in türkisfarbenem, glasklarem Wasser, um eine bunte Unterwasserwelt zu bestaunen, die längst im Sterben lag; nach all den feinen Abendmenüs, den teuren Drinks und Cocktails, war das hektische, aufreibende Indien der größtmögliche Gegensatz, der sich zu so einem süßen Müßiggang denken ließ. Es war Loris’ Idee gewesen, sich mit diesem extremen Kontrastprogramm an die eigenen Privilegien zu erinnern, und er hatte wohl nicht erwartet, dass Annika den anfangs gar nicht ernst gemeinten Vorschlag so begeistert aufnehmen würde. Er hatte nur auf die Landkarte gezeigt und gesagt, es sei erschreckend, wie nahe Luxus und Elend beieinanderlägen, niemand solle nur die eine Seite ohne die andere sehen. »Dann lass uns das machen«, hatte Annika erwidert, »wenn wir schon in der Gegend sind.« Hätte Loris sie dafür noch mehr lieben können, als er es ohnehin schon tat, er hätte es getan. Doch das war unmöglich. Sie sahen dann bei ihrer Tour mit einem einheimischen Führer abseits der Sehenswürdigkeiten, in den Städten und Dörfern, die sie besuchten, tatsächlich viel Armut und Elend, aber nicht nur. Sie sahen auch ein stolzes Land im Aufbruch, das dabei war, seine Fesseln zu sprengen.
Den Tag vor der Heimreise verbrachten Loris und Annika in einem Hotel in Mumbai. Er sollte dem Einkauf von Andenken und Mitbringseln für Familie und Freunde vorbehalten sein. Da Annika an diesem Tag jedoch Kreislaufprobleme hatte, blieb sie lieber im Hotel, weshalb Loris allein loszog. Ihr Führer, der sie nach der Ankunft im Hotel verlassen hatte, hatte ihnen einen Markt empfohlen, auf dem sie alles finden würden, was sie suchten, von Gewürzen über Saris und Schmuck bis hin zu kunsthandwerklichen Dingen.
Der Markt war nicht weit vom Hotel entfernt, so dass Loris kein Taxi nahm, sondern zu Fuß ging. Als er die klimatisierten Räume des Hotels verließ und auf die Straße trat, prallte er wie gegen eine Wand aus schwüler Hitze, Staub und Dunst. Kaum hundert Meter weiter fragte er sich, ob er nicht vielleicht doch besser ein Taxi genommen hätte, denn er war komplett durchgeschwitzt und kriegte nur schwer Luft. Er wischte sich mit der Hand den Schweiß aus dem Gesicht. Da huschte neben ihm wie ein dunkler Schatten ein Wagen heran und hielt an der Bordsteinkante. Loris vermutete im ersten Moment ein Taxi, dessen geschäftstüchtiger Fahrer den Europäer erkannt hatte und ihm nun seine Dienste aufdrängen wollte. Doch auf den zweiten Blick kam ihm der Wagen verdächtig vor, denn es war ein Suzuki Minivan mit abgedunkelten Scheiben, an dem nichts darauf hinwies, dass es sich um ein Taxi handelte. Wohl ein illegaler Chauffeurdienst. Loris hatte gelernt, unerwünschte und unseriöse Angebote abperlen zu lassen, indem er die Zurufe ignorierte und einfach weiterging. Das machte er auch jetzt und tat so, als höre er die »Mister, Mister«-Rufe nicht. Erst als er vernahm, wie die Schiebetür des Wagens aufgerissen wurde, und sah, wie zwei Männer heraussprangen, dämmerte ihm, dass er die Situation falsch eingeschätzt haben könnte. Kräftige Hände packten ihn und zerrten ihn ins Auto, die Tür schlug zu, und wenige Sekunden später schwamm der Minivan im Verkehrsgewühl davon wie ein Stück Treibholz in einem Strom.
Loris lag da schon auf dem Boden des Wagens, seine Hände und Füße waren mit Kabelbindern gefesselt. Neben ihm hockten die beiden Männer und bewachten ihn mit Argusaugen. Dass sie keine Masken trugen, machte ihm Sorgen. Schließlich konnte er sie so identifizieren. Oder war ihnen das egal, weil sie annahmen, er als Tourist sei nicht mehr lange im Land? An ihren Gürteln hingen Macheten. Er bezwang einen Würgereflex, der nicht nur von dem penetranten Geruch nach Müll, Schweiß und Abgasen ausgelöst wurde, sondern mehr noch von der Angst, die ihn erfasste. Was waren das für Leute? Was wollten sie von ihm? Alle paar Sekunden hupte der Fahrer und fluchte auf Marathi über die anderen Fahrer. Wo brachten sie ihn hin?
»What do you want?«, fragte Loris, nachdem er die Stimme wiedergefunden hatte. »Do you want money? I have money! I give it to you! My watch? Take it! It’s very expensive!«
Das war das Ding an seinem Handgelenk nicht. Keine Rolex, keine Tag Heuer. Die hatte er wohlweislich zu Hause gelassen, um bei Dieben keine Begehrlichkeiten zu wecken. Dennoch hatte die Uhr einen großen emotionalen Wert. Annikas Vater hatte sie ihm geschenkt, es war ein Familienerbstück, das dieser selbst von seinem Vater zur Verlobung bekommen hatte. Als der Mann keinerlei Reaktion zeigte, wuchs Loris’ Verzweiflung. Ihm war bewusst, dass es wenig Sinn hatte, den Männern etwas anzubieten, das ihnen faktisch schon gehörte, denn sie mussten es ihm nur noch abnehmen.
»What do you want?«, fragte er noch einmal.
Die Entführer sahen ihn mit Blicken an, die Loris trotz der Hitze innerlich frösteln ließen. Hier ging es nicht um Geld oder teure Uhren. Diese Männer hatten ihn nicht zufällig ausgesucht, und sie hatten einen Plan, von dem sie nichts abbringen konnte. Loris dachte an Annika. Ob er sie jemals wiedersehen würde? Etwas rollte ihm über die Wange. Ein Tropfen Schweiß oder eine Träne. Er wusste es nicht.
Annika schlug die Augen auf und begriff im ersten Moment nicht, wo sie war. Ein Hotelzimmer, das in seiner kühlen Eleganz allerdings überall auf der Welt sein konnte. Dann fiel es ihr wieder ein. Indien. Sie war auf Hochzeitsreise. Neben ihr lag ein Buch. Sie musste beim Lesen eingeschlafen sein. Ein Blick zur Uhr auf dem Nachttisch: schon halb sieben. Ihr Magen knurrte vernehmlich. Sie hatte seit dem Frühstück nichts gegessen. Wo war Loris? Müsste er von der Einkaufstour nicht längst wieder zurück sein? Vorsichtig setzte Annika sich auf. Das Schwindelgefühl war weg, ihr Kreislauf anscheinend wieder stabil. Sie checkte das Handy auf Nachrichten, die erklären würden, warum Loris nicht da war. Nichts. Auch keine entgangenen Anrufe. Sie wollte eine Nachricht schreiben, ließ es dann aber bleiben und rief ihn an. Es meldete sich nur die Mailbox.
»Wo steckst du, Schatz?«, fragte sie. »Ruf bitte an. Ich mache mir Sorgen.«
Loris rief nicht an. Weder in dieser noch in der nächsten Stunde. Annika vergaß ihren Hunger, die Angst um Loris, die mit jeder Minute, die sie ohne Nachricht von ihm war, wuchs, tötete ihren Appetit ab. Sie ging hinunter an die Rezeption. Eine große Halle mit gedämpfter Geschäftigkeit. Annika trat an den spiegelblanken Empfangstresen und erklärte einer jungen Frau in einem weinroten Kostüm ihre Lage.
»What shall I do?«, fragte sie.
Die junge Frau beruhigte sie, wirkte dabei aber selbst besorgt. Dass sie danach mit einem Mann auf Marathi tuschelte, der laut Namensschild am Revers seines ebenfalls weinroten Anzugs der Hotelmanager war, und beide dabei wiederholt zu ihr herübersahen, versetzte Annika in eine leise Panik, die jederzeit offen ausbrechen konnte. Schließlich trat der Hotelmanager vor, ließ sich von Annika noch einmal alle Umstände und Uhrzeiten genau darstellen, um am Ende ihrer Rede mit ernster Miene zu sagen: »We better call the police.«
Das Wort Polizei kam wie eine Erlösung für Annika und versetzte sie zugleich in noch größere Aufregung. Polizei – das bedeutete Hilfe. Dass etwas unternommen wurde. Gleichzeitig verhieß es nichts Gutes. Die Polizei kam nur, wenn etwas Ernstes vermutet wurde. Ein Unfall – Loris, von einem Auto angefahren, bewusstlos in einem Krankenhaus. Oder noch Schlimmeres: Opfer eines Verbrechens. Zusammengeschlagen und ausgeraubt. Oder gar …
Ein Schwindelgefühl befiel Annika, sie musste sich am Rezeptionstresen festhalten. Die junge Inderin erkannte ihre Lage, huschte um den Tresen herum und führte sie zu einem Sessel, während der Hotelmanager mit der Polizei telefonierte. Sie brachte Annika ein Glas Wasser. Obwohl Annikas Kehle vor Trockenheit brannte, weigerte sich ihr Körper, auch nur den kleinsten Schluck zu sich zu nehmen. Er war wie versteinert. Als würde er sich unangreifbar machen wollen gegen alles, was kommen könnte.
»Thank you«, sagte Annika tonlos, stellte das Glas auf den Beistelltisch neben dem Sessel und würdigte es keines weiteren Blickes.
Unschlüssig, ob sie bleiben oder gehen sollte, blieb die junge Inderin neben ihr stehen. Annika war ebenso unschlüssig. Sie wünschte sich weg von hier, wollte allein sein, und fürchtete gleichzeitig genau das. So waren beide erleichtert, als der Hotelmanager nach beendetem Gespräch zu ihnen trat und sagte: »The police is coming.«
Loris’ Leiche wurde am nächsten Morgen in einer Gasse gefunden, nackt, zwischen Müllsäcken. Sie war grausam verstümmelt. Seine Kleidung blieb ebenso verschwunden wie seine gesamten Wertsachen, doch die Art, wie er vor seinem Tod gequält worden war, zeigte deutlich, dass es dem Täter nicht um Wertsachen gegangen war, sondern dass ein sexuelles Motiv vorlag. Der indische Polizeibeamte, der sich als Superintendent Bedi vorstellte – ein gedrungener, bärtiger Mann mit kleinen, wachen Augen –, wand sich, als er Annika das verständlich zu machen versuchte. Es fiel ihm schwer, die Dinge beim Namen zu nennen, vor allem gegenüber einer Frau. Es war ihr recht, nicht all die grausamen Details zu erfahren. Er wollte wissen, ob Loris gewisse Neigungen gehabt habe, die ihn zu einem Ziel gemacht hätten. Annika verstand zuerst nicht. Durch den Schock war sie noch immer wie versteinert, ihr Gehirn arbeitete langsamer als üblich. Dann begriff sie, dass der Ermittler homosexuelle Neigungen meinte. Vermutete er ein Hassverbrechen? Oder glaubte er, dass in seinen Augen Perverse eben andere, noch Perversere anzögen? Es fehlte ihr die Kraft, sich über diese Art von Fragen zu empören. Sie schüttelte nur heftig den Kopf und sagte bestimmt: »No, definitely not.« Superintendent Bedi wirkte nicht überzeugt, insistierte aber nicht. Anscheinend war die Sache für ihn klar.
Zur Identifizierung des Leichnams hatten die Ermittler sich mit einem Foto begnügt, um Annika den Gang in die Pathologie zu ersparen. Zunächst hatte sie diese Rücksichtnahme zu schätzen gewusst, doch nun sagte sie, mitten im Gespräch mit Bedi: »Ich will ihn sehen. Ich will meinen Mann sehen.« Ihr war schlagartig klargeworden, dass sie sich dem Anblick aussetzen musste. Für Loris. Als letzten Liebesbeweis. Nach allem, was er durchgemacht hatte, durfte sie sich nicht schonen. Selbst wenn ihr eine Stimme im Kopf, vielleicht die Stimme der Vernunft, riet, sie solle sich das nicht antun und Loris so in Erinnerung behalten, wie er gewesen war. Das würde sie auch. Keine noch so schreckliche Grausamkeit konnte die Erinnerung an ihre Liebe für ihn und ihr Glück mit ihm verdrängen. Und selbst wenn. Jetzt an sich zu denken wäre ihr vorgekommen, als würde sie Loris im Stich lassen.
Obwohl Annika deutsch gesprochen hatte, hatte Superintendent Bedi verstanden, was sie verlangte. Er nickte ergeben und sagte: »Okay. It’s your decision, Misses.«
5
Der grausame Mord an Loris erregte weit über Deutschland hinaus Aufsehen. Obwohl sie nicht gewusst hatte, wie sie das schaffen sollte, hatte Annika es auf sich genommen, Loris’ Eltern über den Tod ihres Sohnes zu informieren. Sie ersparte ihnen und sich die Details. Es gelang ihr, Loris’ Vater auszureden, nach Mumbai zu kommen. Was sollten sie hier schon tun? Sie selbst musste noch bleiben, um der Polizei für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen. Ein paar Tage nur, wie man ihr versicherte. Ruhiggestellt mit starken Medikamenten, verdämmerte sie in ihrem Hotelzimmer die schier endlosen Stunden, gefangen im immer selben Albtraum, in den sich ihr Leben verwandelt hatte. Unterbrochen wurde sie nur von gelegentlichen Vernehmungen, bei denen sie vor Staatsanwälten und Polizeibeamten wieder und wieder dieselben Fragen beantwortete. Auch vom deutschen Konsulat hatte sich jemand gemeldet und Hilfe bei den Formalitäten zur Überführung der Leiche angeboten. Sie war dankbar dafür, wollte aber niemanden sehen.
Nach Loris’ Eltern hatte Annika ihre eigenen Eltern angerufen. Noch während sie ihnen erzählte, was passiert war, erfasste sie ein Gefühl der Vergeblichkeit. Was erhoffte sie sich davon? Dass die beiden in den nächsten Flieger steigen und zu ihr kommen würden, um ihr in der schwersten Zeit ihres Lebens beizustehen? Ihre Schwiegereltern hätten das getan, und sie hatte es ihnen nur mit Mühe ausreden können. Bei ihren eigenen Eltern war das gar nicht nötig.
»Wir würden ja kommen, aber der lange Flug«, erklärte Norbert Burghardt verlegen, »und dann das anstrengende Klima. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Und würde es sich überhaupt lohnen, all das auf uns zu nehmen, wegen ein oder zwei Tagen, die wir uns eher sehen? Du kannst sicher bald nach Hause, Liebling.«
Ihre Mutter gab sogar ihr und Loris eine Mitschuld daran, dass sie alle das durchmachen müssten (mit sie alle meinte sie in ihrem Narzissmus hauptsächlich sich selbst). »Was wolltet ihr in so einem schrecklichen Land?«, sagte sie. »Auf eurer Hochzeitsreise!«
Das Schlimmste daran war, dass Annika, obwohl sie mit dieser Reaktion gerechnet hatte, allem besseren Wissen zum Trotz gehofft hatte, ihre Eltern könnten in dieser Situation, die alles Vorstellbare überstieg, auf eine andere als die übliche Weise reagieren. Ihr wurde wieder bewusst, dass sie im Grunde wie unter Fremden aufgewachsen war. Niemand hatte sich wirklich für sie interessiert, und auch sie hatte bereits in ihrer Kindheit resigniert aufgehört, die Nähe ihrer Eltern zu suchen. Trotzdem erlosch der Funke Hoffnung, der sich nach elterlicher Nähe sehnte, niemals ganz. Annika verstand sich selbst nicht. Niemand ist eine Insel, hatte Loris gesagt. Doch, sie war in ihrer Familie eine Insel gewesen. Eine Insel im Eismeer.
Wer keine Sekunde zögerte, ihrer besten Freundin beizustehen, war Emily. Kaum hatte Annika sie angerufen, um ihr stockend zu berichten, was geschehen war, buchte sie schon den nächsten Flug nach Mumbai, obwohl sie nicht wirklich verstanden hatte, was Annika ihr mit tränenerstickter Stimme zu erzählen versuchte. Was sie jedoch auf Anhieb verstand, war, dass etwas Schreckliches mit Loris geschehen war und dass ihre beste Freundin sie brauchte. Sofort! Am Tag danach klopfte es an der Tür von Annikas Hotelzimmer. Annika fuhr aus dem Bett auf und rief: »Leave me alone!« und »Go away!«, doch dann hörte sie eine liebe, vertraute Stimme hinter der Tür: »Willst du mich nicht wenigstens kurz sehen, Süße? Und ich müsste dringend aufs Klo, nach zehn Stunden Flug.«
Annika sprang aus dem Bett, riss die Tür auf, und da stand Emily, mit einem Koffer neben sich, verschwitzt, etwas mitgenommen, mit sorgenvoller Miene und Armen so weit wie die Welt. Und Annika ließ sich dankbar hineinfallen. Endlich war da ein Mensch, dem sie vertraute und den sie liebte. Der einzige Mensch, den sie hatte.
Nach etwa einer Woche kam endlich die Erlaubnis zur Ausreise. Loris’ Leichnam werde so bald wie möglich nach Deutschland überführt, versicherte der Staatsanwalt. Was den aktuellen Stand der Ermittlungen anging, hielt man sich bedeckt. Es gebe vielversprechende Zeugenaussagen, hieß es. Leute hätten beobachtet, wie ein Europäer, der Loris gewesen sein könnte, in einen schwarzen Minivan gezerrt worden war. Annika nahm es ohne sichtbare Regung auf. Sie wollte nichts so sehr, als dass diejenigen, die Loris gequält und ermordet hatten, gefasst und bestraft würden. Doch im Moment ertrug sie keine weiteren Details zu dem Verbrechen. Was sie wusste, war schon mehr, als sie eigentlich ertragen konnte.
Superintendent Bedi ließ es sich nicht nehmen, Annika und Emily persönlich in seinem Dienstwagen zum Flughafen zu bringen. Er hatte dafür gesorgt, dass sie nirgends anstehen mussten, sondern an den Heerscharen der anderen Reisenden vorbei direkt zum Gate geleitet wurden, und er blieb an ihrer Seite, bis sie wohlbehalten dort ankamen. Beim Abschied versicherte Bedi, was er Annika schon tausendmal versichert, nein, geschworen hatte: dass die Ermittlungsbehörden nichts unversucht lassen würden, um den oder die sadistischen Mörder ihres Ehemannes ausfindig zu machen und ihrer gerechten Strafe zuzuführen, die in diesem Fall nur die Todesstrafe sein könne.
Annika nickte verhalten und sagte nichts. Trotz all seiner Freundlichkeit spürte sie, dass Bedi, genau wie ihre Mutter, eine Mitschuld bei ihr und Loris sah, wenn auch aus anderen Gründen. Obwohl er es nicht mehr offen sagte, hielt er Loris vermutlich noch immer für einen verkappten Schwulen, und dass wegen so jemandem das Ansehen Indiens in der Welt gerade litt, nahm er persönlich.
»Du setzt besser deine Sonnenbrille auf«, sagte Emily plötzlich, »und hier, nimm meinen Hut.«
Annika verstand erst nicht, was das sollte, bis ihr auffiel, dass einige der deutschen Touristen um sie herum mit Fingern auf sie zeigten und hinter vorgehaltener Hand tuschelten. Ist das nicht die arme Frau, deren Ehemann auf der Hochzeitsreise …? – Ja, das ist sie. Bemitleidenswert! Sicher waren irgendwo Fotos von ihr erschienen, auf denen ihr Gesicht nicht unkenntlich gemacht worden war. Wenn nicht in den Zeitungen, dann im Internet und in den sozialen Medien, wo sich keiner um Persönlichkeitsschutz und Presserecht scherte. Schon wenige Tage, nachdem die Berichterstattung über Loris’ Tod begonnen hatte, waren auf Annikas eigenen Social-Media-Seiten Kommentare und Nachrichten eingegangen, größtenteils von fremden Leuten. Ein paar offenbar gestörte Menschen hatten sich einen Spaß daraus gemacht, mit unflätigen Kommentaren in ihren Wunden zu bohren, der weit überwiegende Teil war jedoch mitfühlend und tröstend gewesen, mit zahlreichen Herzen, weinenden Emojis und Ähnlichem versehen. Trotzdem war ihr auch das bald zu viel geworden, so dass sie sich in einem letzten Posting für die Anteilnahme bedankte, die Kommentarfunktion deaktivierte und dann sämtliche Accounts auf allen Plattformen stilllegte. Schlagartig begriff sie, dass das nicht genug gewesen war. Die Kommunikation über sie und ihr schreckliches Schicksal war an anderer Stelle weitergegangen. Das Reden über die Geschehnisse würde zwar irgendwann abschwellen, doch niemals ganz aufhören. Das bedeutete: Sie würde nicht nur in ihrem Innern für immer eine Gefangene dieser Geschichte bleiben, sondern auch in ihrem alltäglichen Leben. Für die meisten Menschen war sie von nun an die arme Frau, deren Ehemann auf der Hochzeitsreise unter mysteriösen Umständen …
Die Heimreise führte über den Zwischenstopp Amsterdam. Dort angekommen, hatte Emily in der Kommentarspalte eines Klatschblattes unter einem Artikel zum Mord an Loris ein Foto von Annika veröffentlicht und dazu geschrieben: Hammer! Sitze im Flieger aus Mumbai neben Annika. Krass heftig, was sie gerade durchmacht! Wir haben uns richtig angefreundet und noch viel Zeit zum Reden auf unserem Flug nach Hamburg. Doch statt den gebuchten Flieger nach Hamburg zu nehmen, wo sicher schon die gesamte Reportermeute am Flughafen zusammenströmte, nahmen sie einen Mietwagen. Die Fahrt würde zwar knapp sechs Stunden dauern, aber dafür würde sie bei der Ankunft niemand begaffen und mit lästigen Fragen bombardieren.
Annika war es nur recht, dass noch so viele Stunden auf der Straße vor ihr lagen. In Mumbai hatte sie nichts lieber gewollt, als schnell in die vertraute Umgebung zurückzukehren. Jetzt fürchtete sie den Moment der Rückkehr. Denn wohin kehrte sie zurück? Die Welt, aus der sie aufgebrochen war, gab es nicht mehr, weil es Loris nicht mehr gab. Sie war als Frischvermählte abgereist und kehrte als Witwe zurück. Das veränderte alles. Machte sie auf eine harte, unerbittliche Art zu einer Fremden in ihrem eigenen Leben.
Kurz nachdem sie losgefahren waren, sagte Emily: »Willst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du nicht mit dem Flugzeug kommst? Sonst warten sie vergeblich auf dich und werden von Reportern belästigt.«
Annika nahm ihr Handy, überlegte, steckte es wieder weg. »Sollen sie ruhig umsonst warten. Sie haben mich auch warten lassen.«
»Wir fahren erst einmal zu mir«, erklärte Emily bestimmt, »und dort bleibst du so lange, wie du willst.«
Annika war dankbar für diesen Vorschlag. Und dafür, dass sie Emily nicht darum hatte bitten müssen, sondern dass die von sich aus wusste, was Annika brauchte. Denn in ihre Wohnung, die Wohnung, die sie mit Loris geteilt hatte, konnte sie unmöglich zurück. Das war verbrannte Erde. Und zu den Eltern wollte sie nicht. Irgendwann würde sie sich ihnen stellen müssen, aber das hatte Zeit.
Annika lehnte sich zurück und sah aus dem Seitenfenster. Der Flughafen lag hinter ihnen, neben ihnen breiteten sich Wiesen und Äcker aus, während sie sich einem Autobahnkreuz näherten. Emily folgte den Anweisungen des Navis. Die Stimme hatte etwas Beruhigendes. Annika schloss die Augen und wünschte, sie würde sie nie mehr öffnen müssen.
6
Zwei Wochen später erhielt Annika einen Anruf von Superintendent Bedi. Sie versteckte sich noch immer bei Emily. In der Start-up-Softwarefirma bei der sie im Vertrieb angestellt war, hatte sie gekündigt. Als der Anruf aus Indien kam, war sie allein, da Emily noch in der Galerie war, in der sie arbeitete. Annikas Herz fing an zu rasen, als sie die Nummer mit der indischen Landesvorwahl im Display erblickte. Nach kurzem Zögern nahm sie ab. Bedis Stimme zu hören, riss den Schorf, der sich langsam über der Wunde zu bilden begann, wieder auf. Voller Stolz teilte er mit, dass die beiden Männer, die Loris entführt hätten, gefasst seien. Sie seien zwar klug genug gewesen, sich wegen der Kameras an den Bankautomaten zu maskieren, bevor sie mit Loris’ Kreditkarte Geld abhoben, doch zum Glück gab es Zeugen der Entführung. Der Minivan, in den sie Loris gezerrt hätten, sei gefunden worden und voll von DNA-Spuren von Opfer und Tätern gewesen, und das habe den Sack zugemacht. »DNA never lies«, sagte Superintendent Bedi, strotzend vor Selbstzufriedenheit, und Annika sah ihn im Geiste vor sich, wie er seinen dichten Bart zwirbelte.
Die beiden Männer gaben die Entführung zu und gestanden auch, dass sie die Leiche weggebracht hätten, behaupteten jedoch, sie hätten im Auftrag eines Dritten gehandelt, der den Mord und all das andere begangen habe. Ein Mann, dessen Namen sie nicht kannten und dessen Gesicht sie niemals gesehen hätten, da er sich nur mit Schlapphut, Sonnenbrille und medizinischer Atemmaske gezeigt habe. Ein Europäer oder Amerikaner, behaupteten sie weiter, der sie gut für den Job bezahlt und ihnen hinterher die Kreditkarte samt PIN überlassen habe. Doch das, versicherte Bedi, seien nur Schutzbehauptungen, die man von solchen kriminellen Subjekten ständig zu hören kriege. Diese Männer seien drogenabhängig, ihnen sei alles zuzutrauen, weil sie zu allem bereit wären, um das Geld für ihre Sucht aufzutreiben. Sie hatten Loris offenbar gequält, damit er ihnen die PIN-Nummer seiner Kreditkarte verriet. Kein Wort mehr von sexuellen Motiven. Seine Leute würden ihnen schon noch Geständnisse abringen, da könne sie unbesorgt sein, es sei nur eine Frage der Zeit. Am Ende seines Berichts, als sich eine Pause ergab, weil er wohl auf eine Antwort von Annika wartete, allerdings vergeblich, fragte Superintendent Bedi, wie es ihr gehe, und er klang dabei mitfühlend, so als interessiere es ihn wirklich.
»I’m okay«, sagte Annika, bedankte sich für den Anruf und legte auf. Erst im Nachhinein fiel ihr ein, dass Bedi vermutlich ein Lob für die gute Polizeiarbeit verdient gehabt hätte. Sie nahm das Handy, um ihn anzurufen und das nachzureichen. Doch dann kam es ihr lächerlich vor, und sie ließ es bleiben. Schließlich hatte die Polizei von Mumbai nur ihre Arbeit getan, und ob sie sie wirklich gut gemacht hatte, stand keineswegs fest.
Das Smartphone in der Hand, streifte Annika durch die Wohnung, ließ die Fingerkuppen über die glatten Oberflächen von Möbeln gleiten, berührte die raue Polsterung von Sesseln und Sofa.
Loris’ Folterer und – vielleicht – Mörder gefasst.
War sie erleichtert? Zufrieden? Glücklich gar, weil Loris Gerechtigkeit widerfahren würde?