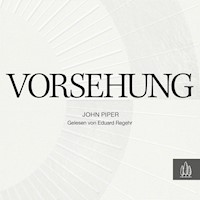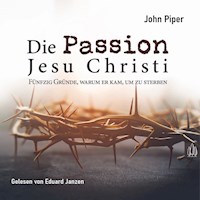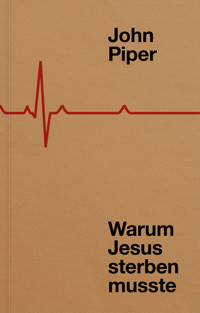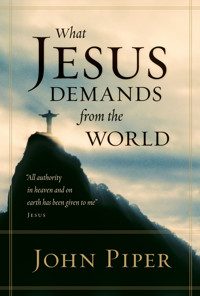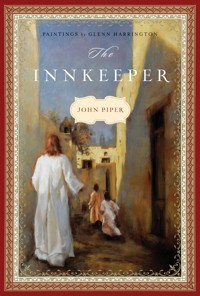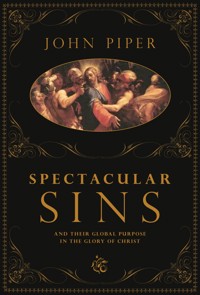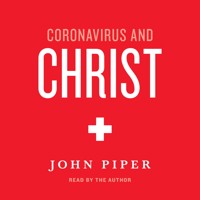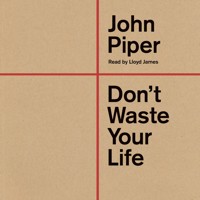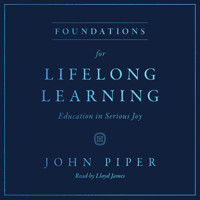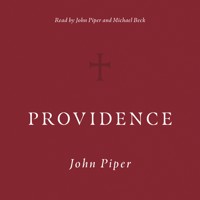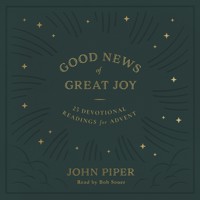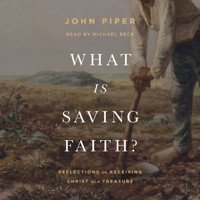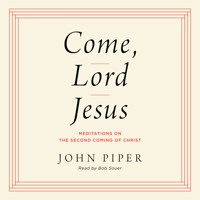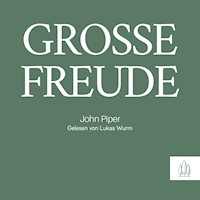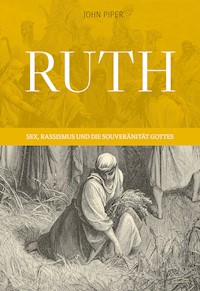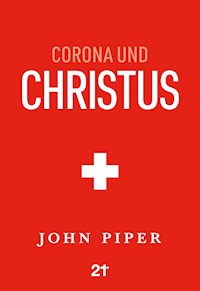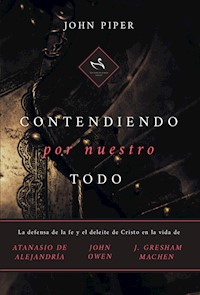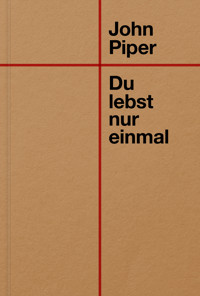
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbum Medien gGmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Streben nach Wohlstand und schnellem Vergnügen prägt das Leben vieler Menschen im Westen. Jesus dagegen erklärte: »Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden«, und rief Menschen dazu auf, für die Ewigkeit und zur Ehre Gottes zu leben. Dieser Bestseller von John Piper ist eine aufrüttelnde Warnung, sich nicht von einem belanglosen Leben gefangen nehmen zu lassen. Piper ruft Schüler und Studenten, aber auch jeden Christen dazu auf, nach tieferer Freude zu streben und Dinge zu wagen, die vor Gott von Bedeutung sind und für die Ewigkeit zählen. • Neuauflage des Bestsellers von John Piper • Weckruf für Christen im kulturellen Westen • Geeignetes Geschenk für Schulabsolventen und Studenten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dulebstnureinmal
John Piper
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich bitte postalisch oder per E-Mail über die angegebenen Kontaktdaten an uns.
Titel des englischen Originals
Don't Waste Your Life
© 2003, 2009, 2023 by Desiring God Foundation
Published by Crossway a publishing ministry of Good News Publishers
Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.
This edition published by arrangement with Crossway.
All rights reserved.
Wenn nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzung verwendet
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
© 2025Verbum Medien gGmbH
Kleines Lohfeld 6
D-32549 Bad Oeynhausen
verbum-medien.de
Übersetzung
Martin Plohmann
Lektorat
Bettina Spengler
Buchgestaltung
Matt Wahl, Karin Rekowski
Satz
Walter Wieser
Druck und Bindung
Finidr, Tschechien
1. Auflage 2025
Best.-Nr. 8652 173
ISBN 978-3-98665-173-2
E-Book 978-3-98665-174-9
Hörbuch 978-3-98665-175-6
DOI 10.54291/z279782542
Solltest du Fehler in diesem Buch entdecken, würden wir uns über einen kurzen Hinweis an [email protected] freuen.
Louie Giglio und seiner Leidenschaft gewidmet, Jesus in dieser Generation bekannt zu machen
Inhalt
Vorwort zur Auflage von 2023
Vorwort zur Auflage von 2018
1 Meine Suche nach etwas, für das es sich zu leben lohnt
2 Der Durchbruch – Jesu Schönheit ist meine Freude
3 Sich nur des Kreuzes rühmen, des strahlenden Mittelpunkts der Herrlichkeit Gottes
4 Christus durch Tod und Leiden verherrlichen
5 Berechtigtes Risiko – Besser sein Leben verlieren, als es zu verschwenden
6 Das Ziel des Lebens – Mit Freude anderen helfen, ihre Freude in Gott zu finden
7 Wir leben, um zu beweisen, dass er wertvoller ist als das Leben
8 Christus bei der Arbeit verherrlichen
9 Die Majestät Christi in Mission und Diakonie – Ein Aufruf an diese Generation
10 Mein Gebet – Lass niemanden am Ende sagen: »Ich habe es verschwendet.«
Endnoten
Vorwort zur Auflage von 2023
Vor zwanzig Jahren habe ich dieses Buch in erster Linie für Studenten geschrieben. Zu meiner Überraschung und Freude haben zahlreiche Menschen in den letzten zwei Jahrzehnten in ihren Fünfzigern und Sechzigern ihr Leben drastisch geändert. Sie waren kurz davor, die nächsten zwanzig Jahre ihres Lebens mit nicht enden wollender Muße zu verbringen. Ich freue mich sehr über diese Neuausrichtung.
Ich frage mich, was genau der Grund dafür ist. Vielleicht liegt es daran, dass sich der »Ruhestand« anfühlt, als würde man noch einmal Anfang Zwanzig sein. Das Studium liegt hinter dir. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen. In dem Moment, als du eine Hochglanzbroschüre über verschiedene Aktivitäten im Ruhestand durchblätterst, kommt ein Buch daher, das dich an den Schultern packt, dir in die Augen schaut und sagt:»Verschwende dein Leben nicht!«.
Das Buch ist nach wie vor für junge Erwachsene gedacht – ob sie nun studieren oder nicht. Egal ob am Beginn oder am Ende einer Karriere – wir sollten immer Träume haben. Du hast nur ein Leben. Dann kommt die Ewigkeit. Das Leben hat verschiedene Phasen. Keine davon ist ausschließlich zur Muße und Entspannung gedacht.
Ralph Winter sagte einmal: »In Amerika sterben Menschen nicht an Altersschwäche. Sie sterben am Ruhestand.« Das ist eine griffige Umschreibung dafür, dass die menschliche Seele bei zu viel Muße verkümmert. Das stimmt, wenn man zwanzig ist, und es stimmt, wenn man siebzig ist. Gott hat uns für mehr geschaffen.
In diesem Buch geht es um eine Art von Freude, die niemals aufhört. Das Besondere an dieser Freude ist, dass sie Gott als den wertvollsten Schatz, der er tatsächlich ist, erscheinen lässt. Ein Leben, das nicht vergeudet ist, beruht auf der Entdeckung, dass unsere Freude und Gottes Ehre gemeinsam ihren Höhepunkt erreichen.
Ich muss dich jedoch auch warnen. Deine Freude in Gottes Verherrlichung zu suchen, wird dich dein Leben kosten. Jesus sagte: »Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten« (Mk 8,35). Mit anderen Worten: Es ist besser, sein Leben zu verlieren, als es zu verschwenden.
Wenn du für die Freude lebst, andere Menschen zu ihrer Freude in Gott zu führen, wirst du Entbehrungen hinnehmen und Risiken eingehen müssen – aber dein Leben wird von Freude erfüllt sein. In diesem Buch geht es nicht darum, ein schwieriges Leben zu vermeiden, sondern ein verschwendetes. Einige von euch werden sterben, weil sie Jesus nachfolgen. Das ist keine Tragödie. Das Leben auf dieser Erde höher zu achten als Christus – das ist eine Tragödie.
Du sollst wissen, dass ich für dich bete – ob du nun Student bist und davon träumst, etwas Besonderes aus deinem Leben zu machen, oder ob du Rentner bist und deine letzten Lebensjahre nicht verschwenden möchtest. Solltest du dich fragen, wofür ich bete, kannst du Kapitel 10 lesen. Dort findest du mein Gebet. Bedenke: Du hast nur ein Leben. Das ist alles. Du bist für Gott geschaffen. Verschwende dein Leben nicht.
John Piper
Februar 2022
Vorwort zur Auflage von 2018
Ob du es glaubst oder nicht, Bob Dylan spielt in dieser Geschichte eine Rolle. Der Grund, warum ich Dylan hier erwähne, ist, dass er zwischen der ersten Veröffentlichung dieses Buches (2003) und jetzt (2017) den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Das ist erstaunlich! Auf der Website des Nobelpreises heißt es, der Preis sei ihm »für die Schaffung neuer poetischer Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Lied-Tradition« verliehen worden.
Es besteht jedoch eine Spannung zwischen dem Dylan in meiner Geschichte und dem Dylan in der Nobelpreisrede. Nachdem er dargelegt hatte, wie die Klassiker Moby-Dick, Im Westen nichts Neues und die Odyssee seine Arbeit geprägt haben, fragte Dylan: »Was hat all das nun zu bedeuten?« Ich hörte gespannt zu. Genau darum geht es schließlich in diesem Buch. Worum geht es im Leben?
Dann antwortet er: »[Meine Lieder] können viele verschiedene Dinge bedeuten. Wenn ein Lied dich bewegt, ist das alles, was zählt. Ich muss nicht wissen, was ein Lied bedeutet.… Und ich werde mir keine Sorgen darüber machen, was das alles bedeutet.«
Wenn sich das für dich heldenhaft, mutig oder authentisch anhört, wirst du dieses Buch wahrscheinlich nicht mögen, zumindest nicht am Anfang. Ich halte das jedenfalls für tragisch. Sechsundsiebzig Jahre sind eine lange Zeit, nur um zu dem Schluss zu kommen: »Ich werde mir keine Gedanken darüber machen, was das alles bedeutet. Wenn es dich berührt, ist das alles, was zählt.« Nein, Herr Dylan, in einer Welt voller Leid und im Angesicht von Tod und Ewigkeit reicht es nicht, »berührt zu sein«.
In diesem Buch geht es um eine Art von Freude, die niemals aufhört. Aber das Besondere ist, dass diese Freude Gott als den wertvollsten Schatz erscheinen lässt, der er tatsächlich ist. Das Leben, das nicht verschwendet ist, beruht auf der Entdeckung, dass unsere tiefste Freude und Gottes wunderbare Majestät gemeinsam ihren Höhepunkt erreichen.
Ich muss dich jedoch auch warnen. Deine Freude in Gottes Verherrlichung zu suchen, wird dich dein Leben kosten. Jesus sagte: »Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten« (Mk 8,35). Mit anderen Worten: Es ist besser, sein Leben zu verlieren, als es zu verschwenden.
Wenn du für die Freude lebst, andere Menschen zu ihrer Freude in Gott zu führen, wirst du Entbehrungen hinnehmen und Risiken eingehen müssen – aber dein Leben wird von Freude erfüllt sein. In diesem Buch geht es nicht darum, ein schwieriges Leben zu vermeiden, sondern ein verschwendetes. Einige von euch werden im Dienst Christi sterben. Das ist keine Tragödie. Das Leben auf dieser Erde höher zu achten als Christus – das ist eine Tragödie.
Ich hoffe, dass ich mich in Bezug auf Bob Dylan irre. Wenn er sagt: »Ich werde mir keine Gedanken darüber machen, was das alles bedeutet«, meint er vielleicht tatsächlich: »Ich werde mir keine Gedanken machen, weil ich den großen Sinn des Lebens entdeckt habe und mir keine Gedanken mehr machen muss.« Vielleicht glaubt er wirklich, dass »die Antwort im Wind weht«. Die Antwort. Du wirst sehen, was dieses Lied mit meiner Geschichte zu tun hat. Es hat mich jedenfalls nicht zu der Überzeugung gebracht, dass es keine Antwort gibt.
Du sollst wissen, dass ich für dich bete – ob du nun Student bist und davon träumst, etwas Besonderes aus deinem Leben zu machen, oder ob du Rentner bist und deine letzten Lebensjahre nicht verschwenden möchtest. Solltest du dich fragen, wofür ich bete, kannst du Kapitel 10 lesen. Das ist mein Gebet.
Zunächst danke ich Gott jedoch für dich. Meine Freude wächst mit jedem einzelnen Menschen, der die Ehre Gottes durch Jesus Christus sucht. Bedenke: Du hast nur ein Leben. Das ist alles. Du bist für Gott geschaffen. Verschwende dein Leben nicht.
John Piper
12. September 2017
1Meine Suche nach etwas, für das es sich zu leben lohnt
Mein Vater war ein Evangelist. Als ich ein kleiner Junge war, boten sich für meine Mutter, meine Schwester und mich manche Gelegenheiten, ihn auf seinen Reisen zu begleiten und ihn predigen zu hören. Ich zitterte jedes Mal, wenn ich meinem Vater beim Predigen zuhörte. Trotz des vorhersehbaren Humors am Beginn einer Predigt empfand ich das Ganze als absolut ernst. Seine Augen hatten einen bestimmten Blick und seine Lippen strafften sich, wenn die Flut von Bibeltexten gegen Ende einer Predigt schließlich in der praktischen Anwendung ihren Höhepunkt erreichte.
»Ich habe es verschwendet, ich habe es verschwendet!«
Er drang ernsthaft auf seine Zuhörer ein. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, frisch Verheiratete, Menschen mittleren und hohen Alters – er trieb sowohl die Warnungen als auch die Einladungen Christi in das Herz jedes Einzelnen. Er hatte unzählige Geschichten für jede Altersgruppe: Geschichten von wunderbaren Bekehrungen sowie Geschichten von Menschen, die den Glauben ablehnten und dann auf tragische Weise ums Leben kamen. Nur selten konnte er sie ohne Tränen in den Augen erzählen.
Das Zeugnis eines Mannes, der sich in hohem Alter bekehrte, gehörte für mich als Junge zu den fesselndsten Geschichten meines Vaters. Jahrzehntelang hatte eine Gemeinde für diesen Mann gebetet. Dennoch blieb sein Herz hart und unempfänglich für das Evangelium. Aus irgendeinem Grund kam er jedoch eines Tages zu einer Veranstaltung, bei der mein Vater predigte. Am Ende der Evangelisation ging er zum großen Erstaunen aller zu meinem Vater und reichte ihm die Hand. Sie setzten sich zusammen in die erste Reihe und sprachen miteinander, während die Leute heimgingen. Gott öffnete an jenem Abend das Herz dieses Mannes für das Evangelium. Er wurde von seinen Sünden errettet und bekam ewiges Leben. Doch das konnte sein Schluchzen nicht aufhalten, und als die Tränen über sein faltiges Gesicht liefen, sagte er: »Ich habe es verschwendet! Ich habe es verschwendet!« Es machte einen tiefen Eindruck auf mich, als mein Vater diese Worte unter Tränen wiederholte.
Die Geschichte dieses alten Mannes, der weinte, weil er sein Leben verschwendet hatte, ergriff mich mehr als alle Berichte von jungen Leuten, die bei Autounfällen umkamen, bevor sie sich bekehrten. In diesen jungen Jahren weckte Gott die Furcht und das Anliegen in mir, mein Leben nicht zu verschwenden. Für mich war es eine schreckliche Vorstellung, als alter Mann einmal unter Tränen sagen zu müssen: »Ich habe es verschwendet!«
»Ein Leben nur, und das wird schnell vergeh'n«
Eine weitere treibende Kraft in meinem jungen Leben – zunächst noch schwach, aber mit der Zeit immer stärker – waren die Worte, die über der Spüle in unserer Küche hingen. Wir zogen in dieses Haus ein, als ich sechs Jahre alt war. Ich schätze, ich habe zwölf Jahre lang fast täglich auf dieses Schild geschaut, bis ich mit achtzehn Jahren für das Studium von zu Hause auszog. Es war ein einfaches Stück Glas, auf der Rückseite schwarz angestrichen, mit einer grauen Kette als Rahmen und zum Aufhängen. Auf der Vorderseite standen in weißer, altenglischer Schrift die Worte:
»Ein Leben nur,
und das wird schnell vergeh'n.
Nur was für Gott wir getan,
wird besteh'n.«
Links neben diesen Worten war ein grüner Hügel gemalt – mit zwei Bäumen und einem braunen Pfad, der hinter dem Hügel verschwand. Als kleiner Junge und später als pickeliger Teenager schaute ich sowohl mit Sehnsucht als auch mit Sorge auf diesen braunen Pfad (mein Leben) und fragte mich, was sich wohl auf der anderen Seite dieses Hügels befand. Die Botschaft war klar. Wir haben nur ein Leben. Das ist alles. Nur eine Chance. Und der bleibende Maßstab für dieses Leben ist Jesus Christus. Dieses Schild hing später jahrelang an der Wand neben unserer Eingangstür. Ich sah es jedes Mal, wenn ich das Haus verließ.
Wie genau würde es aussehen, mein Leben zu verschwenden? Das war eine brennende Frage. Oder positiv ausgedrückt: Was bedeutet es, richtig zu leben – das Leben nicht zu verschwenden, sondern …? Wie dieser Satz weitergehen muss, war die Frage. Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Frage in Worte fassen sollte – geschweige denn, wie die Antwort darauf lauten könnte. Was war das Gegenteil von einem verschwendeten Leben? Im Beruf Erfolg zu haben? Glücklich und zufrieden zu sein? Etwas Großes zu leisten? Erfüllung zu finden? So vielen Menschen wie möglich zu helfen? Christus von ganzem Herzen zu dienen? Gott in allem, was ich tue, zu verherrlichen? Oder gab es ein übergeordnetes Lebensziel, das all diese Träume einschließen würde?
»Die verlorenen Jahre«
Ich hatte mit der Zeit vergessen, wie wichtig diese Frage damals für mich war. Mir wurde das erst wieder bewusst, als ich meine Aufzeichnungen aus diesen Jahren durchblätterte. Kurz bevor ich South Carolina 1964 verließ, veröffentlichte die Wade Hampton High School eine kleine Literatur-Zeitschrift mit Gedichten und Geschichten. Im hinteren Teil befand sich ein Beitrag von Johnny Piper. Ich werde dir das gesamte Gedicht ersparen, denn es war alles andere als gelungen. Jane, die Redakteurin, hatte dabei großes Erbarmen mit mir. Was mir heute noch wichtig ist, sind allein der Titel und die ersten vier Zeilen. Das Gedicht hieß »Die verlorenen Jahre«. Direkt neben dem Gedicht war die Zeichnung eines alten Mannes in einem Schaukelstuhl abgebildet. Das Gedicht fing so an:
»Lange suchte ich nach dem Sinn des Lebens,
als Junge war meine Suche danach vergebens.
Jetzt, da meine letzten Jahre zerrinnen,
muss meine Suche erneut beginnen.«
In den Jahrzehnten, die seit der Verfassung dieses Gedichtes vergingen, konnte ich den furchtbaren Refrain immer wieder hören: »Ich habe es verschwendet! Ich habe es verschwendet!« Ich entwickelte damals eine Leidenschaft dafür, dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen. Die ethische Frage, ob dies oder jenes erlaubt ist, verblasste im Vergleich zu der Frage: »Was ist die Hauptsache, die Essenz des Lebens?« Den Gedanken, mein Leben anhand der Frage »Was ist gerade noch erlaubt?« auszurichten, fand ich abstoßend. Ich wollte kein Leben, das nur die Mindestanforderungen erfüllt. Ich wollte nicht in der Peripherie des Lebens umherstreifen. Stattdessen wollte ich das Wesentliche im Leben verstehen und mit aller Kraft auf dieses Zentrum zusteuern.
Existentialismus war die Luft, die wir einatmeten
Meine Leidenschaft dafür, das Wesentliche nicht zu verpassen und das Leben nicht zu verschwenden, wurde während meines Studiums noch stärker – in den stürmischen späten Sechzigern. Dafür gab es tiefere Gründe – die nicht nur mit dem gewöhnlichen Durcheinander eines Heranwachsenden erklärbar waren. Das »Wesentliche« wurde nahezu überall angegriffen, denn Existentialismus war die Luft, die wir einatmeten. Und Existentialismus bedeutete:»Existenz vor Essenz.« Damit ist gemeint, dass man zuerst existiert – und erst durch das Existieren dann seine eigene Essenz schafft. Man erschafft das Wesentliche, die Essenz oder den Lebenssinn für sich selbst, indem man sich aussucht, wer man sein möchte. Außerhalb von uns selbst gibt es nichts Sinnvolles, an dem wir unser Leben ausrichten können oder wonach es sich zu streben lohnt. Nenne es »Sinn« oder »Zweck« – es existiert nicht, solange du es durch deine Existenz nicht selbst schaffst. (Wenn du jetzt deine Stirn runzelst und denkst: »Das klingt nach einer Beschreibung dessen, was wir heute Postmoderne nennen«, hast du recht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne; nur neue Namen für bereits bekannte Dinge.)
Ich erinnere mich daran, in einem dunklen Theater zu sitzen und mir das schauspielerische Ergebnis des Existentialismus anzuschauen: das sogenannte »Theater des Absurden«. Das Stück war Samuel Becketts Warten auf Godot. Vladimir und Estragon treffen sich unter einem Baum und unterhalten sich, während sie auf Godot warten. Dieser kommt jedoch nicht. Gegen Ende des Stücks teilt ihnen ein Junge mit, dass Godot auch nie kommen wird. Also entschließen sie sich, zu gehen, tun es aber nicht. Sie bewegen sich nicht von der Stelle. Der Vorhang fällt, und Godot [Gott] kommt nicht.
So sah Beckett Menschen wie mich: Sie warten und suchen und hoffen, die Essenz der Dinge zu finden, anstatt einfach aus ihrer freien und grenzenlosen Existenz ihre eigene Essenz zu erschaffen. Du gehst nirgendwo hin – so deutet Beckett in seinem Theaterstück an –, wenn Du nach dem Wesentlichen, nach der Hauptsache, nach der Essenz suchst.
Der »Nirgendwo-Mann«
Im Dezember 1965 veröffentlichten die Beatles ihr Album Rubber Soul und besangen den Existentialismus mit einer für meine Generation überwältigenden Überzeugungskraft. In John Lennons »Nowhere Man« wird es wahrscheinlich am deutlichsten:
»Er ist ein echter Nirgendwo-Mann,
sitzt in seinem Nirgendwo-Land
und macht all seine Nirgendwo-Pläne
für niemanden.
Er hat keinen Standpunkt
und weiß nicht, wo er hingeht.
Ist er nicht ein wenig wie du und ich?«1
Es war eine aufregende Zeit, besonders für Studenten. Zum Glück schwieg Gott in dieser Zeit nicht. Nicht jeder ließ sich vom Absurden und von der Verlockung heroischer Leere verführen. Nicht jeder kam den Aufforderungen von Albert Camus und Jean-Paul Sartre nach. Selbst Menschen, die nicht in der Wahrheit verwurzelt waren, wussten, dass es mehr geben musste – etwas, das außerhalb von uns lag und größer und wertvoller war als das, was wir im Spiegel sahen.
Die Antwort weiß allein der Wind
Bob Dylan schrieb Songs mit versteckten Hoffnungsbotschaften, die in der Musikszene genau deshalb einschlugen, weil sie eine Realität andeuteten, die uns nicht ewig warten lässt. Die Dinge würden sich ändern. Früher oder später würden die Langsamen schnell und die Ersten letzte werden. Und das nicht, weil wir die existentiellen Herren unseres absurden Schicksals sind. Es würde einfach geschehen. Das beschrieb er im Lied »The Times They Are A-Changin'«:
»Die Grenzlinie ist gezogen,
der Fluch gesprochen.
Der Langsame heute
wird später schnell sein.
So wie die Gegenwart heute
später Vergangenheit sein wird.
Die Reihenfolge
verändert sich schnell.
Und der Erste heute
ist später der Letzte,
denn die Zeiten ändern sich.«2
Die Existentialisten muss es geärgert haben, als sie Dylan hörten. Vielleicht ohne es zu wissen, fegte er ihren »Alles-ist-machbar«-Relativismus mit der kühnen Wiederholung der Worte »die Antwort … die Antwort« in seinem Superhit »Blowin' in the Wind« weg:
»Wie oft blickt ein Mensch zum Himmel empor,
bis er ihn auch wirklich sehen kann?
Und wie viele Ohren braucht denn ein Mensch,
bis er die andern schreien hört?
Welch großes Unheil muss erst noch gescheh'n,
damit sich die Menschheit besinnt?
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind.
Die Antwort weiß ganz allein der Wind.«3
Wie oft kann ein Mensch zum Himmel aufblicken, ohne ihn auch wirklich zu sehen? Dort oben gibt es einen Himmel. Du kannst tausendmal nach oben schauen und behaupten, dass du ihn nicht siehst. Das hat jedoch absolut keine Auswirkung auf seine objektive Existenz. Der Himmel ist trotzdem da. Und eines Tages wirst du ihn sehen. Wie oft musst du nach oben schauen, bis du ihn siehst? Darauf gibt es eine Antwort. Die Antwort, die Antwort, mein Freund, kannst du nicht selbst erfinden oder erschaffen. Sie steht bereits fest. Sie liegt außerhalb von dir selbst. Sie ist real, objektiv und eindeutig. Eines Tages wirst du sie erkennen. Du erfindest sie nicht. Du bestimmst sie nicht. Sie kommt zu dir, und früher oder später akzeptierst du sie oder wirst von ihr in die Knie gezwungen.
Das hörte ich aus Dylans Song heraus, und alles in mir sagte: »Ja!« Es gibt sie: die Antwort. Und sie zu verpassen, würde ein verschwendetes Leben bedeuten. Würde ich diese Antwort hingegen finden, so hätte ich eine Antwort auf alle meine Fragen.
Der kleine braune Pfad über dem grünen Hügel, der auf dem Schild in unserer Küche gemalt war, bahnte sich in den Sechzigern seinen Weg durch die süßen Fallen intellektueller Torheit. Wie mutig schien meine Generation, als sie vom Pfad abwich und mit ihrem Fuß in die Falle trat! Einige prahlten sogar:»Ich habe den Weg der Freiheit gewählt und meine eigene Existenz geschaffen. Ich habe die alten Gesetze abgeschüttelt und alles hinter mir gelassen.«
Der Mann mit langem Haar und Kniebundhosen
Gott stellte mir in seiner Gnade unübersehbare Warnschilder in den Weg. Im Herbst 1965 hielt Francis Schaeffer einige Vorlesungen am Wheaton College, die später in seinem Buch The God Who is There4 (dt. »Der Gott, der dort draußen ist«) zusammengefasst wurden. Der englische Titel spiegelt die Einfachheit dieser These wider. Gott ist dort draußen. Nicht hier drinnen, geschaffen und geformt von meinen eigenen Wünschen. Nein, Gott ist dort draußen. Er existiert objektiv. Er ist die absolute Realität. Alles Reale ist von Gott abhängig. Außer der Schöpfung und dem Schöpfer gibt es nichts weiter, und die Schöpfung erhält ihren Sinn und Zweck von Gott.
Das war ein sehr deutlicher Wegweiser: Bleibe auf dem Weg der objektiven Wahrheit. So verhinderst du, dass du umsonst lebst. Bleibe auf dem Weg, auf dem sich auch dein Vater, der Evangelist, schon befand. Vergiss das Schild über der Spüle in der Küche nicht. Das war die gewichtige intellektuelle Bestätigung dafür, dass das Leben in den Steppen des Existentialismus vergeudet wäre. Bleibe auf dem Weg. Es gibt eine Wahrheit. Alles hat einen Sinn und Zweck. Suche weiter. Du wirst diesen Weg finden.
Man sollte sich wohl nicht darüber beklagen, dass man die Studienjahre damit zubringt, das Offensichtliche zu lernen: dass es Wahrheit, objektives Sein und objektive Werte gibt. Es ist, als würde ein Fisch zur Schule gehen, um zu lernen, dass es Wasser gibt, oder ein Vogel, dass es Luft gibt, oder ein Wurm, dass es Erde gibt. Es scheint, als wäre dies in den letzten zweihundert Jahren jedoch zum Hauptinhalt einer guten Ausbildung geworden. Umgekehrt ist das Gegenteil dieser Art von Ausbildung das Wesen einer schlechten Bildung. Also beklage ich mich nicht über die Jahre, in denen ich das Offensichtliche lernte.
Der Mann, der mich das Sehen lehrte
Ich danke Gott für Professoren und Autoren, die sich mit ihrer ganzen Energie dafür einsetzten, die Existenz von Bäumen und Wasser, von Seelen und Liebe sowie von Gott glaubhaft zu belegen. C. S. Lewis, der in Oxford Englisch unterrichtete und 1963 am selben Tag wie John F. Kennedy starb, erschien 1964 am Horizont meines kleinen braunen Pfades mit einer solchen Leuchtkraft, dass ich seine Wirkung auf mein Leben kaum überbewerten kann.
In meinem ersten Studienjahr machte mich jemand auf sein Buch Pardon, ich bin Christ5 aufmerksam. In den nächsten fünf oder sechs Jahren hatte ich fast immer eines seiner Bücher zur Hand. Ich glaube, ohne seinen Einfluss hätte ich mein Leben nicht mit so viel Freude und Eifer gelebt. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Lewis öffnete mir die Augen für chronologischen Snobismus. Das heißt, er hat mir gezeigt, dass Neuheit keine Tugend und Altes kein Laster ist. Wahrheit, Schönheit und Güte werden nicht von der Zeit definiert, in der sie existieren. Etwas ist nicht weniger wert, nur weil es alt ist, und nichts ist wertvoll, nur weil es modern ist. Das hat mich von der Tyrannei des Neuen befreit, sodass ich alte Weisheiten erschließen konnte. Noch heute beziehe ich einen Großteil meiner Seelennahrung aus vergangenen Jahrhunderten. Ich danke Gott, dass mir Lewis das Offensichtliche so überzeugend nahegelegt hat.
Er lieferte mir den Beweis, dass strikte, präzise und scharfsinnige Logik kein Widerspruch zu tiefen, bewegenden Gefühlen und lebendiger, reger – ja sogar verspielter – Vorstellungskraft ist. Er war ein »romantischer Rationalist«. Er verband Dinge miteinander, von denen heute fast jeder meint, sie würden einander ausschließen: Rationalismus und Lyrik, kühle Logik und warme Gefühle, disziplinierte Prosa und freie Phantasie. Indem er diese alten Klischeevorstellungen zunichtemachte, ermöglichte er mir, intensiv nachzudenken und gleichzeitig Gedichte zu schreiben. Er half mir, sowohl für die Auferstehung zu argumentieren als auch Lieder für Christus zu komponieren, nicht nur ein Argument niederzuschmettern, sondern auch einen Freund zu umarmen, eine Definition zu fordern und genauso eine Metapher zu benutzen.
Lewis half mir, die Echtheit und Wirklichkeit der Dinge zu verstehen. Ich kann gar nicht sagen, wie wertvoll dies für mich ist. Beim Aufwachen die Festigkeit der Matratze und die Wärme der Sonnenstrahlen zu spüren, das Ticken der Uhr zu hören, sich der bloßen Existenz der Dinge bewusst zu sein (»des Charakteristischen«6, wie er es nennt). Er verhalf mir zu einem lebendigeren Leben und ließ mich erkennen, was in der Welt war – Dinge, für die wir einen hohen Preis zahlen würden, nur um sie haben zu können, die wir jedoch ignorieren, wenn wir sie besitzen. Er machte mich für Schönheit empfindsam. Er öffnete mir die Augen für die täglichen Wunder, die zur Anbetung führen. Er rüttelte an meiner schläfrigen Seele und schüttete mir das kalte Wasser der Realität ins Gesicht, sodass Leben und Gott, Himmel und Hölle mit Herrlichkeit und Schrecken in meine Welt hereinbrachen.
Lewis entblößte den intellektuellen Widerstand gegen objektives Sein und gegen objektive Werte als die völlige Torheit, die er in Wirklichkeit war. Die philosophischen Könige meiner Generation standen nackt da, und dieser Autor von Kinderbüchern aus Oxford hatte den Mut, das zu sagen.
»Man kann nicht endlos die Dinge ›durchschauen‹. Durch sie hindurchschauen hat nur Sinn, wenn man durch sie hindurch etwas sieht. Es ist gut, daß ein Fenster durchsichtig ist, weil die Straße oder der Garten dahinter undurchsichtig sind. Wie, wenn man auch durch den Garten hindurchsehen könnte? Es führt zu nichts, die Ersten Prinzipien ›durchschauen‹ zu wollen. Wenn man durch alles hindurchschaut, dann ist alles durchsichtig. Aber eine völlig durchsichtige Welt ist unsichtbar geworden. Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr.«7
Wie viel mehr könnte ich noch darüber sagen, wie C. S. Lewis die Welt sah und über sie sprach! Er hatte seine Fehler, sogar einige ernst zu nehmende. Aber ich werde nicht aufhören, Gott für diesen außergewöhnlichen Mann zu danken, der meinen Weg genau im richtigen Augenblick kreuzte.
Eine Verlobte ist eine hartnäckige, objektive Tatsache
Es gab noch eine weitere Kraft, die meinen Glauben an die unumstößliche Existenz objektiver Realität festigte. Ihr Name war Noël Henry. Im Sommer 1966 verliebte ich mich in sie. Wahrscheinlich viel zu früh. Es stellte sich aber heraus, dass es in Ordnung war – ich liebe sie noch immer. Nichts ernüchtert eine umherschweifende philosophische Phantasie so sehr wie der Gedanke an eine Frau und an Kinder, für die man sorgen muss.
Wir haben im Dezember 1968 geheiratet. Es ist gut, sein Denken auf echte Menschen zu konzentrieren. Ab diesem Moment war jeder Gedanke ein Gedanke in einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Nichts war nur eine bloße Vorstellung, sondern hatte Auswirkungen auf meine Frau und später auf meine fünf Kinder und die wachsende Anzahl von Enkelkindern. Ich danke Gott für unsere Ehe als kleines Abbild von Christus und der Gemeinde, das ich in den vergangenen Jahrzehnten meines Lebens darstellen durfte. Es gibt Lektionen im Leben, die ich ohne diese Beziehung wahrscheinlich nie gelernt hätte (ebenso wie es wohl auch Lektionen gibt, die man nur als Single ohne einen Ehepartner lernt).
Pfeiffersches Drüsenfieber, ich danke dir für mein Leben
Im Herbst 1966 grenzte Gott meinen Lebensweg weiter ein. Als er seinen nächsten entscheidenden Schritt tat, fragte sich Noël, wo ich war. Das Herbstsemester hatte begonnen, und ich war weder in den Vorlesungen noch bei den Gottesdiensten erschienen. Schließlich fand sie mich im Krankenhaus. Dort lag ich drei Wochen lang mit Pfeifferschem Drüsenfieber. Der Lebensplan, dessen ich mir ein paar Monate zuvor so sicher war, löste sich in meinen fiebrigen Händen auf.
Im Mai war ich mir noch sicher, dass mein Leben als Arzt am nützlichsten sein würde. Ich liebte Biologie und den Gedanken, Menschen zu heilen. Endlich wusste ich, was ich studieren sollte. Im Sommer besuchte ich deshalb noch einen allgemeinen Chemiekurs, um im Herbst dann gleich organische Chemie belegen zu können.
Durch meine Krankheit hatte ich nun drei Wochen organische Chemie versäumt. Das war nicht mehr aufzuholen. Viel wichtiger war jedoch etwas anderes: Im Krankenhaus hörte ich jeden Morgen auf WETN, dem College-Radiosender, die Predigten von Harold John Ockenga, dem damaligen Pastor der Park Street Church in Boston. Nie zuvor hatte ich jemanden die Bibel so auslegen gehört. Plötzlich konzentrierte sich die herrliche Objektivität aller Wirklichkeit für mich auf das Wort Gottes. Dort lag ich und fühlte mich, als wachte ich von einem Traum auf. Endlich erwacht, wusste ich nun, was ich zu tun hatte.
Als Noël mich besuchte, fragte ich sie: »Was hältst du davon, wenn ich Theologie studieren würde, anstatt eine medizinische Lauf bahn einzuschlagen?« Wie jedes andere Mal, wenn ich in all den Jahren eine ähnliche Frage stellte, war ihre Antwort: »Wenn das Gottes Weg mit dir ist, dann gehe ich mit.« Seit diesem Augenblick habe ich nie an meiner Berufung gezweifelt.
2Der Durchbruch – Jesu Schönheit ist meine Freude
1968 hatte ich noch keine Vorstellung davon, was es für mich bedeuten würde, ein Diener des Wortes zu sein. Ich rechnete damals nicht damit, einmal ein Pastor zu sein – ebenso wenig wie Noël ahnte, einmal die Frau eines Pastors zu sein. Wie aber würde meine Berufung aussehen? Würde es für mich bedeuten, Lehrer oder Missionar zu werden? Sollte ich Autor werden oder Literatur-Professor mit guter Theologie? Ich wusste nur, dass Gottes Wort für mich zur objektivsten und realsten Sache überhaupt geworden war. Der große Sinn und Zweck, nach dem ich mich sehnte, war nun unumstößlich mit der Bibel verbunden. Der Auftrag war klar: »Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt« (2Tim 2,15). Das hieß für mich, Theologie zu studieren und mich darauf zu konzentrieren, die Bibel zu verstehen und richtig auszulegen.
Sich nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt
Mein Streben danach, das Offensichtliche zu lernen, ging weiter. Der moderne Angriff auf die Realität – darauf, dass es eine objektive, erfahrbare Realität außerhalb von uns selbst gibt – hat das Bibelstudium in einen Sumpf der Subjektivität verwandelt. Man konnte das in der Gemeinde feststellen: In Kleingruppen und Hauskreisen tauschte man sich vermehrt über subjektive Eindrücke zu einem Bibeltext aus – darüber, was der Text »für mich« bedeutet, ohne dass diese Ansichten in der ursprünglichen Bedeutung verwurzelt waren. Das Gleiche fand man in wissenschaftlichen Büchern, in denen Gelehrte quasi den Ast absägten, auf dem sie saßen, indem sie behaupteten, Bibeltexte hätten keine objektive Bedeutung.
Wenn es nur ein Leben zu leben gibt in dieser Welt, dann möchte ich dieses nicht verschwenden und so schien mir nichts wichtiger, als herauszufinden, was Gott in seinem inspirierten Wort wirklich meinte. Wenn die Bedeutung von Gottes Wort zur Debatte stünde, dann könnte tatsächlich niemand sagen, welches Leben wertvoll und welches Leben verschwendet ist. Ich war sprachlos über die Kunstgriffe in der akademischen Welt, in der Autoren ihre ganzen intellektuellen Kräfte dafür verwendeten, ihre eigenen Bücher für nichtig zu erklären! Damit meine ich, dass sie Theorien zur Auslegung aufstellten, die besagen, ein Text habe keine eindeutige Bedeutung. Du wirst das wahrscheinlich für unfassbar halten. Ich stimme dir zu: Es ist wirklich unfassbar. Trotzdem verbreiten gut bezahlte Professoren bis heute – unterstützt durch Studiengebühren und Steuergelder – in Vorlesungen ihre Ansicht und behaupten: »Da Literatur die Realität nicht genau vermittelt, müssen auch literarische Interpretationen die Realität in der Literatur nicht genau vermitteln.«8
Mit anderen Worten: Da es keine objektive Realität außerhalb von uns selbst gibt, kann es auch in unseren Büchern keine objektive Bedeutung geben. Beim Auslegen sollen wir nicht den tieferen Sinn und die Bedeutung herausfinden, den der Autor dem Text gegeben hat, sondern nur die Vorstellungen wiedergeben, die uns beim Lesen durch den Kopf gehen. Wenn dem aber so ist, dann ist unsere Auslegung jedoch ohnehin irrelevant, denn wenn andere unsere Interpretation des Bibeltextes lesen oder hören, haben auch sie wiederum keine Möglichkeit, unsere Worte richtig zu verstehen und sind auf ihre eigenen Vorstellungen über die Bedeutung unserer Texte angewiesen. Es ist alles ein Spiel. Allerdings ein böses, denn dieselben Gelehrten (und auch die Leute in deinem Hauskreis) bestehen darauf, dass es für ihre eigenen Liebesbriefe und Verträge sehr wohl einen objektiven Maßstab gibt: Sie bedeuten genau das, was sie damit sagen wollten. Bei der Bank oder dem Eheberater wird es nicht akzeptiert, wenn jemand »Ja« versteht, obwohl ich »Nein« geschrieben habe.
Und so fand der Existentialismus seinen Eingang in die Bibelauslegung: Existenz vor Essenz. Das bedeutet: Ich finde den Sinn nicht, sondern ich erschaffe ihn. Die Bibel ist ein Klumpen Ton, und ich bin der Töpfer. Die Aufgabe der Auslegung ist folglich eine Art von Schöpfung und bringt somit immer etwas Neues hervor. Durch meine Existenz als Subjekt erschaffe ich die »Essenz« des Objekts. Lach jetzt bitte nicht! Diese Menschen meinen das ernst – damals wie heute. Heute werden ihre Ansichten nur anders bezeichnet.
Den Glanz der hellen Mittagssonne verteidigen
In diesen Morast der Subjektivität trat ein Literaturprofessor von der Universität von Virginia: E. D. Hirsch. Sein Buch Validity in Interpretation erschien mir im Treibsand moderner Bedeutungskonzepte wie ein Fels unter den Füßen. Wie die meisten Lehrmeister, die Gott mir über den Weg schickte, verteidigte Hirsch das Offensichtliche. Er bestand tatsächlich darauf, dass eine ursprüngliche Bedeutung existiert, die der Verfasser dem Text gab. Auch behauptete er, dass es die Aufgabe der Bibelauslegung ist, diese Intention im Text zu suchen und stichhaltig zu belegen. Das schien mir so klar wie die helle Mittagssonne. Schließlich gehen wir im täglichen Leben bei allem, was wir sagen oder schreiben, genau davon aus.
Was vielleicht noch wichtiger war: Es war fair und aufrichtig. Niemand möchte, dass seine Textnachrichten, Briefe und Verträge anders interpretiert und verstanden werden als beabsichtigt. Deshalb gebietet es die Höflichkeit, dass wir die Worte anderer auf dieselbe Weise lesen, wie wir auch möchten, dass sie unsere Worte lesen. Das philosophische Gerede über Bedeutung erschien mir als nichts anderes als schlichte Heuchelei: An der Universität stellt man die objektive Bedeutung in Frage, während man zu Hause (und in der Bank) hingegen darauf bestand. An diesem Spiel wollte ich mich nicht beteiligen. Es sah nach einem völlig verschwendeten Leben aus. Wenn es keine richtige Auslegung gibt, die auf der objektiven, unveränderlichen, ursprünglichen Bedeutung einer Aussage basiert, konnte ich nur schließen:»Dann lasst uns essen, trinken und fröhlich sein – aber lasst uns nicht so tun, als wären diese akademischen Übungen von Bedeutung.«
Der Tod Gottes und der Tod der Bedeutung
Dann kam eines zum anderen. An einem kalten Nachmittag im April 1966 nahm ich in der Bibliothek des