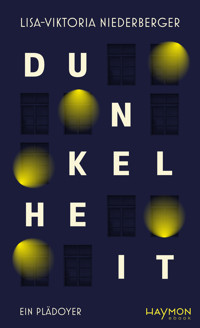
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
INTO THE DARK Über die Bedeutung der Dunkelheit – Warum wir sie verloren haben und doch nicht ohne sie leben können Mit Dunkelheit verbinden wir Gefahr, Angst und Einsamkeit. Das Bild einer Frau, die mit dem Pfefferspray in der Hand nach Hause eilt. Die Monster unter dem Bett, die sich zeigen, sobald das Licht erlischt. Der Tod, vor dem wir uns fürchten. Gleichzeitig ziehen uns das Finstere und die Nacht an, sie faszinieren uns, waren schon immer Teil der (Pop-)Kultur und Kunst. Das Spiel von Schatten und Licht gehört seit jeher dazu. Dunkelheit bedeutet Schrecken und Schönheit. Doch nach und nach haben wir die Dunkelheit aus unseren Leben, unseren Städten verdrängt. Lichtverschmutzung, Umweltzerstörung, der Skyglow, der uns den Schlaf raubt: Zu viel künstliches Licht wirkt sich katastrophal auf ganze Ökosysteme, Tiere und Menschen aus. Die Lösung: Es braucht positive Ansätze und eine reelle Gesetzgebung, um unsere Natur zu schützen. Das Potenzial der Dunkelheit: Lisa-Viktoria Niederberger fragt sich in ihrem sprachgewaltigen Essayband: Wie kann ein Leben aussehen, in dem wir der Dunkelheit wieder mehr Raum erlauben? Sie beschäftigt sich mit Dunkelheit und Machtverhältnissen, mit verborgenen Klassenunterschieden, Patriarchatskritik, mit dem Himmel und den Sternen als Kulturgut, mit Naturschutz, Arbeitsschutz, feministischen und politischen Fragestellungen. "Dunkelheit" ist eine literarische Spurensuche nach Ambivalenzen und Kontinuitäten rund um das Dunkle. Ein Plädoyer für die Rückkehr zu finsteren Nächten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lisa-Viktoria Niederberger
Dunkelheit
Ein Plädoyer
Für den Teil in mir, der glaubt, er kann nichts und bringt nichts zu Ende.
Inhalt
Prolog
Die dunkle Seite der Helligkeit
Das Dunkle durchleuchten
Im Schatten der Straßenlaterne: Über Sicherheit und Unsicherheit auf nächtlichen Wegen (und was das Patriarchat damit zu tun hat)
Alleine in der Nacht
Eine kleine und unvollständige Kulturgeschichte der nächtlichen Beleuchtung – Teil 1
Von der Kriminalisierung des öffentlichen Raums
Das Problem mit der Sittlichkeit
Sicherheit und Unsicherheit in der Gegenwart
Das wahre Problem (und mögliche Lösungen)
Freitagabend im August
Schwindende Welten, verlorener Zauber: Von Glühwürmchen, Sternbildern und Ausflügen in den Lebensraum Nacht
Jäger*innen des verlorenen Leuchtens
Lichtverschmutzung
Von Laubbläsern, Insekten und dem Sich-verwandt-Machen
Das bisschen Licht?
Himmelsdarstellungen, göttliche Muttermilch und das disruptive Potenzial einzelner Sterne
Wem gehört der Himmel oder: Schrottplätze und Cashcows from Outer Space
Friede den Hütten, Krieg den privat geführten Raumstationen
Ein anderer Planet
Zwischen Schlaf und Schaffen: Über jene, die nachts munter sind
Von einer, die auszog, um das Einschlafen zu lernen
Innere Uhren, innere Rhythmen
Eine kleine und unvollständige Kulturgeschichte der nächtlichen Beleuchtung – Teil 2
Nächtliche Beleuchtung und Schlaf
Von der Nachtschwärmerin zur Nachtarbeiterin
Nächtliche Beleuchtung und Nachtarbeit: ein kritischer Blick
Das Dunkle als Hort der Ideen
Projekt Blaue Stunde
Das ultimative Dunkle: Wir und der Tod
Todesangst – ein Rekonstruktionsversuch
Der längste Tag von allen
Abstoßung bei gleichzeitiger Anziehung: das Leichentabu
Statusübergänge – wie der Tod auch die, die bleiben, verändert
Verdrängung, Verteelichtung und das Hinauszögern des Unvermeidbaren
Sich der Dunkelheit stellen
Ein bunter Ort
Epilog: Der weiße Rehbock
Danksagung
Anmerkungen
Literatur
Über die Autorin
Impressum
Prolog
Darkness divides opinions. Some are frightened of the dark or at least prefer to avoid it, and there are many who dislike what it appears to stand for. Others are drawn to its strange domain [...], the call of the mysterious and of unknown possibility.1,2
Nina Edwards – Darkness. A Cultural History, S. 7.
Der Heimweg in einer mondverhangenen Nacht. Durch enge Gassen, über beleuchtete Parkplätze oder an uneinsichtigen Grünflächen vorbei. Jedes Knacken und Rascheln registrieren wir. Wir halten inne. Sind da Schritte? Als würden unsere Ohren versuchen, das, was die Augen nicht leisten können, auszugleichen.
Dunkle Schatten an den Wänden, dieser schwarze Hohlraum unter dem Bett, in dem etwas lauern könnte. Es hilft gegen die Angst, gegen das Herzklopfen, die Bettdecke bis zum Kinn hochzuziehen, die Zehen fest zu verpacken. Kein bisschen Körper darf der Dunkelheit des eigenen Kinderzimmers ausgeliefert sein, weil nur das die Monster abwehrt. Und manchmal zieht sich diese vage Angst bis ins Erwachsenenalter.
Wie ungern ich nachts aus dem Fenster sehe, mich ein Schauer überzieht, bei der Vorstellung, draußen etwas oder gar jemanden Ungewünschten zu entdecken. Oder dieses mulmige Gefühl, wenn der Novembernebel zwischen den Gräbern wabert, das Tageslicht mit jeder Minute etwas mehr schwindet. Immer deutlicher sichtbar werden dafür all die Kerzen in ihren roten Plastikdosen, und obwohl der Verstand sagt, dass von den Toten keine Gefahr ausgeht, sind wir froh, den Friedhof in der Abenddämmerung hinter uns lassen zu können, empfinden wir das Licht von Haltestellenhäuschen oder Laternen, die flimmernd anspringen, als beruhigend.
Licht gibt uns Sicherheit, zumindest subjektiv. Dunkelheit ist Angst, Mysterium, eine fremde Welt, die scheinbar nicht uns gehört, sondern den Unholden, lebend oder tot, seltsamen Tieren, die wir nicht verstehen, vor denen wir uns fürchten oder ekeln. Monster, Schatten. Dunkelheit und dunkle Nächte sind unheimlich. Also entreißen wir sie dem Dunklen. Wir entdeckten vor langer Zeit das Feuer, das dank Blitz und Waldbrand einfach da war, nahmen es mit, bauten eine Feuerstelle, nährten es und scharten uns um es herum. Seitdem ist es eine der Bestrebungen des Menschen, die Wärme und das Licht, das uns das Feuer bringt, zu zähmen, zu optimieren. Kälte und Dunkelheit immer effizienter zu verdrängen. Das Licht muss heller, greller, lauter, besser werden. Das warm flackernde Licht des Urfeuers der frühen Menschen ist in der Gegenwart jenem der LEDs und leuchtenden Displays gewichen. Wir machen die Nacht zum Tag, mehr denn je. Wir beleuchten unsere Gärten, Häuser, Kinder im Gitterbett, Haustiere beim nächtlichen Gassi-Gang, unsere Städte, Industrieanlagen, sogar unbespielte Stadien und seit Generationen unbewohnte Burgen tauchen wir in Licht, weil Beleuchtung nun auch zwei anderen Kriterien folgt: der Ästhetisierung der Nachtlandschaft und der Demonstration von Macht und Profit. Wir beleuchten Fabrikhallen und Betriebe, Wohnungen, verlängern das Tagesende, zögern das Einschlafen hinaus, denn das ist es, was wir seit der industriellen Revolution gelernt haben. Der Wunsch nach Fortschritt und ewigem Wachstum geht Hand in Hand mit einer sukzessiven Verdrängung der Nacht. Wer schläft, kann weder arbeiten noch konsumieren, noch in irgendeiner anderen Art und Weise produktiv sein. Wer in der Freizeit Teil des Nachtlebens ist, alle Angebote, die sich seit dem 18. Jahrhundert auch für das Bürgertum auftun – Jahrmärkte, Theater etc. – beansprucht, kann sich durch deren Nutzung profilieren. Denn wer es sich leisten kann, an einem Dienstag bis spätnachts in der Oper zu sitzen, grenzt sich von jenen, die nachts oder frühmorgens arbeiten müssen, ab.
Was aber verlieren wir? Was bleibt auf der Strecke oder sinkt zurück ins Verborgene, wenn wir die Dunkelheit immer mehr aus unserem Leben verdrängen?
Wir alle, Menschen, Tiere und Pflanzen, brauchen Ruhephasen, um uns vom Tag zu erholen und zu regenerieren. Künstliches Licht in der Nacht, Fachpersonen sprechen auch von LaN – Light at Night, oder aLan, wobei das a für „artificial“, also künstlich, steht, stört dabei, bringt unseren Rhythmus durcheinander. Ohne Dunkelheit keine Ausschüttung des Hormons Melatonin, ohne Melatonin kein guter Schlaf. Ohne ausreichend Nachtruhe geht uns wichtige Erholungszeit verloren. Dunkelheit ist kein alleiniges Patentrezept für guten Schlaf, aber ein relevanter Faktor. Dunkelheit ist wichtig. Für alle.
Gleichzeitig wissen wir, dass sich das Fehlen von Dunkelheit negativ auf nachtaktive Lebewesen auswirkt. Beleuchtete Wiesen werden nachweislich weniger bestäubt. Frisch geschlüpfte Meeresschildkröten sterben, weil sie Hotelbeleuchtungen mit dem Mond verwechseln und statt ins Meer auf die Straße kriechen. Spinnen, die in Versuchen künstlichem Licht ausgesetzt werden, entwickeln kleinere Gehirne als jene, die in Dunkelheit auf-wachsen.3
Und natürlich verlieren wir den Blick auf den Sternenhimmel. Laut Angaben des Klimaschutzminsteriums ist wegen der Aufhellung des Nachthimmels derzeit in Österreich nur mehr jeder zehnte Stern sichtbar.4 Jeder zehnte! Ebenso geht uns das Bewusstsein über die positiven Aspekte der Dunkelheit ab. Dass sie nicht nur Angstort, sondern eben auch samtwarme Umarmung sein kann. Ein Schutzraum, in dem Ruhe, aber auch Zärtlichkeit, Körperlichkeit, Exzess und Selbstentfaltung zelebriert werden können. Wir vergessen, dass Dunkelheit und dunkle Nächte uns von Anfang an in die Arme der Gemeinschaft getrieben haben. Das Lagerfeuer, der Herd, der fein gearbeitete Lampenschirm im bürgerlichen Salon, sie alle sind die Dreh- und Angelpunkte von Versammlungen. Die Orte, an denen Geschichten erzählt, Pläne geschmiedet, zwischenmenschliche Bänder geknüpft und Visionen gesponnen werden.
Dunkelheit bedeutet auch Ruhe, bedeutet in sich gehen. Bedeutet Pause und Sicherheit. Denn Dunkelheit ist ambivalent: Eine dunkle Gasse ist bedrohlich; eine dunkle Höhle aber, in die man sich kuscheln kann, wirkt gemütlich und wird auch von Kindern gerne aus Sofas, Bettwäsche und Polstern gebaut. Dunkelheit ermöglicht Rückzug, Innenschau, macht Lust auf Geschichten.
Was würde also geschehen, wenn wir beginnen, das Licht, das unsere Tage künstlich in die Länge zieht und unsere Nachthimmel aufhellt, nicht nur kritisch zu hinterfragen, sondern auch der Dunkelheit mit Neugier zu begegnen? Wenn wir der Dunkelheit (wieder) Raum geben? Unsere Ängste vor Verbrechen, Tod und Schatten zulassen und adressieren, anstatt sie wegzuschieben?
Über all das habe ich nicht immer schon, aber immer wieder nachgedacht, ebenso über das Privileg von Licht, als mir erstmals klar wurde, dass auch Licht so wie alle Ressourcen auf diesem Planeten zutiefst unfair und ungleich verteilt ist. Denn trotz der weitreichenden Verbreitung von künstlichem Licht ist der Zugang dazu global oft keine Selbstverständlichkeit. Während in Industrieländern die nächtliche Beleuchtung allgegenwärtig ist, gibt es in vielen Regionen Afrikas, Südasiens und Lateinamerikas immer noch Millionen von Menschen, die von zuverlässiger Stromversorgung abgeschnitten sind und weiterhin auf alternative Lichtquellen wie Kerzen, Kerosinlampen oder Solarleuchten zurückgreifen müssen. Diese ungleiche Verteilung hat weitreichende soziale und wirtschaftliche Folgen, denn der Zugang zu Licht ist eng mit dem Zugang zu Bildung, Sicherheit und wirtschaftlichen Möglichkeiten verknüpft. Ohne ausreichend Licht können Kinder nachmittags im Winter weder lernen, noch spielen. Die Arbeitsproduktivität ist begrenzt, und die öffentliche Sicherheit leidet. Wiederum global zu beobachten sind eine generelle jährliche Zunahme der Lichtverschmutzung und die Tendenz, immer mehr ehemals davon unberührte Gebiete zu betreffen. Sogar in der Arktis wächst industrie- und bergbaubedingt die Lichtverschmutzung dem weltweiten Trend entsprechend jährlich um knapp 5 %.5
Dunkelheit ist aber nicht nur eine sternenklare Nacht, ein finsterer Wald oder ein schauriger Keller. Dunkelheit ist auch ein innerer Zustand. Im Zuge der Recherche für dieses Buch stoße ich auf Carl Gustav Jungs Schattentheorie. Sie ist ein zentrales Konzept seiner Analytischen Psychologie und bezieht sich auf jene unbewussten Teile unserer Persönlichkeit, die wir oft verdrängen oder verleugnen. Jung nennt diesen Teil der Psyche den „Schatten“, da er sich im „Dunkeln“ unserer bewussten Wahrnehmung befindet. Der Schatten besteht aus Eigenschaften, Neigungen und Gefühlen, die nicht mit dem bewussten Selbstbild übereinstimmen und deshalb oft als negativ betrachtet werden. Diese Aspekte unseres Selbst können Aggression, Neid, Gier, aber auch unterdrückte Kreativität und ungelebte Potenziale umfassen. Der Schatten ist also jener Teil unseres Ichs, den wir nicht bewusst akzeptieren oder anerkennen wollen. Er umfasst nicht nur die offensichtlich negativen Eigenschaften, sondern auch positive Fähigkeiten und Talente, die aus unterschiedlichen Gründen unterdrückt werden. Laut Jung entsteht der Schatten, weil Menschen gesellschaftlichen, familiären und kulturellen Normen entsprechen wollen. Alles, was nicht in dieses Idealbild passt, wird verdrängt oder ignoriert, wird zu unseren Schatten.
Ich begegnete meinen (und den Schatten anderer) intensiv in einer der dunkelsten Phasen meines Lebens. Als mein Vater starb, fragte ich mich, ob das nun das Schlimmste war, das mir jemals passieren würde, und ob ich die Dunkelheit, die ich seitdem in mir spürte, irgendwann wieder verlieren würde oder ob sie mich nun für immer von allen trennen würde, die noch nicht wissen, wie es ist, ein Mitglied aus dem engsten Kreis zu verlieren. Ich fragte mich, ob meine Angst vor dem Tod vielleicht ausgeprägter war als die des Durchschnittsmenschen, als ich mit 30 wieder begann, mit brennendem Badezimmerlicht und offener Schlafzimmertür ins Bett zu gehen, weil ich mich sicherer fühlte, beschützt vor Alpträumen von meines Vaters Leiche oder irgendeinem schemenhaften Rest von ihm, der seine Wohnung, in der jetzt ich lebte, heimsuchen könnte. Ich fragte mich, ob Angst vor dem Tod die Steigerungsform von Angst vor dem Dunkeln sein könnte? Oder ob Angst vor dem Dunkeln immer auch automatisch Angst vor dem Tod ist, zumindest ein bisschen. Denn was ist denn der Tod anderes als ewige, dunkle Ungewissheit?
Die dunkle Seite der Helligkeit
Dass ich eines Tages, nein, besser, eines Abends einige Jahre später begann, mich mit Lichtverschmutzung auseinanderzusetzen, lag an dem Blick aus meinem Wohnzimmerfenster. An der neuen, grellen LED-Leuchtinstallation am Dach des Universitätsgebäudes in der Nachbarschaft, in die ich mittlerweile gezogen war. Ein Licht, so hell, so schmerzhaft, dass es in den Augen brannte. Es tat weh, es blendete. Mein Partner und ich, wir arrangierten die Pflanzen und Deko-Gegenstände auf dem Fensterbrett neu, versuchten, das Licht zu verbergen, sodass wir zumindest beim Auf-der-Couch-Sitzen nicht gestört wurden. Es funktionierte nur mittelmäßig, und bald mussten wir akzeptieren, dass nur Jalousien wirklich wirkten.
Ich fühlte mich eingesperrt in meinem eigenen Zuhause und musste auf dem Balkon mit dem Gesicht zur Wand sitzen, so sehr blendete mich das Licht. In manchen Nächten wurde die Installation pünktlich um 22 Uhr abgeschaltet, manchmal brannte sie die ganze Nacht, und häufig leuchtete sie noch (oder wieder?), wenn wir morgens aufstanden. Wir begannen sie immer mehr zu hassen. Weil sie uns den ungestörten Blick aus dem Fenster nahm, weil sie, so vermuteten wir damals nur, unmöglich gut für all die Tiere sein konnte, die in den Wäldern und Wiesen leben, an die das Universitätsareal grenzt.
Wir hassten sie aber vor allem, weil ihre Sinnlosigkeit uns störte, sie ein reines Wohnviertel bestrahlte und wir nicht verstanden, wieso und wozu. Wir wohnen in einem Viertel am Stadtrand, das in den 1960er- und 70er-Jahren entstand, als hier die ersten Gebäude der Universität und Wohnhäuser für Studierende und Familien gebaut wurden. Auf Luftaufnahmen aus der Zeit sieht man einzelne Gebäude, Fakultäten und Hochhäuser im Grünen, umgeben von Weizen- und Erdbeerfeldern. Jetzt, knapp 60 Jahre später, ist natürlich alles verdichtet, mit der Stadt zusammengewachsen. Auch die Universität hat dazugewonnen, Studiengänge, prestigeträchtige Sponsor*innen und eben auch jene Aussichtsplattform mit Lichtinstallation, die seit 2019 das Dach des Hochhauses, das u. a. das Institut für Chemie und Physik beherbergt, ziert und die, bezugnehmend auf einen Text Johannes Keplers, „Somnium“ genannt wird.
Ein Prestigeprojekt, diese Installation. Von den vielen Spaziergängen während der Lockdowns kann ich berichten: Man sieht sie kilometerweit. Immer wieder blitzt das immerhin in 60 m Höhe angebrachte LED-Kunstwerk zwischen Häuserschluchten, hinter Bäumen oder Brückenpylonen hervor. Die Installation leuchtet, um des Leuchtens willen. Nicht für Tourist*innen oder Kunstkenner*innen, denn die verirren sich wohl kaum zu uns an den Stadtrand. Sie leuchtet auch nicht für die Studierenden, denn die sind nachts nicht am Campus. Und sie leuchtet vermutlich auch nicht für uns Anrainer*innen, denn wir schlafen auch – insofern wir ob des Lichts können. Sie brennt, weil sie es kann.
(Kunst-)Licht ist Zeichen von Reichtum, Status und damit verbundener Macht. Nächtliche Beleuchtung ist ein Ausdruck von Hierarchie und Hegemonie, dient der Abgrenzung oder auch der Erinnerung daran, wer hier das Sagen hat. Das galt für die Höfe der absolutistischen Herrscher in Frankreich, die täglich mit hunderttausenden Lampen die Nacht zum Tag machten, während jene, die ihre Herrschaft durch Steuern und Arbeit am Laufen hielten, im Dunklen saßen, sowie in der Gegenwart für Bankengebäude und Filialen internationaler Unternehmen, deren Werbetafeln nachts leuchten, und in unserem Stadtteil für die Universität.
Licht als Zeichen von Macht also, für mich, für uns wurde es zum Zeichen unserer Ohnmacht. Ich begegnete erstmals dem Wort „Lichtverschmutzung“, begann zu recherchieren, fand schnell heraus, dass es in Österreich ein Lärm- und ein Luftschutzgesetz, aber kein Lichtschutzgesetz gibt. Das hat sich mittlerweile geändert. Im Rahmen der oberösterreichischen Umweltschutzgesetz-Novelle 2024 wurde Lichtverschmutzung als Problem anerkannt und neue Richtlinien vorgegeben.
Vor ein paar Jahren waren der Einsatz gegen und die Aufklärung über Lichtverschmutzung noch Themen, die primär von engagierten Personen aus der Zivilgesellschaft vorangetrieben wurden. Facebook spielte mir eines Tages die Ankündigung zu einem Vortrag der Paten der Nacht in meinen Feed, und schon während ich ihn mir einige Tage später anhörte, änderte sich mein Blick auf nächtliche Beleuchtung, auf Dunkelheit. Ich saß auf unserem Wohnzimmerboden, schaute in den Computer und hörte zum ersten Mal davon, dass 50 % der Erdbewohner*innen noch nie die Milchstraße gesehen haben, dass man auf Satellitenbildern nachweisen kann, dass die globale Lichtverschmutzung jährlich messbar steigt. Ich hörte, dass das falsche oder zu viel Licht abends und nachts die Melatoninausschüttung verhindert, dass pro Sommer 100 Milliarden Insekten in oder wegen Lampen sterben und so das ökologische Gleichgewicht massiv gefährdet ist. Ich erfuhr von Zugvögeln, deren Orientierung durch das Licht von Hochhäusern so gestört wird, dass sie vor Erschöpfung sterben oder gegen die Gebäude fliegen und sich das Genick brechen. Von Fledermäusen, die wegen der Beleuchtung von Kirchen, Schlössern oder Ruinen ihre Quartiere verlieren, und Bäumen, deren innere Uhren durch Straßenlaternen gestört sind und die zu früh austreiben, was sie anfälliger für Frostschäden macht.
Schon während des Vortrags machte ich mir Notizen, tauchten Figuren auf, ein Mädchen, das die Sterne sehen möchte, eine geblendete Fledermaus, ein müder Baum. Sie alle sollten drei Jahre später zu den Charakteren meines Kindersachbuchs Helle Sterne, dunkle Nacht werden.
Im Rahmen der Recherche wurde ich auf etwas aufmerksam, das sich am besten als „Informationskluft“ beschreiben lässt. Sprach ich mit Menschen „vom Fach“ über Lichtverschmutzung, z. B. mit einer Eulenforscherin, einem Ranger im Nationalpark Donau-Auen und den Mitgliedern vom entomologischen Forschungskreis Linz, waren sich alle über die Problematik der verschwindenden nächtlichen Dunkelheit bewusst. Sie sprachen nostalgisch von den unbeleuchteten Sommernächten ihrer Kindheit und dem ihnen innewohnenden Zauber, mit einer Sehnsucht, die das Gefühl des Verlusts deutlich machte. Die Dringlichkeit wurde erkannt. Sprach ich das Thema in meinem Freund*innen- und Kolleg*innenkreis, der sich im Wesentlichen aus Geisteswissenschaftler*innen, Künstler*innen und Kulturarbeitenden zusammensetzt, an, war die Reaktion eine gänzlich andere. Wieso ich denn ausgerechnet darüber schreiben würde, wieso das wichtig wäre, fragten sie mich, wieder und immer wieder. Noch dazu für Kinder? Das Thema war den meisten komplett fremd. Manche hatten immerhin das unlängst im Radio ausgestrahlte Interview mit einer Epidemiologin gehört, die von den Auswirkungen von Nachtarbeit und nächtlichem Licht auf die Gesundheit sprach. Andere wiederum wussten von dem Aufruf der „Umweltberatung“, einer österreichischen Organisation, die Privatpersonen und Betriebe in ökologischen Fragen betreut, Glühwürmchen zu zählen und zu melden. Ganz stolz erzählte mir eine Freundin von der Handvoll Leuchtkäfer, die sie in ihrem Garten entdeckt hatte, und ich musste mir die Tränen verkneifen, weil sich das Wissen über das Insektensterben mittlerweile so tief in mir verankert hatte. Ganze 40 % der Insektenarten sind gegenwärtig vom Aussterben bedroht. Das ist schon furchtbar, aber noch erschreckender finde ich die folgende Zahl: In den letzten 27 Jahren ist die weltweite Biomasse der Insekten um 76 % zurückgegangen.6 Die nächste alarmierende Erkenntnis ist, dass der Bestand sogar in Naturschutzgebieten dramatisch zurückgegangen ist bzw. zurückgeht.7
Einen Lichtblick gab es. Im Zuge der Energiekrise beschloss die Universität, aus Kostenersparnisgründen die Lichtinstallation auf dem Dach auf unbegrenzte Zeit auszusetzen. Ich stand am Balkon, blickte auf den dunklen Fleck am Himmel, den dahinterliegenden Wald, und fühlte mich leicht. Unbeschwert, als hätte ich etwas zurückbekommen, das mir zu Unrecht genommen worden war. Aber die Freude hielt nicht lange. Vor meinem Schlafzimmerfenster sticht nun an Spieltagen das grellweiße Licht der riesengroßen Flutlichtanlagen des neuen Linzer Stadions. Obwohl es mehrere Kilometer entfernt ist, brennen die Lichter in den Augen. Ich habe von meiner Wohnung einen guten Blick auf die Stadt, kenne die Beleuchtung am Hafen, an den Brücken und so weiter. Es gibt viele nächtliche Lichtquellen in Linz, aber keine ist so hell und strahlend wie diese Flutlichtanlage, die mitten in der Innenstadt am Donauufer errichtet wurde.
Es ist offensichtlich: Ich kann mich über falsches Licht ordentlich aufregen, mich vielleicht sogar hineinsteigern. Ich dachte, es liege an mir, ich sei empfindlich. Vielleicht bin ich das auch. Die Daten jedoch stimmen mir aber zu. Studien haben ergeben: Wer nachts in grellweißes Licht blickt, hat einen höheren Herzschlag und Blutdruck. Es kommt zu einer Ausschüttung von Adrenalin, und nur eine Sekunde Blickkontakt mit diesem Licht reicht unserem Nervensystem aus, um von einem parasympathischen in einen sympathischen Zustand zu wechseln. Soll heißen: Wir sind aktiviert und hellwach. Die Melatoninausschüttung stoppt. Nächtliche Beleuchtung macht also nachweislich etwas mit uns. Mit unserem Körper und, wenn diese Belastung von Dauer ist, mit unserer Psyche. Mit subjektiver Empfindlichkeit hat das nur insofern zu tun, dass es eben manche Menschen gibt, die sensibler auf die Signale des eigenen Körpers reagieren als andere.
Es ist zu hell. Das ist keine Meinung, sondern ein Fakt. Es gibt Messungen, die zeigen, dass manche Straßenlaternen bis zu dreihundertmal heller sind als das Licht bei Vollmond. Und das jeden Tag. Nächtliche Beleuchtung macht uns krank. Was dagegen helfen würde? You guessed it: das Licht abzuschalten, zu dimmen, zumindest teilweise. Und kritisch zu hinterfragen: Was brauchen wir wirklich und wo schießen wir übers Ziel hinaus? Zur Orientierung: Derzeit werden etwa 20 % des globalen Energieverbrauchs dafür verwendet, um die Nacht zu erhellen.
Eine Rückkehr zu dunkleren Nächten könnte also gleichzeitig und mit verhältnismäßig geringem Aufwand viele der dringenden Probleme unserer Zeit bekämpfen. Dazu braucht es am besten internationale und gemeinschaftlich getroffene politische Entscheidungen, die statt Partikularinteressen jene der Allgemeinheit (und der Umwelt) vertreten. Es braucht aber auch Bürger*innen, die über den Wert dunklerer Nächte informiert sind und diese einfordern.
Die Nacht, die Dunkelheit, ist aber seit Menschengedenken ein Angstort. Dunkelheit wird mit Tod und Verbrechen, mit Mord, Einbruch und Vergewaltigung assoziiert. Das sind Ängste, die adressiert werden müssen, denn es werden sich nur jene für die (urbane) Dunkelheit starkmachen, die sich in ihr sicher fühlen. Dunkle Nächte können uns und die Lebewesen, mit denen wir sie teilen, gesünder machen. Sie können uns helfen, Ressourcen zu sparen und damit den CO2-Ausstoß und Kosten für Energieversorgung zu senken.
Das Dunkle durchleuchten
Dieser Essay zeigt, welche unterschiedlichen Felder von nächtlicher Beleuchtung und Lichtverschmutzung betroffen sind, und schlägt Alternativen vor, wagt Gedankenexperimente. Er ist aber gleichzeitig ein Liebesbrief an die Dunkelheit. Eine Einladung hinzuschauen, sich nicht abzuwenden von Ängsten vorm Tod und der Finsternis, sondern in die Schwärze zu blicken. An die ungeliebten, finsteren Orte in uns selbst zu gehen. Vielleicht finden wir dort unerwartet Schönes.
Ich wollte nicht nur in Büchern und meinem eigenen Erfahrungsschatz nach Antworten und Wissen suchen, sondern auch in den Forschungs- und Lebensrealitäten anderer, interdisziplinäre Betrachtungsweisen und eine breit gefasste Forschungslandschaft sind mir wichtig. Daher gilt mein größter Dank der Biologin und Ökologin Annette Krop-Benesch, der Nachtfotografin und österreichischen Bundessprecherin der Paten der Nacht Österreich Simone Weiß, dem ehemaligen Bestatter und Thanatologen Martin Prein, der Schlafmedizinerin Anna Heidbreder sowie Alfred Moser und Josef Springer aus der Abteilung Gewerbe- und Sicherheitstechnik des Magistrat Linz, die mir alle im Rahmen von Expert*inneninterviews von ihrer privaten und beruflichen Auseinandersetzung mit Licht und Dunkel berichtet haben. Die sich mit mir zusammen gefragt haben: Wie können wir der Dunkelheit (wieder) mehr Raum zugestehen, in unseren Städten, Gärten, Zimmern, Leben?
Zur besseren Vorstellung, wie das aussehen könnte, habe ich am Ende jedes Kapitels Zukunftsbilder gezeichnet. Sie sind utopisch, aber das ist gut, denn Utopien können als Leuchttürme in dieser oft düsteren Realität dienen. Sie bieten uns nicht nur eine Flucht aus den gegenwärtigen Schwierigkeiten, sondern auch eine Vision, die uns inspiriert und antreibt. In Zeiten von Klimakrisen, sozialer Ungerechtigkeit und politischer Instabilität können utopische Vorstellungen als Katalysatoren für positive Veränderungen wirken. Sie ermöglichen es uns, über die Grenzen des momentan Möglichen hinaus zu denken und innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Ohne die Vorstellung von einer besseren Welt ist es leicht, den Mut und die Motivation zu verlieren, notwendige Veränderungen anzustreben. Utopien sind daher nicht nur Wunschträume, sondern essenzielle Werkzeuge für gesellschaftlichen Fortschritt und individuelle Hoffnung.
Dunkle bzw. dunklere Nächte allein lösen natürlich nicht alle Probleme unserer Zeit. Sie verhindern nicht den Klimakollaps oder lösen die Energiekrise, zerschlagen weder den Turbokapitalismus noch das Patriarchat. Sie allein werden die Insekten nicht retten, noch uns von unseren zunehmenden Schlafstörungen heilen. Aber dennoch könnten sie ein wichtiges Puzzleteil sein, das einzelnen ökologischen Nischen hilft, sich zu erholen.
Dunklere Nächte können, davon bin ich überzeugt, unsere Städte lebenswerter und uns gesünder, fitter und glücklicher machen. Sie geben uns vor allem das zurück, was für viele von uns längst verloren und vergessen ist: den Blick hinauf in einen Sternenhimmel, ins Universum. Und vielleicht auch die Erinnerung daran, dass wir Teil eines unendlich großen Ganzen sind, für das es sich (immer noch) zu kämpfen lohnt.
Im Schatten der Straßenlaterne
Über Sicherheit und Unsicherheit auf nächtlichen Wegen (und was das Patriarchat damit zu tun hat)
Rooted in early modern daily life, nocturnalisation was a revolution.1
Craig Koslofsky – Evening’s Empire, S. 2.
The price we pay for making our cities accessible or ‚user-friendly‘ throughout the night, with pervasive ‚daylight‘ lighting and camera monitors, frequent public transport and generally a greater sense of accessibility, is that it destroys the very thing we love about the dark night. Without darkness holding sway, night can become too much like day, as atmospheric as an airport lounge.2
Nina Edwards – Darkness. A Cultural History, S. 172.
And by the way, I’m goin’ out tonight.3
Taylor Swift – „Bejeweled“
Alleine in der Nacht
Während meiner Recherchen habe ich gelegentlich das erlebt, was ich an Bildung und Wissenschaft schon immer besonders gemocht habe: zufällig herauszufinden, dass es für Dinge, die ich selbst schon erlebt oder beobachtet habe, tatsächlich Begriffe gibt. Ein Beispiel dafür ist, dass ich beim Lesen von Paul Bogards Standardwerk Die Nacht auf den Begriff celestial vaulting stieß, eine etwas unschön zu übersetzende Formulierung, die aber ein großartiges (und leider immer seltener zu beobachtendes) Phänomen beschreibt.4 Denn Worte fangen das Gefühl, beim Betrachten des Sternenhimmels das Gleichgewicht zu verlieren und in die Unendlichkeit des Universums hineinzukippen, nur unbefriedigend ein. Es ist ein Gefühl, das schwer zu beschreiben ist. Es muss erfahren werden. Unter guten Bedingungen vergisst man vielleicht sogar, wo oben und unten ist.
Ich kann mich noch erinnern, wann ich dieses absolute Hineinkippen das letzte Mal erlebt habe. Im August 2009, am Playa del Inglés auf La Gomera. Bier trinkend und Zigaretten rauchend liegen meine Freundin Sabrina und ich dort stundenlang im Sand, starren schweigend in den Nachthimmel, versinken darin. Es ist ein Blick nach oben, wie ich ihn davor und danach nie wieder erlebt habe. Einer, der mich verstehen lässt, was Astronaut*innen bei der Rückkehr auf die Erde oft in Interviews sagen. Dass man sich angesichts des Universums klein fühlt, unbedeutend. Vielleicht tut uns der Blick in den Sternenhimmel mitunter darum so gut, er rückt die Perspektiven zurecht.
Vierzehn Jahre später, im Herbst 2023, liege ich wieder auf dem gleichen Strand im Sand und starre nach oben. Diesmal bin ich allein unterwegs. Es ist mein erster Urlaub allein. Ich sage nicht „Urlaub“, ich sage „Recherchereise“, und so sehr das stimmt, spüre ich auch, dass ich ausgeruht bin wie selten zuvor. Dass ich meinen Tagesplan mit niemandem absprechen, dass ich generell mit niemandem sprechen muss, erholt mich unerwartet stark. Das Alleinsein ist okay für mich, sage ich allen, die fragen. Aber nun, gegen Mitternacht am Strand, zehn Gehminuten vom Ort entfernt, macht es doch etwas mit mir. Es beginnt mit einer Unruhe, vage, nicht zu greifen. Erst denke ich, das komische Gefühl ist Enttäuschung. Denn der Himmel ist wolkig, ich sehe bloß vereinzelte Satelliten und Fledermäuse. Dann verziehen sich die Wolken und von hinten strahlt mich der Vollmond an wie ein Scheinwerfer. So wird das nichts mit dem Hineinkippen ins Universum. Aber das ist es nicht. Ich fühle mich unwohl. Unsicher. Die Minuten vergehen, ich bin längst am Telefon, wische mich durch meine Galerie, schaue mir Fotos vom Lorbeerwald, durch den ich tagsüber gewandert bin an, anstatt nach Sternen oder Sternschnuppen zu spähen.
Ich beginne, diesen Text in mein Handy zu tippen. Ich schreibe: „Jetzt verstehe ich das in den Romanen, wenn sie von der kriechenden Angst schreiben.“ Denn so fühlt es sich an. Als würde da in der Dunkelheit etwas auf mich zukriechen, wie ein lebender Schatten, der auf mich zuschlängelt. Ich drehe mich immer öfter um, aber da ist nichts. Nur eine schwarze Felswand, ein Weg, weiter hinten die Straße zurück nach La Playa.
Mein Handy hat kein Netz. Ich bin weit weg vom nächsten Haus, dem nächsten Apartmentkomplex, dem nächsten Restaurant. Ich bin allein an diesem Strand, unter dem Nachthimmel, von dem ich so lange geträumt habe, und fürchte mich. Auch das ist Dunkelheit, oder ihre Schattenseite. Diese schwammige Angst. Ich versuche, logisch zu denken. Den Verstand zu gebrauchen. Und dann habe ich die Idee. Ziehe ich den für mich in der Situation einzigen logischen Schluss. Zur Dunkelheit werden, anstatt sie zu fürchten. Der Sand ist schwarz, meine Kleidung ist schwarz. Ich räume mein helles Handtuch weg. Lege mich hinter einen Fels. Versinke im Dunklen und fühle mich tatsächlich ein bisschen besser. Weniger exponiert. Noch möchte ich es der Angst nicht erlauben, mich zu vertreiben.
Ich denke, ich schreibe über Dunkelheit und den Wert dunkler Nächte. Ich kann mich nicht fürchten. Sollte mich nicht fürchten. Aber ich habe immer noch Angst, also leuchte ich mit dem Telefon, finde einen Stein. Er liegt schlecht in der Hand, ich suche einen besseren. Leichter, handlicher. Ich korrigiere mich. Es ist nicht die Nacht, nicht die Dunkelheit, sondern die Menschen, vor denen man sich fürchten muss.
Über mir werden die Sterne von Minute zu Minute mehr. Ich kenne nur den Himmel der Nordhalbkugel, und selbst den nicht gut, finde mich hier nicht zurecht. Dort oben ist nichts, das ich wiedererkenne, kein vertrautes Sternbild, kein Anhaltspunkt. Ich öffne meine Dose alkoholfreies Heineken. Stelle mir vor, es enthielte Alkohol. Versuche, mich an früher zu erinnern. Als ich dachte, Alkohol würde mich mutig machen. Denn das ist es, was ich mir gerade am meisten wünsche. Mut.





























