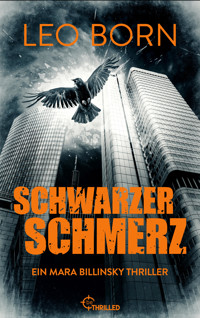9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
Kommissarin Mara Billinsky kommt nicht zur Ruhe: In einem Frankfurter Altenheim stirbt ein ehemaliger Arzt einen qualvollen Vergiftungstod - und er ist nicht das einzige Opfer des brutalen Mörders. Als kurz darauf die verstümmelte Leiche einer Journalistin entdeckt wird, führt eine düstere Spur Mara und ihren neuen Kollegen Tobias Cronberg in ein kleines Dorf im Schwarzwald. Cronberg will sich um jeden Preis beweisen - doch er tappt in eine grausame Falle. Zurück in Frankfurt, gejagt von Selbstzweifeln und einem übermächtigen Feind gerät Mara immer tiefer in einen Strudel aus Lügen, Verrat und hasserfüllter Rache.
»Erst ist da Liebe. Dann ist da bloß noch Hass. So ist es doch immer, oder etwa nicht?«
Mara Billinsky in ihrem zehnten Fall - ein düsterer Thriller voller Spannung, Abgründe und überraschender Wendungen!
Die bisherigen Fälle für Mara »Die Krähe« Billinsky:
Blinde Rache
Lautlose Schreie
Brennende Narben
Blutige Gnade
Vergessene Gräber
Sterbende Seelen
Schwarzer Schmerz
Eisige Stille
Kalte Erlösung
Entdecke auch die zweite Thriller-Reihe von Leo Born mit Jakob Diehl:
Lilienopfer. Dein Tod gehört mir
Racheherz. Der Schrecken in dir
Die dunkle Grenze
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelPrologTeil 1123456789101112131415Teil 2161718192021222324Teil 325262728293031323334353637383940414243444546Teil 44748495051525354555657585960Teil 561626364656667686970717273Teil 67475767778798081828384Teil 7858687888990919293EpilogÜber die AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Kommissarin Mara Billinsky kommt nicht zur Ruhe: In einem Frankfurter Altenheim stirbt ein ehemaliger Arzt einen qualvollen Vergiftungstod - und er ist nicht das einzige Opfer des brutalen Mörders. Als kurz darauf die verstümmelte Leiche einer Journalistin entdeckt wird, führt eine düstere Spur Mara und ihren neuen Kollegen Tobias Cronberg in ein kleines Dorf im Schwarzwald. Cronberg will sich um jeden Preis beweisen - doch er tappt in eine grausame Falle. Zurück in Frankfurt, gejagt von Selbstzweifeln und einem übermächtigen Feind gerät Mara immer tiefer in einen Strudel aus Lügen, Verrat und hasserfüllter Rache.
»Erst ist da Liebe. Dann ist da bloß noch Hass. So ist es doch immer, oder etwa nicht?«
Mara Billinsky in ihrem zehnten Fall - ein düsterer Thriller voller Spannung, Abgründe und überraschender Wendungen!
LEO BORN
DUNKLERSOG
EIN MARA BILLINSKY THRILLER
Prolog
Vor mehr als dreißig Jahren
Sie sieht schlecht aus. Schlechter als zuletzt. Ihr geht es nicht gut. Nein, ihr geht es überhaupt nicht gut.
Sie.
So nenne ich sie. Total unpersönlich. Aber dann fühlt es sich wenigstens anders an. Als würde ich sie gar nicht richtig kennen. Als wäre sie eine Fremde. Einfach nur irgendwer …
Sie muss sich übergeben. Ihr Würgen schallt durch das Haus. Unerträglich laut. Es scheint kein Ende zu nehmen. Dabei isst sie mittlerweile doch so wenig. Ich werde dieses Würgen noch hören, wenn ich steinalt bin. Ein schreckliches Geräusch.
Sie wird nicht nur dünner, auch immer blasser. Wie durchsichtig. Ein Gespenst. Nur dass sie mir keine Angst einjagt, wie ein Gespenst es tun sollte.
So schwach sieht sie aus. So traurig. So wehrlos. Und im Waschbecken habe ich wieder büschelweise Haare gefunden …
Zwei Wochen später.
Er schaut jetzt öfter nach ihr. Mustert sie streng wie ein Lehrer. Stellt Fragen. Notiert sich irgendetwas in seinen Block. Er und sie. Zwei Menschen halt. Einfach nur irgendwer … Und sie wird immer dünner.
Wieder zwei Wochen später.
Sie ist noch dünner geworden. Noch blasser. Sie wird einfach immer weniger. Die ganze Zeit liegt sie zugedeckt im Bett. Sie friert und schwitzt und friert und schwitzt. Ihre Stimme ist weg. Jedenfalls fast. Sie hat gar keinen Hunger mehr. Manchmal hat sie ein bisschen Durst.
Und erneut zwei Wochen später.
Inzwischen ist noch jemand bei uns. Fast unbemerkt hat er sich angeschlichen und sich eingenistet. Jemand, den man nicht sieht und nicht hört und nicht riecht. Und den man trotzdem spürt.
Er ist hier, ich weiß es.
Und ich weiß auch, wer es ist, obwohl ich ihm vorher nie begegnet bin. Ja, er ist hier. Nicht mitten im Zimmer, eher dort drüben an der Wand. Da steht er. Unsichtbar. Ich spüre ihn und frage mich, ob sie ihn auch spürt.
Er wartet ganz in Ruhe.
Ich weiß, wer er ist.
Weiß sie auch, wer er ist?
Es ist der Tod.
Teil 1
Himmelsblut
1
Kommissar Tobias Cronberg versuchte, sich die Nervosität nicht anmerken zu lassen. Sein Händedruck war fest, betont ruhig seine Stimme: »Freut mich, dass es für mich losgeht.«
Er erhielt keine Antwort, aber mit beiläufiger Geste wurde ihm einer der beiden Besucherstühle angeboten, auf dem er rasch Platz nahm.
Über den Schreibtisch hinweg sah er den Mann an, der ab sofort sein neuer Vorgesetzter war und der sich nun ebenfalls setzte, eine schwerfällige Bewegung, die von einem kaum hörbaren Ächzen begleitet wurde.
Offenbar hatte Hauptkommissar Klimmt in letzter Zeit einiges an Gewicht eingebüßt. Das verriet die Haut, die faltig an den Wangenknochen, dem Unterkiefer und um den Hals schlotterte. Auch das zu weite Hemd wies darauf hin.
Nach einer kurzen Stille brummte Klimmt ein knappes Willkommen durch den buschigen, von Grau durchsetzen Schnurrbart.
»Danke«, sagte Cronberg mechanisch.
In einer Abteilung, auf deren Tischen ausschließlich Fälle von schweren Verbrechen landeten, hatte er zum Empfang keine blumigen Wortgirlanden erwartet, aber die eine oder andere Silbe mehr wohl doch.
Während Klimmt mit dickem Zeigefinger seelenruhig über das Display seines Handys scrollte, breitete sich in dem recht kleinen Büro erneut Stille aus.
»Freut mich, dass es für mich losgeht«, wiederholte Cronberg ungewollt gezwungen, als bemühte er sich, zu verhindern, von seinem Gegenüber vergessen zu werden.
»Sie sollte eigentlich schon hier sein«, meinte Klimmt.
»Äh – wer?«
»Die Kollegin, mit der Sie vorrangig zusammenarbeiten werden. Wir hatten ja schon über sie gesprochen.«
»Ach so. Klar.«
Endlich schaute der Hauptkommissar vom Handy auf. »Ihre Unpünktlichkeit ist noch eine ihrer angenehmeren Seiten.«
Aus Klimmts ausdrucklosem Blick konnte Cronberg nicht schließen, ob die Bemerkung ironisch oder ernst gemeint war, und so bestand seine Antwort bloß aus einem etwas ratlosen Schmunzeln.
Es klopfte, und bevor Klimmt reagieren konnte, ging die Tür auf. Eine Frau betrat den Raum. Lässig stieß sie die Tür wieder zu.
»Wie überaus nett von Ihnen, dass Sie Ihren neuen Kollegen nicht noch länger warten lassen«, knurrte Klimmt.
Automatisch erhob sich Cronberg, um einen Schritt auf die Frau zuzugehen. »Hallo, freut mich sehr. Ich bin Tobias Cronberg.«
Als sie nichts erwiderte, fügte er an: »Cronberg mit einem C.«
Kaum waren die Worte ausgesprochen, wurde ihm klar, wie albern er sich angehört hatte. »Also nicht mit einem K, äh, wie die Stadt«, sprach er rasch weiter, was es nicht besser machte.
Er räusperte sich und hielt ihr die Hand hin.
Die Frau betrachtete seine Hand, dann sah sie ihm durchdringend in die Augen.
»Billinsky«, sagte sie. »Mit einem B.«
2
Alles war gut verlaufen. Der Patient lag auf dem Operationstisch und lächelte ihn dankbar an.
Ein Blick zur Uhr: gut eine halbe Stunde früher als vorherberechnet. Doktor Alfred Mertesheimer nickte zufrieden.
Das Team klatschte ihm zu, auch der Patient fiel in den Beifall ein. Es gab sogar Zuschauer, die sich kreisförmig um das OP-Team postiert hatten und jubelten.
Das Deckenlicht im Saal strahlte in einem seltsamen lilafarbenen Ton, fast wie in einer Diskothek. Warum eigentlich?
Mertesheimer drehte sich zur Seite und hob die Hände ein wenig an, damit die auffallend hübsche Assistenzärztin ihm die OP-Handschuhe abstreifen konnte. Trotz der Schutzmaske, die sie trug, wusste er, dass auch sie ihn anlächelte.
Ja, alles war gut verlaufen. Wie immer. Keine Komplikationen, nichts Unvorhergesehenes. Außer diesem Disko-Licht. Und diesem Geräusch …
Was war das nur für ein Klopfen? Es war laut und störend.
Im nächsten Moment wurde alles dunkel.
Mertesheimer blinzelte verwirrt und fuhr sich mit der Hand über die schlafverkrusteten Augen. Dann starrte er in die matte Schwärze seines Apartments.
Immer wieder führten ihn solche Träume zurück in sein früheres Leben, was wohl kein Wunder war bei einem alten Menschen wie ihm. Zunächst wirkte in den Träumen alles so greifbar, doch stets gab es kuriose Details, die surreal waren. Er schmunzelte darüber, auch jetzt, und erst dann fiel ihm auf, dass das seltsame Geräusch keineswegs verstummt war.
Das Klopfen. Es war echt.
Wahrscheinlich war es der Grund für sein Aufwachen gewesen.
Tatsächlich, da klopfte jemand an seine Tür. Er knipste die Nachttischlampe an, warf die Zudecke zurück und schob sich aus dem Bett.
Wer konnte das sein?
Nun ja, wohl nur der junge Mann, der am Empfang die Nachtschicht übernommen hatte. Ein freundlicher Typ mit einer gewissen medizinischen Ausbildung, um den alten Menschen hier im Notfall helfen zu können.
Mertesheimer ging zur Tür, spähte durch den Spion und nahm verdutzt zur Kenntnis, dass auf dem Flur kein Licht brannte. Es waren nur die Konturen des jungen Mannes zu erkennen.
Er öffnete.
Erschrocken stellte er fest, dass ihm nicht der junge Mann vom Empfang gegenüberstand, sondern eine Gestalt in Schwarz, deren Gesicht von einer Ski- oder Motorradmaske verborgen wurde. Lediglich die Augen waren zu sehen.
Harte, unnachgiebige Augen. Ein zutiefst entschlossener Blick.
Wie aus dem Nichts erfolgte der Faustschlag, der Mertesheimer zurück in das Apartment schleuderte. Er fand sich auf dem Teppichboden wieder, wurde hochgerissen, ein zweiter heftiger Schlag ins Gesicht traf ihn.
Abermals landete er auf dem Boden. Er stöhnte. Sein Gesicht schmerzte, aber das war gar nicht mal so schlimm. Schlimm war die Angst. Sie kroch eiskalt an ihm hoch, breitete sich in seinem Inneren aus, umschloss ihn mit festem Griff.
Er hatte noch nie Furcht empfunden. Sein ganzes Leben lang nicht, nein, er war nun wirklich kein ängstlicher Typ. Aber jetzt …
Er stöhnte. Ein hilfloser, rauer Laut, der seinem Mund entwich. Zitternd starrte er zu der schwarzen Gestalt hoch. Eine unwirklich lange Sekunde herrschte Stille. Mertesheimer hätte sich gern der Illusion hingegeben, dass auch das nur ein Traum sei.
Vorsichtig suchte sein Blick den roten Notknopf an der Wand, direkt über dem Kopfteil des Bettes – ein Fingerdruck genügte, um den jungen Mann vom Empfangsbereich zu alarmieren und anrücken zu lassen.
»Denken Sie nicht mal dran«, sagte die Stimme, die so kalt war wie die Augen, die ihn ohne Unterlass ansahen.
In diesem Wohnstift für Senioren war es noch nie zu einem Überfall gekommen. Zu keinem Einbruch, nicht einmal zu einem Handtaschendiebstahl. Hier war man so sicher wie in Abrahams Schoß, betonten die alten Leute ständig.
»Was wollen Sie?«, fragte Mertesheimer mit bebenden Lippen.
Keine Antwort.
Die Gestalt bewegte sich geschmeidig nach links, griff nach dem leeren, aber benutzten Glas auf der Spüle und ließ es mit Leitungswasser volllaufen. Anschließend schüttete der Übeltäter ein Pulver aus einem Beutel in das Wasser und verrührte alles mit einem Kaffeelöffel.
»Was soll das?«
Mertesheimer lag noch immer auf der Seite in seinem Seidenpyjama auf dem Boden.
Das Glas wurde vor ihm abgestellt.
»Na los, trinken Sie.«
»Nein«, hörte er sich antworten.
Ansatzlos wie zuvor die Schläge kam der Tritt. Mertesheimer brüllte auf. Sein Magen schmerzte unerträglich.
»Schreien Sie ruhig. Hier sind ja doch alle schwerhörig, es wird niemand mitbekommen.«
Mertesheimer wimmerte.
Regentropfen trommelten gegen die Fensterscheibe, ein Guss wie aus dem Nichts. Dabei waren die Wetteraussichten doch so gut gewesen, wie es Mertesheimer törichterweise durch den Kopf ging. Angeblich standen goldene Herbsttage bevor. Er hatte sich sehr gut gefühlt in den letzten Wochen und war unbewusst davon ausgegangen, noch viele unbeschwerte Jahre vor sich zu haben.
»Trinken Sie!«
Er wimmerte erneut.
»Am Anfang ist es nicht so schlimm. Ein bisschen Bauchweh, ein bisschen kotzen. Aber dann …«
Er starrte das Glas an, dann den Eindringling, dann wieder das Glas. Mit seiner Hand stieß er es um. Die Flüssigkeit verteilte sich auf dem Teppich.
»Ich habe noch reichlich von dem Pulver dabei«, entgegnete er mit einem leisen Lachen. »Wollen Sie es wirklich auf diese Art hinter sich bringen? Auf die schmerzhafte Weise?«
Mertesheimer senkte verzweifelt den Blick. Nackte Angst hatte ihn gepackt. Ihn traf der zweite Tritt. Wieder schrie er auf.
»Sie werden noch trinken, da bin ich absolut sicher. Und ich hoffe, Sie können mir verraten, wo ich einen bestimmten Herrn finde.«
3
Tobias Cronberg parkte seinen silberfarbenen Audi in der Waldschmidtstraße und stieg aus. Die Nachricht hatte ihn sozusagen überfallen, als er morgens gerade im Präsidium angekommen war. Und er war natürlich sofort losgefahren.
Es war nicht sein erster Tag in der neuen Abteilung, aber so fühlte es sich an. Heute ging es richtig los für ihn. Ein Todesopfer! Ein Fall! Das erste Kapitalverbrechen, an dessen Ermittlung er beteiligt sein würde. Er war siebenundzwanzig, er war ehrgeizig, und er war bereit.
Entschlossen schob er sich zwischen einigen Leuten hindurch, die um diese Zeit schon unterwegs und aus Neugier stehen geblieben waren. Bei den uniformierten Kollegen wies er sich aus. Dann bewegte er sich weiter auf den Tatort zu, der sich in einem großen Gebäude befand, nicht weit entfernt vom Frankfurter Zoo.
Seitlich von einem blausilbernen Polizei-VW-Bus blieb er abrupt stehen.
Im Schutz des Autos spähte er zu der Frau, die einige Meter vom Gebäudeeingang entfernt stand, Handy am Ohr, eine Hand in die Hüfte gestemmt. Die Krähe. So nannte man Mara Billinsky. Pechschwarze Haare bis knapp über die zierlichen Schultern, ein schmales, bleiches Gesicht mit einem Piercing an der Oberlippe und großen dunklen Augen, die einen beunruhigend direkt anzustarren vermochten.
In den letzten, eher ereignislosen Bürotagen hatte er gelegentlich versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, aber das hatte sich als mühsames Unterfangen erwiesen. Eine Plaudertasche konnte er sie nicht gerade nennen.
Cronberg hatte sich über ihren Werdegang informiert und dabei einiges über ihren Ruf erfahren. Quertreiberin, Dickschädel, Provokateurin, Einzelgängerin bis hin zu Teamunfähigkeit. Rasselte in gefahrvolle Situationen hinein, weil sie auf ihr Bauchgefühl vertraute statt auf den Kopf oder ihr Ausbildungswissen. Und sie hatte sich vermutlich oft genug in Schwierigkeiten gebracht. Angeblich hielt Hauptkommissar Klimmt, der sie anfangs wohl leidenschaftlich gehasst hatte, seine schützende Hand über sie.
Doch die streitbare Lady hatte offenbar auch Erfolge vorzuweisen. Erfolge, die allein auf Glück zurückzuführen waren, wenn er den Kollegen Glauben schenkte, die sie nicht mochten. Und diejenigen, die sie mochten, hatte Cronberg noch nicht gefunden.
Er setzte sich wieder in Bewegung, ging auf sie zu.
»Guten Morgen«, begrüßte er sie.
Sie telefonierte nicht mehr, hatte aber das Handydisplay noch vor der Nase. Kurz drehte sie den Kopf in seine Richtung und nickte ihm knapp zu.
Er wusste nicht so recht, was er sagen sollte, und das war eigentlich untypisch für ihn. Er hatte es immer geschafft, die Leute für sich einzunehmen. Bei dieser Billinsky jedoch … Vielleicht sollte er einfach mehr Geduld mit ihr haben und weiterhin einen offenen Ton anschlagen.
Ein leichter Regen setzte ein. Cronberg schaute erst in den trüben Himmel, dann hinunter auf seine neuen, noch strahlend weißen Sneaker.
Billinsky tippte immer noch schweigend auf ihrem Handy herum. Nach einer Weile steckte sie es in die Innentasche ihrer sichtlich stark abgewetzten, etwas zu großen Motorradlederjacke.
»Gibt’s schon erste Erkenntnisse?«, fragte er, und bereits, als ihm die Worte über die Lippen rutschten, kam er sich dämlich vor. Was für eine blöde Frage. Nie zuvor in seinem dienstlichen Leben hatte er eine derart gestelzte Frage gestellt.
Ein spöttisches Grinsen huschte über die Lippen seiner neuen Kollegin.
»Immerhin gibt’s eine Leiche«, meinte sie trocken.
Wenige Minuten später standen sie nebeneinander vor dem Toten.
Die Spitzen seiner Sneaker und Billinskys schwarze Dr.-Martens-Schuhe, in durchsichtige Schutzfolie gehüllt, berührten fast den linken ausgestreckten Arm des Mannes, der offenbar unter großen Qualen gestorben war. Ein letzter Schmerzensschrei schien immer noch lautlos in der Luft des geräumigen, mit teurem Mobiliar eingerichteten Apartments zu stehen.
Cronberg wehrte sich hartnäckig, dennoch musste er vernehmbar schlucken.
Kein schöner Anblick. Wahrlich nicht.
Die Kollegen von der Spurensicherung in ihren Ganzkörperschutzanzügen standen bereit, um ihre Arbeit fortzusetzen.
Billinsky sagte kein Wort. Ihrem Gesicht war nicht die geringste Regung anzumerken.
Cronberg zwang sich, genau hinzusehen. Das Gesicht des Toten war von Hämatomen und eingetrocknetem Blut übersät, sein rechter Arm unnatürlich verrenkt, als wäre ihm die Schulter ausgekugelt worden. Der gestreifte Pyjama war zerrissen und wies Schmutzflecken auf, die ebenfalls eingetrocknet waren, wie auch der Teppich ringsum.
»Er hat sich heftig übergeben«, sagte Cronberg, nur um etwas zu äußern und endlich diese schreckliche Stille zu unterbrechen.
»Wie man sehen kann.« Billinsky nickte. »Und auch riechen.«
Erst bei ihrem Stichwort wurde ihm der Gestank so richtig bewusst, diese Mischung aus Erbrochenem und Tod. Nur mit Mühe gelang es ihm, ein Würgen zu unterdrücken, und ihm war klar, dass ihr das nicht entging.
»Er wurde zusammengeschlagen«, brachte er hervor.
»Aber das dürfte kaum die Todesursache sein.«
»Und jetzt?«
Schon wieder kam ihm seine Frage dumm vor.
Er bekam keine Antwort.
Ihm fiel auf, wie intensiv Billinsky den Toten musterte. Als erwartete sie, er könnte noch etwas von sich geben.
»Wir hören uns um«, sagte sie unvermittelt. »Und wir teilen uns auf. Das spart Zeit. Ich hier im Haus, Du in der direkten Nachbarschaft.«
Ihre Sätze waren kurz und knapp, die einzelnen Worte fast wie Gewehrschüsse, und er fühlte sich davon unter Druck gesetzt. Er wollte noch etwas fragen, doch sie eilte bereits mit energischen Schritten davon.
4
»… sicher, es ist vielleicht nicht wahnsinnig originell, wenn ich meinen eigenen Vater als Vorbild nenne, aber ohne ihn …«
Der Typ hält einfach nicht die Klappe, dachte Mara Billinsky.
Ihr Schweigen hatte etwas Eisiges, aber es nützte nichts, denn nach einigen Tagen vorsichtiger Zurückhaltung hatte Tobias Cronberg offenbar den Entschluss gefasst, sie durch Gesprächigkeit weichzukochen. Und das ausgerechnet jetzt, da sie einen neuen Fall auf dem Tisch hatten, der sich womöglich als komplizierter herausstellen konnte, als es auf den ersten Blick den Anschein haben mochte. Jedenfalls hatte Mara so eine Ahnung, was das betraf.
»… na ja, ohne ihn würde ich heute bestimmt nicht hier sitzen. Mein Vater war Polizist, und genau wie er wollte ich …«
Bei dem Geplapper wurde Mara bewusst, was sie immer an ihrem früheren Teampartner Jan Rosen geschätzt hatte. Dass er so verdammt ruhig war. Dass sie nie das Gefühl hatte, sie müsse unbedingt etwas äußern, um Einvernehmlichkeit zu erzielen, und sich jeder von ihnen in die Stille regelrecht eingraben konnte.
Seit beinahe zwei Stunden war sie zurück im Präsidium an ihrem Schreibtisch im Großraumbüro: eine Zweierzone, durch mobile Trennwände vom Rest abgeteilt. Der Neue hatte Jan Rosens verwaisten Platz eingenommen, direkt gegenüber Maras.
Eigentlich hätte sie Klimmt über die Situation informieren müssen, die sie am Tatort vorgefunden hatte. Früher wäre er unverzüglich bei ihr am Schreibtisch aufgetaucht, um sich ein Bild zu verschaffen.
Dem alten Klimmt ging es echt nicht gut, aber natürlich verlor er kein Wort darüber, und sie würde ihn auch nie darauf ansprechen. So funktionierte ihre eigenwillige berufliche Allianz einfach nicht.
Mara fuhr fort, alles in Berichtform in ihren Laptop einzutippen, was die morgendlichen Befragungen ergeben hatten. Gleichzeitig versuchte sie, erste Schlüsse zu ziehen. Das Seniorenwohnstift, in dem der frühere Arzt Alfred Mertesheimer gewaltsam zu Tode gekommen war, lag mit seiner unmittelbaren Nähe zum Zoo und zur beliebten Berger Straße in einer hervorragenden Wohngegend. Nur gut betuchte Leute konnten es sich leisten, sich in dem Wohnstift einzumieten. Durch Maras Gespräche mit der Heimleitung, dem Personal und den Bewohnern über Mertesheimer ergab sich das unspektakuläre Bild eines äußerst rüstigen, freundlichen, wenn auch etwas arroganten Witwers, bei dem niemals ein derartig brutales Ende auch nur ansatzweise vorhersehbar gewesen wäre.
Es gab keine Anzeichen für einen Raub, keine Hinweise auf ein mögliches Motiv.
Was war die unmittelbare Todesursache?, fragte sie sich einmal mehr.
»… er war nie für eine Abteilung für Schwerverbrechen tätig. Mein Vater, meine ich. Aber die Art und Weise, mit der er seinem Beruf nachging, war mehr als ein Job. Eher Berufung statt Beruf, und so will ich es auch halten. Weil es …«
Abrupt hob Mara den Kopf, um ihren Kollegen auf ihre unvermittelte Art anzublicken, was ihn jäh verstummen ließ.
Na endlich, dachte sie.
Cronberg wandte sich seinem Got-Bag-Rucksack zu und zog etwas Buntes hervor, wie Mara aus den Augenwinkeln wahrnahm. Es handelte sich um irgendeine Comicfigur aus Kunststoff, die er auf seinen Schreibtisch stellte.
»Glücksbringer«, erläuterte er.
Mara schwieg.
Aus dem Rucksack kam nun eine gerahmte Fotografie zum Vorschein, die er hochhielt, damit sie einen Blick darauf werfen konnte. Was sie auch tat. Das Bild zeigte eine junge blonde Frau, die mit der Sonne um die Wette strahlte. Fast unbewusst wurde Mara klar, dass sie noch nie von jemandem ein Foto im Büro gehabt hatte.
»Das ist Liz«, sagte Cronberg.
»Hübsch«, murmelte Mara.
»Danke«, antwortete Cronberg.
Er stellte das Bild neben die Figur.
»Ich hab sie gefragt«, bemerkte er mit einem versonnenen Lächeln und veränderte die Position des Fotos noch ein wenig, bis er endgültig zufrieden war.
»Wen?«
»Liz natürlich.« Er unterstrich seine Worte mit einem nachdrücklichen Nicken. »Vor genau drei Wochen war es so weit, da hab ich sie gefragt.«
»Und was genau?«
»Ob sie mich heiraten will.«
Erneut folgte ein eifriges Nicken.
»Oh.«
»Sie hat Ja gesagt.«
»Glückwunsch.«
»Danke.«
»Was hat sich in der Nachbarschaft des Toten ergeben?«, erkundigte sich Mara übergangslos.
»Äh, also ich trage gerade im Bericht alles zusammen«, erklärte er. »Und dann werde ich …«
»Irgendwas, das du mir direkt mitteilen kannst?«
»Hm, ehrlich gesagt, war das alles nicht sonderlich ergiebig, sonst hätte ich dir …«
»Also nix«, meinte sie.
Er sah aus, als wollte er noch etwas erwidern, aber sie war so rasch aufgestanden, dass er nicht mehr dazu kam.
Beim Verlassen des Büros spürte sie seinen Blick im Rücken. Dabei waren ihre knappen Worte gar nicht böse gemeint gewesen. Wieder einmal wurde ihr bewusst, dass sie sich nie Gedanken darüber machte, wie sie auf andere wirken mochte.
Wie dem auch sei, jetzt brauchte sie das, was sie eigentlich immer brauchte: Kaffee.
Sie folgte einem der vielen Flure im Präsidium, einem sechsstöckigen, festungsartigen Gebäudeklotz, der über dreitausend Mitarbeitern Raum bot und im Keller unter anderem eine hochmoderne Schießanlage beherbergte.
In einem der verstecktesten Winkel des Baus, am Ende eines jener endlosen Flure, befand sich Maras Ziel: der Getränkeautomat.
Schon von Weitem sah sie den Mann, der gerade eine Münze in den Schlitz schob, den Rücken ihr zugewandt. Sofort wurde sie von einem vertrauten Déjà-vu-Gefühl erfasst. Sie näherte sich, ein verstecktes Grinsen im Gesicht.
Mit dem Becher in der Hand drehte sich Jan Rosen um. Als er sie bemerkte, blitzten seine Augen vor Überraschung auf.
Wie üblich verzichteten sie auf Begrüßungsworte und wechselten nur einen raschen Blick. Nachdem sich auch Mara mit einem Kaffee versorgt hatte, prosteten sie sich ironisch zu.
»Fast wie in den guten alten Zeiten, was?«, meinte Rosen.
Er trug einen burgunderfarbenen Pullunder über einem Hemd in zartem Hellgrün.
»Alt schon, aber gut?«
Sie schmunzelten und tranken von der dünnen Brühe, die so schauderhaft schmeckte wie immer.
»Du hast einen neuen Teampartner, wie ich höre.«
»Einen neuen Kollegen«, betonte Mara – für sie eine feine, aber wichtige Unterscheidung. »Und du? Immer noch im Kellerverlies gefangen?«
Er nickte mit einem Lächeln. »Hoffentlich lautet das Urteil nicht lebenslänglich.«
Nicht nur die Schießanlage, auch die Abteilung, die sich um Cybercrime-Aktivitäten kümmerte, war zumindest übergangsweise im Untergeschoss untergebracht – und ihr gehörte Rosen seit einiger Zeit an.
»Woran arbeitest du gerade?«, fragte er.
Mara erwähnte den Toten im Seniorenwohnstift in der Waldschmidtstraße, und Rosen hörte still und geduldig zu. Auch das löste bei ihr ein unterschwelliges Déjà-vu-Gefühl aus.
»Ich kenne die Adresse«, sagte er. »Direkt beim Mousonturm, in der Nähe vom Zoo.«
Keine Überraschung für Mara, Rosen kannte immer alles.
»Ich habe mich dort einmal nach einer möglichen Unterbringung für meine Mutter umgehört«, fuhr er fort. »Aber sie wollte dann doch nicht einziehen. Erst recht nicht, nachdem wir die Kosten erfahren haben. Durchaus nachvollziehbar übrigens. Hm, du hast heftige Schläge erwähnt. Klingt für mich eher nach einem jüngeren Täter, nicht nach einem betagten Mitbewohner.«
Sie nickte bestätigend. »Alles am Tatort fühlt sich für mich so an.«
Rosen runzelte die Stirn. »Wie gesagt, ich kenne das Haus. Und da frage ich mich natürlich zuerst, wie der Täter reingekommen ist. Mitten in der Nacht … Es gibt für Außenstehende nur einen Zugang – vorbei an der Rezeption. Für alle anderen Eingänge ist eine spezielle Key-Card nötig.«
»Vielleicht war er schon im Gebäude.«
»Das ist schon eher möglich. Tagsüber herrscht immer viel Betrieb im Empfangsbereich, das ist mir damals aufgefallen. Kuriere, Postboten, Krankengymnasten, Besucher, Taxifahrer. Da kommt einer durchaus ungesehen an der Rezeption vorbei, wenn er es darauf anlegt. Und dann könnte er sich im Keller verstecken. Auch den hab ich mir damals angeschaut, da gibt’s etliche dunkle Ecken.« Er stockte. »Äh, müsstest du das nicht mit deinem Teampartner besprechen?«
»Kollegen«, korrigierte sie erneut. »Das werde ich schon noch mit ihm bequatschen, keine Sorge. Trotzdem hilfreich, dass du früher mal in dem Gebäude warst.«
»Falls du noch Fragen hast, immer gern. Weißt du ja. Aber jetzt muss ich wohl mal wieder los.«
Ein seltsamer Ausdruck zeigte sich in seinem Gesicht, als warte er darauf, dass sie noch etwas sagte. Hoffte er auf eine Äußerung, die ihm ein bisschen Mut machen oder Trost schenken sollte angesichts seiner privaten Situation? Kam er allmählich über die Enttäuschung hinweg? Wie auch immer, sie schwieg, genauso wie er über ihren Privatkram kein Wort verloren hatte, und das war ebenfalls wie früher.
Mara schaute zu, wie er davonging, den Becher in der Hand. Niemand unter den Kollegen merkte ihm seinen Kummer an, da war sie sich sicher, und das war Rosen bestimmt mehr als recht.
Kein Teufelskerl. Das war ihr erster Gedanke gewesen, als sie ihn damals an ihrem ersten Morgen im Präsidium kennengelernt hatte. Eine zutreffende Einschätzung, wie sich herausgestellt hatte, doch es war zu Situationen gekommen, in denen dieser Nicht-Teufelskerl hatte zeigen können, dass er auf seine Art ein fähiger Ermittler war, der auch in besonders vertrackten Fällen Ergebnisse lieferte.
Wie sah es derzeit in ihm aus? Sie konnte es sich vorstellen …
Armer Rosen, dachte Mara
5
Verrat ist der Kuss des Todes.
Verrat ist der Kuss des Todes.
Die Stimme wiederholte den Satz immer wieder.
Verrat ist der Kuss des Todes …
Gab es die Stimme überhaupt wirklich? Kam sie vielleicht aus einem diffusen, dunklen Traum? Bildete Melike sie sich lediglich ein?
Verrat ist der Kuss des Todes …
Die Worte brachten sie dazu, allmählich aufzuwachen, sich ein wenig zu regen, zu blinzeln.
Oder war es gar nicht die Stimme, die sie aus dem Schlaf riss, sondern die Kälte? Diese eisige Luft, die ihren Köper umschloss, sich unter die Haut wühlte, bis tief hinein ins Mark der Knochen, und sie starr machte, zu einem morschen Stück Holz werden ließ.
Möglicherweise war es eher die brennende Hitze, die sie in diesen merkwürdigen Moment zurückholte, den sie nicht einzuordnen wusste. Welcher Tag war heute? War es morgens, nachts? Wo war sie überhaupt? Wie war sie hierhergekommen? Warum war alles so finster?
Diese Hitze … Ein kleiner flammender Punkt inmitten der Kälte. Keineswegs Hitze, es war ein Schmerz, der heftig brannte, ein Schmerz, der vom Mund ausging, unerträglich und böse. Und wie es brannte. Ihr Gesicht brannte.
Melike wollte den Mund öffnen, um mehr Luft einatmen zu können, doch das ging nicht. Ihr Mund war … Ihre Lippen waren …
Ja, was eigentlich?
Sie lag auf dem Rücken. Ihre Hände waren auf dem Bauch gefesselt. Sie hob sie an, tastete sich mit den Fingerspitzen ab, die so klamm waren, als könnten sie gleich abfallen. Vorsichtig berührte sie den Unterkiefer, dann das Kinn, strich hinauf zum Mund. Sie fühlte etwas, das nicht dorthin gehörte, etwas Hartes, Fremdes. Etwas, das auf ihren Lippen … Es war …
Sie hielt inne, die Finger wie gefroren. Es war …
Eine Naht.
Ihr Mund war … Ihre Lippen waren …
Zugenäht.
Sie blinzelte erneut, und in der Finsternis meinte sie, schemenhaft die fahlen Umrisse eines Menschen zu erkennen … Nein, nicht eines Menschen, eher eines …
Was um alles in der Welt war das?
Was für ein … Wesen mochte das sein?
Jedenfalls eines, das sie beobachtete.
Der Kopf wirkte riesig. Seltsam klobig. Fast viereckig. Und von dem Kopf gingen Hörner aus. Spitz und leicht schräg nach oben zulaufende Hörner, eins rechts, eins links.
Irgendwo in Melikes Kopf glaubte sie ein Geräusch wahrzunehmen.
Nein, kein Geräusch, eine Stimme. Dieselbe Stimme wie zuvor.
Verrat ist der Kuss des Todes …
6
Jan Rosen schob den Schlüssel ins Schloss, betrat mit einem tiefen Seufzer seine Wohnung und schaltete das Licht ein.
Er hörte Tessas Gesang, während er die Jacke auszog und die Schuhe abstreifte. Wieder drückte er den Lichtschalter, und im Flur herrschte Dunkelheit.
Wie war dein Tag, Sherlock Holmes?, hörte er Tessa fragen, begleitet von ihrem unverwechselbaren Lachen.
»Es war ein absolut großartiger Tag«, sagte er kaum hörbar, als er ins Wohnzimmer ging. »Der großartigste von allen.«
Na, wie viele böse Jungs hast du heute in den Kerker geworfen?
»Ach, ich konnte sie gar nicht zählen, so viele waren das.«
Er ließ sich aufs Sofa sinken.
»Ich bin Billinsky über den Weg gelaufen, und sie hat mir von einem Fall erzählt, den sie bearbeitet …«
Seine Stimme verklang in der Stille. Er hatte nicht einmal daran gedacht, die Deckenlampe anzuknipsen. Nur durchs Fenster drang ein Streifen milchiges Licht von der Straßenlaterne herein.
»Übrigens, Billinsky hat einen neuen Kollegen und …«
Er brach mitten im Satz ab und ermahnte sich stumm: Hör endlich auf mit dem Quatsch!
Die Stille umfing ihn wie etwas, das er mit den Händen hätte greifen können.
So schnell wie Tessa Steinberg in Rosens gleichförmiges Leben eingefallen war und es auf den Kopf gestellt hatte, so schnell war sie auch wieder daraus verschwunden.
Er hatte nicht erwartet, dass die Verbindung ewig halten würde, nicht bei einem traurigen Ritter wie ihm, aber dass sich alles derart rasch in Luft auflösen würde, damit hatte er keineswegs gerechnet.
Tessa hatte Schluss gemacht, wie es so unschön hieß. Sie hatte ihm über die Wange gestreichelt, ihre Sachen gepackt und war verschwunden – einfach weg. Nichts mehr da von ihrem lauten Lachen, ihrer Körperlichkeit, ihrem ansteckenden Optimismus. Allein ihr Parfümduft hielt sich noch in den Zimmerecken, zumindest glaubte Rosen ihn hin und wieder wahrzunehmen.
War er nicht ein Pechvogel?
Und ob er das war!
Nur Billinsky wusste von der Trennung. Nicht einmal seiner Mutter hatte er davon erzählt – die Ärmste war doch so erfreut oder wohl eher erleichtert gewesen, dass er nicht mehr allein war.
Wie schön es sich immer angefühlt hatte, nach Feierabend von Tessa empfangen zu werden. Wie wenig er das ausgekostet hatte. Viel zu wenig. Man konnte Glück eben nicht festhalten, oder?
Hör auf, dich selbst zu bemitleiden, ermahnte er sich schon wieder stumm.
Seine Gedanken wanderten noch einmal zu Billinsky, die in privater Hinsicht ebenfalls turbulente Monate hinter sich hatte. Er dachte an das heutige Gespräch mit ihr, ihre Äußerungen über den Todesfall in der Wohnanlage für ältere Leute, die ihm wie eine friedliche City-Oase vorgekommen war, einer jener Orte in Frankfurt, an denen man am wenigsten ein Verbrechen erwarten würde.
Seine Gedanken führten ins Nichts, wie so oft, wenn er hier war. Auch seine Wohnung war eine Art Oase gewesen, eine Schutzwand vor den Brutalitäten, die ihm häufig im Job begegneten. Aber seit Tessas jäher Bekanntgabe, sie brauche einfach wieder mehr Luft zum Atmen, erdrückten ihn seine vier Wände manchmal. Auch jetzt schien ihm die Decke geradezu auf den Kopf zu fallen. Es roch nicht nach Damenparfüm, sondern nach Trostlosigkeit.
Ja, ein trauriger Ritter. Wer hatte den Begriff noch mal für Rosen verwendet? Ein früherer Kollege? Er erinnerte sich nicht mehr, es war ja auch egal. Was er hingegen genau wusste, war, dass er hier rausmusste. Andere würden in diesem Fall ihre Stammkneipe aufsuchen, aber eine solche hatte Rosen nie gehabt.
Es gab nur einen Ort, der ihm einfiel.
Also verließ er die Wohnung, setzte sich hinters Steuer und machte sich auf den Rückweg durch die Stadt, rechts von ihm die Banktürme, kantige Riesen mit kalt glitzernden Augen. Frankfurt war ihm immer irgendwie fremd geblieben, obwohl er schon so lange hier lebte. Es ging etwas Schroffes, Unbeugsames von diesen Straßen aus. Wie schaffte es Billinsky bloß, immer wieder mit Frankfurt regelrecht zu verschmelzen? Sie gehörte hierher, sie mochte Frankfurt. Natürlich hatte sie das nie auf diese Art ausgesprochen, das würde sie nie tun, aber er wusste, dass es so war. Vielleicht weil sich Billinsky und die Stadt auf verrückte Weise ähnlich waren.
Eine halbe Stunde später saß Rosen wieder an seinem Schreibtisch im Kellerbüro, in dem seine Abteilung angeblich nur übergangsweise ihr Quartier bezogen hatte.
Er meldete sich im System an, und in seinem Kopf erklang erneut Billinskys Stimme. Sie hatte den Namen des Arztes erwähnt, der zu Tode gekommen war: Mertesheimer.
Er loggte sich nun auch in Datenbanken ein, suchte mithilfe von Stichworten und begann seine virtuelle Recherche, ohne ein exaktes Ziel zu verfolgen. Auch so fand er gelegentlich unerwartete Informationen, die nützlich sein konnten.
Die Minuten vergingen, es war mucksmäuschenstill, abgesehen von den Klicklauten der Tastatur. Hin und wieder kam er sich bei solchen Recherchen vor wie ein Äthersüchtiger, der tief inhalierte und sich von immer dichterem Nebel umschließen ließ.
Plötzlich hielt er inne, die Hand an der Computermaus, die Augen konzentriert auf den Monitor gerichtet.
Er war auf einen Fall gestoßen, bei dem es ebenfalls um einen ehemaligen Arzt ging. Ein Fall mit bemerkenswerten Parallelen.
War das nur Zufall oder steckte mehr dahinter?
»Sieh mal einer an«, staunte Rosen leise, seine Stimme wie eine plötzliche Störung in dem stillen Großraumbüro, in dem lediglich seine Schreibtischlampe brannte.
Er ließ die Maus los und lehnte sich zurück.
Wie sagte Billinsky immer: Ich glaube an überhaupt nichts, schon gar nicht an Zufälle.
7
Mara war morgens als Erste im Büro eingetroffen. Sie war aber nur für ein paar Minuten geblieben, um mehrere E-Mails vom Vortag zu lesen. Wegen des neuen Falls hatte sie die Nachrichten noch nicht beantwortet. Dazwischen gönnte sie sich rasch noch einen zweiten Kaffee.
Gleich darauf war sie wieder aufgebrochen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Es konnte ihr gar nicht früh genug sein. Am liebsten hätte sie sich überhaupt nicht in der Nacht ins Bett gelegt. Nur so gelang es ihr, den Bildern ein Schnippchen zu schlagen, die sie überfielen, wenn sie die Augen schloss. Der Moment, als sich Erik Nordin die Pistole an den Kopf gehalten hatte. Die Blutfontäne, sein zerplatzter Schädel.
Je stärker sie alldem auszuweichen versuchte, desto stärker schien es sie zu verfolgen, erst recht, wenn sie allein war. Und sie war eigentlich immer allein, seit Nordin tot war. Wie bereits in den vielen Jahren, bevor der Schwede in ihr Leben getreten war. Alleinsein gehörte zu ihr, war für sie wie eine zweite Haut.
Vermisste sie ihn eigentlich, diesen undurchschaubaren Mann, der nicht nur ihr Kollege, sondern weit mehr als das gewesen war?
Sie zwang sich, nicht darüber nachzudenken, sie wollte gar keine Antwort darauf finden, sondern das tun, was sie immer tun wollte: sich nicht unterkriegen lassen und weitermachen. Einfach weitermachen.
Von der Seniorenwohnanlage begab sie sich nun auf den Rückweg zu ihrem Alfa, den sie in der Mousonstraße geparkt hatte. Gar nicht einmal so weit von hier befand sich auch Maras Wohnung. Sie hatte erneut Bewohner und Bedienstete des Wohnstifts befragt, aber wiederum war nichts Verwertbares dabei herausgekommen. Wie viel wertvolle Ermittlungszeit doch immer dafür draufging, dass man dann mit leeren Händen dastand …
Sie lief an ihrem Wagen vorbei, um eine sogenannte Trinkhalle zu erreichen, einen jener berühmten Frankfurter Kioske, die von früh bis spät geöffnet hatten und von unterschiedlichster Kundschaft aufgesucht wurden. Dort besorgte sie sich einen mit einer altmodischen Maschine frisch gebrühten Kaffee im XXL-Becher.
Sie fand seitlich des Kiosks ein ruhiges Plätzchen und zog das Handy aus der Jackentasche. Eine E-Mail, die sie nur Minuten zuvor erreicht hatte, war von Doktor Tsobanelis gekommen, dem Gerichtsmediziner. Offenbar betrachtete er Erkenntnisse der ersten Obduktion als derart bemerkenswert, dass er es eilig hatte, sie noch vor dem offiziellen Bericht mitzuteilen.
Mara las und pfiff leise durch die geschlossenen Zähne. Aus der E-Mail ging hervor, dass es sich bei der Todesursache im Fall Alfred Mertesheimer um die Einnahme einer großen Menge eines Gifts handelte: Colchicin.
Sie hatte den Namen nie gehört. Laut Tsobanelis wurde es vor allem zur Behandlung von akuter Gicht genutzt. Bei einer Überdosierung wirkte es allerdings extrem toxisch, wie er sich weiter ausdrückte. Eine plötzliche und sehr hohe Dosierung führte zunächst zu schmerzhaften Magen- und Muskelkrämpfen sowie heftiger Übelkeit mit Erbrechen. Bei fehlendem Gegenmittel konnte insbesondere bei älteren oder Menschen mit schwacher Konstitution nach mehreren qualvollen Stunden der Tod eintreten.
Mara las die letzte Anmerkung, die Tsobanelis in seine E-Mail getippt hatte: Das Gift ist überaus schwer nachzuweisen. Um darauf zu stoßen, müsste man fast schon wissen, wonach man Ausschau hält. Es sei denn, man ist ein medizinisches Genie. Zum Glück bin ich eins …
Eine Bemerkung, die gar nicht so ironisch gemeint war, wie es schien. Es war bekannt, dass der Gerichtsmediziner nicht gerade an Minderwertigkeitskomplexen litt. Sie mochte ihn nicht, und er sie noch weniger, aber er war tatsächlich ein fähiger Mann, das hatte sie ihm immer schon lassen müssen.
Mara steckte das Handy weg, nippte an ihrem Kaffee und blickte kurz hoch in den grau marmorierten Himmel, aus dem bereits vereinzelt Tropfen fielen. Den Andeutungen in der E-Mail zufolge war kaum davon auszugehen, dass das Todesopfer die extrem hohe Menge Colchicin freiwillig eingenommen hatte. Also war er dazu gezwungen worden, direkt vor Ort, in dem Apartment im Wohnstift. Um den nötigen Druck auszuüben, hatte der Täter das Opfer mit zahlreichen brutalen Schlägen und Tritten malträtiert.
Mara fragte sich, warum er so vorgegangen war. Normalweise wurde Gift als Tötungsmittel verwendet, wenn man die Mordabsicht verschleiern wollte. Doch in diesem Fall hatten die Tritte und Schläge zahlreiche Hämatome und andere Verletzungen beim Opfer hinterlassen, dass eine Fremdeinwirkung sofort klar gewesen war. Wollte der Mörder, dass seine Tat als Mord zu erkennen war?
Der Regen nahm zu, und Mara rettete sich in ihren Alfa. Sie fädelte sich in den dichten City-Verkehr ein und suchte in den folgenden Stunden Bekannte und einstige Kollegen von Alfred Mertesheimer auf, bei denen sie sich vorher telefonisch angekündigt hatte.
Nicht nur die Befragungen, vor allem die Fahrten von Stadtteil zu Stadtteil kosteten sie viel Zeit. Doch auf gewisse Weise genoss Mara es, im Nieselregen und durch Nebelfetzen zwischen den Hochhäusern hindurchzusteuern, die wie düstere, seelenlose Kolosse aus einer plötzlich nicht mehr fernen Endzeit auf sie herabzustarren schienen. So kannte sie Frankfurt. Es war ihre Stadt. Ihr Verbündeter und zugleich ihr Gegner, sehr vertraut, jedoch auch unberechenbar, hinterhältig. Sie fühlte sich wie in einem Dschungel aus Beton- und Stahl, aber es war eben ihr Dschungel.
Als sie zurück im Präsidium war, saß Tobias Cronberg an seinem Platz und empfing sie mit einem vorsichtigen, prüfenden Blick.
Sie nickte ihm zu, setzte sich und klappte den Laptop auf, um sich von Neuem ins System einzuloggen.
»Wo warst du?«, wollte er wissen.
»Unterwegs.«
»Ich habe dich mehrfach angerufen und …« Er ließ den Satz verklingen.
»Für die Befragungen habe ich das Handy stummgeschaltet.«
Mit unverändertem Blick betrachtete er sie über ihre beiden Schreibtische hinweg. »Welche Befragungen?«
»Colchicin«, sagte sie, und erst jetzt schaute sie ihn wieder an.
»Bitte?«
Sie informierte ihn über die Hinweise, die ihr Tsobanelis hatte zukommen lassen, und fügte an: »Du kannst gern weiteres Hintergrundwissen über Colchicin ranschaffen, eventuell auch noch mehr in der Gerichtsmedizin erfragen.«
Er nickte. »Okay.«
Als sie wieder in Schweigen verfiel, meinte er: »Sollten wir nicht mal zusammentragen, was wir bisher haben?«
»Damit sind wir wohl recht schnell fertig.«
»Aber es würde doch nicht schaden, oder?«
Cronberg erhob sich, zog hinter der Trennwand ein Flipchart auf Rollen hervor und platzierte es neben seinem Schreibtisch. Er griff zu einem Edding®-Stift, um Stichworte auf dem Chart festzuhalten.
»Starten wir mit dem Opfer«, sagte Mara. »Doktor Alfred Mertesheimer. Vor einem Monat 78 Jahre alt geworden. Geboren in der ehemaligen DDR. Medizinstudium, dann eine ärztliche Laufbahn, die ihn in verschiedene Ostberliner Kliniken und medizinische Forschungsinstitute führte. Nach dem Mauerfall erfolgte der Wechsel in den Westen. Erst Göttingen, anschließend am Institut für Neuroonkologie am Frankfurter Universitätsklinikum, wobei er kaum noch als Arzt praktizierte, sondern noch ausgiebiger im Forschungsbereich tätig war als früher.«
Das leise Quietschen des Filzstifts verklang, als Cronberg innehielt. »Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, warum ausgerechnet dieser Mann das Opfer einer derartigen Tat wurde. Sein privates und auch sein berufliches Leben scheint vollkommen ohne größere Konflikte verlaufen zu sein. Richtig?«
Als sie nichts antwortete, warf er die nächste Frage in den Raum: »Vielleicht ist er einfach ein Zufallsopfer?«
Maras Blick ruhte auf dem Flipchart. »Das ist ein Wohnstift mit über 300 Apartments unterschiedlicher Größe.« Sie zuckte skeptisch mit der Augenbraue. »Genau dieses Apartment mit genau diesem Bewohner – ein Zufall? Nein. Es war geplant. Alles sollte exakt so ablaufen.«
Cronberg nickte zustimmend.
Sie schilderte ihm Rosens Gedanken darüber, wie der Täter tagsüber ins Gebäude gekommen war und Alfred Mertesheimer nachts aus dem Schlaf geklopft haben mochte.
»Äh – wer ist Rosen?«
»Cybercrime-Abteilung. Früherer Kollege«, entgegnete sie schmallippig.
»Und du hast dich mit ihm über den Fall ausgetauscht?«
Maras Blick blieb auf die Stichworte gerichtet.
»Wie auch immer«, meinte Cronberg. »Also kein Zufallsopfer, sondern gezielt ausgesucht.«
»Womit wir beim Täter wären, der sehr ruhig und überlegt vorgegangen ist. Vor allem, was seinen Abgang betrifft. Der Mann am Empfang hat ausgesagt, dass er kurz vor sechs Uhr morgens auf das Alarmsignal aus Mertesheimers Apartment aufmerksam geworden war. Worauf er sofort losrannte und den Fahrstuhl in den vierten Stock nahm. Dort eilte er zu dem Apartment. Er bemerkte, dass die Tür nur angelehnt war, ging hinein und stieß auf die Leiche. Mit dem Handy alarmierte er sofort Notarzt und Polizei.«
»Also hat der Täter selbst den Alarm ausgelöst«, beeilte sich Cronberg anzumerken.
»Er drückte den Notknopf, verließ das Apartment, und während der Mann vom Empfang im Aufzug nach oben fuhr, verschwand er über das Treppenhaus und durch die Lobby, in der sich um diese Zeit niemand befunden hatte.«
»Moment mal, die Überwachungskameras. Die müssten doch …« Cronberg sah sie erwartungsvoll an.
Sie grinste flüchtig. »Wird Zeit, dass du danach fragst, findest du nicht?«
»Was ist denn mit den Kameras?«
»Es gibt keine. Das Wohnstift wirbt mit seiner besonderen Diskretion. Keine Kameras, kein An- und Abmelden, keine Pflichtveranstaltungen, nicht das leiseste Gefühl von Überwachung. Eine Gemeinschaft, die dem Einzelnen Luft zum Atmen lässt. Kein Bewohner ist jemals einsam, aber immer dann allein, wenn er es sein will.«
»Ich dachte, bei einer solchen Einrichtung muss auf jeden Fall …«
»Bleiben wir beim Täter. Er geht nicht nur überlegt vor, er ist auch jemand mit …?« Fragend ließ sie den Satz offen.
»Äh … mit …«
» … einem bestimmten medizinischen Wissen. Wer kennt schon Colchicin und seine mörderische Seite? Laut Tsobanelis wird es in Tablettenform verabreicht. Wahrscheinlich hat der Täter die Pillen zu Pulver zerstoßen, damit er sein Opfer leichter zwingen konnte, sie einzunehmen und auch, weil sie so schneller ihre Wirkung entfalten.«
»Wie kam er an die Tabletten? Ist er selber Arzt? Oder Krankenpfleger?«
»Falls nicht, kann er sich die Medizin auch im Netz beschafft haben.« Mara legte die Beine auf die letzte freie Ecke ihres Schreibtischs, der ansonsten mit Papierkram und leeren Kaffeebechern übersät war. »Was wissen wir noch über ihn?«
»Also …« Cronberg ließ das Wort in der Luft hängen, seine Stirn legte sich grüblerisch in Falten.
»Wir wissen, dass er offenbar ein Sadist ist. Der Tod trat nicht gerade schnell ein. Nach Einschätzung von Tsobanelis hat das Schauspiel gut fünf bis sechs Stunden gedauert.« Mara faltete die Hände im Nacken. »Der Täter hat sich womöglich daran geweidet, wie Mertesheimer gelitten hat und Minute für Minute dem Tod nähergekommen ist.«
Wieder sagte ihr ein unbestimmbares Gefühl, dass hinter diesem Verbrechen noch viel mehr steckte als allein die Durchführung eines durchdachten, brutalen Mordes.
»Was ist denn nun mit der Nachbarschaft?«, fragte sie übergangslos.
Cronberg stand da und hielt den Stift in der Hand. »Ich hab dir doch eine Übersicht zugeschickt.«
»Das war ’n bisschen dünn, oder?«
Sichtlich beleidigt verzog er den Mund. »Was fehlt denn?«
»Wir brauchen nicht nur eine Namens- und Adressliste, sondern Infos zu diesen Namen.«
Er stöhnte auf. »Aber das kann ewig dauern, ohne dass wir dann wohl viel mehr in der Hand hätten und …«
»Ich dachte, ihr neuen Jungs seid so clever und fix, was den ganzen Online-Kram betrifft.«
Er suchte nach einer Antwort.
Sie nahm die Füße wieder vom Tisch. »Dreh da einfach noch eine Runde, und ich nehme mir noch mal Mertesheimer vor. Vielleicht finde ich ja doch einen dunklen Punkt auf seiner weißen Doktorweste.«
»Vor allem findest du immer Wege, wie du allein agieren kannst.«
Cronberg warf den Edding®-Stift auf seinen Tisch und marschierte davon.
Mara sah ihm nicht hinterher. Ihr Blick war nach wie vor auf die Stichworte auf dem Flipchart gerichtet.
Es waren lediglich ein paar Sekunden vergangen, als sie erneut Schritte vernahm.
Wollte der neue Kollege ihr etwa noch etwas an den Kopf werfen, fragte sich Mara. Aber es war nicht Tobias Cronberg, der neben der Trennwand erschien.
»Oh, ein Überraschungsgast.« Mara grinste. »Hättest du dich angekündigt, hätte ich Kuchen gebacken.«
»Rotweinkuchen, nehme ich an.«
Rosen setzte sich auf Cronbergs freien Stuhl, der einmal ihm gehört hatte.
»Heute überaus schlagfertig, der Kollege. Was kann ich für dich tun?«
»Vielleicht kann ich was für dich tun.«
Sie grinste erneut. »Wäre nicht das erste Mal.«
»Ich bin auf etwas gestoßen, und es hat sofort klick bei mir gemacht.«
Rosen fuhr sich durch die schütteren, hellblonden Haare. Heute trug er einen smaragdgrünen Pullover.
»Vor ein paar Wochen kam es in Freiburg zu einem brutalen Gewaltverbrechen. Ein zweiundachtzigjähriger Mann wurde von der Reinigungsfrau in seiner Villa tot aufgefunden. Er wies viele heftige Hämatome auf, Rippen waren gebrochen … Die Tritte, die ihm der Täter verpasst hat, führten zu zahlreichen inneren Verletzungen. Er muss ziemliche Qualen erlitten haben. Aber die Todesursache …« Er hob mit einer fragenden Geste die Hand.
»… war ein Rätsel, schätze ich.«
»Jedenfalls zunächst. Die Obduktion ergab allerdings, dass er eine extrem hohe Menge eines Medikaments eingenommen hatte, das Gichtpatienten erhalten und …«
»Colchicin«, warf Mara betont beiläufig ein.
Rosen sah verblüfft auf. »Ach?«
»Tsobanelis war sehr schnell.«
»Aha. Dann kannst du dir bestimmt auch denken, was der ältere Mann in Freiburg früher von Beruf war.«
»Arzt«, sagte Mara prompt.
»Richtig.«
Sie wechselten einen langen Blick, ließen die Informationen sacken.
Mit einem Schmunzeln fragte Mara: »Wie kam es eigentlich, dass du auf die Sache gestoßen bist, wie du sagst?«
Er winkte ab. »Irgendwie rein zufällig.«
»Irgendwie …«, ahmte Mara seinen ausweichenden Tonfall nach. »Na klar, da wette ich drauf.«
»Jedenfalls weisen die Mordfälle für meine Begriffe viel zu viele Gemeinsamkeiten auf.«
»Hast du auch persönliche Infos zu dem Freiburger Mordopfer?« Ironisch fügte sie an: »Rein zufällig natürlich.«
»Doktor Kilian Seywald. Bereits seit Langem im Ruhestand gewesen, ein vermögender älterer Witwer, der offenbar sehr zurückgezogen gelebt hat.«
»Trotz seines Vermögens keine Hinweise auf einen Raub, tippe ich einfach mal.«
»Die Parallelen hören nicht auf, was?« Rosen nickte eifrig. »Geboren und aufgewachsen ist Seywald in der früheren …«
»Sag nicht DDR«, fiel Mara ihm ins Wort.
»Mertesheimer etwa auch?«
Sie hob den Daumen zur Bestätigung. »Ich hab mich in der Uni-Klinik umgehört. Es gibt noch Ärzte und Leute vom Personal, die Mertesheimer kannten und mit ihm zusammengearbeitet haben. Bei den Befragungen ist Freiburg erwähnt worden. Nur nebenbei, und da hab ich dem natürlich keine große Beachtung geschenkt.«
»Freiburg? Inwiefern?«, hakte Rosen nach.
»Wie gesagt, es kam nur beiläufig zur Sprache. Mertesheimer hatte bei Forschungsprojekten mit der dortigen Uni-Klinik zu tun und hat sich wohl häufiger dort aufgehalten.«
»Im Mordfall Seywald gab es offenbar keinen Verdächtigen und kaum Befragungen. Die Kollegen haben auch kein Tatmotiv herleiten können. Für mich hat es den Anschein, als wären die Ermittlungen recht schnell im Sande verlaufen.«
»Seywald und Mertesheimer«, sagte Mara, als wären das zwei Losungsworte.
»Nicht ganz.«
»Was heißt nicht ganz?«, fragte sie irritiert.
»Dass noch etwas fehlt. Denn ein bestimmtes Detail hab ich dir noch gar nicht erzählt.«
***
Mit entschlossenen Schritten näherte sich Tobias Cronberg der Bürotür.
Sie war geschlossen, und das war sie eigentlich immer, wie ihm schon aufgefallen war.
Ein Signalton informierte ihn, dass eine WhatsApp eingetroffen war. Er nahm sein Handy und klickte sie an: Ich denk an dich. Hinzugefügt worden waren ein Kuss-Emoji und ein rotes Herz.
Natürlich von Liz.