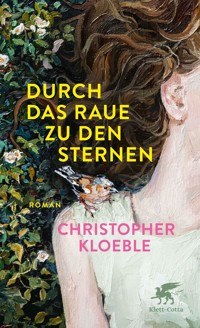
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Man kann nur richtig laut sein, wenn man das Leise versteht.« Arkadia will in einem Knabenchor singen, und das um jeden Preis. Atmosphärisch, tief bewegend und auf tragikomische Weise erzählt Christopher Kloeble in »Durch das Raue zu den Sternen« von der großen Liebe eines Mädchens zu ihren Eltern und der Musik. Und dem unbändigen Willen, der Welt zu beweisen, wer man sein kann, wenn man sich den Regeln der Gesellschaft nicht beugt. Arkadia Fink ist eine Heldin, die man nicht vergisst: 13 Jahre alt, musikalisch hochbegabt und mit reichlich Fantasie gesegnet. In ihrem bayerischen Dorf macht sie das zur Außenseiterin. Die Einzige, die Arkadia versteht, ist ihre Mutter: eine extravagante, erfolglose Komponistin, die davon überzeugt ist, dass Beethoven eine Frau war. Doch nun ist Arkadias Mutter verschwunden. Gegen diese schmerzhafte Gewissheit kämpft Arkadia mit überbordender Energie und Vorstellungskraft an. Und sie hat eine Idee: Wenn der weltberühmte Knabenchor sie aufnimmt und sie auf der großen Bühne singt, wird ihre Mutter zurückkehren. Die Hürden mögen unüberwindbar scheinen – noch nie hat ein Mädchen in dem Chor gesungen. Aber Arkadia denkt nicht daran aufzugeben. »Durch das Raue zu den Sternen« ist ein zu Herzen gehender Roman, dem die Kraft der Musik innewohnt, ein fantastisches Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christopher Kloeble
DURCH DAS RAUE ZU DEN STERNEN
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: © FAVORITBUERO, Buero für Gestaltung, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Mariia aiiraM / Shutterstock
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-96657-2
E-Book ISBN 978-3-608-12459-0
Für Saskya, C. und F.Für alle, die singen
Wer war glücklicher als ich, da ich noch den süßen Namen Mutter aussprechen konnte, und er wurde gehört, und wem kann ich ihn jetzt sagen.
Ludwig van Beethoven
Ziel des Knabenchors ist es, Jungen mit dem musikalischen Rüstzeug auszustatten, sodass sie eine hohe Leistung erbringen können. Das ist kein Widerspruch zum naturgegebenen Verhalten eines Kindes. Denn nur hochqualitative Musik ohne Leistung ist ein Widerspruch in sich. Die Ausbildung des Knabenchors basiert auf dem wissenschaftlichen Fakt, dass jeder Schüler aus Freude an der Sache selbst lernt.
Aus den Statuten des Knabenchors
Save me from the grave and wise,For vainly would I tax my spirit,Be the thing that I despise,And rival all their stupid merit.On! my careless laughing heart,O dearest Fancy let me find thee,Let me but from sorrow part,And leave this moping world behind me.
Irisches Volkslied (Vorbild für den 4. Satz von Beethovens 7. Sinfonie)
1. Satz
schnell, aber nicht zu schnell, ein wenig majestätisch
Die ganze Welt wird immer besser
Ich heiße Arkadia Fink, meine Augenfarbe ist grau und ich wurde am 1. Januar 1979 geboren. Das steht jedenfalls in meinem Perso. Aber die meisten Leute nennen mich Moll, meine Augenfarbe ist manchmal auch blau und ich wurde erst richtig geboren, als meine Mutter kurz weggegangen ist.
Das ist jetzt acht Monate, drei Wochen und sechs Tage her. Es macht mir nichts aus, ich komme gut ohne sie klar und schlafe tief. So tief, als würde sie mich jeden Abend in den Schlaf singen. (Ja, ich bin dreizehn und lasse mich noch von meiner Mutter in den Schlaf singen. Wer das komisch findet, hat bestimmt keine Mutter, die ihn in den Schlaf singt.) Meine absolute innere Ruhe kommt daher, dass ich nicht daran denke, was passiert ist. Ich bin sehr beliebt im Dorf und habe eine Menge Freunde. Sie wollen dauernd meine Stimme hören. Eines Tages werde ich zu den überragenden Persönlichkeiten der Musikgeschichte zählen. Das wissen die nicht, aber irgendwie wissen sie es doch. Sobald ich singe, haben alle Tränen in den Augen. Selbst die Jungs mit den geschwollenen Kehlköpfen. Es stimmt nicht, dass sie mich neulich gezwungen haben, das Kleid meiner Mutter auszuziehen, was ich am liebsten trage, und fast nackt über die Hauptstraße zu rennen und dabei die Bayernhymne zu singen. Das ist nur eine Geschichte, über die ich selbst gut lachen kann, weil sie unrealistisch ist.
Mein Vater kommt mit der Abwesenheit meiner Mutter nicht so gut klar wie ich. Das weiß ich, weil ich ihn gefragt habe, wie er damit klarkommt, und er hat geantwortet: »Gut.« Mein Vater sagt dauernd, ich darf ruhig traurig sein. Damit will er sagen, dass ich traurig sein soll. Er sieht mich dann an, als würde ich ihn enttäuschen, weil ich nicht flenne. Er geht zum Weinen in seine Schreinerei. Wenn er die Kreissäge anschmeißt, zerteilt er nicht Holz, sondern sein Schluchzen. Ich habe das heimlich durch eines der vielen staubigen Fenster beobachtet. Das Weinen ist wie eine Krankheit, es überfällt ihn in Schüben. Am meisten weint er mit seinen Händen. Das Zittern kann so stark werden, dass er seine Gabel, den Hammer oder die Zahnbürste weglegen und die Hände in seine Hosentaschen stecken muss, damit sie sich beruhigen. Er hat seit acht Monaten, drei Wochen und sechs Tagen nichts mehr geschreinert. Ich weiß nicht, wie lange unser Gespartes reichen wird. Für den Klingelbeutel nimmt er sonntags nur noch Münzen mit, und auf der Kommode in unserem Flur stapeln sich Rechnungen. Aber wenn ich meinen Vater frage, ob wir Geld brauchen, sagt er: »Nein.«
Dass er nicht mehr schreinert, ist besonders schlimm für seine Hände. Sie sind für Holz gemacht. Und ich glaube auch, dass Holz für seine Hände gemacht ist. Er hat unser Haus gebaut und die meisten Möbel darin. Natürlich hatte er dabei Hilfe, doch es gibt kein Teil, über das er nicht mitentschieden hat. Wenn er Holz prüft, sieht er nicht nur mit den Augen genau hin, er lässt auch seine Hände darübergleiten. Das Holz spricht zu ihm, wie eine Melodie zu mir spricht. Sitzen wir beim Abendbrot in der Stube, schimmern die Narben auf seinen Händen im Licht der Deckenlampe. Sein Blut ist in dem Holz um uns herum. Ich frage mich, ob er Holz so sehr mag, dass ihm die Verletzungen nichts ausmachen, oder ob er das Holz wegen der Verletzungen mag.
Wie auch immer, mein Vater ist zurzeit jedenfalls nicht richtig mein Vater. Selbst wenn wir wüssten, wo meine Mutter ist, könnte er sie nicht zurückholen. Sie würde ihn wahrscheinlich fragen: Wer bist du denn? Und er würde antworten: Ich weiß es nicht, wenn du nicht da bist. Und dann würde sie sagen: Ich kann erst wieder da sein, wenn du wieder du bist. Und dann würde er wahrscheinlich weinen.
Wenigstens ist meine beste Freundin immer noch sie selbst. Sie heißt Bernhardina. (Ihre Eltern hielten das für eine gute Idee.) Früher war sie Musiklehrerin in Namibia oder, wie sie das nennt, im guten, alten Südwestafrika. Heute lebt sie im SENIORENDOMIZIL PHOENIX. (Ihre Kinder hielten das für eine gute Idee.) Meine Mutter und ich haben Bernhardina bei einem Konzert im Kurhaus von Bad Loss kennengelernt. Sie bezeichnet Bernhardina als ihre Apothekerin, denn bei ihr kauft meine Mutter ihre Medizin. Manchmal begleite ich sie dabei. Nachdem sie Geld gegen Tabletten getauscht haben, trinken sie immer eine Kanne Kaffee und unterhalten sich darüber, wie unmusikalisch viele Menschen sind. Meine Mutter sagt, sie ist so dankbar, dass es Bernhardina gibt. Sie teilt ihre Medikamente mit meiner Mutter, weil der einzige Arzt in unserem Landkreis ihr kein solches Rezept geben will. Er behauptet, sie sei nicht krank. Meine Mutter sagt aber, die Medizin rette ihr das Leben. Ich weiß nicht, ob sie ohne die Tabletten wirklich sterben würde, aber es stimmt, dass sie ihr helfen. Wenn die Luft an einem rauen Februartag schwer über dem Dorf hängt, liegt meine Mutter nur im Bett, riecht nach Stall und kann stundenlang nicht aufstehen. Doch sobald sie ihre Medizin schluckt, spielt sie nachts Chopin, bis unsere Nachbarn damit drohen, die Polizei zu rufen, weil sie so viel Schönheit nicht ertragen können.
Ich muss Bernhardina jeden Tag um achtzehn Uhr anrufen. Sie will nicht erst nach Wochen tot in ihrem Zimmer aufgefunden werden, sagt sie. Es kommen doch ständig Pfleger vorbei, sage ich. »Die behandeln mich«, antwortet sie dann, »als wäre ich schon tot. Wie sollen die den Unterschied kennen?«
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass sie Gesellschaft braucht – wie die alten Männer bei den Gemeindeversammlungen, zu denen ich immer gehe, um über alle Neuigkeiten im Dorf informiert zu sein (die Versammlungen sind sehr kurz). Diese Männer melden sich zu Beginn jeder Fragerunde und sagen: Ich habe keine Fragen, bloß einen langen Kommentar, der ganz viel mit mir zu tun hat und niemanden von euch wirklich interessiert, aber was könnt ihr schon tun, ich habe bereits angefangen zu reden, und wenn ich erstmal in Schwung gerate, hält mich keiner so schnell auf, und es fühlt sich richtig gut an, gehört zu werden, heutzutage wollen ja alle nur noch reden und niemand will mehr zuhören, das war früher so viel besser, da mussten alle still sein, wenn ich etwas zu sagen hatte, und was schon immer so war, hat seine Richtigkeit, sonst wäre es ja nicht schon immer so gewesen, darum kapier ich auch nicht, warum es Moll stört, wenn ich sie in die Wange kneife und sie ein fesches Weibsbild nenne, das ist doch ein Kompliment, es ist total hysterisch, dass sie mich deshalb angeschrien hat, da war es doch nur logisch, sie zu watschen, denn so behandelt man alte Menschen nicht, die so viel für dieses Land getan haben, und natürlich verwende ich diese Worte nicht, wenn ich bei der Gemeindeversammlung etwas nicht-frage, diese Worte sind von Moll, aber für alle, die gut hinhören, sage ich genau das.
Bernhardina redet nicht viel. Wenn ich sie anrufe und sie den Hörer abnimmt, sagt sie normalerweise: »Wird auch Zeit.« Manchmal sagt sie auch: »Hölle hier.« Und frage ich sie dann, wie es ihr geht, sagt sie: »Lebe noch.«
Es kommt so gut wie nie vor, dass ich vergesse, mich bei ihr zu melden. Ich habe einen perfekten inneren Takt. Zu jeder Tageszeit weiß ich, wie viel Uhr es ist. Nur Musik kann dazwischenkommen. Höre ich die 9. Sinfonie bei voller Lautstärke, sodass die Grünlilie vor der Stereoanlage mitzittert und ich ein bisschen schwebe, verhält sich die Zeit unzuverlässig, macht Sprünge und rennt mir davon. Da kann es vorkommen, dass Bernhardina mich später anruft und mir vorhält, wie mühsam es war, all die Zahlen ins Telefon zu drücken, und dass sie längst im Verwesungsstadium sein könnte.
Bei jedem unserer Gespräche verlangt sie, dass ich ihr etwas erzähle. Ich muss das sehr laut machen. Bernhardina hört nicht mehr gut. Gleichzeitig ist kaum jemand so gut im Zuhören wie sie. Meine Mutter sagt immer, es gibt einen Grund dafür, dass wir zwei Ohren und nur einen Mund haben. (Das Zitat hat sie einem alten Griechen geklaut.) Vielleicht hört Bernhardina so gut zu, weil ihre Ohren nicht mehr so gut funktionieren. Ich erzähle ihr, dass ich Schweinebraten mit Semmelknödeln gegessen und nicht von meiner Mutter geträumt habe und dass mein Vater wenig weint. Sie hört raus, dass ich fertigen Kuchenboden aus dem Supermarkt gegessen und von den Händen meiner Mutter auf Klaviertasten geträumt habe und dass mein Vater zu viel weint. Bernhardina verlangt dann, dass wir zusammen hören. Sie liebt Mozart. Das liegt daran, sagt sie, dass er sie daran erinnert, warum sie Musiklehrerin geworden ist. Sie wollte Kindern beibringen, dass Musik die größte unerforschte Kraft der Welt ist. Jeder kennt und fast jeder hört Musik und trotzdem weiß so gut wie niemand, wie sie funktioniert. Die meisten Menschen können nicht einmal Noten lesen. Das ist so, als würden wir alle am Meer leben und nicht schwimmen können. Bernhardina hat Generationen von Kindern in Musik unterrichtet. Mozart war immer bei ihr. Einmal, als sie ein paar Kirschlikörpralinen zu viel genascht hatte, hat sie mir erzählt, dass sie an vielen Abenden in Swakopmund dort saß, wo die Wüste direkt ins Meer übergeht, und die kleine Nachtmusik auf ihrem Walkman hörte. Dann war die Welt in perfekter Harmonie, sagte sie.
Ich war noch nie in Namibia und liebe Mozart nicht, aber ich weiß, was sie meint. Wenn ich beim Hören mit ihr die Wahl habe, entscheide ich mich meistens für die größte Tondichterin aller Zeiten. Wir sind beide Fans. (Auch wenn Bernhardina noch immer darauf besteht, dass Beethoven ein Mann war.) Bernhardina sagt, die Musik gibt ihr das Gefühl, dass ihr Körper funktioniert. Als ich sie einmal besucht habe, hat sie getanzt. Das hat sie für mich getan. Es ist nämlich unmöglich, nicht zu lächeln, wenn eine Frau, die nicht mehr gehen kann, in ihrem Bett für dich tanzt.
***
Bernhardina ist nur dann nicht meine beste Freundin, wenn sie sagt, dass meine Mutter vielleicht nicht zurückkommt.
Kein Wunder, dass sie und Bernhardina sich nicht immer einig sind. Meine Mutter sagt zum Beispiel, dass die ganze Welt immer besser wird, und wenn manche Geschichten schlimmer werden, dann nur, damit sie am Ende gut sein können. Ein Beweis dafür: Die Mauer ist gefallen.
Aber Bernhardina sagt, das ist ein Beweis für’s Gegenteil, denn jetzt kommen die alle zu uns.
Seitdem meine Mutter kurz weggegangen ist, habe ich Bernhardina oft erklärt, dass meine Mutter ja meine Mutter ist und dass sie deshalb zurückkommen wird. Dann werde ich sie nur ein paar Mal umarmen müssen, damit sie sich wieder so anfühlt wie meine Mutter.
Kleine Götter
Morgen oder spätestens übermorgen, wenn ich in der Zeitung stehen werde, soll niemand denken, dass ich gestorben bin, weil meine Mutter kurz weggegangen ist. Sie trägt keine Schuld. Ich habe das alles nicht geplant. Wahrscheinlich erwartet niemand, dass sein letzter Tag ein Mittwoch ist. Vor ein paar Stunden dachte ich das auch noch nicht. Ein Freitag, ja. Ein Sonntag, absolut. Sogar ein Montag. Aber ein Mittwoch?
Wie immer war ich in der großen Pause am selben Ort: hinter dem Mauervorsprung beim Seiteneingang der Schule. Dort kommt selten jemand vorbei und stört mich beim Hören. Heute aber hat mich der Schmidbauer entdeckt. Er trug dasselbe Hemd wie immer, rot-weiß kariert wie die Tischdecken im Gasthof. Es könnte natürlich auch immer das gleiche Hemd sein, aber er riecht eher wie immer dasselbe. Die einzigen Haare an seinem Kopf, die er nicht wegrasiert, wachsen auf seiner Oberlippe. Der Schmidbauer sagte zu mir, ich soll mich nicht absentieren. (Er ist Deutschlehrer.) Ich sagte, ich absentiere mich nur, weil ich zu beliebt bin, ich bräuchte mal Ruhe.
Er tastete mit dem Zeigefinger seinen Schnurrbart ab, als wolle er überprüfen, ob er noch da ist. Der Schmidbauer hat mich nie darauf angesprochen, dass meine Mutter kurz weggegangen ist. Ich weiß aber, dass er es weiß. Er fragt mich nämlich dauernd, wie es mir geht.
Ich antworte jedes Mal: »Prima.«
Er sagt dann jedes Mal: »Prima.«
Und dabei belassen wir es normalerweise.
An diesem Mittwoch fragte er: »Was hörst du?«
Er deutete auf meine Kopfhörer, die mir meine Mutter zu meinem zehnten Geburtstag geschenkt hat. Sie halten meine Ohren warm und überflüssige Geräusche draußen.
Leider nicht alle überflüssigen Geräusche.
»Was du hörst, habe ich gefragt«, sagte der Schmidbauer.
»Musik«, sagte ich.
»Was Bekanntes?«, fragte er.
»Ja.«
»Darf ich?«
Wieder deutete er auf meine Kopfhörer.
»Nein«, sagte ich.
»Warum nicht?«
»Die meisten Leute sind nicht gut im Hören.«
»Ich bin nicht die meisten Leute«, sagte er. »Gib mir die Hörer.«
»Muss ich?«
»Ich kann sie auch konfiszieren.«
»Erpressung. Sehr pädagogisch.«
»Wie redest du eigentlich mit mir?«
»Das ist eine seltsame Frage für jemanden, der angeblich gut im Hören ist.«
»Arkadia Fink.«
»Okay, okay.«
Ich reichte ihm die Hörer und er setzte sie sich auf die haarlosen Ohren. Sofort veränderte sich etwas in seinem Blick.
»Du hörst das gerne?«
Ich nickte.
Er lauschte noch etwas länger.
»Haydn«, sagte er.
»Beethoven.«
»Bist du sicher?«
»Die neunte Sinfonie ist anders als alle anderen Sinfonien davor, weil Beethoven menschliche Sprache reinkomponiert hat.«
»Menschliche Sprache?«
»Es wird gesungen.«
»Ach so. Ja. Das wusste ich.«
Der Schmidbauer gab mir die Hörer zurück.
»Arkadia, wäre es nicht besser für dich, wenn du dich zu den anderen Kindern gesellst?«
»Nein, danke.«
»Hast du eine Freundin? Jemanden, mit dem du reden kannst?«
»Ja.«
»Wer ist es?«
»Kennen Sie nicht.«
»Wie heißt sie denn?«
»Bernhardina.«
Er seufzte.
»Ehrlich, ist das der beste Name, den du dir ausdenken kannst?«, fragte er.
»Ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Das ist die Wahrheit.«
Der Schmidbauer räusperte sich.
»Du hast neulich behauptet, dass Beethoven eine Frau war.«
»Stimmt.«
»Ich verstehe, dass es nicht immer leicht ist, die Wahrheit zu akzeptieren. Aber lügen? Das ist nicht gut.«
»Woher wollen Sie wissen, was gut für mich ist?«
Dann sagte er: »Deine Mutter ist …«
Ich kann es absolut nicht leiden, wenn Leute einen Satz so beginnen. Das bedeutet immer, dass ich gleich etwas Falsches hören werde. Und wer hört schon gerne etwas Falsches über seine Mutter. Davor muss ich mich schützen. Manchmal renne ich weg. Manchmal setze ich meine Kopfhörer auf und fahre die Lautstärke hoch. Und manchmal haue ich jemandem eine rein.
***
Meine Mutter ist ein Apfelbaum, der wenig von den Gesetzen der Jahreszeiten hält. Das behauptet jedenfalls mein Vater. An manchen Tagen im tiefsten Winter hängen fette Früchte an seinen Ästen, sagt er, an anderen im Frühling verweigert er auch nur eine einzige Blüte, und an wieder anderen im Sommer schüttelt er sich wie aus einer Laune heraus und verabschiedet sich von all seinen Blättern.
Bei der Sonntagsmesse, zum Beispiel, trägt meine Mutter von allen Frauen die höchsten Absätze.
»Um dem lieben Gott möglichst nah zu sein«, sagt sie oft in Richtung der Frauen, die ihre Köpfe schütteln. »Und um ein Stück weiter von denen entfernt zu sein«, flüstert sie mir zu.
Am weitesten sind wir von denen auf unserem Dach entfernt. Dort hoch klettern wir oft an Sommerabenden, wenn die Sonne sich rot färbt, die letzten Kühe eingetrieben werden und die Schwalben auf Jagd gehen. Da unser Haus oben am Hang liegt, sind wir auf dem Dach der höchste Punkt unserer Gemeinde. Wir sind sogar höher als die Kirchturmspitze. Die Schindeln geben die Hitze des Tages ab. Meine Mutter legt ihre Arme um mich. Ihr Atem kitzelt mich im Nacken. Meine Augen sind dann immer blau, das spüre ich. Wir reden miteinander. Oder wir reden gar nicht. Es fühlt sich an, als würden wir auf etwas warten. Auf was genau, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es kommen wird, solange ich bei ihr bin. (Seitdem sie kurz weggegangen ist, klettere ich oft allein aufs Dach und halte Ausschau, weil ich ganz genau weiß, worauf ich warte.)
Meine Mutter ist aber noch viel mehr. Sie ist eine Nachfahrin von Maral, meiner Großmutter mit zwölf Urs, die vor vierhundert Jahren gelebt hat. Maral hat nie geheiratet und führte als erste Frau eine Bäckerei in unserem Dorf. Wenn wir zuhause Schwarzbrot backen, benutzen wir noch heute ihren Sauerteig-Ansatz. Er ist älter als unsere Kirche. Meine Mutter sagt, obwohl Maral vor langer Zeit gelebt hat, ist sie am engsten mit ihr verwandt.
Meine Mutter ist auch eine Organistin. Sie hat sich schon mehrmals bei unserer Kirche beworben. Nur hat diese bereits einen Organisten. Der muss erst sterben, ehe sie die Stelle neu besetzen, sagt meine Mutter. Sie sagt: »Seine Hände klatschen auf die Tasten wie Fische, die an Land verrecken.« Meine Mutter ist überzeugt davon, dass sie nach fast vierhundert Jahren die erste Organistin unserer Gemeinde werden wird.
Sie ist außerdem eine Forscherin. Sie arbeitet an einem sensationellen Werk über die größte Tondichterin aller Zeiten: Ludwig van Beethoven. Das Buch schreibt sie in einer Nebenkammer der Stube. Es ist fast ein Abstellzimmer. Darin stehen: Ein Neo-Bechstein-Flügel, ein klobiger Holzofen und ein Sessel mit kaputten Sprungfedern und abgewetztem Blumenmuster. Drum herum überall Bücher. Atlanten, Reiseführer, Ausstellungskataloge, Romane. Und vor allem: Notenbücher, Notenbücher, Notenbücher. Sie türmen sich vom Boden bis zur Decke, und wenn meine Mutter ein Buch von weiter unten lesen möchte, muss ich ihr helfen, einen der Stapel anzuheben. Schon lange wünscht sie sich von meinem Vater, dass er ihr ein paar Regale zimmert, aber sobald sie ihn darauf anspricht, schiebt er wichtigere Arbeit vor, weshalb sie im Oktober, wenn die ersten schweren Regenwolken an den Bergen hängen bleiben und es tagelang schüttet, viel Wert darauf legt, dass in dem Holzofen ein Feuer brennt, um die Feuchtigkeit aus der Kammer fernzuhalten. Der Neo-Bechstein ist natürlich verstimmt. Meine Mutter tut so, als würde sie das nicht stören. Sie sagt, jeder verändert sich mit der Zeit, warum nicht auch ein Flügel?
Meine Mutter ist vor allem eine Tondichterin. Die Musik, die sie in der Kammer erfindet, hält sie in den Notenheften fest. Die darf ich nur in ihrem Beisein lesen und daran halte ich mich. Auch wenn sie kurz weg ist. Ihre Noten sind schöner als ihre Buchstaben. Noten zeichnet sie, Buchstaben schreibt sie nur. Sie hat mir das Notenlesen beigebracht, bevor ich Buchstaben lesen konnte. Als mein Vater das bemerkt hat, drohte er, alle Notenhefte wegzuwerfen. Also brachte sie mir auch das Buchstabenlesen bei – mithilfe von Noten. Für mich beginnt das Alphabet noch immer mit einem c.
Jedes ihrer Notenhefte hat einen Titel. Manchmal gehe ich in die Kammer und lese die. Das hat sie mir ja nicht verboten.
Das Notenheft des Wartens. Das Notenheft der Angst. Das Notenheft der Schmerzen. Das Notenheft der verlorenen Dinge. Das Notenheft der fabelhaften Verlierer. Das Notenheft der Lieder, die nicht sattmachen.
Eins heißt Das Notenheft des Schätzens. Das erste Lied darin: Unsere geschätzte Liebe. Meine Mutter hat es mir einmal auf dem Flügel vorgespielt. Als ich es gehört habe, traute ich mich nicht zu fragen, wessen Liebe sie damit meint. Es war kein kurzes Lied. Es war auch kein hässliches Lied. Es war nicht einmal ein schwieriges Lied. Aber es war auch kein langes, schönes, einfaches Lied.
***
Als dem Schmidbauer ein Tropfen Blut aus der Nase lief und auf sein Hemd sprang und ein weißes Rechteck auf seinem Hemd so rot färbte wie die roten Rechtecke drum herum, da war ich einen Augenblick lang sehr glücklich. Ich spürte meine Mutter in mir. Zwar habe ich noch nie gesehen, wie sie jemanden zum Bluten gebracht hat, aber ich war dabei, wenn sie Leuten den Mittelfinger gezeigt oder als sie dem Heuschneider ins Gesicht gespuckt hat, weil er sie das Wort mit Sch genannt hat, was ich ihr versprochen habe, nie zu verwenden.
Gleich danach war ich sehr unglücklich. Es ist unfair, wenn man sich jemandem nah fühlt, der nicht nah ist.
Vielleicht habe ich meine Kraft etwas unterschätzt. Das mit dem Verletzen war zu leicht. Ich glaube, auch der Schmidbauer hat sich gewundert. Er stand einfach nur da und sah mich an. Er wirkte wie jemand, der nicht wusste, dass er bluten kann.
»Tut es weh?«
Ich reichte ihm eine Packung Taschentücher.
Er nahm einige und drückte sie gegen seine Nase.
»Entschuldigung«, sagte ich.
Der Schmidbauer bedeutete mir, ihm zu folgen. Ich sagte ihm, er solle sich erst mal um sich selbst kümmern. Ich sagte ihm das in exakt dem gleichen Ton, in dem mein Vater das immer zu meiner Mutter sagt.
Da drehte der Schmidbauer sich zu mir um und flüsterte, ich solle den Mund halten. Den Satz kann ich fast so wenig leiden wie Leute, die einen Satz mit Deine Mutter ist beginnen. In dem Moment hätte ich dem Schmidbauer gern gesagt, dass er eines Tages wahrscheinlich ein alter Mann auf einer Gemeindeversammlung sein wird. Aber es war schlauer, ihn nicht auch noch seelisch zu verletzen. Wenn man in meinem Dorf einen Mann oder einen Jungen, der sich für einen Mann hält, seelisch verletzt, dann weint er entweder und sperrt sich zum Beispiel in einer Schreinerei ein, oder er verletzt dich zurück, nur meistens eher nicht seelisch. Auf beides hatte ich keine Lust.
***
Ich musste in einem leeren Klassenzimmer warten. Der Schmidbauer hatte mich dort abgesetzt und um einen Moment Geduld gebeten. Der Moment dauerte lange.
Klassenzimmer ohne Kinder sind keine schönen Orte. In ihnen wächst etwas Unheimliches. Was das genau ist, kann ich nicht sagen. Es hat etwas mit der Stille zu tun. Sie ist ohrenbetäubend. Ich kann sie nicht ausstehen. Sie ist das einzige Geräusch, das niemand braucht. Die Stille ist gemein. Sie lauert ständig. Wenn du nicht aufpasst, überfällt sie dich und füllt dich aus, so dass du keinen Ton mehr rauskriegst.
Die Mittagssonne fiel durch die Fenster und machte hunderte von Fingerabdrücken sichtbar. Manche waren von mir. Vor ein paar Tagen hatte ich die ersten fünf Takte von Beethovens An die ferne Geliebte an die Fensterscheibe gedrückt.
Die Luft roch nicht unangenehm nach Turnschuhen.
Meine rechte Hand pochte. Die Nase vom Schmidbauer war härter gewesen, als ich gedacht hatte.
Mein Kopf spiegelte sich in einer Glasschüssel auf dem Lehrerpult, in der ein Goldfisch im Kreis schwamm. Er sah aus wie ein geschupptes Herz. Ich fragte mich, wie alt er war. Wie konnte er täglich so weitermachen? War es ihm nicht längst genug mit der ewig gleichen Runde? Könnte er sich entscheiden einfach aufzugeben, die Flossen hängen zu lassen? Und würde er dann ertrinken?
Können Fische ertrinken?
Da hörte ich Musik. Nicht die Art von Musik, die ich manchmal in der Schule hören muss, wenn wir mit unserer Lehrerin fröhliche Volkslieder singen, die eigentlich peinliche Geräusche sind. Nein, das, was ich in dem Moment hörte, das war richtige Musik.
Ich öffnete die Tür und horchte. Das simple Lied war mir nicht bekannt. Die volle Stimme auch nicht. Sie ließ das Lied elegant klingen, mit einer Bestimmtheit und einer Zartheit, als müsste ich es kennen. Jeder Ton wurde getroffen und festgehalten, und ich wollte das nicht denken, aber mir war sofort klar, dass diese Person sogar noch besser sang als meine Mutter.
Das Klassenzimmer war kaum mehr unheimlich. Es fühlte sich auf einmal mehr an wie ein Zuhause. Nicht mein Zuhause. Aber ein Zuhause. Der Goldfisch hörte auf zu schwimmen. Also, nicht wirklich, aber er wurde langsamer und bewegte sich mehr am Rand der Glasschüssel, als würde er lauschen.
Die Stimme kam vom Ende des Flurs. Ich sah mich um. Der Schmidbauer konnte jeden Moment zurückkehren. Ich durfte nicht gehen. Mein Vater weinte so schon genug. Ich durfte nicht gehen.
Ich ging.
Die Musik kam aus dem Klassenzimmer der 2 b. Ich konnte nun Worte ausmachen.
Unsere kleine Eisenbahn hält an keinem Bahnhof an
Ein Teil von mir wollte die Tür nicht öffnen, weil Hören einfach besser ist als Sehen. Doch ich musste wissen, wem die Stimme gehört.
Einmal Sulzbach und zurück, hin und her in einem …
Ich trat ein. Das Singen brach ab. Im Klassenzimmer saßen ungefähr fünfundzwanzig Schüler. Die meisten guckten zu mir, als wüssten sie nicht, dass Menschen durch Türen kommen können.
Ich sah mich nach der Person um, der die Stimme gehörte, und entdeckte eine noch ziemlich junge Frau. Ich hatte sie noch nie in der Schule gesehen, sie musste eine neue Lehrerin sein. Ihr Haar war kurzgeschnitten wie das von Lady Di. Sie war aber weder hübsch noch besonders unhübsch. Die Frau trug Turnschuhe, Jeans und eine graue Strickjacke. In den Händen hielt sie ein kleines elektrisches Keyboard. Sie blickte mich fragend an. Ich spürte die Blicke der Schüler in meinem Gesicht.
»Haben Sie gerade gesungen?«, fragte ich.
Die Frau schlug einen Akkord auf dem Keyboard an und wendete sich wieder den Schülern zu.
Sie kennt jeden Stamm am Weg, jede Schranke, jeden Steg,
jeden Bach und jeden Strauch und die Menschen kennt sie auch.
Ich beobachtete die Frau beim Singen. Nun, da ich sie noch einmal hörte, kam mir ihre Stimme bekannt vor. Ich wusste nicht, woher. Die Töne kamen so mühelos über ihre Lippen. Sie stand ganz still, als wäre sie selbst ein Instrument, und ihre Musik verwandelte dieses stickige Klassenzimmer in einen Konzertsaal mit richtig guter Akustik, und ich wusste, dass das eigentlich nicht sein konnte, aber es schien mir, als hätte ich noch nie eine Frau so singen gehört. (Ich bin ein großer Fan von Grace Bumbry.)
Nachdem sie fertig war, drehte sie sich zu mir um und erst da bemerkte ich Tränen in meinen Augen, die ich schnell wegwischte.
Ich bin niemand, der flennt.
»Du bist immer noch da.«
»Sie singen nicht schlecht«, sagte ich.
»Danke«, sagte sie und machte ein Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen, worauf einige Schüler kicherten.
Die Frau legte das Keyboard beiseite und trat auf mich zu.
»Dein Name.«
Das war keine Frage.
»Arkadia Fink. Aber Sie können mich Moll nennen.«
»Was machst du hier, Moll?«
»Hören.«
Sie sah mir zum ersten Mal in die Augen.
»Kannst du auch singen?«
»Ich werde eines Tages zu den überragenden Persönlichkeiten der Musikgeschichte zählen.«
»Ist das so?«
Natürlich glaubte sie mir nicht. Niemand glaubt mir das.
»Magst du uns eine Kostprobe geben, du überragende Persönlichkeit?«, fragte sie.
»Jetzt?«
Sie nickte.
Ich überlegte, welches Lied.
»Schiss?«
Das Wort peitschte durchs Klassenzimmer. Noch nie war ich einer Lehrerin begegnet, die ein solches Wort verwendet. Auch den Schülern ging es so. Das konnte ich hören: Einige atmeten kurz nicht.
Schiss.
Als sie das sagte, kam zum ersten Mal ein wenig Bairisch durch. Es ließ sie mehr wie ein Mann klingen. Meine Mutter gibt sich immer Mühe, nicht bairisch zu klingen. Mein Vater sagt, das sei absurd, sie ist nun mal eine Bayerin. Sein Bairisch ist das Einzige, das sie mag. Manchmal fordert meine Mutter ihn auf, es dick aufzutragen, das bringt sie zum Schmunzeln und dafür lässt sie sich dann auf seinen Schoß fallen und küsst ihn so, dass ich weggucken muss. Mein Vater versteht nicht viel von Musik. Wenn er aber für meine Mutter Bairisch spricht, kommt das am ehesten an Musik heran.
Ich sang Gehn wir im Prater.
Auch, weil ich sehen wollte, wie die Frau reagiert. Die Prandl, unsere Musiklehrerin, erlaubt uns nicht, den Kanon zu singen. Er ist nichts für Kinder, sagt sie. Ich habe sie gefragt, warum nicht. Weil er nicht schön ist, hat sie gesagt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob eine Frau, die Fingernägel kaut, immer rosa Blusen trägt und nach Hund riecht (sie hat ihren Pudel Julio getauft, nach ihrem Lieblingssänger Julio Iglesias) – ob eine solche Frau viel von Schönheit versteht.
Der Kasperl ist krank, der Bär ist verreckt
Als ich die zweite Strophe begann, setzte die Frau ein. Ich hielt inne. Sie bedeutete mir weiterzusingen.
Wir sangen gemeinsam.
Was tät ma in der Hetz drauß, in der Hetz drauß, in der Hetz drauß?
Wir sangen weiter und immer weiter. Es fühlte sich an, als würde ich mich mit der Frau unterhalten. Wir waren im Klassenzimmer in unseren Körpern. Wir waren aber auch woanders, nur in unseren Stimmen.
Die Schüler sahen mich nun anders an. Ich mag es nicht, beobachtet zu werden, doch beim Singen macht es mir nichts aus. Wenn ich singe, stimmt immer alles.
Meine Augen fühlten sich sehr blau an.
Nachdem wir ein paar Runden absolviert hatten, machte die Frau eine Handbewegung, die ich nicht kannte, bei der ich aber sofort wusste, dass ich langsamer werden und am Ende den Ton halten sollte.
Dann Schluss.
»Nicht schlecht«, sagte sie. »Schade.«
Sie war, wie sie mir erklärte, Gesangslehrerin bei einem Knabenchor und heute in unserer Schule, weil sie Nachwuchstalente suchte. Als sie den Namen des Knabenchors nannte, rief ich: »Das ist ein berühmter Chor!«
Zuhause haben wir ein paar CDs von ihm. Manchmal, wenn wir sie hören, schaue ich mir die Cover an. Die Jungs darauf tragen entweder Tracht oder schwarze Pullover und Hosen. Sie sehen sich nicht nur deswegen ähnlich. Auch wenn sie eindeutig keine Geschwister sind, erinnern mich die Bilder an Familienfotos. Alle meine vielen Freunde haben Familienfotos bei sich zuhause. Wir haben keine. Meine Mutter ist dagegen. Sie sagt, Familienfotos sind etwas für Menschen, die wollen, dass man sich nur an glückliche Momente erinnert. (Bernhardina sagt sogar, glückliche Menschen gibt es nur auf Fotos.) Auf den Familienfotos des Knabenchors sehen die Jungs sehr glücklich aus. Ich wüsste gerne, ob sie glücklich sind, weil sie in dem Chor singen, oder ob der Chor nur Kinder annimmt, die glücklich sind.
Meine Mutter hat mich einmal zu einer Aufführung des Tannhäusers mitgenommen, bei der auch Knaben vom Chor dabei waren. Mein Vater ist zuhause geblieben und hat meiner Mutter noch Wochen später vorgehalten, wie teuer die Eintrittskarten für die Oper waren. Meine Mutter hatte uns Plätze in der ersten Reihe besorgt, wo man die Schminke der Sänger riechen und den Schweiß auf ihrer Stirn sehen konnte. An einer Stelle marschierten drei Knaben quer über die Bühne. Sie trugen weiße, glitzernde Klamotten und Perücken und auf ihren Schultern einen riesigen Adler. Sie sahen aus wie kleine Götter. Meine Mutter flüsterte mir zu: »Eines Tages wirst du dort oben singen. Und dann werde ich hier sitzen und dir zuhören.«
Daran dachte ich, während die Gesangslehrerin wieder das Lied von der kleinen Eisenbahn anstimmte. Diesmal sollte die ganze Klasse mitsingen.
Ein paar Kinder beschwerten sich, dass sie den Text nicht kannten.
Die Gesangslehrerin schüttelte den Kopf.
»Singt!«, rief sie. »Singt, als würde es euch vorm Ersaufen retten!«
Darauf sangen alle, die meisten Lalala und falsch.
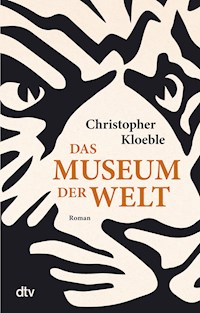
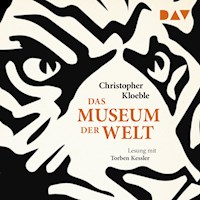
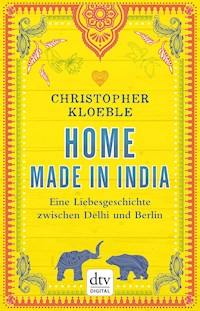
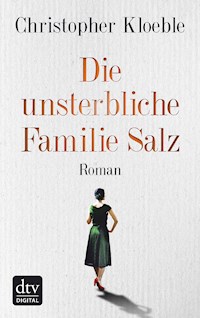
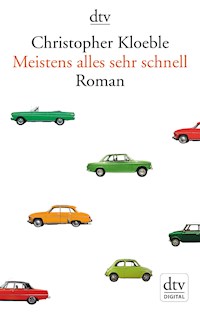













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










