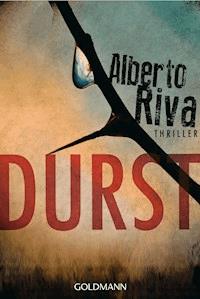
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Kampf ums Wasser hat begonnen. Und die Menschheit schwebt in höchster Gefahr ...
Sarah Clarice, die in Bahia für eine Umweltorganisation arbeitet, steht vor einem Rätsel: Ein Abschnitt des Flusses Rio Sao Francisco, der jahrzehntelang verseucht war, ist bei einem großen Säuberungsprojekt wieder nutzbar gemacht worden. Doch gleichzeitig grassiert in der Gegend eine mysteriöse Krankheit, die schon mehrere Todesopfer gefordert hat. Sarah beschließt der Sache nachzugehen und findet in dem Chemiker Matheus einen Verbündeten. Die Spuren führen die beiden zum Chef eines mächtigen Wasserkonzerns, genannt „Drago“, der Drache. Der skrupellose Machtmensch verfolgt einen wahnwitzigen Plan, der mit allen Mitteln verhindert werden muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Brasilien: Sarah Clarice, eine junge Frau, halb Brasilianerin, halb Engländerin, die in Bahia für eine Umweltorganisation arbeitet, beschäftigt sich mit einem Fall, in dem es um Wasserreserven geht. Ein Abschnitt des Flusses Rio Sao Francisco in einem Gebiet, das jahrzehntelang von Pestiziden verseucht wurde, ist bei einem großen und teuren Säuberungsprojekt der Regierung wieder nutzbar gemacht worden. Das Wasser ist sauber – angeblich. Dagegen spricht, dass Sarah Clarice Fotos von Kindern mit Missbildungen zugespielt werden, die sie nicht mehr schlafen lassen. Als mehrere Menschen an seltsamen Darmerkrankungen sterben, die sich niemand erklären kann, beschließt Sarah Clarice, der Sache nachzugehen, und sie findet einen Verbündeten: den Chemiker Matheus Braga. Bald machen die beiden eine seltsame Entdeckung: Das Wasser des Flusses ist vollkommen rein und enthält keine der üblichen Bakterien und Spurenelemente … Nach und nach wird ihnen klar, dass sie auf ein gigantisches Komplott um die begehrteste Reserve der Menschheit gestoßen sind: Wasser. Und die beiden geraten in einen erbitterten Krieg zwischen einem der größten Wasserkonzerne der Welt, dessen mysteriöser Chef unter dem Decknamen »Drago«, der Drache, bekannt und gefürchtet ist, und der größten und mächtigsten brasilianischen Wasserfirma. Und in diesem völlig wahnwitzigen Krieg werden keine Kosten gescheut − und auch keine Opfer …
Autor
Alberto Riva ist 1970 in Mailand geboren. Er ist Journalist und lebt seit 2004 in Brasilien, von wo aus er für verschiedene Zeitungen und Agenturen schreibt. »Durst« ist sein erster Roman.
Alberto Riva
Durst
Thriller
Aus dem Italienischenvon Claudia Franz
Die Originalausgabe
erschien 2011 unter dem Titel »SETE«
bei Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
1. Auflage
Taschenbuchausgabe November 2013
Copyright © der Originalausgabe 2011 by
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagbild: Eudald Castells /Partner agency / Demurez;
FinePic®, München
Redaktion: Amut Werner
LT · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-11886-0
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Mutter und meinen Vater,
diese schweigsamen Meister,
für Samira,
die brasilianische Blume,
und für Joselindo,
der in der Wüste Eis verkauft hat.
Der Dampf, den der Drache speit, verwandelt sich in eine Wolke. Die Wolke und der Drache besitzen keine übernatürlichen Kräfte, so viel scheint sicher. Und doch reitet der Drache auf der Wolke, schwebt durch den unermesslichen Himmel, spendet Licht und Schatten, entfesselt Blitz und Donner und herrscht so über den Wandel der Natur. Das Wasser, das aus dem Himmel fällt, überschwemmt Täler und Hügel. Die Wolke hat also übernatürliche Kräfte– und doch auch wieder nicht, denn es sind die Kräfte des Drachen. Woher aber hat er sie, diese Kräfte? Nicht von der Wolke jedenfalls, so viel scheint sicher. Und doch kann der Drache seine übernatürlichen Kräfte ohne sie nicht entfalten. Nur durch sie ist es ihm möglich, in Erscheinung zu treten. Der Drache ist nichts ohne die Wolke. Die Wolke aber ist ihrerseits nichts.
HANYU, Der Drache und die Wolke
Prolog
Paraná, Südbrasilien, 2001
»Was haben sie denn gesagt?«
»Dass wir gehen sollen.«
»Was?«
»Wir sollen von hier verschwinden!«
»Sind es wieder dieselben?«
»Ja. Sie sind wieder mit dem grünen Wagen gekommen.« Ulisses zeigte in Richtung der Scheinwerfer hinter sich. Dort würde in einer Stunde die Sonne aufgehen; der Himmel hatte sich bereits violett gefärbt. Der Schrei eines Vogels und das Brummen des Jeeps hatten die feuchte Luft zerrissen.
Als er sah, dass sich die Augen des alten Manuel bereits zu wütenden Schlitzen zusammenzogen, bat Ulisses seinen Vater, ruhig zu bleiben. Der Alte stand reglos da und starrte zu dem grünlichen Fleck des Jeeps. Gegen den Rat des Arztes in der Stadt hatte er sich den grauen Star nicht wegoperieren lassen. Mittlerweile sah er fast nichts mehr.
»Es reicht, wenn ich die Erde sehe. Die Erde kann ich auch noch bestellen, wenn ich blind bin. Ja, selbst wenn ich tot bin, kann ich sie noch bestellen«, wiederholte er zu jeder Gelegenheit.
Jetzt fragte er: »Was machen die hier? Warum verschwinden sie nicht?«
Ulisses schwieg. »Sie gehen gleich…«, flüsterte er dann.
Früher hätte der Vater ihn einfach stehen lassen und wäre mit erhobenem Spaten auf die Leute zumarschiert. Jetzt zitterte er und klammerte sich an sein Gerät.
Ulisses spürte die Wut in sich aufsteigen, zusammen mit der Kälte aus dem dürren Boden. Unter dem Schleier des Morgentaus reckten sich bereits die kräftigen Spitzen von Roter Beete, Möhren und Blumenkohl aus der Erde.
Grelles Scheinwerferlicht fiel auf sein Profil– das Profil eines Halbindianers–, als er nun rief: »Ihr könnt wieder gehen, wir haben verstanden! Verschwindet von hier!«
Er hatte es für seinen Vater getan, obwohl er wusste, dass Schreien nichts half.
Diese Leute kamen nun schon zum dritten Mal zum Feld. Ein Wagen blieb immer am Eingang der Fazenda stehen, schaltete die Scheinwerfer aus und behielt die Staatsstraße im Blick. Der andere durchquerte auf der unbefestigten Straße das gesamte Gelände, auf dem noch vor gar nicht langer Zeit undurchdringlicher Wald wucherte und wo jetzt, ordentlich aufgereiht, die jungen Eukalyptusbäume standen. Manuel, sein Sohn Ulisses und ein paar andere Bauern hatten diesen abgelegenen und seit Jahren nicht mehr bestellten Teil der Fazenda vor ein paar Monaten besetzt.
Der Alte rückte bedächtig seinen Hut zurecht und wollte zum Lager zurückkehren, als er plötzlich hörte, wie der Motor des Jeeps ausgeschaltet wurde.
»Geh nach Hause. Ich kümmere mich darum«, sagte sein Sohn.
Der Alte schritt aber bereits entschlossen auf den Zaun am Feldrand zu. Der Himmel war ein wenig aufgeklart. Die flachen Wolken hingen tief, aber es würde nicht regnen. Vier Männer stiegen aus dem Jeep.
Ulisses rannte los. »Papa, bleib stehen. Geh da nicht hin. Ich kümmere mich schon darum.«
Aber der Alte hörte nicht. Er war nicht nur fast blind, sondern auch praktisch taub. Und selbst wenn er etwas gehört hätte, hätte er seinem Sohn nicht gehorcht. Er hatte bereits ein paar Auseinandersetzungen mit diesen Leuten gehabt und wusste, wie man mit ihnen umging. Immerhin war das Recht auf seiner Seite. Sie durften auf diesem Land bleiben, solange das Gericht nichts Gegenteiliges entschied. Unwillkürlich nahm er den Hut ab, fuhr sich mit der Hand durchs dichte, von der Sonne gebleichte Haar und rief dann, was er in einem feierlichen Tonfall immer rief, wenn sich jemand seiner Tür näherte: »Guten Tag. Ich heiße Sie willkommen auf unserer Erde…«
Die Kugel traf ihn in die Brust. Ulisses, der ein paar Schritte weiter stand, sah, wie sein Vater in die Knie sank und schützend seinen Strohhut an den Oberkörper presste. Er weigerte sich, seinen Augen zu trauen. Vermutlich hatte der Schuss sein Ziel verfehlt, und der alte Manuel war nur aus Angst zusammengesackt. Jetzt trat der Schütze an den Alten heran und hielt ihm die Pistole an den Kopf.
»Nein! Tu das nicht, um Gottes willen«, schrie Ulisses.
Der Mann gab zwei Schüsse ab.
Nun packte Ulisses die Panik, und er rannte in Richtung Lager. Sein Herz raste. Er dachte an seine Frau Floriana und an seinen Sohn Gabriel. Und an die anderen Menschen, die mit ihnen dieses Land besetzt hielten. In den Zelten brannten schon die Lichter. Die Leute sprangen in die alten, klapprigen Fords und den total verrosteten weißen Käfer. Auch im Lieferwagen, mit dem sie sonst die Kartoffelsäcke in die Stadt brachten, drängten sich bereits die Landarbeiter.
Alle hatten die Schüsse gehört, und sie hatten verstanden. Vollkommen außer Atem stürzte Ulisses in sein Zelt. Floriana stand da und hielt das weinende Baby im Arm.
»Wir müssen fort. Beeil dich!« Er spuckte sauren Speichel aus.
Dann bückte er sich und kramte unter dem Bett nach der Blechdose. Floriana blieb reglos stehen; Gabriel schrie. Durch den offenen Zelteingang sah Ulisses, dass sich der Jeep dem Lager näherte.
»Herrgott, nun beeil dich doch! Versteck das Kind«, schrie er seine Frau an.
Floriana aber stand bloß da und schaute ihm zu.
Dieses Mal waren es nur zwei Männer. Reglos standen sie vor ihrem Zelt.
Floriana legte das Kind, das sie in ein Geschirrtuch gewickelt hatte, auf den nackten Fußboden und bekreuzigte sich.
Fünf Jahre später
Erster Teil – Atemübungen
1
Die Hunde.
Sie hörte Hundegebell und dachte unweigerlich an eine Stadt.
Stadt war allerdings nicht das richtige Wort für das, was sie erwartete.
Nelson hatte ausdrücklich gesagt: »Du musst vor Anbruch der Dunkelheit zurück sein.«
Die Dunkelheit war aber ohne Vorwarnung hereingebrochen.
Sarah Clarice hatte immer noch den Hut auf, obwohl die Sonne schon vor über einer Stunde untergegangen war. Mit schweren Schritten schleppte sie sich über die rote Erde, die Hände zu Fäusten geballt. Irgendwann erblickte sie eine Ansammlung von schachtelartigen Umrissen: Häuser. Eine schwarze Silhouette vor dem abweisenden Dunkelblau des Himmels. Sie war mittlerweile schon seit Stunden unterwegs. Ohne es zu wissen, hatten die Hunde sie geleitet. Plötzlich sah sie weißes Scheinwerferlicht und hielt an. Wie irre Glühwürmchen huschten die Scheinwerfer hin und her und wurden allmählich größer. Sarah Clarice fuhr sich mit der Zunge über die trockenen, staubbedeckten Lippen. Vor ihr tauchte ein auberginefarbener Passat auf.
Sie atmete tief durch.
Nelson hatte einige Mühe, ihre Fäuste zu öffnen. Sie rührte sich nicht. Eigentlich hätte sie ihn gerne um Entschuldigung gebeten, aber sie schwieg. Das Ganze kam ihr total absurd vor, als wäre sie die letzte Vollidiotin.
»Was hatte ich gesagt? Und warum hast du so lange gebraucht?«
»Ich habe die Entfernung unterschätzt.« Dann brachte sie es doch über die Lippen. »Entschuldigung.«
Nelson lächelte. »Scheiße, Sarah. Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Es ist meine Schuld.«
Nelson ließ ihre Hände los.
»Du bist doch wohl nicht zu Fuß von São Pedro gekommen?« Die Antwort kannte er bereits.
Sie nahm den Hut ab. Nelson konnte sich kaum vorstellen, wie ihre Mähne darunter Platz gefunden haben sollte.
»Hast du Wasser?«
»Das Wasser ist alle. Ich habe Cachaça, wenn du magst.«
»Damit kann ich mir wenigstens die Lippen befeuchten.«
»Komm.« Nelson ging zum Wagen.
Sobald sie saß, nahm Sarah Clarice einen großen Schluck aus der Cachaça-Flasche.
Nelson ließ den Motor an. »Trink nicht zu viel von dem Zeug. Das ist stark.«
»Ich weiß, aber ich bin vollkommen ausgetrocknet.«
»Wie viele Kilometer bist du gelaufen?«
»Weiß nicht. Viele.«
»Herrgott, Sarah. Hat es sich wenigstens gelohnt?«
Die Frau lächelte, als sie ihm die Flasche zurückgab. Sie nahm ihren grünen Rucksack mit den schwarzen Nähten, stellte ihn auf ihre nackten Knie und holte eine Nikon D70 heraus. Schnell drückte sie auf den Tasten am Display herum.
»Hier«, sagte sie und reichte Nelson die Kamera. »Entscheide selbst, ob es sich gelohnt hat…«
»Warte, ich brauche erst meine Brille.« Nelson beugte sich zum Handschuhfach vor, holte eine elegante Brille heraus und setzte sie auf. Dann nahm er die Kamera. Sarah Clarice betrachtete ihn. Er hatte ein schönes, ausdrucksstarkes Gesicht mit einem dunklen Bart. Seine mandelförmigen Augen starrten auf das Display.
»Wie komme ich zum nächsten Bild?«
»Mit diesen beiden Tasten hier. Vor und zurück.«
Sarah Clarice wartete gespannt, die Lippen leicht geöffnet. Sie hatte immer noch Durst, wollte sich aber nicht am Cachaça betrinken. Eigentlich wollte sie sich einfach nur hinlegen und schlafen. So schnell wie möglich.
»Wo hast du die gemacht? In São Pedro?«
»Ja. Was hältst du davon?«
»Es hat sich gelohnt, würde ich sagen.«
Sarah Clarice musterte ihn, nahm ihm die Kamera dann aus der Hand und schaute aufs Display. »Warte«, sagte sie. »Du hast noch nicht alles gesehen.«
Nelsons Gesicht war angespannt. Die ganze Zeit lief der Motor.
Schnell drückte sie auf den Tasten herum und hielt ihm die Kamera dann erneut unter die Nase. »Schau dir das hier an.«
Nelson schien nicht zu begreifen, was er da sah. »Moment, ich kann nicht …« Er kniff die Augen zusammen. »Das ist doch nicht möglich. Was zum Teufel hat das zu bedeuten?«
»Er heißt Lucas und ist fünf Jahre alt. Vermutlich sollte ich besser sagen: Das war Lucas. Jede Familie hat mindestens ein, zwei Kinder, die so aussehen wie er. Dann gibt es da noch eine Frau namens Margarete. Sie hat vier Kinder. Schau mal, wie abgemagert sie ist. Egal was sie zu sich nimmt, es kommt sofort wieder raus, wie Wasser aus dem Abfluss eines Waschbeckens.«
Nelson schwieg eine Weile. Dann legte er den Fotoapparat beiseite und stellte den Motor aus.
»São Pedro, Cutumá, Valsa und Barra Quebrada liegen am weitesten vom Staudamm entfernt. In diesen Dörfern hat es meines Wissens nie Probleme mit dem Wasser gegeben, daher habe ich vor einem Jahr beschlossen, nicht mehr hinzufahren.«
»Und seither bist du nicht mehr dort gewesen?«
Nelson schüttelte den Kopf und starrte Sarah Clarice an. Hinter den Brillengläsern wirkten seine Augen runder. Einen kurzen Moment kam es ihr so vor, als wäre er in Gedanken ganz woanders. Schweigend saßen sie da. Irgendwann ließ Nelson den Motor wieder an.
»Lass uns heimfahren.«
»Okay. Kannst du mich in diese Absteige bringen? Cutupí hieß das doch, oder?«
»Du bist wohl verrückt. Ich nehme dich mit nach Hause. Du musst doch Hunger haben.«
»Ehrlich gesagt sterbe ich vor Hunger.«
»Es gibt nichts Besseres als den Reis mit Bohnen und getrocknetem Fleisch von meiner Frau.«
»Reis und Bohnen sind gut. Fleisch esse ich nicht.«
Nelson schaute sie verblüfft an. Er verließ die unbefestigte Piste und bog in eine Straße mit niedrigen Häusern ein, wo ein paar Lichter brannten. Man konnte die Sterne sehen, und die Luft war so heiß, als käme sie direkt aus dem Backofen.
»Selbst schuld, Sarah Clarice«, tadelte er sie mit einem sanften Lächeln.
Nelson Braga war achtundvierzig Jahre alt. Früher hätte man ihn einen Kreisarzt genannt, aber was genau in seinen Aufgabenbereich fiel, ließ sich nicht wirklich sagen. Außer dass er Kranke heilte natürlich, und zwar in einem Umkreis von hundert Kilometern um die Stadt Juazeiro in Bahia herum.
Wie zwei Schwestern, die sich lieben, sich gleichzeitig aber auch misstrauisch beäugen, liegen sich Juazeiro und Petrolina am Ufer des São Francisco gegenüber.
Der Fluss entspringt in der Serra da Canastra, in einer Höhe von tausendzweihundert Metern, und beschließt seine Reise nach zweitausendachthundert Kilometern im Atlantik. Brasilien ist ein seltsames Land: Innerhalb weniger hundert Kilometer weichen die tropischen Strände und die wuchernde Küstenvegetation einer gnadenlosen Wüste, durch die der Fluss über weite Strecken strömt. Die Alten dort– jene, die den Fluss liebevoll Velho Chico nennen, alter Knabe, oder sogar seinen alten indianischen Namen Oparà benutzen– pflegen zu sagen, dass er von den Dörfern und Städten an seinem Lauf zahllose Geschichten zu erzählen habe.
Nelson Braga gehörte zu jenen, die die Windungen des Flusses und das Leben an seinen Ufern bestens kannten. 1994 hatte er nach zehn Jahren als Thoraxchirurg in der Notaufnahme des Krankenhauses von Salvador da Bahia beschlossen, dass es nunmehr endgültig Zeit wäre, etwas anderes zu tun. Eigentlich war es nicht wirklich seine Entscheidung gewesen. Die Frau, mit der er damals zusammen war, hatte ihm vielmehr ein Ultimatum gestellt.
Sandra Bittencourt hatte wie Nelson in der Hauptstadt von Bahia Medizin studiert, dann in einem Kinderkrankenhaus als Ärztin angefangen und war schließlich zu einer Privatklinik gewechselt. Glücklich war sie dort nicht gewesen. 1993 hatte ihr Vater dann einen Herzinfarkt erlitten und war inmitten der Reihen von Papayabäumen auf seiner Fazenda in Juazeiro gestorben, einem gewaltigen Besitz, der neben zweitausend Landarbeitern auch noch ein paar Dutzend Agraringenieure und eine Gruppe treuer Verwalter beschäftigte. Für so treu hatte der alte Bittencourt sie jedoch nicht gehalten, dass er darauf verzichtet hätte, seiner Tochter bei einem seiner seltenen Besuche in Salvador das Versprechen abzunehmen, eines Tages, wenn er diese Erde verlassen haben würde, seinen Platz einzunehmen. Und dieser Tag war 1993 also gekommen.
Nelson hatte immer schon den Verdacht gehegt, dass sich hinter Sandras demonstrativem Desinteresse für diese ferne Aussicht eigentlich die Sehnsucht verbarg, nach Hause zurückzukehren und das zu tun, was ihre Familie seit mindestens zweihundert Jahren tat. Allzu erstaunt war er also nicht, als Sandra ihm wenige Wochen nach dem Ableben des alten Bittencourt ihre Entscheidung mitteilte.
»Das war mir längst klar. Nur nicht, wann du es mir sagen würdest.«
Sie saßen vor ihrem Garnelenreis in einem Restaurant in Rio Vermelho, dem Viertel am Meer, in dem Nelson damals wohnte. Sandra musterte ihn neugierig mit ihren hellen Augen. Irgendwann strich sie sich die blonden Haare aus dem Gesicht. »Kommst du mit?«
Nelson lächelte und fragte zurück: »Was denkst du?«
»Ich denke, du kommst mit«, sagte Sandra und leerte ihren Weißwein in einem Zug.
Sie stießen an und zogen wenige Wochen später in ein altes Bauernhaus unweit des Flusses, ein paar Kilometer von Juazeiro entfernt. Sandra übernahm die Fazenda und wählte unter den engsten Mitarbeitern ihres Vaters einen Berater und Vertrauensmann aus.
Nelson arbeitete zunächst für das Kommunalkrankenhaus von Juazeiro, stellte aber schnell fest, dass es eher eine Schlangengrube als eine Heilanstalt war. Nach ein paar Wochen bekam er einen Anruf von einem gewissen Doktor Kosinski, der sich als Leiter einer öffentlichen Praxis an der Peripherie der Stadt vorstellte. Als sich Nelson am nächsten Tag dorthin begab, traf er auf einen hageren älteren Herrn in einem schmuddeligen weißen Kittel. Kosinski war gebürtiger Pole, hatte jedoch die brasilianische Staatsangehörigkeit. Sein Gesicht war eingefallen und unrasiert, aber seine Augen strahlten in einem intensiven Blau.
Er kam sofort zur Sache. »Ich brauche einen Wanderarzt.«
»Einen was?«
»Einen Arzt, der zu den Patienten fährt. Haben Sie ein Auto?«
Mit diesem Angebot hätte Nelson im Leben nicht gerechnet. Außerdem besaß er kein Auto. Allerdings hatten sie zusammen mit dem Bauernhaus einen alten auberginefarbenen VW Passat geerbt. »Einen Wagen hätte ich vielleicht…«, sagte er.
»Gut«, erklärte Kosinski. »Wenn Sie mögen, können Sie sofort anfangen.«
Nelson erwiderte, dass sie ja noch nicht einmal darüber geredet hätten, was genau seine Aufgaben wären.
Kosinski wirkte leicht gereizt. »Es geht darum, Kranke zu heilen. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie ungefähr zehn Jahre in der Notaufnahme des Krankenhauses von Salvador gearbeitet. Das dürfte kein leichter Job gewesen sein.«
Nelson nickte wortlos.
»Nun, das hier ist genau dasselbe. Nur dass Sie jetzt nicht darauf warten, dass die Patienten zur Tür hereinspaziert kommen, sondern gleich zu ihnen nach Hause fahren. Oder an ihren Arbeitsplatz.«
»Verstehe.«
»Dann sind wir uns also einig?«
Während er sprach, schaute Kosinski aus dem Fenster in den blauen Himmel mit den flachen weißen Wolken.
Nelson erklärte, er freue sich auf die Arbeit.
»Warten Sie, bis Sie unsere Patienten sehen, und sagen Sie mir dann, ob Sie sich immer noch freuen.«
Nelson beschloss, das Spielchen des Polen mitzuspielen. »Und wer sind unsere Patienten?«
Kosinski zündete sich eine Zigarette an und hielt Nelson die Schachtel hin. Der lehnte ab.
Qualm trat aus Kosinskis Mund, als er nach einem tiefen Zug antwortete: »In erster Linie Landarbeiter, Bauern oder Tagelöhner, die auf den großen Farmen angestellt sind. Und Heerscharen von schwangeren Frauen.«
Bald verbrachte Nelson viele Stunden des Tages in seinem auberginefarbenen Passat. Und legte Dutzende von Kilometern zurück. In den Zweizimmerwohnungen der Peripherie von Juazeiro untersuchte er alte Asthmatiker, schwangere Frauen und fiebernde Kinder. Schnell war ihm allerdings klar, dass diese Kranken gegenüber den Patienten in den großen Agrarbetrieben nur einen Bruchteil ausmachten. Und dass er es mit den typischen Problemen von Landarbeitern zu tun bekam: mit Wunden, die sie sich an rostigen Arbeitsgeräten zugezogen hatten, rheumatischen Erkrankungen, Augenentzündungen und Atemwegsinfektionen, die sie dem Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln und anderen chemischen Substanzen verdankten. Dazu kamen Hauterkrankungen, üble Schwellungen, nie gesehene und oft unheilbare Tumore, die viel zu spät entfernt wurden. Natürlich betreute er auch die Arbeiter der Fazenda jener Frau, die inzwischen seine Gattin war: Nelson und Sandra hatten im Juni 1998 standesamtlich geheiratet. Trotz hartnäckigster Bemühungen hatten sie allerdings keine Kinder bekommen.
Nelson wurde schnell klar, dass viele Dörfer nicht einmal eine provisorische medizinische Praxis besaßen. Deshalb verließ er die Stadtgrenzen oft und fuhr die lange staubige Straße am Ufer des Flusses entlang. Die Siedlung Sobradinho, sein Ziel, war für jene errichtet worden, die zwischen 1972 und 1979 den gleichnamigen Staudamm gebaut hatten, den größten am Fluss. In Sobradinho gab es zwar so etwas wie ein Krankenhaus, aber es wurden ausschließlich die Mitarbeiter des Wasserkraftwerks behandelt. Alle anderen konnten sehen, wo sie blieben.
Die Stadt bestand aus niedrigen Häusern, einem Gitter staubiger Straßen und zwei asphaltierten Trassen von ein paar Kilometern Länge. Auf dieser Höhe war der zuvor aufgestaute Fluss nur noch ein trauriges Rinnsal. Man konnte auf den schlammigen Grund sehen, der von einer dünnen, grünlichen Algenschicht bedeckt war. Die Holzkanus der Fischer lagen im Schlick. Zusammen mit dem Wasser waren auch die Fische verschwunden, und die Fischer waren gezwungen, sich als Tagelöhner zu verdingen. Die Dörfer waren geschrumpft oder ihre Bewohner weiter nach Norden, in die Nähe der großen Fazendas, umgesiedelt, wo der Wasserstand noch höher war.
Gegen Ende der Neunzigerjahre sah sich Nelson plötzlich mit der Aufgabe konfrontiert, die Dörfer am Flussufer mitversorgen zu müssen, vor allem in der Gegend um Cabobró und Barra Quebrada herum. Zu den alten Problemen wie der Kropfbildung, die von der Mangelernährung herrührte, waren neue Krankheitsbilder gekommen, die sich der schlechten Wasserqualität verdankten. Zwei schwere Choleraepidemien brachen aus und forderten Dutzende von Toten– vor allem kleine Kinder. An manchen Stellen erreichte der Fluss einen gefährlichen Tiefststand, der Sauerstoffgehalt nahm ab, und die Fische starben. Trotzdem wurde das Wasser noch für die sanitären Einrichtungen und zum Kochen benutzt. Für ihre Felder legten die Bauern artesische Brunnen an, deren Wasser jedoch vom Dünger und den Unkrautvernichtungsmitteln der großen Agrarbetriebe belastet war.
Nelson bekämpfte die Folgen und kümmerte sich nicht weiter um die Ursachen. Er verabreichte Antibiotika, behandelte Hautgeschwulste und erteilte– oft vergeblich– Ratschläge, um den Menschen das Leben mit einem chronischen Husten zu erleichtern. Daneben musste er erfahren, wie mühselig es war, sich mit den abgelegenen Gemeinden auseinanderzusetzen und träge Amtspersonen dazu zu bewegen, einen Lastwagen mit Trinkwasser loszuschicken, um die Zisternen, die inmitten der Wildnis wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, auffüllen zu lassen. Die Zisternen waren seit Monaten leer, da offenbar das Wasserverteilungsprogramm nicht umgesetzt wurde. Bei sengender Sonne und siebenunddreißig Grad im Schatten stand Nelson dann neben seinem auberginefarbenen Passat– das schweißnasse Hemd klebte ihm am Rücken– und verfolgte die kostenlose Wasserausgabe an die Frauen, Kinder und Alten, die mit ihren Eimern Schlange standen.
Ohne es zu merken, wurde Nelson immer mehr zum Vermittler zwischen den abgelegenen Gemeinden und dem SUS, dem brasilianischen Gesundheitssystem, das zwar eigentlich in staatlichen Händen liegen sollte, tatsächlich aber von den Interessen der Kommunen gesteuert wurde. Wenn die Mittel– wie in den meisten Fällen– nicht am Ziel ankamen, dann nicht, weil keine Gelder bewilligt worden wären, sondern weil sie unterwegs irgendwo versickerten. Sobradinho war der eklatanteste Fall. Dank der Erträge aus der Stromerzeugung hätte es der Stadt in diesem trostlosen Hinterland von Bahia blendend gehen müssen. Tatsächlich aber legte die Kommunalverwaltung immer nur rote Zahlen vor. Unter den ausufernden Diskussionen mit Politikern und lokalen Beamten, weil irgendwelche Projekte einfach nicht in Gang kommen wollten, litt schließlich sogar Nelsons eigentliche Arbeit. Er wurde zu einer Art Kontrolleur, ohne über die nötigen Kontrollinstrumente zu verfügen. Sein Name fiel nicht mehr nur in den Dörfern, sondern auch in Juazeiro und sogar in Salvador, allerdings in vielen Fällen nicht gerade mit Begeisterungsstürmen verbunden.
Im Jahr 2002 wurde er aufgefordert, als Abgeordneter für eine Partei zu kandidieren, von der er noch nie etwas gehört hatte. Nachdem er mit Sandra herzlich darüber gelacht hatte, lehnte er das Angebot ab und beschloss, die Dinge fortan etwas leichter zu nehmen. Er war müde und hatte das Gefühl, dass tief im Innern seiner Existenz irgendetwas nicht stimmte. Deshalb kehrte er zu seinen angestammten Kranken zurück und konzentrierte sich ausschließlich auf die Fazendas um Juazeiro herum. An Arbeit mangelte es nicht. Sandra hatte aus dem Unternehmen ihres Vaters mittlerweile einen der weltgrößten Obstexporteure gemacht– für eine Fazenda, die mitten im trockenen Bahia lag, war das eine beachtliche Leistung.
Eines Morgens im Mai 2006, als er gerade mit seinem auberginefarbenen Passat das Grundstück ihres Bauernhauses verlassen wollte, klingelte Nelsons Handy. Am Himmel hingen schwere sandfarbene Wolken.
»Ja?«
»Hier ist Kosinski. Kannst du sprechen?«
»Hallo, Kosinski.« Nelson nahm den Fuß vom Gas. »Klar, schieß los. Ich sitze im Auto.«
»Das ist ja mal was ganz Neues«, witzelte der Pole und sagte dann: »Hier ist eine Person, die mit dir sprechen möchte.«
»Mit mir? Wer denn?«
»Eine junge Frau aus Salvador, Sarah Soundso. Aber es wäre vielleicht besser, wenn du persönlich mit ihr reden würdest. Kannst du kurz vorbeischauen?«
Nelson hielt den Wagen an.
»Okay«, sagte er widerstrebend. »Ich komme.«
Als Nelson die Praxis betrat, blieb Doktor Kosinski sitzen. An seiner Unterlippe hing die obligatorische Zigarette. Er hob die Hand zum Gruß und zeigte dann auf die junge Frau, die vor ihm saß. Sie begrüßten sich. Nelson hasste den Qualm, der sich in der ganzen Praxis festsetzte, und sagte zu der Frau: »Hier in der Nähe ist ein Café. Was halten Sie davon, wenn wir uns dort unterhalten?«
»Okay.«
Sarah Clarice bestellte einen Acai-Saft mit Banane und Getreide, Nelson einen Mate-Eistee. Er trank einen Schluck und lehnte sich dann zurück.
»Also, schießen Sie los. Was kann ich für Sie tun?«
Sarah Clarice erzählte, dass sie in Salvador für eine internationale Nichtregierungsorganisation namens Health Scanner arbeitete. Health Scanner befasste sich mit Gesundheitsfragen und nahm einschlägige staatliche Projekte unter die Lupe.
Nelson betrachtet Sarah Clarice. Sie trug ein weißes T-Shirt mit einer aufreizend geschminkten gelb-grünen Kuh auf der Brust. Darunter stand: SCHÖN, DASSICHDIRGEFALLE, ABERMUSSDASJEDERMITBEKOMMEN?
»Zurzeit beschäftigen wir uns mit den Reinigungsmaßnahmen, die am Staubecken von Sobradinho durchgeführt wurden. Wissen Sie etwas darüber?«
Nelson trank einen Schluck Tee. »Ich habe davon gehört.«
Sarah Clarice zögerte unmerklich, bevor sie weiterredete.
»Gut. Wie Sie vermutlich wissen, hat das Projekt weit über ein Jahr gedauert. Der Rückgang der Flussfauna und die aberwitzige Zahl von Vergiftungen– auch schweren Vergiftungen– alarmierten die staatlichen Behörden. Irgendjemand hat auf den Tisch gehauen, worauf man sich an die Aufklärungsarbeit gemacht hat. Dann wurde in ganz großem Stil an der Wasserqualität gearbeitet. Das Ganze hat ein Wahnsinnsgeld gekostet, wie Sie sich vermutlich vorstellen können. Allein die Kosten für die Wasseraufbereitungsanlage made in Japan …«
»Ich kenne die Geschichte«, unterbrach Nelson sie.
»Wir wollen herausfinden, was tatsächlich gemacht wurde.«
»Verstehe, aber warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir?« Nelson schaute sie immer noch an.
»Irre ich mich, oder habe ich vorhin eine gewisse Ironie herausgehört, als Sie sagten, Sie hätten von der Sache gehört?«, erkundigte sich Sarah Clarice.
»Sie irren sich nicht.«
»Darf ich nach den Gründen fragen?«
Nelson lächelte. »Ich habe von diesen Maßnahmen in erster Linie gehört, denn nach dem zu urteilen, was ich bei meinen Fahrten sehe, habe ich nicht den Eindruck, dass sich seitdem irgendetwas gebessert hätte.«
»Aha! Dann liegen wir also richtig.«
»Falls Sie mir das erklären könnten…«
»Wir gehen davon aus, dass gar keine Reinigungsmaßnahmen stattgefunden haben.«
Nelson hatte in den vergangenen zehn Jahren schon viel erlebt, aber diese Behauptung verblüffte ihn dann doch.
»Wir wissen es nicht genau, aber aus den Krankenberichten, die uns aus Sobradinho und aus den Krankenstationen der Provinz Juazeiro erreichen, könnte man den Schluss ziehen, dass das Wasser im Staubecken immer noch stark verunreinigt ist, um es vorsichtig auszudrücken.«
»Würde mich nicht überraschen«, erklärte Nelson.
»Also bin ich zu Ihnen gekommen, weil ich gehört habe, dass Sie diese Orte besser kennen als jeder andere.«
»Wer hat das gesagt?«
»Jemand aus den oberen Etagen des Krankenhauses von Juazeiro.«
Nelson schaute sie verblüfft an.
Sarah Clarice beeilte sich, die Sache richtigzustellen. »Ursprünglich hat man mich zu Kosinski geschickt, und der hat dann Sie ins Spiel gebracht. Da bin ich also.«
Nelson musterte sie noch eindringlicher. Wie alt sie wohl sein mochte? Fünfundzwanzig? Sie sprach mit leicht bahianischem Akzent– offenbar hatte sie nicht immer in Salvador gelebt. Vielleicht war sie im Ausland gewesen?
»Was gedenken Sie und Ihre Leute zu tun?«
»Wir würden uns gerne selbst einen Eindruck von der Situation verschaffen.«
»Mhm.«
»Ich dachte, dass Sie mich vielleicht in die Dörfer begleiten könnten, um die Leute dort zu befragen.«
»Kein Problem. Dann sollten wir uns aber duzen.«
Am nächsten Morgen ließ sich Sarah Clarice am Busbahnhof von Juazeiro abholen. Sie hatte ihr Haar mit einem giftgrünen Tuch zusammengebunden und trug ein weißes T-Shirt, weite Bermudashorts und Wanderschuhe. Außerdem hatte sie einen prall gefüllten Rucksack auf dem Rücken.
In weniger als einer Stunde erreichten sie Sobradinho, obwohl der Passat alle zwei Kilometer drohte, endgültig den Geist aufzugeben. Während der Fahrt sprachen sie nicht viel. Sie hatten die Fenster heruntergekurbelt, und der Lärm war ohrenbetäubend.
»Wie lange lebst du schon hier?«, rief Sarah Clarice irgendwann.
»Ungefähr zehn Jahre«, antwortete Nelson.
»Und wo hast du vorher gewohnt?«
»In Salvador.«
Nelson schien keinen gesteigerten Wert auf Smalltalk zu legen.
»Wieso bist du aus Salvador weggegangen?«
»Wegen meiner Frau. Sie ist von hier. Sie musste zurück, und da bin ich eben mitgekommen.«
Auf der Straße war fast niemand. Manchmal überholten sie einen Obstlaster, gelegentlich auch einen Karren mit Tagelöhnern. Nelsons Passat war eine Art Praxis auf Rädern. Auf dem Rücksitz lagen sein schwarzes Köfferchen und etliche Medikamentenschachteln. Vor der Rückscheibe stapelten sich Papiere, daneben lagen zwei durchsichtige Plastiktüten mit Gaze, Pflaster und Salben. Und zwischen dem ganzen Kram steckten überall Bücher.
Sie fuhren über die einzige Zufahrtstraße nach Sobradinho hinein. An der Hauptstraße standen ein paar zweistöckige Häuser, aber für gewöhnlich waren sie niedriger. Nacktes Mauerwerk oder bröckelnder Putz bestimmten das Bild. Viele Gebäude waren verlassen. Die Tore in den Grundstücksmauern hatte man mit Vorhängeschlössern gesichert. Jedes dritte oder vierte Haus war eine evangelikale Kirche. Die Kirchen ähnelten den anderen Gebäuden, nur dass man hinter der Tür Holzbänke oder Plastikstühle erblickte. Die im Hintergrund erkennbaren Altäre waren roh gezimmerte Holzklötze, an denen ein weiterer Plastikstuhl und ein Mikrofon standen. Ein paar Bars gab es, außerdem ein paar Stände, an denen Mangos, Papayas, Cajus, Ananas und Bananen verkauft wurden. In den Seitenstraßen mit ihrem Boden aus roter Erde sah man blau, gelb, rosa und kalkweiß getünchte Fassaden, da und dort auch eine schemenhafte Gestalt in einem dunklen Fenster. An einigen Hauswänden hatten sich die mittlerweile verblichenen Sprüche aus dem Wahlkampf von 2002 erhalten. WÄHLTLULA.
Es war noch nicht einmal neun Uhr, aber die Hitze schon brütend. Nelson fuhr jetzt langsamer. Gelegentlich grüßte ihn jemand.
Nachdem sie das Zentrum durchquert hatten, kamen sie in ein moderneres Viertel mit Einfamilienhäusern und Vorgärtchen.
»Hier wohnen die Leute, die am Staudamm arbeiten«, erklärte Nelson.
Sarah Clarice schaute aus dem Fenster und schwieg.
Sie verließen die Siedlung über eine perfekt asphaltierte Straße. Vor ihnen lag die endlose Caatinga, die typische Landschaft des Sertão.
An einem Kreisverkehr sagte Nelson: »Hier rechts geht’s zum Fluss. Wir fahren aber über den Staudamm.«
»Ist das der Staudamm?« Sarah Clarice zeigte auf eine lange Linie, die sich am Horizont verlor. »Der ist ja gewaltig.«
Nelson beschleunigte.
Der Himmel war azurblau– nicht die Spur einer Wolke war zu sehen. Links vom Staudamm wirkte der São Francisco wie ein riesiger grau-blauer See inmitten von glattgewaschenen Felsen und niedrigen grünlichen Bergen.
Sarah Clarice nahm die Eindrücke schweigend in sich auf. Das Ganze hatte etwas von einer Mondlandschaft, wurde aber vom leuchtenden Licht des Äquators eingehüllt. Die Formen hoben sich scharf von der Oberfläche ab, und die Farben waren so klar, dass sie wie gemalt wirkten. Auf der anderen Seite des Damms war der Wasserspiegel erheblich niedriger. Das Ufer war zugewuchert, und man sah Hütten und Boote, die auf dem Trockenen lagen. Irgendwo hinter dieser grünen Mauer versteckte sich Sobradinho.
Nelson fuhr schweigend weiter.
Auf der anderen Seite des Staudamms stand ein mit Bambus beladener Karren. Das davorgespannte Pferd scharrte nervös mit dem Huf. Am Straßenrand lag ein Mann. Ein anderer kniete vor ihm.
Nelson bremste vorsorglich.
»Was ist da los?« Sarah Clarice beugte sich zur Windschutzscheibe vor, um besser sehen zu können.
»Keine Ahnung.« Nelson brachte den Passat zum Stehen. Dann öffnete er die Tür und stieg aus. »Du bleibst im Wagen«, befahl er.
Soweit Sarah Clarice verstand, kannte Nelson diese Leute. Der kniende Typ erhob sich und verfolgte jede Bewegung des Arztes. Irgendwann holte Nelson einen Kanister aus dem Kofferraum, schüttete dem liegenden Mann etwas Wasser über den Kopf und reichte ihm dann ein Glas Wasser zum Trinken. Der Mann stützte sich auf die Ellbogen und lächelte. Der andere klopfte Nelson auf die Schulter.
Sie fuhren weiter.
»Kanntest du die Leute?«, fragte Sarah Clarice.
»Ja. Die beiden kommen aus Casa Nova, einem Dorf hier in der Gegend. Sie wollen in Sobradinho Bambus verkaufen. Casa Nova ist eines der Dörfer, die evakuiert wurden, als man den Stausee volllaufen ließ. Aber du kannst dir ja gleich selbst einen Eindruck von der Lage verschaffen.«
In den nächsten Stunden besuchten Nelson und Sarah Clarice fünf Dörfer und fanden überall die gleiche Situation vor: Es herrschte bittere Armut. Nelson wusste bereits, was ihn erwartete. Dennoch überraschte ihn das Ausmaß an Magen-Darm-Infektionen und offenkundiger Unterernährung. Vor allem Frauen waren betroffen. In diesen Dörfern hatten Fischer gelebt, die jetzt dazu übergegangen waren, Maniok und Obst anzubauen. Die reichsten unter ihnen hatten Stacheldraht um vier in den Boden gerammte Pfähle gespannt, um Ziegen und Schweine zu halten.
Sarah Clarice sprach mit vielen Bauern und Frauen. In ihrem Heft und mit ihrem Aufnahmegerät hielt sie etliche Fälle von plötzlichen Fehlgeburten im vierten und fünften Schwangerschaftsmonat fest. Nelson war schon seit mindestens einem Jahr nicht mehr in der Gegend gewesen und wurde das Gefühl nicht los, dass sich die Lage inzwischen verschlimmert hatte.
In Areia Branca lebte man noch vom Fisch. Außer ein paar Mandelbäumen und wenigen Caju-Bäumen, die ein paar Säcke Cashew-Kerne abwarfen, besaßen die Menschen dort fast keine Nutzpflanzen. Sämtliche Versuche, etwas auszusäen, Wasser- oder Honigmelonen etwa, waren kläglich gescheitert. Viehzucht könne man erst recht vergessen, erklärte ihnen ein Mann um die fünfzig, der seinen Cowboyhut an den Ohren heruntergeklappt hatte. Er musste der Dorfoberste sein.
Ein paar Ziegen, Kälber und Schweine hätten sie gehabt, aber die seien mittlerweile alle tot. »Würmer«, sagte er mit starrem Blick, als Sarah Clarice nach dem Grund fragte. »Sie haben das Wasser aus dem Fluss getrunken«, erklärte er und zeigte auf einen Trampelpfad, der zwischen dürren Büschen hindurch aus dem Dorfzentrum hinausführte.
»Und was trinken Sie selbst?«
»Wir trinken das Wasser aus dem Brunnen. Wir kochen es vorher allerdings ab. Nach den Reinigungsmaßnahmen hat man uns mitgeteilt, dass es mit dem Wasser keine Probleme mehr gebe, aber wir trauen denen nicht.«
»Haben Sie denn etwas von den Reinigungsmaßnahmen bemerkt?« Beim Reden stellte sich Sarah Clarice in den Schatten eines Mangobaums. Obwohl es schon nach vier war, brannte die Sonne erbarmungslos.
»Bemerkt? Wir haben gesehen, dass die Leute aus Juazeiro gekommen sind, um ihre Kontrollen durchzuführen. Das haben wir bemerkt. Die Tiere sind aber trotzdem gestorben. Die Ziegen. Milchziegen.«
»Vor den Reinigungsmaßnahmen, meinen Sie, oder?« Sarah Clarice schrieb etwas in ihr Heft.
»Nein, hinterher. Nachdem die mit dem Chevrolet gekommen waren, um ihre Rohre im Flussbett zu verlegen.« Sarah Clarice löste den Blick von ihrem Heft.
»Was waren das für Leute, die mit dem Chevrolet?«
»Was weiß ich? Leute von der Regierung, die erst die Reinigung gemacht haben und dann die Kontrollen. Dieselben Leute wohlgemerkt. Drei Chevrolets waren es insgesamt. Sie kamen mit den Rohren und verlegten sie im Fluss. Damit sei die Reinigung abgeschlossen, sagten sie uns, und dass die Rohre die Wasserqualität garantieren würden. Sie sagten auch, dass wir das Wasser trinken könnten und dass es jetzt sauberer sei als vorher. Ich habe denen aber nicht getraut und die Ziegen nie wieder zum Fluss gelassen. Ich bin doch nicht verrückt. Dann wurde allerdings das Brunnenwasser knapp, und Menschen und Tiere konnten nicht mehr alle aus demselben Brunnen trinken. Damals fing es auch an, dass es meiner Frau so schlecht ging.«
»Wann war das?« Sarah Clarice zog das giftgrüne Tuch aus ihrem Haar und fuhr sich damit über die verschwitzte Stirn.
»Sechs, sieben Monate wird das jetzt her sein.«
»Was hatte Ihre Frau?«
»Die Ruhr. Irgendwann hat sie nur noch vierzig Kilo gewogen.«
Nelson und Sarah Clarice sahen sich an und wussten nicht, wer die Frage stellen sollte. Sie hatten Glück, denn der Mann sagte es von sich aus.
»Gott sei Dank hat der Herr sie schnell zu sich gerufen.«
»Das tut mir leid«, sagte Sarah Clarice.
»Es war besser so«, wiederholte der Mann. »Nach dem Tod meiner Frau habe ich die Ziegen wieder an den Fluss getrieben. Sie konnten schließlich nicht ewig aus dem Brunnen trinken. Aber weiß der Teufel, was in dem Wasser war: Innerhalb weniger Wochen sind sie alle krank geworden, und eine nach der anderen ist jämmerlich verendet.«
»Und trotzdem fischen Sie weiter?«
»Was sollen wir denn machen, können Sie mir das mal sagen? Immerhin haben wir noch den Fisch. In Barra Quebrada oder São Pedro haben die Leute nicht einmal mehr das. Nur noch Gift.« Er lachte mit weit aufgerissenem Mund, in dem nur noch wenige Zähne zu sehen waren.
Sarah Clarice warf Nelson einen fragenden Blick zu.
»Barra Quebrada? São Pedro? Wo ist das?«
»Weiter im Norden«, antwortete der Arzt. »Man gelangt von der anderen Flussseite dorthin, bevor man nach Sobradinho hineinfährt. Ich komme selten in diese Orte.«
»Ich möchte dorthin.«
»Wann?«
»Gleich morgen, wenn’s geht.«
»Morgen kann ich nicht«, sagte Nelson. »Ich habe in drei Fazendas Sprechstunde.«
Nun mischte sich der Dorfoberste ein. »Es gibt einen Bus, der nach São Pedro fährt. An der Tankstelle in Sobradinho kann man zusteigen.«
Sarah Clarice klappte ihr Heft zu. »Gut. Dann dürfte das ja kein Problem sein.«
»Das mit dem Bus sollten wir aber im Vorfeld klären«, sagte Nelson und blickte zum Himmel hoch. »Bald wird es dunkel, wir machen uns also besser auf den Weg.«
Sie beschlossen, dass Sarah Clarice über Nacht in Sobradinho bleiben sollte. Dort gab es nur ein einziges Hotel– wobei die Bezeichnung ›Hotel‹ gewaltig übertrieben war. Auf dem Weg dorthin fuhren sie an der Tankstelle vorbei und fanden heraus, dass es tatsächlich einen Bus gab, der die Strecke Sobradinho–Valsa bediente. Valsa war der letzte Ort an dem Flussabschnitt, an dem auch São Pedro lag. Morgens um sieben fuhr der Bus los; abends um fünf trat er in Valsa die Rückfahrt an. Nelson und Sarah Clarice kamen überein, am nächsten Abend zu telefonieren.
Das Hotel befand sich in einem zweistöckigen Gebäude mit vergitterten Fenstern. Aus dem Eingang fiel Neonlicht auf die Straße. Nelson entschuldigte sich dafür, dass er Sarah Clarice nicht begleiten könne, und erteilte ihr einen Haufen Ratschläge.
»Danke, aber du hast mir schon sehr geholfen. Es ist alles bestens.«
»Machst du diese Arbeit schon lange?«
»Ungefähr drei Jahre.«
»Gefällt sie dir?«
»Ja, sehr.«
Er nickte langsam.
Sie stieg aus dem Passat aus, und bevor sie das Hotel betrat, winkte sie ihm noch einmal zu.
Den nächsten Tag verbrachte Nelson mit seinen ärztlichen Untersuchungen, aber in Gedanken war er bei Sarah Clarice. Um halb sechs versuchte er, sie auf dem Handy anzurufen, aber ihr Anschluss war nicht erreichbar. Als er um sieben immer noch nichts von ihr gehört hatte, machte er sich langsam Sorgen. Er rief Sandra an und erzählte es ihr.
»Schau nach, was los ist«, sagte seine Frau.
Kurz nach acht war er in Sobradinho. Er fuhr zum Hotel Cutupí, aber der Besitzer, ein Glatzkopf mit einer beachtlichen Wampe unter dem offenen Hemd, teilte ihm mit, dass die junge Frau im Morgengrauen aufgebrochen und bislang noch nicht zurückgekommen sei. Also fuhr Nelson zur Tankstelle. Niemand hatte Sarah Clarice jedoch aus dem Bus aus Valsa steigen sehen. Sein Herz schlug schneller.
Es war dumm von mir, sie alleine hinzuschicken, dachte er.
Mittlerweile war es stockduster. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er durch die Stadt und nahm die Straße nach Valsa. Nach etwa zehn Kilometern fielen die Scheinwerfer seines Passats auf eine Gestalt, die mit großen Schritten in seine Richtung kam. Als sie den gesamten rechten Rahmen der Windschutzscheibe ausfüllte, lächelte Nelson.
»Sarah Clarice isst kein Fleisch«, sagte Nelson Braga zu seiner Frau, als die in Richtung Küche ging, um den Herd anzuschalten.
»Reis und Bohnen sind wunderbar«, sagte Sarah Clarice und trat zögernd ein.
»Keine Sorge«, sagte Sandra lächelnd. »Mir fällt schon etwas ein, was ich dir anbieten kann. Du kannst dich in der Zwischenzeit frischmachen. Das hast du sicher nötig.«
Sarah Clarice nahm das Angebot an. Sandras Bad war ziemlich groß und vollständig mit weißen, hellblau gemusterten Fliesen gekachelt. Aus dem Duschkopf kam ein kräftiger Wasserstrahl, und die Temperatur war perfekt. Sie hätte selbst nicht sagen können, wie lange sie unter der Dusche stand.
Als sie in die Küche zurückkehrte, saß Nelson an einem langen Holztisch und aß getrocknetes Fleisch. Sarah Clarice bekam einen Teller mit Reis und Bohnen, in Butter gebratenem Maniok und gedünstetem Gemüse. Dann ließ Sandra die beiden allein.
Nachdem Sarah Clarice ein wenig in ihrem Essen herumgepickt hatte, schaute sie Nelson an.
»Was hältst du von den Fotos, die ich dir gezeigt habe?«
Nelson legte Messer und Gabel auf den Teller.
»Ehrlich gesagt bin ich überrascht. Nicht so sehr über den Zustand der Frau, denn diese Form von viraler Gastroenteritis ist ziemlich gravierend. Aber so etwas wie dieses Kind habe ich noch nie gesehen. Wie kann es zu solchen Verstümmelungen kommen? Ich werde dafür sorgen, dass er ins Krankenhaus von Juazeiro gebracht wird, auch wenn ich jetzt schon sagen kann, dass da nicht mehr viel zu machen ist.«
»Lucas ist nicht das einzige Kind in diesem Zustand.«
»Wie viele sind es?«
»Genau weiß ich das nicht. In São Pedro sind es jedenfalls drei. Und wie es aussieht, gibt es in Valsa auch noch ein paar. Bis dorthin bin ich aber nicht mehr gekommen.«
»Und was macht ihr in einem solchen Fall?«
»Ich schreibe einen ausführlichen Bericht, dann bringt die NGO die Sache an die Öffentlichkeit. In diesem Fall möchte ich aber sogar noch weiter gehen.«
»Inwiefern?«
»Ich halte es für wichtig, das Wasser in diesem Flussabschnitt noch einmal analysieren zu lassen, damit der Bericht vollständig ist. Das ist aber nicht ganz einfach.«
»Neue Analysen machen zu lassen?«
»Ja. Sie vor allem so machen zu lassen, dass sie amtlich sind. Ich kann ja nicht einfach zur chemischen Fakultät der Universität von Bahia gehen, wo die Analysen ursprünglich gemacht wurden, und die Leute dort bitten, das Ganze noch einmal aufzurollen. Immerhin wurden die Ergebnisse von der Regierung gebilligt. Die Sache wäre mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden.«
»Müssen die Analysen denn unbedingt amtlich sein?«
»Wie meinst du das?«
»Müssen sie unbedingt offiziell durchgeführt werden, wollte ich sagen? Reicht es nicht, wenn du den Beweis dafür hast, dass das Wasser kontaminiert ist, um das in deinen Bericht schreiben zu können?«
»Theoretisch ja. In der Praxis verliert der Bericht dann aber an Schlagkraft.«
Nelson schwieg und stand auf. Er nahm eine Flasche sehr alten Cachaça von der Anrichte und goss sich sein Glas bis zum Rand voll. Langsam nippte er daran. Im Nachbarzimmer war der Fernseher zu hören.
Sarah Clarice riss ein Stück von ihrem gebratenen Maniok ab, steckte es in den Mund und dachte laut nach. »Leicht ist das nicht. Und selbst wenn ich inoffizielle Untersuchungen in Auftrag gebe, muss ich mir sicher sein können, dass die Daten unangreifbar sind. Dazu brauche ich ein anerkanntes Labor. Es reicht nicht, irgendeinen selbsternannten Experten zu nehmen, verstehst du?«
Nelson hatte zugehört und dabei ins Dunkel jenseits des Fensters gestarrt. Nun setzte er sich wieder, als hätte er beschlossen, einen quälenden Gedanken zuzulassen.
»Vielleicht wüsste ich eine Person, die deinen Anforderungen genügen würde.«
Sarah Clarice war sofort hellwach. »Wer?«
»Mein Bruder«, sagte Nelson und presste die Lippen zusammen. »Mein Bruder Matheus ist der beste Biochemiker, der zurzeit in Brasilien herumläuft. Bliebe nur herauszufinden, ob er bereit ist, dir zu helfen.«
2
Die Wohnung, in der Matheus Braga wohnte, war zwar nicht die seiner Träume, kam dem aber schon sehr nahe. Sie war einer der Vorteile, wenn man sich für ein Leben in Ilhéus entschied. In jeder beliebigen Großstadt Brasiliens würde eine Zweizimmerwohnung mit Bad, Küche und großer Terrasse ein kleines Vermögen kosten, aber hier konnte man sich so etwas sogar mit einem kleinen Wissenschaftlergehalt leisten– zumal die Immobilienpreise damals, als er nach Ilhéus umgezogen war, noch nicht explodiert waren, wie es in den letzten Jahren, dem boomenden Tourismus sei Dank, überall an der ›Kakaoküste‹ geschah.
Es hatte ihn überrascht, wie leicht das Leben sein konnte, nachdem ihn die Bürokratie in São Paulo viele Jahre lang in den Wahnsinn getrieben hatte. Er hatte die Wohnungsanzeige in der Região gelesen, angerufen, war zu Fuß losgezogen, um sich die Wohnung anzuschauen, und hatte innerhalb weniger Tage die Schlüssel in der Tasche gehabt.
Der Umzug war problemlos gewesen, da er praktisch nichts gehabt hatte, was er mitnehmen konnte. In einem Supermarkt hatte er sich fünf Kartons besorgt: In drei packte er seine Bücher, in einen davon ausschließlich wissenschaftliche Literatur. In den vierten Karton kamen die CDs und in den fünften seine Papiere, Dokumente, Notizbücher und Fotos. Zwei Koffer mit Kleidern, zwei Rucksäcke und die Kiste mit der Stereoanlage vervollständigten das Ganze.
Geschirr, Wäsche oder Möbel hatte er nicht, das würde er alles vor Ort kaufen, beschloss er.
Während der ersten Monate blieb sein Zuhause allerdings ziemlich kahl. Die Wohnung war mit einem schlichten alten Messingdoppelbett, einem Küchentisch und drei Stühlen möbliert. Das Zimmer mit der großen Fenstertür zur Terrasse, das nach Matheus’ Vorstellung das Wohnzimmer werden sollte, stand jedoch lange leer. Gelegentlich dachte er daran, ein Sofa zu kaufen, konnte sich aber nie dazu durchringen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























