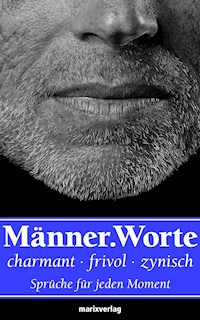30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Bestseller
- Sprache: Deutsch
Der Sophienlust Bestseller darf als ein Höhepunkt dieser Erfolgsserie angesehen werden. Denise von Schoenecker ist eine Heldinnenfigur, die in diesen schönen Romanen so richtig zum Leben erwacht. Das Kinderheim Sophienlust erfreut sich einer großen Beliebtheit und weist in den verschiedenen Ausgaben der Serie auf einen langen Erfolgsweg zurück. Denise von Schoenecker verwaltet das Erbe ihres Sohnes Nick, dem später einmal, mit Erreichen seiner Volljährigkeit, das Kinderheim Sophienlust gehören wird. E-Book 1: Hätte ich doch eine Familie E-Book 2: Ein tapferes Bubenherz E-Book 3: Ungeweinte Kindertränen E-Book 4: Ein Kind zwischen den Eltern E-Book 5: Unzertrennlich wie Schwestern E-Book 6: Dirk, der Ausreißer E-Book 7: Bedrohtes Kinderglück E-Book 8: Mutter hat mich verlassen E-Book 9: Der Junge aus dem Moor E-Book 10: Hab Sonne im Herzen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Hätte ich doch eine Familie
Ein tapferes Bubenherz
Ungeweinte Kindertränen
Ein Kind zwischen den Eltern
Unzertrennlich wie Schwestern
Dirk, der Ausreißer
Bedrohtes Kinderglück
Mutter hat mich verlassen
Der Junge aus dem Moor
Hab Sonne im Herzen
Sophienlust Bestseller – Staffel 14 –E-Book 131-140
Diverse Autoren
Hätte ich doch eine Familie
Roman von Swoboda, Elisabeth
Fröhlich vor sich hin pfeifend betrat Sascha von Schoenecker die Bankfiliale in Heidelberg, bei der er sein Konto hatte. Eigentlich hatte er keinen Grund zur Fröhlichkeit, denn er hatte in letzter Zeit ziemlich viel Geld verbraucht, ohne recht zu wissen, wo es geblieben war. Aber Sascha ließ sich, solange er noch etwas auf dem Konto hatte, finanzieller Probleme wegen keine grauen Haare wachsen. Das Semester ging bald zu Ende, und bis dahin würde er bei einiger Sparsamkeit schon auskommen. Dann begannen die großen Ferien. Er würde zuerst einmal seine Familie in Wildmoos aufsuchen, und später würde er vielleicht noch mit Freunden eine Campingreise machen.
Im Kassensaal der Bank herrschte wenig Betrieb, sodass Sascha sofort an die Reihe kam. Er hob einen Betrag ab, der seinen Kontostand ziemlich dezimierte, nicht jedoch seinen Optimismus. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag, da musste man einfach gut aufgelegt sein, fand Sascha. Die Bankangestellte aber, die ihm die Banknoten aushändigte, schien anderer Ansicht zu sein. Dem Studenten fiel auf, dass der schön geschwungene Mund der jungen Frau verkniffen war, während ihre grauen Augen leicht gerötet waren. Sascha warf einen Blick auf das Namensschild, das am Schalterpult stand und fragte teilnahmsvoll: »Haben Sie Kummer, Frau Kunze?«
Die junge Frau zuckte zusammen und strich eine Strähne ihres blonden Haares aus der Stirn. Sie sah Sascha nicht besonders freundlich an und entgegnete unwirsch: »Ich bin nicht Frau Kunze. Das ist ja der Jammer. Ich bin Frau Pöschek und vertrete Frau Kunze.«
»Ach so«, sagte Sascha, ein wenig verwundert über die Unfreundlichkeit der jungen Frau. »Ich wollte Ihnen nicht nahetreten. Ich hatte nur den Eindruck, dass Sie niedergeschlagen sind. Aber natürlich geht mich das nichts an.« Er nickte der jungen Frau kurz zu, verstaute das Geld in seiner Brieftasche und schickte sich an zu gehen.
»Ver…, verzeihen Sie«, sagte die Kassiererin plötzlich. »Ich wollte nicht unfreundlich sein. Es ist nur … Ach, ich würde am liebsten alles hinwerfen und davonrennen.«
»Ärger mit Ihrem Vorgesetzten?«, erkundigte sich Sascha mitfühlend.
»Ja, so könnte man es nennen«, erwiderte Gerda Pöschek und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen. Dann sah sie sich verstohlen um. Ihre Kollegin wurde von einem anderen Bankkunden in Atem gehalten, einem älteren Herrn, der sich lautstark über schlecht bearbeitete Daueraufträge beschwerte. Die Rundfunkgebühr war ihm in den letzten Monaten doppelt abgezogen worden, dafür hatte man die Miete zu überweisen vergessen, was zu Komplikationen mit dem Hausbesitzer geführt hatte.
»Und reden Sie sich ja nicht auf den Computer heraus!«, schimpfte der alte Herr.
Zwei weitere Bankangestellte eilten der bedrückten Kassiererin zu Hilfe. Niemand achtete auf Frau Pöschek und Sascha. Gerda seufzte. Es drängte sie, jemandem ihren Kummer anzuvertrauen. Sascha war ihr vollkommen fremd. Er würde ihr kaum helfen können, aber er sah so aus, als ob er ihr wenigstens zuhören würde. Trotzdem meinte sie zögernd: »Sie werden mich vielleicht für aufdringlich halten …«
»Keineswegs«, entgegnete Sascha. »Ich habe Sie ja nach dem Grund Ihres Kummers gefragt. Soll ich zum Vorstand gehen und ihm klarmachen, dass er seine Untergebenen nicht schlecht behandeln darf?«
»Um Gottes willen, nein!«, rief Gerda erschrocken aus. »Er ist nämlich vollkommen im Recht. Leider. Ich habe ihn um Urlaub gebeten, und er hat es mir abgeschlagen. Frau Kunze ist krank, und ich musste sie vertreten. Normalerweise bearbeite ich zusammen mit einer anderen Frau die Buchhaltung. Aber da Frau Kunze krank und ein weiterer Kollege im Urlaub ist, muss ich hier aushelfen.«
»Und nur deswegen regen Sie sich so auf?«, fragte Sascha erstaunt.
»Nicht nur deswegen. Ich würde so dringend zwei Wochen Urlaub brauchen. Der Kindergarten ist nämlich gestern gesperrt worden, weil Scharlach ausgebrochen ist. Unglücklicherweise hat sich auch die Erzieherin angesteckt. Man hat mir gesagt, dass es zwei Wochen dauern kann, bis man einen Ersatz für sie gefunden hat.«
»Der Kindergarten?«, fragte Sascha verwirrt. »Was haben Sie mit einem Kindergarten und einer Kindergartentante zu tun?«
»Ich habe eine kleine Tochter – Leonie«, erklärte Frau Pöschek. »Sie ist fünf Jahre alt. Da ich berufstätig bin, sind wir auf den Kindergarten angewiesen. Außer Leonie habe ich niemanden mehr – keine Verwandten. Meine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben. In den Ferien kann ich Leonie tagsüber zu den Nachbarn geben. Sie beaufsichtigen sie dann. Leider sind sie aber im Moment verreist. Alle anderen Hausparteien sind so wie ich berufstätig. Leonie ist also völlig allein im Haus. Ich bin deshalb furchtbar in Sorge. Es ist ja niemand da, an den sie sich wenden könnte, wenn …, wenn etwas passiert. Sie ist zwar für ihr Alter ziemlich selbstständig, und ich habe ihr auch die Telefonnummer von der Bank aufgeschrieben und sie auf die Wand neben dem Telefon geklebt, aber trotzdem – ich habe einfach keine Ruhe.«
»Das kann ich verstehen«, stimmte Sascha ihr zu. Er überlegte eine Weile, dann fuhr er langsam fort: »Vielleicht wüsste ich eine Möglichkeit. Aber ich will Ihnen noch nichts versprechen, bevor ich mich erkundigt habe.«
Gerda Pöschek sah den jungen Mann zweifelnd an. Er merkte es, lachte ein wenig und meinte: »Ich bin in Kinderfragen zwar kein Experte, aber möglicherweise gelingt es mir, für Ihre Tochter einen Platz ausfindig zu machen, an dem sie die vierzehn Tage sicher aufgehoben ist.« Mehr sagte er nicht. Er verabschiedete sich von Frau Pöschek und versprach, sich wieder zu melden.
Saschas nächster Weg führte ihn zu einem Postamt, von wo er nach Wildmoos telefonierte. Er hatte die Nummer von Gut Schoeneich gewählt, und sein Vater Alexander von Schoenecker hob ab. Nachdem Sascha seinen Vater beruhigt und ihm erklärt hatte, dass sein unverhoffter Anruf keineswegs etwas mit etwaigen Schwierigkeiten zu tun habe, verlangte er seine Stiefmutter zu sprechen.
»Denise ist in Sophienlust«, erwiderte Alexander.
»Danke, Vati. Dann werde ich mein Glück dort versuchen«, meinte Sascha.
Der zweite Anruf führte Sascha dann zum Ziel. Er erreichte seine Stiefmutter Denise von Schoenecker in Sophienlust, dem Kinderheim, das sie für ihren Sohn aus erster Ehe, Dominik, verwaltete. Er erzählte ihr von seinem Besuch in der Bank und der Sorge, die Frau Pöschek bedrückte.
»Du hast Geld abgehoben?«, fragte Denise. »Hast du überhaupt noch etwas auf deinem Konto?«
»Jetzt beinahe nichts mehr«, gestand Sascha.
»Soll ich Vati bitten, dass er dir …«
»Nein, danke«, unterbrach Sascha seine Stiefmutter. »Irgendwie werde ich bis zum Semesterschluss schon auskommen. Das ist im Moment nebensächlich. Ich habe dich wegen der kleinen Leonie angerufen. Wäre in Sophienlust ein Platz für sie frei? Es geht ja nur um höchstens vierzehn Tage, bis der Kindergarten wieder geöffnet wird.«
»Warum wurde er gesperrt?«, fragte Denise.
»Die Erzieherin und vermutlich auch einige Kinder haben Scharlach.«
»Scharlach!«, wiederholte Denise erschrocken. »Nein, Sascha. Wenn du mir dieses Kind nach Sophienlust bringst, werden womöglich alle anderen angesteckt.«
»Aber, Mutti, seit wann bist du so ängstlich? Leonie ist gesund, sonst würde sie im Krankenhaus liegen und ihre Mutter brauchte sich keine Sorgen darüber zu machen, dass sie den ganzen Tag über allein ist. Abgesehen davon musst du doch immer damit rechnen, dass eines der Kinder in Sophienlust krank wird. Sie können sich bei Spielkameraden anstecken, in der Schule. Überall lauert die Gefahr.«
»Das brauchst du mir nicht extra zu sagen. Das weiß ich selbst gut genug«, seufzte Denise.
»Dann nimmst du Leonie auf?«, fragte Sascha. Um Denise den Entschluss leichter zu machen, fügte er hinzu: »Stell dir einmal vor, was es bedeutet, dass dieses fünfjährige Kind den ganzen Tag über allein im Haus ist. Die Nachbarn sind verreist, alle anderen arbeiten, niemand ist zu Hause. Was ist, wenn Diebe einbrechen oder ein Gasrohr platzt? Oder wenn ein Feuer ausbricht oder …«
»Hör auf, Sascha!«, bat Denise. »Ich begreife, dass die Lage schwierig ist. Hat Frau Pöschek denn wirklich niemanden, der auf das Kind aufpassen könnte?«
»Nein, sicher nicht. Sie wäre sonst nicht so verzweifelt gewesen.«
»Gut, dann werde ich Leonie in Sophienlust aufnehmen«, entschloss sich Denise. »Frau Pöschek kann das Kind noch heute herbringen.«
Sascha sah auf seine Armbanduhr und runzelte die Stirn.
»Ich fürchte, für heute ist es schon zu spät. Da Frau Pöschek keinen Urlaub bekommt, müsste sie in der Nacht die Rückfahrt antreten. Nein, ich selbst werde Leonie morgen nach Sophienlust bringen.«
»Du? Hast du denn so viel Zeit? Ich möchte nicht, dass du eine wichtige Vorlesung versäumst.«
»Keine Angst«, beruhigte Sascha seine Stiefmutter.
Nachdem er nun alles zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte, eilte er zurück zur Bank, um der Kassiererin den Vorschlag, morgen mit Leonie nach Sophienlust zu fahren, zu unterbreiten.
Sascha hatte angenommen, dass Gerda Pöschek begeistert sein würde, aber die junge Frau zögerte anfangs. »Ein Kinderheim?«, fragte sie unsicher. »Ob sich Leonie dort wohlfühlen wird?«
»Gewiss wird sie das«, sagte Sascha. »Bisher haben sich alle Kinder in Sophienlust wohlgefühlt. Und vor allem wäre Ihre Tochter unter Aufsicht, und Sie brauchten nicht zu zittern, dass ihr etwas zustößt. Und am Wochenende können Sie Ihre Tochter besuchen und sich davon überzeugen, dass es ihr gut geht.«
Das gab den Ausschlag. »Sie sind so freundlich«, murmelte Gerda. »Und dabei kennen Sie mich und auch Leonie gar nicht. Ich …, ich hätte nicht gedacht, dass jemand so hilfsbereit sein kann.«
»Warum denn nicht?«, entgegnete Sascha. »Haben Sie bisher mit Ihren Mitmenschen nur schlechte Erfahrungen gemacht?«
Sascha hatte in einem scherzhaften Tonfall gesprochen, aber Gerdas schöne grauen Augen verdunkelten sich und nahmen einen traurigen Ausdruck an. Sie enthielt sich einer Antwort.
»Sie müssen mir noch Ihre Adresse mitteilen, damit ich Leonie morgen früh abholen kann«, erinnerte Sascha sie. »Oh – und hier sind Anschrift und Telefonnummer von Sophienlust. Am besten, Sie rufen gleich dort an, um sich zu überzeugen, dass alles stimmt, dass ich kein Schwindler bin.«
Gerda wurde rot, aber Sascha half ihr über ihre Verlegenheit hinweg, indem er lachend sagte: »Wenn ich ein Kind hätte, würde ich es auch nicht so ohne Weiteres einem Fremden anvertrauen. Außerdem wäre es gut, wenn Sie selbst mit meiner Stiefmutter sprechen und ihr einiges über Leonie erzählen würden.«
Gerda befolgte Sachas Rat und tätigte den vorgeschlagenen Anruf. Sie bedankte sich bei Denise von Schoenecker für die Bereitschaft, Leonie in Sophienlust aufzunehmen, und versprach, das Kind Sascha mitzugeben.
*
Sascha hatte befürchtet, dass Leonie ungern ihre Mutter verlassen und sich sträuben würde, mit ihm nach Wildmoos zu fahren, aber nichts dergleichen geschah. Das Kind wirkte überhaupt nicht schüchtern, sondern war aufgeweckt und zutraulich. Der Ernst ihrer Mutter fehlte Leonie. Sie hatte ein lustiges rundes Gesicht mit einem Grübchen am Kinn. Kecke Ponyfransen hingen ihr in die Stirn, und zwei blonde Schwänzchen vervollständigten das Bild eines heiteren, zufriedenen Kindes.
Sascha blieb nur so lange in Sophienlust, wie nötig war, um zu sehen, dass Leonie ein herzlicher Empfang bereitet wurde. Besonders die fünfjährige Heidi freute sich über den Neuankömmling. Leonie war nicht nur im gleichen Alter wie die lebhafte Heidi, sie hatte auch eine ähnliche Wesensart. Die beiden Mädchen fanden vom ersten Augenblick an Gefallen aneinander.
Sascha hatte nicht viel Zeit. Er stattete noch seinem Vater einen Besuch in Schoeneich ab, dann fuhr er zurück nach Heidelberg.
Abgesehen von Denises leiser Furcht, dass in Sophienlust eine Scharlachepidemie ausbrechen könnte, ergaben sich mit Leonies Aufnahme keine weiteren Probleme. Das kleine Mädchen war fröhlich, manchmal auch etwas ausgelassen, aber niemals unfolgsam. Leonie fügte sich klaglos in die Gemeinschaft der anderen Kinder ein, und diese bedauerten, dass sie nur so kurze Zeit bei ihnen bleiben würde.
»Es ist zu dumm, dass Leonie nur mehr elf Tage in Sophienlust sein kann und dann wieder weg muss«, beklagte sich Heidi einmal bei Regine Nielsen, der Kinderschwester.
»Woher weißt du, dass es genau elf Tage sind?«, fragte Schwester Regine. »Seit wann kannst du so weit zählen?«
»Ich kann noch viel weiter zählen! Bis zwanzig. Und dann kommt dreißig, vierzig, fünfzig und hundert.«
»Nach zwanzig kommt nicht dreißig, sondern einundzwanzig«, berichtigte Schwester Regine Heidis flüchtige Zählmethode.
»Von einundzwanzig hat Henrik nie etwas gesagt«, entgegnete Heidi. »Wenn wir Verstecken spielen, zähle ich immer eins, zwei …« Heidi zählte weiter bis zwanzig und ließ darauf sprunghaft dreißig folgen.
»Nein, Heidi, nach zwanzig geht es weiter: einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierund…«
»Aber Schwester Regine, das dauert viel zu lange«, jammerte Heidi. »Wenn ich so langsam zähle, rennen mir alle davon und verstecken sich so gut, dass ich sie nie finde.«
»Na ja, wenn ihr Verstecken spielt, kannst du einstweilen bei deiner Methode bleiben«, räumte die Kinderschwester ein. »Solange du noch nicht in die Schule gehst, ist das nicht so wichtig.«
»Schade, dass ich nicht zusammen mit Leonie in die Schule gehen kann«, meinte Heidi. »Ich möchte, dass Leonie immer in Sophienlust bleibt. Soll ich Tante Isi darum bitten? Wenn ich sie lange bitte, erlaubt sie es vielleicht.«
Mit Tante Isi meinte Heidi Denise von Schoenecker, die von den Kindern so angesprochen wurde. Schwester Regine lächelte über Heidis Eifer, entgegnete jedoch: »Darum geht es nicht. Wenn es notwendig wäre, würde Tante Isi Leonie gern behalten. Aber Leonie hat eine Mutti, die sie gernhat und die sie sicher nicht für immer hergeben will.«
»Wieso hat Leonie nur eine Mutti und keinen Vati?«, wollte Heidi plötzlich wissen.
»Da musst du sie schon selber fragen«, erwiderte Schwester Regine gedankenlos. »Nein, frag sie lieber nicht«, verbesserte sie sich hastig. Sie wusste, von Leonies Vater war nie die Rede gewesen. Entweder war er gestorben oder von Leonies Mutter geschieden. Schwester Regine hielt es jedenfalls für besser, dieses Thema in Leonies Gegenwart nicht zu berühren. Ob sie sich allerdings auf Heidis Diskretion würde verlassen können, bezweifelte sie.
»Leonie hat mir erzählt, dass am Samstag ihre Mutti zu Besuch kommt«, sagte Schwester Regine in dem Bestreben, Heidi von Leonies möglicherweise nicht existierendem Vater abzulenken. Das gelang ihr auch vorzüglich.
»Am Samstag?«, rief Heidi. Ihr Gesichtchen hellte sich dabei auf. »Hoffentlich kommt Leonies Mutti zum Feuerwerk zurecht!«
»Aber sicher. Das Feuerwerk findet ja erst um neun Uhr abends statt. Eigentlich ist das ein Zeitpunkt, zu dem kleine Kinder wie du und Leonie längst in ihren Betten liegen und schlafen sollten.«
Heidi riss ihre blauen Augen weit auf und warf Schwester Regine einen gleichermaßen erschrockenen wie vorwurfsvollen Blick zu. »Schla…, schlafen?«, stotterte sie. »Während alle anderen nach Maibach fahren und sich das Feuerwerk anschauen dürfen? Nein, das …, das halte ich nicht aus. Leonie und ich …, wir …, wir werden aus unseren Betten springen und zu Fuß nach Maibach laufen«, drohte sie.
»Da kämt ihr zum Feuerwerk viel zu spät«, entgegnete die Kinderschwester und bemühte sich, möglichst ernst zu bleiben.
Heidi beschloss, die Taktik zu wechseln. Sie zog ihre Mundwinkel nach unten, in der Bereitschaft, augenblicklich in Tränen auszubrechen. »Ich habe mich so auf das Feuerwerk gefreut«, sagte sie. »So lange habe ich keines gesehen. Es wird bestimmt ganz prächtig. Oh …, und …, und wenn Leonie und ich schlafen gehen müssen, muss jemand in Sophienlust bleiben und auf uns aufpassen. Ihr könnt uns nicht allein lassen. Du wirst ebenfalls daheimbleiben müssen. Dann wirst du das Feuerwerk auch nicht sehen«, schloss die Kleine rachsüchtig.
Schwester Regine lachte und schloss das Kind in ihre Arme. »Heidi! Mein dummes Kleines!«, rief sie. »Ich habe doch nur gesagt, dass ihr um neun Uhr eigentlich im Bett liegen solltet, aber von wirklich war nicht die Rede. Selbstverständlich sehen wir uns alle gemeinsam das Feuerwerk an. Am Sonntagmorgen habt ihr dann Zeit genug auszuschlafen.«
*
Samstag, am späten Vormittag, traf Gerda Pöschek in Wildmoos ein. Denise von Schoenecker fand die junge Frau recht sympathisch, wenn ihr auch die Lebhaftigkeit und Lebensfreude, die ihre Tochter auszeichnete, abging.
Denise bot Gerda Pöschek an, in einem der Gästezimmer in Sophienlust zu übernachten.
Gerda wehrte bescheiden ab. »Nein, danke, ich will Ihnen nicht zur Last fallen«, sagte sie. »Ich bin so froh und dankbar, dass Sie Leonie aufgenommen haben. Ich war nämlich vollkommen ratlos und nahe daran, meinen Arbeitsplatz zu verlassen. Das hätte eine Menge Nachteile mit sich gebracht, aber für Leonie war ich bereit, sie in Kauf zu nehmen. Ich war schon halb und halb dazu entschlossen, bis Ihr Stiefsohn als rettender Engel in der Bank erschien.«
Denise verbiss sich mit Mühe ein Lächeln. Sie hatte Sascha sehr gern und kannte seinen guten und hilfsbereiten Charakter, aber mit einem Engel hätte sie ihn trotzdem nie verglichen. Sie behielt diesen Gedanken jedoch für sich und sagte nur: »Sie würden uns nicht zur Last fallen. Sie können das Zimmer gern haben.«
»Nein, danke«, entgegnete Gerda. »Als ich durch den Ort fuhr, bin ich an einem Gasthof vorbeigekommen. Er kam mir recht nett und sauber vor. Ich bin deshalb stehen geblieben und habe mir ein Zimmer genommen.
»Ach so, wahrscheinlich meinen Sie den ›Grünen Krug‹.«
»Ja.«
»Aber zum Feuerwerk kommen Sie doch mit uns? Das werden Sie mir nicht abschlagen«, sagte Denise.
»Zu welchem Feuerwerk?«, fragte Gerda.
»In Maibach gibt es heute Abend eines«, erklärte Denise. »Die Kinder freuen sich unbändig darauf und reden seit Tagen von nichts anderem. Es handelt sich um das Sommerfest des Maibacher Turnvereins. Es findet auf dem Sportplatz statt. Wir werden alle gemeinsam mit unseren Schulbussen hinfahren. Leonie wäre gewiss sehr traurig, wenn Sie ihr verbieten würden mitzukommen.«
»Oh, ich verbiete es ihr nicht!«, rief Gerda.
»Dann fahren Sie auch mit?«
Dieses Angebot Denise von Schoeneckers nahm Gerda an. Der Entschluss dazu sollte ihr ganzes zukünftiges Leben ändern.
*
Vor dem Feuerwerk fanden Sportdarbietungen der Maibacher Turngruppen statt, denen die Kinder von Sophienlust mit schlecht verhehlter Ungeduld folgten.
»Wann kommt endlich das Feuerwerk?«, fragte Heidi immer wieder.
»Pst, schau zu, wie gut die Mädchen da unten auf dem Rasen turnen können«, sagte Schwester Regine. »An denen solltet ihr euch ein Beispiel nehmen.«
»Pah, was die können, kann ich noch lange«, prahlte Henrik, Denise von Schoeneckers neunjähriger Sohn.
»Hintereinander fünf Räder schlagen, und jedes mit tadellos gestreckten Beinen«, zweifelte Henriks sechzehnjähriger Halbbruder Nick. »Das musst du uns erst einmal vormachen.«
»Eine Kleinigkeit«, entgegnete Henrik. Als aber die gleichen Mädchen einen Salto nach dem anderen schlugen und dabei kaum den Boden zu berühren schienen, verstummte er.
Leonie saß zwischen ihrer Mutter und Heidi. Die beiden kleinen Mädchen plauderten miteinander und flüsterten sich gegenseitig Unsinn ins Ohr, worüber sie laut und herzlich lachten. Ein paar vor ihnen sitzende ältere Leute drehten sich um und maßen mit zurechtweisenden Blicken die beiden Kinder, die die Turndarbietungen so lustig fanden.
»Seid nicht so laut«, ermahnte Gerda ihre Tochter und Heidi.
»Zuschauen ist langweilig«, sagte Leonie.
»Ja. Warum dürfen wir nicht mitturnen?«, fragte Heidi.
»Weil du nicht einmal einen ordentlichen Purzelbaum zustande bringst«, erwiderte der hinter Heidi sitzende Henrik.
»Das ist nicht wahr«, wehrte sich Heidi. »Ich kann einen Purzelbaum. Soll ich es dir zeigen?«
»Nein! Nicht jetzt. Bleib sitzen!«, gebot Schwester Regine ihr. Insgeheim hatte sie befürchtet, dass die beiden Jüngsten schläfrig werden würden. Nun fragte sie sich, ob nicht Schläfrigkeit der Munterkeit, der sich die beiden erfreuten, vorzuziehen gewesen wäre.
»Kann man denen nicht sagen, dass sie aufhören sollen mit dem Turnen?«, fragte Heidi, nachdem sie eine ihr endlos vorkommende Weile stumm und brav auf die Rasenfläche hinuntergeblickt hatte. »Dann könnten sie endlich mit dem Feuerwerk beginnen.«
Zum Glück näherte sich die Turnvorführung bald ihrem Ende. Junge Mädchen schwangen meterlange bunte Bänder zu Spiralen und anderen Figuren. Es war eine Darbietung, die auch bei Heidi und Leonie Gefallen fand.
»Das möchte ich auch machen. Zu meinem Geburtstag wünsche ich mir auch so ein Band. Ein rotes«, verkündete Heidi.
»Das ist nicht so leicht, wie es aussieht«, dämpfte die Kinderschwester Heidis Enthusiasmus. »Um das zu können, müsstest du lange üben.«
»Ich werde lange üben«, erwiderte Heidi. »Darf ich mir so ein Band wünschen?«
»Hm, vielleicht fällt dir bis zu deinem Geburtstag ein dringenderer Wunsch ein«, meinte Schwester Regine. Sie hoffte es, denn vor ihrem inneren Auge war blitzartig das Bild entstanden, wie Heidi sich in ein zehn Meter langes rotes Seidenband verwickelte, sodass sie einer Mumie glich.
»Nein, mir wird nichts anderes einfa… Oh!« Heidi vergaß mit einem Schlag die bunten Bänder und sah fasziniert zum Himmel empor. Das Feuerwerk hatte begonnen.
In der nächsten halben Stunde galt die Aufmerksamkeit aller den Feuerwerkskörpern, die zum Himmel aufschossen.
»Da, da! Seht ihr? Grüne Kugeln! Und jetzt rote!«, schrie Leonie.
»Lila! Lila Sterne!«, jubelte Heidi. »Habt ihr das gesehen?«
»Ja, natürlich. Wir sind ja nicht blind«, erwiderte Henrik.
»O Nick, schau, wie wundervoll«, seufzte Pünktchen, ein ungefähr dreizehnjähriges blondes Mädchen, ergriffen. »Ich könnte ewig dasitzen und … Oh, die war besonders herrlich!«
Leider dauerte das Feuerwerk nicht ewig, sondern war für alle viel zu schnell zu Ende.
»Ist es schon aus?«, fragte Heidi, als sie merkte, dass sich die Leute rundherum von ihren Sitzen erhoben und den Ausgängen zustrebten.
»Ja, es ist schon aus«, erwiderte Pünktchen.
»Schade. Ich hätte es lieber gehabt, wenn es noch viel, viel länger gedauert hätte.«
»Nun sei nicht unbescheiden«, meinte Schwester Regine lächelnd. »Komm, gib mir deine Hand, damit ich dich in dem Gedränge nicht verliere.«
Gehorsam schob Heidi ihre kleine Hand in die der Kinderschwester. Gerda beeilte sich, Schwester Regines Beispiel zu folgen. Sie nahm ihrerseits ihre Tochter bei der Hand, um in dem allgemeinen Geschiebe nicht von ihr getrennt zu werden.
Alle Leute schienen es plötzlich ungemein eilig zu haben, den Sportplatz zu verlassen. Manche drängten die Kinder rücksichtslos zur Seite, und ein paar junge Burschen machten sich ein besonderes Vergnügen daraus, andere Leute anzurempeln.
»Lasst euch Zeit«, befahl Denises ruhige Stimme ihren Schützlingen. »Auf ein paar Minuten mehr oder weniger kommt es nicht an. Wartet lieber. Ihr wisst ja, wo unsere Busse stehen. Dort treffen wir uns. Keine Angst, wir fahren erst los, wenn alle beisammen sind.«
Diese Worte hörte Gerda noch, dann schoben sich fremde Menschen zwischen sie und die Sophienluster. Sie befand sich mit Leonie in einem wirren Knäuel, von dem sie einfach weitergeschoben wurde.
»Mutti! Mutti! Wo ist Heidi?«, fragte Leonie besorgt.
»Schwester Regine wird schon auf sie aufpassen«, beruhigte Gerda das Kind. »Und du bleibst schön bei mir.« Sie fasste Leonies Hand fester. Es war unangenehm, so im Gewühl eingekeilt zu sein. Gerda trachtete vor allem danach, Leonie nur ja nicht loszulassen.
Endlich hatten die beiden den Ausgang passiert. Das Gewühl lichtete sich. Gerda blieb stehen, um sich zu orientieren. Ja, dort links waren die Parkplätze. Dort mussten die roten Schulbusse aus Sophienlust stehen.
Gerda wandte sich abrupt nach links und stieß dabei mit einem fremden Mann zusammen. Er trat einen Schritt zurück, murmelte eine Entschuldigung und wollte an ihr vorbeieilen. Doch etwas in Gerdas Blick hielt ihn fest.
»Hans«, stammelte Gerda und streckte ihre linke Hand aus, um ihn festzuhalten. »Hans!«
»Mutti, dort sind Pünktchen und Heidi. Schnell, laufen wir hin!« Leonie zerrte an Gerdas rechter Hand und wollte ihre Mutter weiterziehen.
Unwillkürlich blickte Gerda zu dem Kind hinab, und als sie wieder aufsah, war der Mann verschwunden. Sie drehte sich um und lief einige Schritte zurück, aber da geriet sie neuerlich in einen Menschenstrom.
»Das ist die falsche Richtung. Dorthin müssen wir. Au! Ich werde zerquetscht!«, jammerte Leonie.
Gerda bückte sich und nahm das zappelnde Mädchen hoch. Dann eilte sie weiter.
»Mutti! Mutti! Wohin läufst du? Pünktchen und Heidi sind ganz woanders!«
»Sei still. Ich muss …« Gerda brach ab. Ihre Suche war sinnlos. Der Mann, mit dem sie zusammengestoßen war, war längst in dem Gewühl untergetaucht. Gerda stellte Leonie wieder auf den Boden und ging langsam mit ihr zum Parkplatz.
»Was hast du, Mutti?«, fragte Leonie, der das Verhalten ihrer Mutter merkwürdig vorkam. Doch Gerda war viel zu erregt, um antworten zu können.
Leonie gab sich jedoch nicht so leicht geschlagen. »Hat dir der Mann wehgetan? Ist er dir auf den Fuß getreten?«, fragte sie.
Gerda schüttelte nur stumm den Kopf. Dann waren die beiden bei den roten Kleinbussen angelangt, und Leonie wurde sofort von ihrer Freundin Heidi in Beschlag genommen.
»Wo wart ihr solange?«, rief Heidi ihnen entgegen. »Ihr seid die Letzten! Alle anderen sitzen schon in den Bussen. Aber ich wollte noch nicht einsteigen. Schwester Regine und ich haben auf euch gewartet.«
»Wie lieb von euch«, murmelte Gerda mechanisch.
»Ein böser Mann ist mit Mutti zusammengestoßen, und sie ist ihm nachgelaufen«, berichtete Leonie.
»So?«, fragte Schwester Regine mit hörbarem Staunen.
»Aber nein. Ich habe nur für einen Augenblick die Orientierung verloren«, sagte Gerda und wurde feuerrot, was aber infolge der schlechten Beleuchtung von niemandem bemerkt wurde.
»Marsch in den Bus mit euch!«, befahl die Kinderschwester Heidi und Leonie.
Die Kinder stiegen ein, Schwester Regine und Gerda folgten ihnen.
Während der Fahrt nach Wildmoos war keinem der Kinder das geringste Anzeichen von Schläfrigkeit anzumerken. Sie unterhielten sich aufgeräumt über die Pracht des Feuerwerks, nur Gerda saß still und schweigsam neben der Kinderschwester. Beim »Grünen Krug« hielt der Chauffeur Hermann den Bus an, um Gerda aussteigen zu lassen. Sie drückte ihrer Tochter einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn, bedankte sich fürs Mitmachen und verließ den Bus.
Dann suchte sie ihr Zimmer in dem Gasthof auf. Der Wirt und die übrigen Gäste waren ebenfalls in Maibach bei dem Sportfest gewesen. Es herrschte unter den Touristen eine ausgelassene Stimmung. Man hatte sich in den Garten gesetzt und Wein bestellt.
»Kommen Sie, Frau Pöschek. Hier ist noch ein Platz frei!«, rief eine Dame mittleren Alters Gerda zu und nahm ihre Handtasche von einem der grün gestrichenen Gartensessel.
»Nein, danke«, entgegnete Gerda. »Ich gehe zu Bett. Ich habe Kopfweh.«
»Oh, wie unangenehm. Wollen Sie eine Tablette?«, fragte die freundliche Frau.
»Nein, danke«, sagte Gerda zum zweiten Mal. »Ich habe selbst welche.«
»Na ja, dann gute Nacht«, sagte die Dame ein wenig beleidigt, was Gerda jedoch überhaupt nicht bemerkte. Es lag ihr nichts an Geselligkeit. Sie hatte jetzt nur den Wunsch allein zu sein. Beinahe fluchtartig lief sie auf ihr Zimmer, zog sich aus, wusch sich mechanisch und sank in ihr Bett.
Gerda hatte gehofft, Ruhe zu finden, aber sie irrte sich. Die Fenster gingen zum Garten hinaus, fröhliche Stimmen drangen von unten zu ihr herauf. Die lustige Runde begann zu singen.
»Dieses Gegröle ist nicht zum Aushalten«, stöhnte Gerda und zog sich die Decke über den Kopf. Sie grollte diesen Menschen da unten, die sich so heiter ihres Lebens erfreuten, während sie …
Gerda stand auf und schloss die Fenster. Jetzt war der eher unmelodische Gesang nur mehr gedämpft zu vernehmen. Trotzdem fühlte Gerda sich um keine Spur besser. Sie setzte sich an den kleinen Tisch, der sich in ihrem Zimmer befand, und stützte den Kopf in beide Hände. Als sie vorhin Kopfweh vorgeschützt hatte, hatte sie gelogen. Ihr Kopf schmerzte zwar, aber dagegen würde ihr keine Tablette helfen. Nichts würde ihr helfen.
Gerda sprang auf und lief in dem kleinen Zimmer auf und ab. Vielleicht wäre es besser gewesen, sich zu den anderen zu setzen, zu lachen und zu trinken – und zu vergessen.
Aber während sie das dachte, wusste Gerda, dass es für sie kein Vergessen gab. Sie hatte sich mit ihrem Schicksal in den letzten Jahren abgefunden gehabt. Heimlich hatte sie allerdings die Hoffnung genährt, ihrem Hans eines Tages wieder zu begegnen. Und nun war es geschehen. Auge in Auge hatten sie einander gegenübergestanden, mindestens eine Sekunde lang. Und dann hatte sie weggesehen, und er hatte die Gelegenheit genutzt, um feig die Flucht zu ergreifen.
Gerda zweifelte nicht an der Richtigkeit ihrer Wahrnehmung. Sie hätte Hand, ihren Hans, unter Millionen wiedererkannt. Die vergangenen sechs Jahre schienen wie weggewischt zu sein, und doch hatte sich so vieles seit damals verändert. Vor allem war Gerdas Mutter gestorben, und sie selbst besaß nun keinen Menschen mehr, dem sie sich rückhaltlos anvertrauen konnte.
Gerda fand in dieser Nacht wenig Schlaf, was man ihr am nächsten Tag deutlich anmerkte. Um ihre Augen lagen tiefe Schatten. Nach einem zeitig eingenommenen Frühstück ging sie nach Sophienlust, um Leonie zu besuchen.
Doch in dem Kinderheim herrschte eine ungewöhnliche Stille. Auf Gerdas verwunderte Frage teilte Schwester Regine ihr mit, dass sich die Kinder noch in ihren Zimmern aufhielten und zum Teil sogar noch schliefen.
»Es ist gestern doch ziemlich spät geworden«, meinte die Kinderschwester. »Außerdem waren die Kinder so aufgeräumt, dass es noch eine Weile dauerte, bis sie endlich ins Bett zu bringen waren. Soll ich Leonie aufwecken?«
»Nein, auf keinen Fall«, beeilte sich Gerda zu sagen.
»Ich halte es auch für besser, sie gründlich ausschlafen zu lassen«, stimmte die Kinderschwester ihr zu. »Sonst ist sie womöglich grantig und schlecht aufgelegt. Vielleicht wollen Sie sich einstweilen den Park ansehen? Sie finden dort eine Laube mit Sitzgelegenheiten. Sobald Leonie munter ist, schicke ich sie hinaus.«
Der Park von Sophienlust war wunderschön angelegt. Es gab einen Springbrunnen und einen Weiher, alten Baumbestand und blühende Sträucher, Gerda wanderte umher, nahm aber nichts von alledem wahr. Sie hatte gehofft, dass die Beschäftigung mit ihrem Kind ihr Ablenkung bringen würde, aber nun war sie erst recht wieder ihren Gedanken überlassen.
»Guten Morgen, Frau Pöschek«, schreckte eine frische Stimme sie aus ihren Grübeleien auf. Es war Nick, der mit seiner Mutter von Schoeneich kam.
»Guten Morgen«, erwiderte Gerda mechanisch.
»Wo sind denn die Kinder?«, fragte Nick. »Warum gehen Sie ganz allein hier herum?«
»Die Kinder schlafen noch. Ich warte auf Leonie«, sagte Gerda.
»Diese Schlafmützen!« Nick lachte. »Dann ist Henrik also nicht der Einzige, der noch in den Federn liegt und träumt.«
Denise, die Gerda freundlich zugenickt hat, meinte: »Wir wollen ihnen den Schlaf gönnen. Weck sie nur ja nicht auf, Nick.«
»Nein, nein«, entgegnete Nick und schlenderte auf das Haus zu.
Seine Mutter war bei Gerda stehen geblieben und musterte die junge Frau aufmerksam. »Sie sehen auch nicht besonders ausgeschlafen aus«, meinte sie. »Hatten Sie es im ›Grünen Krug‹ nicht bequem? Sie hätten doch mein Angebot annehmen sollen.«
»Ja, ich …, ich habe kaum geschlafen«, gab Gerda zu. »Aber das lag nicht am ›Grünen Krug‹«, fügte sie leise hinzu.
»Haben Sie Sorgen?«, fragte Denise hellhörig.
»Ich … Sorgen kann man es eigentlich nicht nennen«, stammelte Gerda. Dann riss sie sich zusammen und sagte: »Ich bin froh, dass ich Sie heute treffe. Ich habe mit Ihnen noch gar nicht die Kostenfrage erörtert. Ich weiß doch nicht, was ich für Leonies Aufenthalt in Sophienlust bezahlen muss …«
»Deswegen hätten Sie keine schlaflose Nacht haben müssen«, unterbrach Denise die junge Frau. »Falls Sie kein Geld dafür aufbringen können, ist das nicht so schlimm. Für mittellose Kinder sorgt eine Stiftung.«
Gerda sah Denise verständnislos an, dann rief sie: »O nein. Nein, deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Mein Verdienst als Bankangestellte ist zwar nicht gerade üppig, aber am Hungertuch nage ich nicht. Selbstverständlich werde ich für Leonie bezahlen. Nein, Geldsorgen habe ich keine«, betonte sie und seufzte.
Denise hatte den Eindruck, dass Gerda Pöschek Geldsorgen dem Kummer, der sie bedrückte, bei Weitem vorziehen würde. »Wollen Sie mir nicht sagen, weswegen Sie so niedergeschlagen sind?«, fragte Denise freundlich. Sie nahm die junge Frau beim Arm und führte sie mit sanftem Druck zu einer zierlichen weißen Gartenbank. »Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein«, sagte sie, nachdem die beiden sich gesetzt hatten, Gerda aber noch immer beharrlich schwieg.
»Ja, vielleicht könnten Sie das«, erwiderte Gerda endlich. »Sie sind hier zu Hause und kennen wahrscheinlich auch eine Menge Leute aus Maibach.«
»Eine Menge gerade nicht«, sagte Denise vorsichtig. »Spielen Sie auf jemand Bestimmtes an?«
»Ja, auf Hans. Auf Hans Binder«, stieß Gerda hervor.
Denise schüttelte den Kopf. »Nein, einen Hans Binder kenne ich nicht«, stellte sie ruhig fest.
»Aber ich habe ihn gesehen! Er stand vor mir und …, und dann war er plötzlich weg.«
»Beruhigen Sie sich. Wieso liegt ihnen denn so viel an diesem Hans Binder?«, fragte Denise.
Gerda war nicht sofort zu einer Antwort bereit. Sie sah vor sich hin, und ihre Blicke schienen einem gelben Schmetterling, der von Gänseblümchen zu Gänseblümchen gaukelte, zu gelten.
»Ich …, ich komme Ihnen wahrscheinlich sehr lächerlich und …, und dumm vor«, sagte sie schließlich stockend. »Es …, es ist alles so schwierig.«
Denise von Schoenecker war ein sehr geduldiger Mensch, aber sie hatte an diesem Tag noch Verschiedenes zu erledigen.
Deshalb sagte sie: »Ich will Sie nicht dazu drängen, sich mir anzuvertrauen. Aber sie sollen wissen, dass ich Ihr Vertrauen nicht missbrauchen würde. Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen, können Sie auf mich zählen.«
Denise wollte sich erheben, aber diese Bewegung veranlasste Gerda zu dem hastigen Ausruf: »Bitte, lassen Sie mich hier nicht allein. Ich glaube, wenn ich noch länger nachgrüble, werde ich wahnsinnig. Es klingt so …, so unglaubwürdig …«
Denise sah die junge Frau ernst an. »Was klingt unglaubwürdig?«, fragte sie.
»Alles. Meine ganze Geschichte. Es ist beinahe sechs Jahre her, dass ich Hans … kennenlernte. Er ist nämlich Leonies Vater. Sie werden mich jetzt gewiss verachten …«
»O nein, warum sollte ich?«, warf Denise ein.
»Aber wir waren nicht verheiratet, und ich wusste kaum etwas über Hans. Eigentlich wusste ich gar nichts von ihm, nur seinen Namen. Und selbst …, selbst da bin ich nicht sicher, ob es der richtige Name ist. Er kam damals nach Heidelberg, im Frühjahr, und wollte sich umsehen, weil er ab Herbst dort studieren wollte.«
Nun, da Gerda sich zum Reden entschlossen hatte, sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus und überstürzten sich. Denise spürte, dass Gerda Pöschek ihren Kummer viel zu lange in sich verschlossen und verdrängt hatte.
»Wir haben uns ineinander verliebt«, erzählte Gerda. »Gleich vom ersten Augenblick an. Es war so wundervoll. Ich war sicher, dass wir eines Tages heiraten würden. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht. Ich war fest überzeugt, dass Hans mich genauso liebte, wie ich ihn. Ich habe ihm nie Fragen gestellt, ich meine, nach seinen Eltern und seinem Zuhause und so. Dazu hatten wir auch kaum Zeit. Wir …, wir kannten uns noch nicht lange, als Hans wieder abreiste. Er hatte einen Ferienjob in England angenommen, aber …, aber er hatte mir fest versprochen, im Herbst wiederzukommen. Ich habe gewartet und gewartet, und als ich dann merkte, dass ich schwanger war … Es war schrecklich. Mama war so zornig und machte mir Vorwürfe …« Sie verstummte.
»Er ist also im Herbst nicht gekommen«, stellte Denise trocken fest.
»Nein. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.«
»Aber haben Sie, nachdem Leonie zur Welt gekommen war, nicht nach ihm geforscht? Falls er in Heidelberg inskribiert hatte …«
»Das hatte er nicht«, erwiderte Gerda tonlos. »Außer seinem Namen hatte ich keinerlei Anhaltspunkte. Nach Leonies Geburt hat sich die Fürsorgerin im Krankenhaus nach allem erkundigt. Für sie war es nur eine Routineangelegenheit, aber trotzdem habe ich ihren Spott deutlich gefühlt. Sie meinte, dass es sinnlos wäre, Leonies Vater aufspüren zu wollen. Den Namen Hans Binder gebe es doch zu Dutzenden und außerdem … Außerdem äußerte sie den Verdacht, dass er mir wahrscheinlich einen erfundenen Namen genannt habe. Die Chance wäre also gleich Null. Ich habe mich schließlich damit abgefunden. Es ist mir ja auch nichts anderes übrig geblieben«, sagte Gerda bitter.
»Und wieso sind Sie nun auf einmal davon überzeugt, dass dieser angebliche Hans Binder in Maibach wohnt?«, fragte Denise.
»Weil ich ihn gesehen habe! Ich habe es Ihnen ja schon erzählt. Er stand mir plötzlich gegenüber, mitten in dem Gedränge. Gestern, nach dem Feuerwerk. Ich habe seinen Namen gerufen, aber …, aber er ist verschwunden.«
»Vielleicht hat er Sie nicht erkannt?«
»Aber er hat mich angesehen! Zwar nur kurz, aber mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Ich … Er wollte mich nicht erkennen.«
»Und Sie? Sind Sie wirklich ganz sicher, dass er es war?«, erkundigte sich Denise.
»Aber ja!« Gestern war Gerda fest davon überzeugt gewesen, dass sie Hans Binder gesehen hatte. Doch jetzt runzelte sie die Stirn. »Er war es, er war es bestimmt«, betonte sie trotzdem. »Nur – er hat wesentlich älter ausgesehen. Aber das ist ja kein Wunder. Schließlich sind seither sechs Jahre vergangen. Damals war er einundzwanzig, jetzt müsste er siebenundzwanzig Jahre alt sein. Vielleicht …, vielleicht war es die schlechte Beleuchtung, die ihn so viel älter erscheinen ließ.«
»Hm«, sagte Denise, denn etwas anderes fiel ihr im Moment nicht ein. Gerdas Geschichte hatte tatsächlich höchst sonderbar geklungen. Soweit sie das Geschehen vor sechs Jahren betraf, glaubte Denise ihr alles, hingegen bezweifelte sie, dass Frau Pöschek gestern Leonies Vater gesehen hatte. Sie war der Meinung, dass die junge Frau einem Phantom nachjagte, von dem Wunsch beseelt, den einstigen Geliebten wiederzufinden.
Trotzdem hatte Denise von Schoenecker eine Idee. »Wenn Ihr Hans Binder in Maibach lebt, ist er vermutlich im Telefonbuch zu finden«, meinte sie. »Ich werde gleich nachschlagen.«
Mit Gerda im Schlepptau suchte Denise das Büro der Heimleiterin auf und begann im Telefonbuch zu blättern. Aber die Suche verlief ergebnislos. Es gab in Maibach keinen Hans Binder, genau wie Denise vorausgesehen hatte. Gewissenhaft schlug sie auch die Seiten auf, an denen die Orte der näheren Umgebung verzeichnet waren, mit demselben Misserfolg.
»Obwohl Binder ein relativ häufiger Name ist, scheint es in Maibach nur einen Mann dieses Namens zu geben«, sagte Denise schließlich. »Aber der heißt nicht Hans, sondern Richard, hat einen Doktortitel und ist Rechtsanwalt.«
»Ach!« Gerda wirkte mutlos und verzweifelt. »Was soll ich jetzt machen?«, fragte sie Denise hilflos.
Entgegen ihrer ursprünglichen Absicht Gerda zuzureden, die Sache auf sich beruhen zu lassen, sagte Denise: »Vielleicht sollten Sie diesen Dr. Richard Binder einmal aufsuchen. Er könnte ein Verwandter von Ihrem Hans sein.«
Gerdas Gesicht hellte sich auf. »Ja, das wäre möglich«, erwiderte sie. »Ich will auf der Stelle hingehen. Wie lautet die Adresse?«
»Heute ist Sonntag«, erinnerte Denise sie, erkannte jedoch gleichzeitig, dass es ihr nicht gelingen würde, Gerda von ihrem Vorhaben abzubringen. Obwohl sie annahm, dass Gerda eine Enttäuschung bevorstehe, hielt sie es doch für besser, wenn die junge Frau sogleich den Rechtsanwalt aufsuchte, statt eine zweite schlaflose Nacht, erfüllt von Grübeleien und fruchtlosen Vermutungen, zuzubringen.
»Sie müssten sich an seine Privatadresse wenden, denn die Kanzlei ist heute bestimmt geschlossen«, sagte Denise.
Gerda nickte. Sie schrieb sich die Adresse auf und ließ sich von Frau von Schoenecker erklären, wie sie am schnellsten dorthin kam.
*
Gerda besaß einen Wagen, dessen Baujahr etliche Zeit zurücklag, aber ihr leistete er gute Dienste. Sie fuhr damit nach Maibach, folgte dabei Denises Angaben und fand ohne Umwege das Haus des Rechtsanwaltes.
Es lag in einer stillen Straße. Die Häuser waren meist Villen aus den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts, jedoch mustergültig in Ordnung gehalten und zur Straße hin von Vorgärten abgeschirmt. Die Gegend erschien Gerda recht vornehm. Ein wenig Scheu überkam sie, sodass sie zweifelnd das gelb verputzte Haus mit den geschwungenen Erkerfenstern betrachtete. Dann aber drückte sie entschlossen auf den Klingelknopf.
Nach kurzer Zeit ertönte ein Summen. Gerda öffnete die Gartentür, trat ein und schritt auf das Haus zu, dessen Eingang sich seitlich befand. Dort stand ein Mann, offensichtlich in Erwartung des Ankömmlings. Als er Gerda erblickte, zog er unwillig die Augenbrauen zusammen.
Gerda hielt den Atem an. Es war der Mann von gestern Abend – Hans.
»Was wünschen Sie?«, erkundigte er sich nicht eben freundlich.
»Ich …, oh …, aber …, aber erkennst du mich denn nicht?«, stammelte Gerda.
»Nein, ich erkenne Sie nicht«, versetzte der Mann hart.
»Das ist nicht wahr!«, rief sie. »Ich habe dich gestern Abend auf den ersten Blick erkannt und bin sicher, dass es bei dir genauso war. Du kannst mich nicht vergessen haben, nicht, nachdem du …, nachdem wir …« Der angewiderte Blick, der in den dunklen Augen des Mannes lag, brachte Gerda zum Verstummen.
»Ach so, Sie sind die Frau, mit der ich gestern nach dem Feuerwerk unversehens zusammenstieß. Ich bin in Sie hineingerannt – das war Pech«, sagte er.
Gerda glaubte aus seiner Stimme beleidigenden Hohn herauszuhören. Nun geriet sie außer sich.
»Du …, du hast nicht das Recht, über mich zu spotten!«, rief sie mit beträchtlicher Lautstärke. »Nach allem, was du mir angetan hast!«
»Hören Sie auf, sich wie eine Verrückte zu benehmen«, entgegnete er mit unterdrückter Wut. »Ich lege nicht den geringsten Wert darauf, die Aufmerksamkeit meiner Nachbarn zu erregen. Ich kenne Sie nicht, habe Sie nicht gekannt, und ich will Sie auch nicht kennenlernen. Am besten, Sie gehen jetzt.«
»Wie kannst du nur behaupten, mich nicht zu kennen? Du …, ich hätte nie gedacht, dass du so falsch sein, und dich derart verstellen könntest. Aber vielleicht habe ich dir wirklich nichts bedeutet, während ich so töricht war, dir zu glauben und zu hoffen, dass dein Ausbleiben auf einem Missverständnis beruhte.«
»Schluss jetzt mit dem Theater!«, befahl er. »Ich begreife nicht, was sie damit bezwecken wollen. Entweder sind Sie tatsächlich verrückt, oder … soll das womöglich gar eine neue Art von Werbung sein? Sind Sie eine Vertreterin für Teppichkehrer oder so etwas Ähnliches?«
»O Hans, warum …, warum bist du nur so gemein?« Gerda schluchzte nun beinahe.
Er sah sie nachdenklich an, dann sagte er langsam: »Ich heiße nicht Hans. Sie unterliegen einem Irrtum.« Er schien noch etwas hinzufügen zu wollen, unterließ es aber.
Gerda starrte den Mann an. Ihr Eindruck von gestern Nacht stimmte. Er war älter geworden, aber es war unzweifelhaft Hans. Er war mittelgroß, wenn auch einen Kopf größer als sie. Aber das besagte nicht viel, denn sie war eher klein. Seine dunkelbraunen dichten Haare waren noch die gleichen wie damals. Kein einziges weißes Haar war dazwischen.
Nein, er kann ja gar keine weißen Haare haben, dachte Gerda plötzlich. Dazu ist er noch viel zu jung. Sein Gesicht wirkte allerdings älter als das eines siebenundzwanzigjährigen Mannes. Es wies Fältchen auf, die früher nicht dagewesen waren. Aber die Augen waren noch die gleichen wie damals. Oder doch nicht? Sie waren dunkelbraun, fast schwarz, und früher hatte ein warmer liebevoller Ausdruck in ihnen gelegen, wenn sich ihre Augen begegnet waren. Jetzt ruhte eine abweisende Kälte in ihnen, die Gerda wehtat und sie erbitterte.
»Gut, ich werde gehen«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Wenigstens hat mir mein Besuch hier Aufklärung gebracht. Ich weiß jetzt, dass du ein gewissenloser Lügner bist und es niemals aufrichtig mit mir gemeint hast.«
»Was bilden Sie sich eigentlich ein?«, fragte er mit nun ebenfalls erhobener Stimme. »Ich habe Ihnen keine Ursache gegeben, mich derartig zu beschimpfen. Sie verwechseln mich mit einem anderen.« Er zuckte mit den Schultern.
»Ich habe nun genug Geduld mit Ihnen bewiesen. Wenn Sie so weitermachen, geraten Sie in Gefahr, dass ich ungemütlich werde. Dann …« Er hielt inne und lauschte. Leichte Schritte erklangen im Inneren des Hauses und näherten sich der Tür.
»Ja, droh nur«, sagte Gerda gerade, als hinter dem Mann, den sie für Hans hielt, eine Frau erschien, die ihn zur Seite schob.
»Was ist geschehen?«, fragte die Neuangekommene. »Ich hörte streitende Stimmen.«
»Es ist nichts«, unterbrach der Mann sie hastig. »Die junge Frau hat eingesehen, dass sie einem Irrtum unterlegen ist.«
»Ich habe gar nichts eingesehen«, beharrte Gerda trotzig, und der Mann knirschte hörbar mit den Zähnen.
Die eben hinzugekommene Dame sah ihm auffallend ähnlich, nur war sie wesentlich älter als er. Ihr dunkles, duftig frisiertes Haar war von vielen grauen Strähnen durchzogen. Den Fältchen nach, die um ihre braunen Augen und um den Mund lagen, schätzte Gerda sie auf ungefähr fünfzig bis fünfundfünfzig Jahre. Später erfuhr sie, dass Barbara Binder achtundfünfzig Jahre alt war. Sie war ein wenig größer als Gerda, schlank und gut, aber nicht auffallend, mit einem lose fallenden, grünweiß gemusterten Kostüm bekleidet.
Sie musterte Gerda forschend, dann fragte sie den Mann: »Warum hast du die junge Frau nicht hereingebeten, Richard? Man diskutiert nicht zwischen Tür und Angel. Ich will nicht, dass sich die Nachbarn die Hälse ausrenken, um mitzubekommen, was bei uns Ungewöhnliches vorgeht.«
Der Mann warf einen ärgerlichen Blick zur Nachbarsvilla hinüber, wo sich tatsächlich der Vorhang an einem der Fenster bewegte. Das stimmte ihn nicht freundlicher. Er fuhr Gerda an: »Wollen Sie jetzt endlich verschwinden?«
Gerda achtete nicht auf das, was er sagte. Sie war noch mit dem Namen beschäftigt, mit dem die Frau ihn angesprochen hatte. »Richard«, wiederholte sie leise für sich. Zum ersten Mal fühlte sie sich unsicher. »Heißt …, heißen Sie wirklich Richard?«, fragte sie.
»Ja, seit meiner Taufe«, erwiderte er sarkastisch.
»Aber Hans …, Hans hat Ihnen zum Verwechseln ähnlich gesehen. Ich verstehe nicht, Sie …, Sie sind doch Hans Binder?«
»Halten Sie den Mund«, herrschte er sie an, aber es war zu spät. Das Gesicht der Frau neben ihm umschattete sich wie in einem tiefen Schmerz. Er nahm sie sanft beim Arm und sagte mit gänzlich veränderter, besorgter Stimme: »Du darfst dich nicht aufregen, Mama. Lass dich wieder ins Haus führen.«
»Und die junge Dame? Willst du sie hier einfach stehen lassen? Wie heißt sie, wer ist sie?«, fragte seine Mutter.
»Das weiß ich nicht, und es ist mir auch völlig gleichgültig. Sie will Unruhe stiften, nichts weiter.«
»O nein«, sagte Gerda leise. Sie stand vor einem Rätsel. Warum sah die Frau, offensichtlich die Mutter des Mannes, der sich Richard nannte, plötzlich so traurig aus? Warum war Richard so besorgt, dass sie sich aufregen könnte?
Richards Mutter schüttelte die Hand ihres Sohnes ab und wandte sich an Gerda. »Wollen Sie nicht hereinkommen, damit wir in Ruhe miteinander reden können? Ich bin Barbara Binder, und das ist mein Sohn Dr. Richard Binder.« Sie sah Gerda fragend an, und diese murmelte ihren Namen.
»Bitte, kommen Sie«, sagte Frau Binder noch einmal.
»Mama!«, rief Richard, aber sein Protest hatte keinen Erfolg. Gerda folgte der Einladung seiner Mutter. Sie wurde in einen großen, für ihre Begriffe recht prächtigen Raum geführt, von dessen Stuckdecke ein funkelnder Kristalllüster herabhing. Auf dem Parkettboden lag ein großer bunter Orientteppich, die Möbel waren alt und gepflegt.
Barbara Binder bat Gerda, sich zu setzen. »Sie haben vorhin Hans erwähnt«, eröffnete sie das Gespräch.
»Ja«, erwiderte Gerda und blickte sich unbehaglich um, doch Richard war den beiden nicht gefolgt.
»Sie brauchen keine Angst zu haben«, ermunterte Barbara sie. »Falls mein Sohn unfreundlich war, hat er es bestimmt nicht so gemeint.«
Gerda war anderer Ansicht, aber sie schwieg.
»Was haben Sie auf dem Herzen?«, fragte Frau Binder. Sie wirkte traurig. Gerda hatte jedoch nicht den Eindruck, dass sie ihr feindlich gesinnt sei.
»Ich, ich …, ich fürchte, ich habe mich recht töricht benommen«, sagte Gerda. »Gestern war ich bei dem Feuerwerk und nachher, beim Verlassen des Sportplatzes, bin ich in Ihren Sohn hineingerannt. Er hat sich entschuldigt, und ich … Mir blieb fast das Herz stehen. Ich war überzeugt, Hans vor mir zu haben. Es war seine Stimme, sein Gesicht, nur älter. Darüber habe ich mich nicht weiter gewundert. Es sind ja sechs Jahre vergangen, seit ich Hans zum letzten Mal sah.«
»Und wo haben Sie … Hans damals gesehen?«, fragte Frau Binder leise.
»In Heidelberg. Es war im Frühjahr. Er hatte sich in meiner Heimatstadt umgesehen, weil er ab Herbst dort studieren wollte. Im Sommer fuhr er nach England. Er hatte mir versprochen zu schreiben, aber …, aber er hat sein Versprechen nicht eingehalten.«
»Er konnte nicht«, sagte Barbara Binder tonlos.
»Wieso? Was …, was meinen Sie?«, fragte Gerda.
Barbaras braune Augen richteten sich voll auf Gerda, der unter diesem traurigen Blick bang wurde.
»Nach allem, was Sie mir gerade erzählt haben, waren Sie mit meinem jüngeren Sohn Hans befreundet«, sagte Barbara. »Er war vor sechs Jahren einige Zeit in Heidelberg und fuhr dann nach England, um dort einen Ferienjob anzunehmen. Er ist nie wieder zurückgekommen. Hans ist in der Nähe von London tödlich verunglückt.«
Gerda hatte das Gefühl, dass die Welt zusammenbreche. All die geheimen Hoffnungen, die sie gehegt hatte, waren mit einem Schlag zunichtegemacht worden. Hans war tot, sie würde ihn nie mehr wiedersehen. Bei Leonis Geburt war er schon nicht mehr am Leben gewesen. Leonie hatte ihr in den letzten beiden Jahren, seit sie verständig genug war, manchmal Fragen gestellt, und Gerda hatte ihr immer darauf geantwortet, dass ihr Vater verreist sei. Entgegen aller Vernunft hatte sie die Hoffnung, dass Leonie ihren Vater eines Tages kennenlernen würde, nicht aufgeben wollen. Damit war es nun endgültig vorbei.
»Er ist tot«, flüsterte Gerda vor sich hin.
»Ja. Sie haben ihn wohl gut gekannt? Er hat mir zwar nie von Ihnen erzählt, aber die Zeit vor seiner Abreise nach England war knapp. Er hätte es wohl später nachgeholt. Warum haben Sie nicht schon früher bei uns nach ihm gefragt?«, erkundigte sich Frau Binder.
»Ich habe nicht gewusst, dass er hier zu Hause war«, erwiderte Gerda. »Aber nachdem ich gestern mit Ihrem anderen Sohn zusammenstieß und ihn für Hans hielt, riet mir Frau von Schoenecker … Ich meine, wir sind im Telefonbuch auf den Namen Dr. Richard Binder gestoßen, und ich bin hergefahren, weil ich gedacht habe, gehofft habe …« Gerda wusste nicht weiter. Nach einer kurzen Pause sagte sie entschuldigend: »Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Ich verstehe nicht, warum mir Ihr Sohn nicht gleich die Wahrheit gesagt hat. Ich habe ihn gestern mit Hans angesprochen und heute wieder. Er hat mir aber nichts erklärt. Ich glaube, er wollte mich nur möglichst schnell loswerden.«
»Richard ist bestrebt, mir jede Aufregung zu ersparen«, erwiderte Barbara Binder. »Damals, nach dem Unglück, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Kurz vorher war mein Mann gestorben – es war einfach zu viel für mich. Richard fürchtete, dass ich einen Rückfall erleiden könnte. Er steht unter dem Eindruck, dass Hans mein Lieblingssohn war, was jedoch nicht stimmt. Ich habe beide Kinder gleich gerngehabt. Aber Hans – welche Mutter könnte ihr Kind vergessen! Ich habe mich mit seinem Tod abgefunden, aber vergessen werde ich ihn nie. Richard glaubt, dass es für mich leichter ist, wenn möglichst selten über Hans gesprochen wird, aber das ist ein Irrtum.«
»Es tut mir leid«, sagte Gerda noch einmal wie betäubt und verabschiedete sich.
Barbara sah ihr bekümmert nach. Sie hätte gern noch länger mit der jungen Frau gesprochen, wollte sie jedoch nicht zurückhalten.
*
Als Gerda nach Sophienlust zurückkam, hatte sie zumindest ihre äußere Ruhe wiedergefunden. Der Traum, dem sie sich jahrelang hingegeben hatte, war in Nichts zerstoben. Sie litt unter Hans’ Tod, aber gleichzeitig tat ihr die Gewissheit gut, dass er sie nicht treulos verlassen hatte. Sie war nun sicher, dass er sein Versprechen gehalten hätte und im Herbst zu ihr zurückgekehrt wäre. Zu dritt hätten sie ein glückliches Leben geführt, Hans, sie und Leonie. Nein, das wollte sie sich nicht ausmalen. Der Gedanke an das, was hätte sein können, schmerzte sie zu sehr.
Es war kurz vor dem Mittagessen, die Kinder waren von Schwester Regine eben aufgefordert worden, sich die Hände zu waschen. Denise sprach mit der Krankenschwester über diverse Unternehmungen, die für die nächste Woche geplant waren, aber als sie Gerda Pöschek erblickte, unterbrach sie sich und ging der jungen Frau entgegen.
»Haben Sie etwas erreicht?«, erkundigte sich Denise.
»Es ist alles aus. Er ist tot«, stieß Gerda hervor.
»Davon müssen Sie mir genauer berichten. Jetzt ist die Zeit aber zu kurz. Nach dem Essen«, sagte Denise.
Leonie begrüßte ausgelassen ihre Mutter, die sie an diesem Tag noch nicht gesehen hatte, und zog sie in den Speisesaal. »Du musst unbedingt mit uns essen, Mutti. Das Essen ist hier so gut. Wenn ich wieder bei dir bin, musst du mir auch so etwas Gutes kochen«, teilte sie ihrer Mutter mit.
Zuerst wollte Gerda sich sträuben, an der Mahlzeit teilzunehmen, aber die Kinderschwester bestätigte Leonies Einladung. Im Speisesaal bekam Gerda den Platz neben Leonie. Sie führte automatisch einen Bissen nach dem anderen zum Mund, ohne zu bemerken, was sie aß. Das Essen, das die Köchin Magda wie immer mit viel Liebe und großem Können zubereitet hatte, war an Gerda verschwendet. Sie musste sich zusammenreißen, um auf Leonies Geplauder eingehen zu können, und sie war froh, als die Mahlzeit zu Ende war und die Kinder hinaus in den Park liefen.
Diesmal hatte Denise keine Schwierigkeiten, Gerda zum Sprechen zu bringen. Für die junge Frau war es eine Wohltat, sich alles von der Seele reden zu dürfen. Sie berichtete ziemlich genau von ihrem Wortwechsel mit Dr. Richard Binder und dessen Mutter. Als sie damit fertig war, fragte Denise: »Und das ist alles?«
»Ja. Glauben Sie, dass etwas nicht stimmt? Frau Binder war sicher aufrichtig und hat mir die Wahrheit gesagt. Hans ist tot. Daran besteht für mich kein Zweifel mehr.«
Denise nickte ungeduldig und meinte: »Ja, Frau Binder ist sicher aufrichtig gewesen. Sie hingegen waren es nicht.«
»Ich? O doch! Ich habe Sie nicht belogen. Es war alles so, wie ich es Ihnen beschrieben habe. Dieser Richard, der Rechtsanwalt, war anmaßend und widerlich. Ich wundere mich, woher ich den Mut nahm, mich ihm zu widersetzen. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich noch überzeugt, dass er Hans ist.«
»Ich rede nicht davon, dass Sie mich belogen haben. O nein, ich glaube Ihnen aufs Wort«, sagte Denise. »Aber Sie haben Frau Binder, die Ihrem Bericht nach recht freundlich zu Ihnen war, eine wichtige Tatsache unterschlagen.«
»Eine wichtige Tatsache?«, wiederholte Gerda, ohne zu begreifen.
»Leonie«, sagte Denise. »Sie haben mit keinem Wort erwähnt, dass Sie Frau Binder von Leonie erzählt hätten.«
»Das habe ich auch nicht getan«, gab Gerda zu.
»Ja, aber das hätten Sie tun sollen!«, rief Denise. »Frau Binder ist schließlich Leonies Großmutter.«
Denise merkte, dass dieser Aspekt für Gerda völlig neu war. »Daran habe ich überhaupt nicht gedacht«, sagte die junge Frau. »Und ich finde …, ich finde, es ist besser, dass ich Leonie nicht erwähnt habe«, fügte sie nach kurzer Überlegung hinzu.
»Warum?«, fragte Denise.
»Weil …« Gerda fand es schwierig, ihre Gefühle in Worte zu kleiden. »Weil Leonie bisher ausschließlich zu mir gehörte. Ihre Großmutter … Wie sonderbar das klingt! Nein, Frau Binder hat mit Leonie nichts zu tun. Bisher sind wir allein zurechtgekommen, und so soll es auch in Zukunft bleiben. Ich will nicht, dass ein Fremder sich in meine und Leonies Angelegenheiten einmischt.«
»Aber bedenken Sie doch, vielleicht brauchen Sie oder Ihre Tochter eines Tages Hilfe. Ihrem Kind zuliebe sollten Sie Frau Binder eröffnen, dass sie eine Enkelin hat.«
Gerda schüttelte den Kopf. »Nein, das bringe ich nicht über mich. Was würde Frau Binder von mir denken? Und er? Ihr Sohn, meine ich?«
Denise verstand Gerdas Bedenken, redete ihr aber dennoch weiter zu. »Natürlich wird es Sie einige Überwindung kosten, dieses Thema zu berühren«, meinte sie.
»Und wer weiß, ob die beiden mir glauben würden«, sagte Gerda. »Dieser Dr. Richard Binder – ihm würde es ähnlich sehen, mich zu verdächtigen, dass ich den Tod seines Bruders ausnütze, um …, um seiner Mutter ein Enkelkind unterzuschieben, dessen Herkunft fragwürdig ist. Nein, selbst Leonie zuliebe bringe ich es nicht über mich, mich so sehr zu erniedrigen. Wenn ich wenigstens sicher wäre, dass Leonie einen Vorteil davon hätte, aber so? Sie entbehrt ja nichts. Sie war bisher zufrieden, sie wird es auch weiterhin sein.«
»Ja«, erwiderte Denise, »ja, was Sie da sagen, hat einiges für sich. Und trotzdem – ich bin für klare Verhältnisse. Mir würde es nicht liegen, Tatsachen zu verschweigen und für mich zu behalten.«
Bei aller Sanftheit und scheinbarer Fügsamkeit war Gerda nicht gewillt, ihre Meinung zu ändern. »Nein, ich kann das nicht. Ich gehe nicht noch einmal zu diesem Rechtsanwalt«, beharrte sie.
»Und ich? Wenn ich es versuche?«, schlug Denise vor.
»Wenn Sie was versuchen?«, fragte Gerda begriffsstutzig.
»Frau Binder mit dem Gedanken vertraut machen, dass sie ein Enkelkind besitzt«, erklärte Denise. Da Gerdas Miene keine besondere Zustimmung ausdrückte, fuhr sie fort: »Selbstverständlich liegt es mir fern, mich in Ihre Angelegenheiten einzumischen. Es war nur ein Vorschlag.«
»Ich …, es ist so schwierig«, seufzte Gerda und fuhr sich mit einer irgendwie hilflosen Handbewegung über die Stirn. »Ich schäme mich eben.«
»Leonies wegen?«, fragte Denise, obwohl sie genau wusste, worauf die junge Frau anspielte.
»Das brauchen Sie nicht. Leonie ist ein entzückendes und wohlerzogenes Mädchen. Auf so ein Kind kann jede Mutter stolz sein.«
»Das bin ich ja«, beeilte sich Gerda zu versichern. »Nur – ich habe ihren Vater so kurz gekannt. Ich war zwar noch sehr jung damals und …, und habe mich eben auf den ersten Blick in ihn verliebt, ohne zu bedenken …«
»Niemand wird Ihnen daraus einen Vorwurf machen«, entgegnete Denise. »Außerdem ist es lächerlich, jetzt eine Geschichte zu bereuen, die sechs Jahre zurückliegt.«
»Ich bereue sie nicht«, sagte Gerda leise. »Ich habe Leonie, die ich um nichts in der Welt wieder hergeben würde. Nein, ich bereue nichts«, wiederholte sie. »Aber andere Leute, wie Dr. Binder werden wohl nicht meiner Meinung sein.«
»Was diesen Rechtsanwalt betrifft, scheinen Sie ja einen regelrechten Komplex zu haben!«, rief Denise aus. »Hat er Sie so sehr eingeschüchtert? Beinahe werde ich neugierig auf ihn.«
»Nicht direkt eingeschüchtert«, entgegnete Gerda. »Ich möchte ihm einfach nie wieder begegnen. Ich ärgere mich, weil ich mich so dumm benommen habe, und weil er mich nicht gleich darüber aufgeklärt hat, dass er nicht Hans ist. Das ist zwar nebensächlich, aber …« Sie sah Denise unglücklich an.
»Ich werde Ihre Angelegenheit noch überdenken«, meinte Denise abschließend. »Habe ich Ihre Einwilligung, mich eventuell an Frau Binder zu wenden?«
»Ja. Ja, natürlich«, erwiderte Gerda.
Den Rest des Nachmittages verbrachte Gerda mit ihrer Tochter. Gegen Abend trat sie die Heimfahrt nach Heidelberg an. Sie trennte sich ungern von Leonie, wusste aber gleichzeitig, dass diese in Sophienlust so gut aufgehoben war, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchte.
Auch andere Gedanken beschäftigten Gerda. Wenn sie damals gleich von Hans’ Tod erfahren hätte, wäre ihr Schmerz unermesslich gewesen. Aber die Nachricht hatte sie erst mit sechsjähriger Verspätung erreicht, und so wurde sie weniger vom Schmerz beherrscht, sondern von einer sanften Trauer und dem Gefühl, dass die Vergangenheit nun endgültig begraben sei. Sie war nicht ganz sicher, ob sie Denise von Schoeneckers Vorschlag, Frau Binder mit Leonies Existenz zu konfrontieren, eigentlich guthieß. Sie wollte ihre Tochter mit niemandem teilen, auch nicht mit einer Großmutter, und schon gar nicht mit einem Onkel, gegen den sie eine unüberwindliche Antipathie gefasst hatte. Gleichzeitig gebot ihr jedoch ihr mütterlicher Instinkt, jede Chance, die sich Leonie bieten mochte, im Auge zu behalten.
Denise von Schoenecker hatte angedeutet, dass Leonie außer ihrer Mutter niemanden hatte. Gerda war klug genug zu wissen, dass auch sie gegen Unglücksfälle nicht gefeit war. Wenn ihr etwas zustieß, würde Leonie mutterseelenallein zurückbleiben. Ja, Frau von Schoenecker hat recht, gestand sie sich ein. Hans’ Angehörige müssen von Leonies Dasein erfahren.
Gerda war nur froh, dass Denise sich erboten hatte, ihr diesen Schritt abzunehmen. Sie selbst hätte sich wohl kein zweites Mal zu einem Besuch in der Villa des Rechtsanwaltes aufgerafft.
*
Denise hingegen zögerte nicht lange. Für sie als Außenstehende war es natürlich leichter, den Rechtsanwalt und dessen Mutter aufzusuchen. Sie setzte ihr Vorhaben auch gleich am Montagvormittag in die Tat um. Sie hatte ohnedies einige Einkäufe in Maibach zu erledigen und brauchte keinen großen Umweg zu machen, um Dr. Binders Haus zu erreichen.
Barbara Binder öffnete ihr auf ihr Läuten. Denise nannte ihren Namen und erklärte, dass sie im Zusammenhang mit Frau Pöscheks Besuch etwas Wichtiges mit Frau Binder und ihrem Sohn zu besprechen hatte.
»Mein Sohn ist leider nicht zu Hause«, sagte Barbara. »Er hat seine Kanzlei auf der Hauptstraße und müsste jetzt dort sein. Soll ich Ihnen die genaue Adresse sagen? Hauptstraße neunund…«
»Nein, danke. Ich hätte daran denken sollen, dass Dr. Binder an einem Montagvormittag nicht zu Hause sein kann. Aber vielleicht ist es sogar besser, wenn ich zuerst mit Ihnen allein spreche.«
»Bitte, kommen Sie herein«, sagte Barbara. Sie führte Denise in ihr Wohnzimmer und forderte sie auf, Platz zu nehmen. Die Putzfrau, die gerade damit beschäftigt war, den Teppich zu saugen, sah Denise neugierig an, beeilte sich jedoch, ihre Tätigkeit in einen anderen Raum zu verlegen.
»Was wollen Sie mit mir besprechen?«, fragte Barbara Binder.
Denise wartete, bis sich die Tür hinter der Putzfrau geschlossen hatte. Dann sagte sie: »Hm – es ist eine etwas heikle Angelegenheit. Ich möchte nicht …«
Sie unterbrach sich. Vom Nebenzimmer her erklang durch die dazwischenliegende Wand geschwächt, das Surren des Staubsaugers.
»Haben Sie Angst, dass Frau Schmid uns belauscht? Solange der Staubsauger läuft, kann sie kein Wort von dem, was hier gesprochen wird, verstehen – außer wir schreien.«
»Das werden wir hoffentlich nicht«, sagte Denise schwach lächelnd. »Obwohl Ihnen das, was ich Ihnen mitzuteilen habe, wahrscheinlich einen gelinden Schock versetzen wird.«
»Einen Schock?«, fragte Barbara erschrocken. »Mein Gott – Richard wird doch nichts passiert sein?« Sie vergaß, dass Denise von Schoenecker vorhin nach eben diesem Richard gefragt hatte und daher unmöglich die Überbringerin einer Unglücksbotschaft über Richard sein konnte.
»Nein, beruhigen Sie sich«, bat Denise. »Die Sache hat nichts mit Ihrem Sohn zu tun. Nicht mit Ihrem Sohn Richard«, verbesserte sie sich.