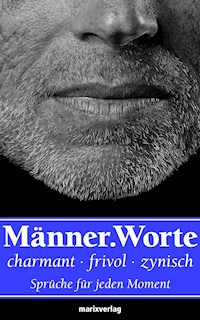30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1: Der erste Schritt in ein neues Leben E-Book 2: Unverhofft - und doch geliebt E-Book 3: Franzi setzt sich durch E-Book 4: Der freche kleine Max E-Book 5: Hilfe kommt von meinem großen Freund E-Book 6: Felix, der kleine Detektiv E-Book 7: Geliebte Zwillinge E-Book 8: Trubel im Entbindungsheim E-Book 9: Als wärest du meine kleine Schwester E-Book 10: Glückliche Kinderwelt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1162
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Der erste Schritt in ein neues Leben
Unverhofft - und doch geliebt
Franzi setzt sich durch
Der freche kleine Max
Hilfe kommt von meinem großen Freund
Felix, der kleine Detektiv
Geliebte Zwillinge
Trubel im Entbindungsheim
Als wärest du meine kleine Schwester
Glückliche Kinderwelt ...
Mami – Staffel 17 –E-Book 1888-1897
Diverse Autoren
Der erste Schritt in ein neues Leben
Mit Baby Anja kam die Liebe zurück
Roman von Reutling, Gisela
»Nein, Mathi, nein!« rief Gaby aus und nahm ihrem Brüderchen das Schulheft aus der Hand, nach dem er blitzgeschwind gegriffen hatte. In der linken Faust hielt er einen Malstift. Sie ahnte schon, was er damit vorhatte. »Das darfst du nicht haben. Was glaubst du, was mein Lehrer sagt, wenn du darin herumschmierst.«
»Ich tu’ nicht schmieren«, erwiderte der Kleine gekränkt. »Ich wollt’ es nur ein bißchen bunt anmalen.«
»Von meinen Schulsachen läßt du die Finger«, sagte Gaby bestimmt. »Malen kannst du da –« Mit ausgestrecktem Arm wies sie auf die offenstehende Tür, dahinter sich sein Zimmer befand. »Und jetzt läßt du mich schön in Ruhe bei meinem Englischaufsatz. Hast du mich verstanden, du Plagegeist?«
Mit gespielter Strenge sah sie in das runde Gesicht des Bübchens.
Aber so leicht ließ ein Mathias Mathi, wie er mit vollem Namen hieß, nicht verscheuchen, auch wenn er erst drei Jahre alt war.
Er hob sich auf die Fußspitzen, legte die Ellenbogen auf den Tisch und sah kriegerisch seine große Schwester an.
»Ich weiß nich’, was ein Plagegeist ist, aber ich frag’ die Mama, wenn sie kommt«, verkündete er. Dann, rasch abgelenkt: »Was ’n das?« Sein Blick war auf ein aufgeschlagenes Buch gefallen. Er zog es zu sich heran. »Was sind das für Leute?«
Spitzbärtige waren es, mit hohen Halskrausen und ebensolchen Hüten. Sehr sonderbar fand er die.
»Das sind Männer, die Stücke geschrieben haben«, erklärte ihm Gaby.
»Was denn für Stücke?«
»Für Theateraufführungen.«
»Und warum sind die so komisch angezogen?«
Ungeduldig stand das junge Mädchen vom Stuhl auf. »Das war eben die Mode vor ein paar hundert Jahren.«
»Vor ein paar hundert Jahren«, wiederholte das Brüderchen staunend. Darunter konnte er sich kaum etwas vorstellen. »Da war ich noch nicht auf der Welt«, fügte er mit seinem treuherzigen Augenaufschlag hinzu.
»Nein.« Gaby mußte lachen. »So, und jetzt ist es genug.« Sie nahm seine Hand und führte ihn in sein Zimmer, wo es alles erdenkliche Spielzeug gab. »Hier bleibst du jetzt, Mathi, bis die Mama vom Frisör kommt. Guck mal, auf deiner Tafel kannst du ein Bild malen, das zeigst du dann dem Papa.«
»Hm, kann ich ja machen.« Er ließ sich auf den Teppich plumpsen, drehte sich auf den Bauch und angelte nach der Maltafel.
Gaby ging wieder an ihren Platz. Das Brüderchen würde nun hoffentlich für eine Weile beschäftigt sein!
Sie waren schon ein besonderes Geschwisterpaar, mit ihren zwölf, beinahe dreizehn Jahren Altersunterschied. Aber was sollte es – heißgeliebt war der Mathias ja doch. Wie der Papa nur immer strahlte, wenn er aus der Firma kam und sein Jüngster fast über die kleinen Beine stolperte, weil er ihm nicht schnell genug entgegenlaufen konnte, von ihm aufgenommen und herumgeschwenkt werden wollte.
Sie war nie eifersüchtig gewesen. Dafür wußte sie zu viel.
Sie wußte, daß ihr Vater Maximilian Hirth von ihr, seiner Tochter Gaby, zehn Jahre lang nichts gehabt hatte und es deshalb für ihn etwas Großes war, diesen einen Sohn nun aufwachsen zu sehen.
Ihre Mutter Corinna war sehr jung und eigenwillig gewesen, sie hatte den Max nicht heiraten wollen, obwohl sie von ihm schwanger war. Da war er, bitter enttäuscht, als Ingenieur nach Brasilien gegangen, und er war dort all die Zeit geblieben.
Erst als er zurückgekommen war, hatten sich Vater und Tochter kennengelernt. Es war nicht einfach gewesen damals, weil ihr Herz doch an ihrem Stiefvater gehangen hatte. »Stiefvater«, so sagte man wohl, aber dieses Wort hatte für sie keine Bedeutung gehabt. Seit ihrem fünften Lebensjahr, als die Mutter Axel Römer geheiratet hatte, war dieser für sie nur der liebe gute Papa gewesen.
Doch schließlich hatte er seiner Berufung folgen müssen.
Als Opernsänger, mit einer herrlichen Stimme gesegnet, hatte ihn eine steile Karriere ganz nach oben geführt. Von ihnen fort.
Max hatte es fertiggebracht, die Lücke zu füllen, die er hinterließ. Sie gewann ihren leiblichen Vater lieb, der nun immer für sie da war. Der vorherige Papa rückte ihr ferner. Im Laufe der Jahre hörten sie immer weniger voneinander. Das war schon ein bißchen traurig. Der berühmte Tenor Axel Römer gehörte eben zu einer anderen Welt. Das war die Welt der großen Opernhäuser, in denen er Gastspiele gab, bis nach Amerika hin.
Das mußte man verstehen.
Hier waren sie ja auch eine richtig glückliche Familie. Die Mama hatte endlich eingesehen, daß sie im Grunde viel besser zu Max paßte als zu Axel, für dessen Künstlertum sie nie das richtige Verständnis aufgebracht hatte. Das hatte Gaby schon als Kind mitbekommen.
Und daß noch ein kleiner Mathias dazugekommen war, der jetzt nebenan seine Malkünste mit allerlei Reden und Ausrufen begleitete, das sollte so sein! – Damit schloß Gaby ihren Gedankengang ab, um sich endlich wieder auf ihren Aufsatz über den Dramatiker Shakespeare und seine Zeitgenossen zu konzentrieren.
Es war ein Thema, das ihr lag.
*
»Nein, die braune Spange, die mit dem Schmetterling«, verlangte Anja.
»Auch gut.« Andrea legte die Haarspange zurück, die sie schon in der Hand hielt, und nahm die gewünschte aus der Schale. Sie hatten sie in den Sommerferien auf einem Markt in Italien gekauft. Neckend sagte sie: »Du willst wohl fein sein für Mathi?«
Rechtsseitig steckte sie ihrem Töchterchen die Spange in das glatte, seidenweiche blonde Haar. Sie waren heute nachmittag bei ihrer Schwester Corinna eingeladen. Ihre Kinder waren nur ein halbes Jahr auseinander. Anja wurde am Jahresende vier.
»Meinen schwarzen Bimbo nehm’ ich auch mit«, redete Anja weiter. »Den hat Mathi aboptiert.«
Andrea stutzte. »Adoptiert, meinst du wohl. Wo habt ihr das denn her?« fragte sie amüsiert.
»Die Kerstin im Kindergarten ist adoptiert«, brachte Anja das Wort nun richtig heraus. »Jetzt heißt sie so wie ihre Eltern.«
Als sie zum Ausgehen fertig waren und Andrea ihren Wagen aus der Garage holte, bemerkte sie: »Wir wollen noch am Friedhof vorbeifahren. Die Blumen auf Jessicas Grab werden verwelkt sein.«
»Dann müssen wir neue kaufen«, sagte das Töchterchen ernsthaft.
Sie taten es im Blumengeschäft nahebei.
Für Anja war der Friedhof nichts weiter als ein großer, stiller Park. Darin lag ihr Schwesterchen begraben, das vor vielen Jahren winzigklein gestorben war. Ihre Mama hatte ihr erzählt, wie lange sie furchtbar traurig darum gewesen war, und daß sie erst wieder richtig froh sein konnte, seit sie ihre Anja hatte. Deshalb wollte Anja sie auch doppelt liebhaben und immer mit ihr zu Jessica gehen, deren Seele schon lange im Himmel war. Vielleicht konnte sie es ja sehen von oben.
»Jetzt ist es wieder schön«, sagte sie zufrieden, als sie frisches Wasser geholt und die bunten Astern in der Vase gefällig zurechtgesteckt hatten.
Andrea nahm die kleine Hand und ging mit ihr den Weg zurück. Nur wer einmal ein Baby verloren hatte, konnte ermessen, was es bedeutete, ein gesundes Kind aufziehen zu dürfen. Der erste Schritt in ein neues Leben war getan worden. Sie konnten wieder glücklich und vor allem, fröhlich sein.
Corinna hatte den Tisch auf der Terrasse gedeckt, wo sie die milde Sonne des Spätsommers noch genießen konnten. Die Kinder alberten herum, Mathi hatte sich den Bimbo auf die Schultern gesetzt, dessen Bastrock kitzelte ihn im NacKen, der runde schwarze Negerkopf überragte seinen braunen Schopf.
»Nun setzt euch mal hin«, sagte die Hausfrau zu den beiden, die wie die Zicklein umeinandersprangen. »Für euch gibt’s eine Portion Eis.«
Da waren sie freilich geschwind auf ihren Stühlen. Für ihre Schwester und für sich schenkte sie Kaffee ein, dabei teilte sie ihr beiläufig mit, daß Max nach Möglichkeit etwas früher heimkommen wollte, damit er sie auch noch begrüßen konnte.
»Wie geht es denn im Geschäft, sind genügend Aufträge da?« erkundigte sich Andrea. »Mutter klagte über die Lage, als sie neulich bei uns war.«
»Das tut unser Muttchen ja gern«, erwiderte ihre Schwester mit dem Anflug eines Lächelns. »Aber wir kommen ganz gut über die Runden, und niemand muß entlassen werden.«
»Gott sei Dank«, atmete Andrea auf. Corinna mußte es wissen, denn sie hatte immer die Übersicht behalten und war zu Zeiten in der Firma tätig gewesen.
Vater Hanspeter Ronacher hatte ein mittleres Bauunternehmen. Es war nicht immer leicht, sich gegen die scharfe Konkurrenz der Großen durchzusetzen.
»Ein Glück, daß er einen tüchtigen Schwiegersohn hat«, sagte sie. »Da weiß er doch, daß sein Lebenswerk auch später mal in guten Händen sein wird, wenn er sich zur Ruhe setzt.« Mit einem vieldeutigen Blick sah Andrea ihre Schwester an. »So hatte unser guter Vater sich das ja schon vor siebzehn, achtzehn Jahren gedacht, als du mit dem jungen Maximilian Hirth verlobt warst. Habe ich recht?«
»Jetzt fang’ nicht wieder mit den alten Geschichten an«, lachte Corinna auf. »Ich habe es ja wieder gutgemacht. Paps hat seinen Nachfolger, und Max habe ich noch einen Sohn geboren. Guck ihn dir an, den Burschen… Nicht so wild, Mathias«, rief sie in den Garten hinunter, wohin die Kinder sich begeben hatten, nachdem sie in Windeseile ihr Eis gelöffelt hatten. »Sonst fliegst du noch ’runter!«
»Ich doch nicht!« krähte der Kleine, und er schwang sich auf der Schaukel immer noch höher. Kusinchen Anja schaute ihm halb ängstlich, halb bewundernd zu. So einen Schwung kriegte sie nie. Wollte sie auch gar nicht. Sie war ja kein Junge.
»Laß Anja auch mal auf die Schaukel«, sagte seine Mutter.
»Klar, mach’ ich auch«, kam es zurück.
Corinna wandte sich wieder an ihre Schwester. »Was macht die Arbeit, Andrea? Hast du den weißen Kittel schon wieder angezogen?«
»Bis jetzt noch nicht. Ich habe den Urlaub ganz schön verlängert. Aber im Herbst wird Mertens mich wieder brauchen. Halbtags, wenn Anja im Kindergarten ist, gehe ich wieder in die Praxis.«
»Irgendwann muß ich doch mal kommen, ich würde dich zu gern als Frau Doktor sehen«, lächelte Corinna.
»Sei froh, daß dir nichts fehlt«, warf Andrea ein.
»Mutti sagt, du machtest dich großartig«, fuhr Corinna fort. »Sie hat schon bemerkt, als sie sich ihr Rezept für die Herztropfen abholte und etwas warten mußte, daß Patienten direkt nach Frau Hardenberg fragten. Ganz stolz hat sie mir das erzählt.«
»Großartig – da übertreibt sie ein bißchen«, sagte Andrea bescheiden. »Aber ich bin gern dort und habe guten Kontakt zu allen, das stimmt schon.«
Sie hatte seinerzeit, als ihr Mann Rolf sich von ihr abwandte, ihr vor der Ehe begonnenes Medizinstudium wieder aufgenommen und ihr Staatsexamen gemacht. Es war die einzige Möglichkeit gewesen, nach der langen Depression, in die sie der plötzliche Tod ihres Babys gestürzt hatte, wieder ins Leben zurückzufinden. Und es hatte sie wieder mit Rolf zusammengebracht, der sich mit einer jungen, frischfröhlichen Kollegin ein neues Glück erhofft hatte. Das Mädchen war gegangen.
Ihre Liebe zueinander, nur verschüttet, nie ganz verloren, konnte neu erblühen.
Andrea lächelte leise in sich hinein. Ein zärtlicher Blick ging zu Anja. Die Kinder hatten ihre Köpfe zusammengesteckt. Was sie sich wohl zu erzählen hatten?
Désirée kam aus dem Haus, blickte zu ihnen hinauf. »Ist Gaby da, Frau Hirth?« fragte sie.
»Nein, Gaby ist zu Katrin gegangen«, antwortete Corinna freundlich.
Das junge Mädchen nickte. Es tat ein paar Schritte auf die Kleinen zu. »Na, Mathi, hast du heute Besuch…« Sie hockte sich zu ihnen auf den Rasen, sie redeten und lachten miteinander.
Die beiden Frauen beobachteten die Szene von der Terrasse her.
»Sie ist ein schönes Mädchen geworden«, bemerkte Andrea. Sie kannte Désirée Brencken gut, wohnte sie doch mit ihren Eltern im Parterre dieses Zweifamilienhauses. Sie war mit Gaby zusammen aufgewachsen, sie gingen von klein auf in dieselbe Schule und waren seit eh und je die besten Freundinnen. Äußerlich konnten sie freilich nicht unterschiedlicher sein, die blonde hellhäutige Gaby und dieses Mädchen mit den schwarzen Haaren, den dunklen Augen und dem bräunlichen Teint.
»Ja, sie ist recht apart«, stimmte Corinna ihrer Schwester zu. »Sie hat nicht die mindeste Ähnlichkeit mit Frau Brencken und ihrem Mann.«
»Hm, das kommt vor«, äußerte Andrea leichthin. »Vielleicht gab es unter den Vorfahren einen Südländer. Erst Generationen später kann sich das wieder bemerkbar machen. – Kannst deine Nachbarin ja mal fragen«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Ich glaube, Désirées Mutter würde nicht gern darauf angesprochen werden«, meinte Corinna etwas nachdenklich. Dann zuckte sie die Achseln. »Es geht uns ja auch nichts an.«
Das Mädchen war wieder hineingegangen. Corinna stellte die Tassen und Teller zusammen. Ihr Sohn rief: »Wirfst du uns mal die Bälle runter, Mama?«
»Wollt ihr nicht lieber hereinkommen? Es wird kühl, wenn die Sonne fort ist, und Anja ist leicht angezogen. Hast du ihr denn schon deine neue Autorennbahn gezeigt?«
»Och, da kann sie doch nix mit anfangen«, behauptete Mathi.
»Warum nicht«, protestierte das Kusinchen. »Meinst du, ich wär’ dumm?«
»Das nich’ grad«, schränkte Mathi ein. »Aber wenn meine große Schwester schon wie blöd davorsteht –« Er legte zwei Finger gegen den Mund und schielte nach oben. »Blöd« sollte er nicht sagen. Das durften nur die im Kinderfunk. »Wo ist ’n der Bimbo?« lenkte er ab.
Der lag mit verdrehtem schwarzen Kugelkopf beim Rosenstrauch, der seine letzten Blüten trug. Sie sammelten ihn auf und sprangen ins Haus.
»Max verwöhnt seinen Sohn zu sehr«, beklagte sich Corinna indessen. »Jetzt wieder diese teure Rennbahn mit allen Schikanen für seine Serie von Spielzeugautos. Wohin soll das noch führen, wenn sie in dem Alter schon alles haben«, schloß sie unmutig.
»Schilt deinen Mathias nicht«, hielt Andrea ihr heiter entgegen. »Ich glaube, damit werden die Väter selbst wieder zu kleinen Jungs.«
»Ja, ja«, Corinna stieß ein kleines Lachen aus, »das gestandene Mannsbild spielt auch mit Begeisterung damit.«
Das »Mannsbild« kam wenig später, von seinem Söhnchen so stürmisch empfangen, als hätten sie sich ewig lange nicht gesehen.
»Ist das bei euch auch so eine stürmische Begrüßung, wenn dein Papa nach Hause kommt?« fragte der breitschultrige Mann mit seinem offenen Lachen die kleine Anja.
»Bald so«, nickte das Kind. »Tag, Onkel Max«, und sie streckte ihm das Händchen entgegen.
Die Erwachsenen plauderten noch eine Weile miteinander. »Rolf soll doch auch mal wieder mitkommen«, sagte Maximilian Hirth zu seiner Schwägerin. »Wir könnten uns einen gemütlichen Abend machen oder nett ausgehen. Das haben wir schon lange nicht mehr getan. Gaby ist ja bei Mathi, und du kannst Anja zu Oma Jutta bringen.«
»Ja, darüber läßt sich reden«, stimmte Andrea zu. »Aber jetzt muß ich wirklich gehen, sonst kommt Rolf in die leere Wohnung.« Sie stand auf. »Komm, Anja, sag auf Wiedersehen…«
Als sie vor dem Haus in ihren Wagen steigen wollte, kam Gaby dahergeschlendert, ein langbeiniger, überschlanker Teenager. Mit lachendem Mund winkte sie ihrer Tante zu.
»Hallo, Andrea!« Auf die Anrede »Tante« verzichtete sie, seit sie sich fast erwachsen fühlte. »Grüß dich, Anja.« Sie bückte sich zu der Kleinen und hauchte ihr ein Küßchen auf die Wange.
Ein paar Worte hin und her, ein Winken zurück, und Andrea fuhr mit ihrem Töchterchen nach Hause.
*
»Übrigens habe ich gestern deine Jamila gesehen«, sagte Gaby am nächsten Tag in der Pause zu Désirée.
»Es ist nicht meine Jamila«, gab die Freundin zurück und sah beiseite.
»Aber du möchtest es gern«, äußerte Gaby neckend.
Désirée preßte die Lippen zusammen und schwieg. Da legte Gaby der um fast einen halben Kopf kleineren den Arm um die Schulter.
»Ach komm, reagiere doch nicht immer so empfindlich, wenn es um Jamila geht«, äußerte sie versöhnlich. Dann lachte sie ein wenig. »Darüber haben wir schon als Kinder gestritten, weißt du noch? Ich wollte immer nicht, daß du zu dem fremden Mädchen gingst und mir von den Navals vorschwärmtest und alles so toll fandest. Das war echt kindisch von mir. Inzwischen finde ich doch gar nichts mehr dabei.«
»Hast du mit ihr gesprochen?« fragte Désirée nach einem kurzen Schweigen.
»Nein, nur gesehen, von weitem. Ich kenne sie doch kaum«, antwortete Gaby. »Kommt sie eigentlich nie zu euch?«
Désirée schüttelte den Kopf. Es klang gepreßt, als sie sagte: »Meine Eltern wollen doch nicht, daß ich sie mitbringe. Darin sind sie komisch. Ich gehe auch nur selten hin.«
»Hmm…« Gaby überlegte, warum die Brenckens eigentlich etwas gegen die Marokkaner hatten. Sie waren doch auch nicht antirassistisch eingestellt. Es war vor Jahren eine Zufallsbekanntschaft zwischen Jamila und Désirée gewesen. Idris Naval, der Vater Jamilas, besaß ein feines Teegeschäft in der Stadt, reich im Stil seiner marokkanischen Heimat ausgestattet. Die beiden Kinder hatten sich stark zueinander hingezogen gefühlt. Vielleicht lag das daran, daß sie sich ähnlich sahen, als kämen sie aus demselben Land. Gaby hatte es immer ganz lustig gefunden, daß sie beide vom Typ her so verschieden waren.
Die Klingel schrillte zum Zeichen, daß die Pause beendet war.
»Vergiß es«, sagte sie und griff nach Désirées Hand. »Jetzt wollen wir mal sehen, was der Müller uns für Noten gegeben hat für die Klassenarbeit.«
Zusammen gingen sie hinein.
*
Es war Herbst geworden.
Die Familie Brencken hatte an diesem Wochenende Besuch gehabt. Oma Anneliese war gekommen, ein stets lieber und gern gesehener Gast. Am frühen Sonntagabend brachte sie der Schwiegersohn zum Zug, Carola, ihre Tochter, hatte sich mit in das Auto gesetzt. Nur Désirée hatte keine Lust gehabt.
»Du kommst doch bald mal wieder, Omi, da müssen wir dich ja nicht allesamt am Bahnhof verabschieden, oder?«
Die Großmama hatte ihr die Wange getätschelt. »Schon gut, Kleines, bleib du nur…«
Sie hatten sich am Nachmittag noch Fotos angesehen, teils in Alben, teils lose verwahrt. Der Vater hatte noch die Kassette hervorgeholt, darin er Wertsachen und wichtige Papiere aufhob. Darin mußten sich noch alte, halb vergilbte Bilder befinden von längst verstorbenen Familienmitgliedern, auf die im Laufe der lebhaften Unterhaltung die Sprache gekommen war. O ja, die Oma konnte sich an diesen und jenen noch gut erinnern!
Désirée hörte gern zu, wenn von vergangenen Zeiten erzählt wurde.
Sie trat an den Schreibtisch, wo, in losem Durcheinander, die Sachen noch lagen, die ihr Papa herausgesucht hatte. Sie wegzuräumen hatte er keine Zeit mehr gefunden, weil Oma nervös wurde, wenn sie nicht mindestens eine Viertelstunde vor Abgang des Zuges am Bahnhof war.
Das junge Mädchen kramte ein wenig in den Papieren herum. Das Diplomzeugnis von ihrem Vater, ausgestellt von der Fakultät für chemisch-technische Wissenschaften – die Heiratsurkunde ihrer Eltern Georg und Carola Brencken – Bankpapiere, Aktien, Anteilscheine, davon verstand sie nichts…
Désirée wollte schon davon ablassen – der Vater würde es sicher nicht gern sehen, daß sie hier neugierig war –, als ihr Blick auf ein merkwürdig rohfaseriges Blatt fiel, das fremde Schriftzüge trug. Das war doch arabisch!? Ja, natürlich, diese Schriftzeichen hatte sie schon bei Jamila gesehen, im Geschäft deren Vaters und auch in der Wohnung der Navals. Da gab es solche Zeitungen, Bildunterschriften…
Arabisch, tatsächlich, staunte Désirée. Wie kam ein solches Papier nur in die Kassette von ihrem Vater?
Sie betrachtete es näher. Es sah ziemlich amtlich aus. Oben links, neben dem Briefkopf, befand sich ein Bild des Königs von Marokko.
Jamila stammte doch aus Marokko. Aber wieso…
Da entdeckte sie, daß es unten zum arabischen Text auch eine knapp gefaßte französische Übersetzung gab. Von Jamila wußte sie, daß neben der Landessprache Arabisch die Geschäfts- und Bildungssprache Französisch war.
Das konnte Désirée ganz gut, lernte sie es doch seit sechs Jahren in der Schule. Sie begann, den Text zu übersetzen, ihre Lippen bewegten sich dabei, sie wurde immer verwirrter.
Das war doch zu sonderbar!
Um ein aufgefundenes neugeborenes Kind handelte es sich. Es war anonym abgelegt worden, was bedeutete, daß keiner es haben wollte und auch niemand jemals danach fragen würde.
Désirée konnte plötzlich nur noch mühsam atmen. Mit brennenden Augen suchte sie fieberhaft nach einem Datum – fand es endlich –
Es war das Jahr ihrer Geburt! IHR GEBURTSJAHR…
Das Mädchen preßte die geballte Faust an ihre Lippen.
War am Ende sie das – sie? War sie gar nicht Désirée Brencken? War sie nur ein ABGELEGTES Kind aus Marokko?
Mit verstörtem Blick sah sie sich um. Ihr war, als müßten die Wände über sie niederstürzen. Sie taumelte empor. War sie denn plötzlich verrückt geworden? Es war doch Wahnsinn, so etwas zu denken.
Wie sollte sie denn hierhergekommen sein?
Ihre Füße trugen sie ins Bad. Dort machte sie das grelle weiße Licht über dem Spiegel an, brachte ihr Gesicht nahe heran.
Ja, sieh dich nur an! Sieh deinen Gesichtsschnitt, dein schwarzes Haar, die dunkelgrünen Augen –
»Nein, nein!« schrie sie auf, und noch einmal brach es aus ihr heraus. Wie ein verzweifeltes Sichaufbäumen war es: »NEIN!«
Sie krümmte sich, sank über dem Waschbecken zusammen.
Sie wollte sterben. Sie wollte nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nichts mehr wissen.
So fand Carola Brencken ihre Tochter.
»Désirée«, sagte sie erschrocken. »Was ist denn, Désirée? Ist dir schlecht geworden?«
Als das Mädchen sich nicht bewegte, zog sie es sacht empor. »Nun sag schon… Was ist?«
Aber Désirée schüttelte nur wild den Kopf. Wir irr ging ihr Blick umher.
Die Mutter umfaßte sie, führte sie aus dem Bad ins Wohnzimmer, ließ die Willenlose dort in einen Sessel gleiten.
»Was hat sie denn?« fragte auch ihr Mann. »Vorhin war sie doch noch ganz munter.«
Als seine Frau nur ratlos die Schultern hob, ging er zum Schreibtisch, wo er alles liegengelassen hatte. Ein Blatt lag auf dem Fußboden, er hob es auf und zuckte zusammen.
In diesem Moment sagte Désirée mit einer fremden, tonlosen Stimme: »Bis vorhin wußte ich auch noch genau, wer ich war.«
»Was soll das heißen?« stieß die Mutter hervor. »Was redest du da? Désirée! Erkläre uns doch endlich, was dich so verstört hat!«
Georg Brencken trat auf seine Frau zu, er hielt ihr mit ausgestrecktem Arm jenes auf irgendeiner Dienststelle in Marokko verfaßte Schreiben unter die Augen…
Carola wurde sehr blaß. Sie hob die Lider, stumm sahen sie sich in die Augen. Es war soweit. Désirée wußte es.
O großer Gott, laß uns die richtigen Worte finden.
Bewahre das geliebte junge Wesen vor einem Sturz in die Tiefe.
Carola mußte sich setzen, so zitterten ihr die Knie. Sie preßte die Hände im Schoß zusammen, daß ihr die Fingernägel ins Fleisch drangen. Doch es gelang ihr, mit einigermaßen fester Stimme zu sagen: »Du bist unser Kind, Désirée. Nichts anderes.«
»Dann ist das gar nicht wahr?« Désirées Kopf schwankte hin und her, sie deutete auf das Schreiben, das der stehende Vater noch in der Hand hielt. »Habe ich mir das nur zusammenphantasiert? Bitte sagt, daß es nicht wahr ist. Bitte.«
Ihr Flehen schnitt der Mutter ins Herz. Sie warf einen verzweifelten Blick zu ihrem Mann hin. Doch dieser sagte – und es mußte ja gesagt werden –. »Es ist wahr, Désirée. Wir haben dich als verlassenes Baby aus Marokko mitgebracht. Fortan warst du unser Kind.«
Das Mädchen schlug die Hände vor das Gesicht. Weinte sie?
»Es tut uns sehr leid, daß du es auf diese Weise erfahren hast«, sprach Georg Brencken weiter. »Wir wollten es dir vorsichtiger beibringen, später, wenn du erwachsen sein würdest…«
Er sah zu Boden. Sie hatten es immer vor sich hergeschoben. Später. Später, wenn sie größer sein würde. Ach, warum war es nur so schnell groß geworden, sein kleines Mädchen.
»Ich bin sechzehn«, kam es denn auch anklagend zurück. »Sechzehn Jahre lang habt ihr mir verschwiegen, wer ich wirklich bin.« Désirée ließ ihre Hände sinken. »Aber wer bin ich denn? Wer?« Und ihr Mund öffnete sich wie zu einem stummen Schrei.
»Unser Kind«, sagte eindringlich Carola, die es gar nicht oft genug wiederholen konnte, »unsere Tochter Désirée Brencken.«
Désirées Blick ging von einem zum anderen. Nach einer Pause brachte sie tonlos hervor: »Ihr habt mir nie erzählt, daß ihr mal in Marokko gewesen seid.«
Der Vater setzte sich nun auch hin.
»Es war eine Ferienreise«, begann er mit schleppender Stimme. »Wir konnten es uns erlauben zu reisen, denn wir hatten keine Kinder. Wir wußten, daß wir auch nie welche haben würden. Auf einer Fahrt durch das Land entdeckten wir ein kleines Bündel, abseits an einem Wege liegend – ein Baby. Weit und breit kein Mensch, nur karge Landschaft –« Für einen Moment schloß Georg Brencken die Augen, als sähe er dies deutlich vor sich.
»Wir nahmen es mit, wir konnten es doch nicht dort liegenlassen«, sprach Carola statt seiner weiter. »Das wäre sehr bald das Ende dieses winzigen Geschöpfleins gewesen.«
»Ja«, Georg nickte schwer, »wir sind dann in die nächste Stadt gefahren, zur Polizei. Wir stießen auf eine Gleichgültigkeit, die uns schaudern ließ. Du mußt wissen, Désirée, daß es eine unbeschreibliche Armut gibt in diesem Land. Es gibt zu viele Kinder, die zu einer Last werden können. In Horden betteln sie in den Straßen…«
»Und dann wirft man sie fort?« Désirée legte die Finger gegen ihre zitternden Lippen. »Ich bin – fortgeworfen worden?«
Plötzlich weinte sie laut auf.
Mit zwei Schritten war Carola bei ihr, beugte sich über sie, umfaßte den dunklen Kopf.
»Liebes, mein Liebes, ich habe dich aufgefangen in meinen Armen, ich habe dich von der ersten Stunde an so sehr lieb gehabt!«
Auch in ihrer Kehle saß ein Schluchzen, so erschüttert war sie bis ins Tiefste. Ihr Mann preßte die Lippen zusammen, wandte sich beiseite. Nicht umsonst hatte er sich vor dieser Stunde der Wahrheit gefürchtet.
Erst als Désirées Weinen leiser geworden, die Mutter ihr mit einem Taschentuch das nasse Gesicht abgetupft hatte, ergriff er wieder das Wort. Mit großem Ernst sagte er: »Désirée, versuch es doch einmal so zu sehen, daß der Schöpfer aller Dinge nicht wollte, daß du stirbst. Er hat zu deiner Errettung zwei Menschen auf den Weg geschickt, die dich behüten sollten. Und warst du denn nicht glücklich bei uns, so wie wir es mit dir immer waren?«
»Doch.« Zitternd holte das Mädchen Atem. »Aber jetzt –«
»Es ist jetzt nichts anders geworden«, fiel ihre Mutter ihr leidenschaftlich ins Wort. »Du weißt jetzt, daß ich dich nicht geboren habe. Darum bist du doch mein Kind, vom ersten Tag deines Lebens an.«
Désirées Kopf sank auf die Brust. Langsam und schwer wälzten sich die Gedanken hinter ihrer Stirn. Carola setzte sich wieder. Sie betete darum, daß das Schlimmste vorüber sein möge.
»Warum habt ihr mich Désirée genannt?« flüsterte das Mädchen. »Das heißt die Erwünschte. Ich war doch nicht erwünscht, da, wo ich herkomme –« Schon wieder schwankte das Stimmchen bedenklich.
»Von uns erwünscht, mein Liebes!« betonte Carola. »Für mich war doch das kleine Mäuschen wie ein Geschenk des Himmels.« Dabei versuchte sie ein Lächeln, sehnte sich danach, daß sich ein schwacher Abglanz davon auch auf dem jungen Gesicht zeigen möge. Aber das war wohl zuviel verlangt.
Der Mann erhob sich endlich von seinem Platz. Dramatisch genug war die Stunde gewesen. Sollte man nicht, trotz allem, wenigstens Anstalten machen, zur Tagesordnung überzugehen?
»Wie wäre es denn noch mit einem leichten Abendessen, Carola?« wandte er sich an seine Frau.
»Ja.« Sie stand auf. Es war längst über die übliche Zeit geworden. Bevor sie in die Küche ging, um etwas vorzubereiten, warf sie noch einen besorgten Blick auf die Tochter. Sie saß zusammengekauert im Sessel, mit vorgezogenen Schultern, das dunkle Haar fiel ihr über das Gesicht.
Das wurde eine schweigsame Mahlzeit. Sie wußten kaum, was sie zu sich nahmen. Désirée kaute auf einer Scheibe Tomate, als würde sie ihr im Mund quellen. Als die Mutter den Tisch abräumte, verschwand sie stillschweigend in ihr Zimmer. Carola wollte ihr folgen, aber ihr Mann hielt sie zurück.
»Sie muß erst mal allein damit fertig werden«, meinte er mit ernster Miene.
Lange hielt Carola es indessen nicht aus. Sie litt mit dem Kind, das sich fühlen mußte, als sei ihm der feste Boden unter den Füßen weggezogen.
Behutsam öffnete sie die Tür. Ihre Tochter lag noch angekleidet auf dem Bett. »Désirée«, redete sie sie leise an.
Désirée rührte sich nicht. Sie starrte weiter gegen die Zimmerdecke. Carola setzte sich auf die Bettkante.
Sie nahm die schmale Mädchenhand, die sich eiskalt anfühlte. Da legte sie ihre andere Hand noch darüber. So blieb sie, ohne ein Wort zu sagen.
Lange Minuten waren vergangen, als Désirée endlich den Mund auftat. »Ich werde niemals wissen, wer die Frau war, die mich geboren hat«, sagte sie in einem Ton, als kämen ihr die Worte von ganz fern.
»Nein, Désirée, das werden wir niemals wissen. Meinst du, ich hätte mir nicht früher auch Gedanken darum gemacht? Aber es führt zu nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen.«
»Warum hat sie es nur getan«, kam es wie vorher über die Lippen des jungen Mädchens. »Wenn sie mich doch neun Monate in ihrem Leib getragen hat.«
»In letzter Verzweiflung, denke ich mal«, sagte Carola. »Vielleicht hat sie nicht gewußt, wie sie dich ernähren sollte.«
»Nicht ein bißchen Milch für mich?« fragte Désirée mit einem traurigen Kopfschütteln.
Carola mußte die Zähne zusammenbeißen. Tränen drängten sich ihr heiß und brennend gegen die Lider. Würde es dieses Kind, das sie mit soviel Liebe großgezogen hatte, für immer in der Seele zerstören, daß es seine Wurzeln nicht kannte?
»Sie mag selbst halbverhungert gewesen sein, dann gab ihre Brust keine Milch«, vermutete sie schwach.
Darüber dachte Désirée nach. »Wenn es so wäre«, sagte sie nach einer Pause, »ist es doch sonderbar, daß ich immer gesund und kräftig war. Schon mit ein paar Monaten hatte ich ganz runde Wangen. Wir haben uns heute noch mit Oma die Kinderbilder von mir angesehen.«
Sie schloß die Augen. War das wirklich erst heute gewesen, als sie sie lachend betrachtet hatten? Was war inzwischen auf sie niedergegangen!
Carola nickte vor sich hin. »Es ist wahr, du hattest dich bald prächtig entwickelt«, murmelte sie. »Ich konnte stolz auf unser Baby sein.«
Wieder schien Désirée weit fort von ihr. Hilflos überlegte die Mutter, was sie nur tun konnte, um ihr zu helfen. Reden? Schweigen? Sie in den Arm nehmen? Ach, sie fand im Moment keine Brücke zu ihrer jungen Tochter.
Sie wollte schon schweren Herzens von ihr lassen, als Désirée wie traumbefangen sprach: »Ich bin nun von Geburt her Marokkanerin, wie Jamila Naval. Ich habe sie immer so gern gehabt. Aber du hast ja keine engere Freundschaft zwischen uns zugelassen.«
Carola schluckte hart. »Versteh das doch«, bat sie mit enger Stimme. »Du ließest dich so sehr von diesen Menschen faszinieren, daß ich Angst um dich bekam. Es wurde da etwas aufgerührt, an das ich nicht erinnert werden wollte. Nur darum wollte ich dich fernhalten von denen.«
Désirée schwieg darauf. Eine kleine steile Falte stand zwischen ihren feingezeichneten schwarzen Augenbrauen. Es gab dem unschuldigen Gesicht einen Ausdruck angestrengten Nachdenkens.
Mit einem unterdrückten Seufzer stand Carola endlich von der Bettkante auf. Sie konnte nun hier nichts mehr ausrichten.
»Zieh dich aus, Désirée, und geh zu Bett«, sagte sie sanft. »Grüble nicht länger, versuche zu schlafen. Morgen hast du wieder früh Schule.«
Sie streichelte ihr über die Wangen, wartete noch auf ein Wort, das nicht kam. Ihre Augen blickten verhangen, als sie das Zimmer verließ.
»Die Oma hat angerufen, daß sie gut nach Hause gekommen ist«, empfing sie ihr Mann, der nach der Zeitung gegriffen hatte, die noch ungelesen lag.
Carola nickte abwesend. Dann fragte sie: »Hast du ihr schon etwas gesagt?«
»Aber nein. Ich werde deine Mutter doch am späten Abend nicht noch aufregen. Sie würde die ganze Nacht nicht schlafen.«
Ein trübes Lächeln verzog Carolas Mundwinkel. »Ich fürchte, wir werden alle nicht viel Schlaf finden, Georg.«
*
Am Donnerstagnachmittag war Désirée oben bei Gaby. Die Mädchen wollten sich gegenseitig Vokabeln abhören. Aber Désirée war nicht bei der Sache. Sie malte irgendwelche Zeichen auf ein Blatt Papier, und sie tat es, wie Gaby jetzt feststellte, von rechts nach links.
»Was machst du denn da?« fragte Gaby. »Du paßt überhaupt nicht auf. So kommen wir nicht vorwärts.«
»Das ist arabisch«, sagte Désirée. Sie hatte einmal gesehen, wie Jamila auf diese Weise schrieb. Ihr ging das ebenso flüssig von der Hand wie die deutsche Schrift.
»Arabisch«, wiederholte Gaby verblüfft. »Sag mal, spinnst du? Was heißt das denn?« Mit dem Kinn wies sie auf das Blatt.
»Das weiß ich nicht«, antwortete Désirée. »Ich kann es doch nicht. Ich probiere es nur mal so aus.«
»Und wozu soll das gut sein?«
»Für nichts«, sagte Désirée, und sie deckte das Blatt zu.
»Du bist vielleicht komisch.« Aufmerksam sah Gaby die Freundin an. »Du kommst mir schon die ganze Woche verändert vor. Ist was? Mir sagst du ja nichts mehr.«
Der dunkle Kopf neigte sich zur Brust. Désirée kämpfte mit sich. Sie hatten einander von kleinauf immer alles anvertraut. Sie hatte Gaby auch schon manchmal trösten müssen, zum Beispiel damals, als ihr geliebter Stiefvater Axel Römer ging.
Aber alles Geschehen erschien ihr gering gegenüber dem, was sie jetzt als Geheimnis mit sich herumtrug.
»Bist du mir wegen irgend etwas böse?« fragte Gaby in die Stille hinein.
»Nein. Weswegen sollte ich dir denn böse sein?«
Jetzt reichte es Gaby. Temperamentvoll hieb sie auf das aufgeschlagene Lehrbuch. »Okay, okay. Dann behalte es eben für dich, warum du sauer bist.«
»Ich bin nicht sauer.« Désirée hob den Blick. »Dir wäre wohl auch nicht nach Lachen und Schwatzen zumute, Gaby, wenn du plötzlich erfahren müßtest, daß deine Eltern gar nicht deine leiblichen Eltern sind.«
Gaby riß die Augen auf. »Wie bitte?« fragte sie gedehnt.
Désirée nickte schwer. Sie hatte es nun über die Lippen gebracht. Leichter wurde ihr darum nicht. Sie wandte den Kopf beiseite.
»Sie haben mich nur irgendwo aufgelesen – irgendwo in Marokko.«
Gaby verschlug es die Sprache. Wollte die Freundin ihr ein Märchen erzählen, würde sie gleich in ein Lachen ausbrechen, weil natürlich kein Wort davon wahr war? Sie starrte auf Désirée abgewandtes Gesicht, und dabei überkam sie eine niegekannte Beklommenheit.
»Désirée«, flüsterte sie, »das kann doch nicht wahr sein…«
»Doch. Sieh mich doch an.«
»Ach, das –« stotterte Gaby, »das gibt es doch schon mal, daß jemand –« Sie wußte nicht weiter.
»Die Frau, die mich geboren hat, hat mich einfach ausgesetzt. Kannst du dir vorstellen, wie ich mir vorkomme?«
Gaby konnte es sich nicht vorstellen. Es war zu schrecklich. Und eigentlich auch ganz unfaßbar. Désirée, ihre liebste Freundin Désirée, sie waren doch wie Schwestern zusammen in diesem Haus aufgewachsen.
»Wann haben dir deine Eltern das denn erzählt, daß sie da mal waren?«
»Vor ein paar Tagen. Am Sonntag. Ich hatte da so ein amtliches Schreiben gefunden, damit beglaubigte eine dortige Polizeidienststelle, daß ich, ein neugeborenes Baby, niemandem gehörte.«
»Da haben sie dich einfach mitgenommen?« stieß Gaby angespannt hervor.
»Ja. Und mich hier als ihr eigenes ausgegeben.«
Gaby lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, sie streckte die langen Beine von sich und ließ beide Arme hängen. Wenn einen das nicht umhaute!
Nebenan war Mathi laut geworden, Corinnas Stimme dämpfte seinen Übermut.
»Wollen wir«, sagte Désirée nach endlos scheinenden Minuten und zog das Schulbuch heran.
Aber jetzt schien es Gaby ganz unmöglich, sich auf Schularbeiten zu konzentrieren. »Dann haben dir deine Eltern doch das Leben gerettet«, sagte sie gedankenvoll. »Sonst gäbe es dich ja überhaupt nicht mehr.«
»Wär’ vielleicht besser«, kam es undeutlich zurück, weil die andere kaum die Lippen dabei bewegte.
Mit einem Satz richtete Gaby sich aus ihrer lässigen Haltung auf.
»O Désirée, sag doch so etwas nicht!« rief sie heftig aus. »Wir haben dich alle lieb und nicht zuletzt ich. Du würdest mir schrecklich fehlen.«
Sie hatte das noch nie ausgesprochen. Wozu auch. Sie hatten es doch immer gewußt, wie nahe sie sich waren.
»Weißt du, Désirée«, fuhr sie in gemäßigterem Ton fort und beugte sich etwas vor, »ich würde da am besten gar nicht mehr dran denken. Du hast einen Vater und eine Mutter, und du bist nicht anders als ich und als wir alle. Oder hast du da jemals einen Unterschied gespürt?«
»Nein.«
»Na also. Dann laß uns gar nicht mehr darüber reden. – Los, vielleicht geht doch noch was in unseren Kopf rein, sonst stehen wir morgen dumm da.«
Entschlossen fing sie an, die unregelmäßigen Verben herzusagen.
*
Natürlich ließ sich das Ungeheuerliche nicht beiseiteschieben.
Gaby mußte es ihrer Mutter erzählen. Auch Corinna war tiefbetroffen. »Vielleicht hätten sie es ihr gar nicht sagen sollen«, meinte sie nach einigem Überlegen.
»Aber ihr war doch ein Papier aus Marokko in die Hände gefallen, das in ihrem Geburtsjahr ausgestellt war«, erwiderte Gaby eifrig. »Wie hätten sie ihr da noch die Wahrheit verheimlichen können. Désirée tut mir echt leid, Mama«, schloß sie mitfühlend.
Als ihr Vater davon hörte, befand er nüchtern: »Das Mädchen kann von Glück sagen, daß es leben durfte, und gut leben. Sie ist als Europäerin erzogen worden und weiß es nicht anders.«
»Aber sie weiß nun, daß sie von fremdem Blut ist, Max«, gab Corinna zu bedenken.
»Das ändert doch nichts an ihren Lebensumständen«, sagte Maximilian Hirth.
Nein, äußerlich änderte sich nichts bei Désirée und den Eltern Brencken. Nur, daß die Sechzehnjährige stiller geworden war und manchmal länger als sonst in ihrem Zimmer verweilte. Carola ließ sie dann in Ruhe. Nur die Gedanken waren bei ihrem Kind, das etwas zu verkraften hatte.
Wenn die Frau, die mich geboren hat, ganz schrecklich arm war, grübelte Désirée in solchen Stunden vor sich hin, dann wollte sie mir vielleicht nur ein schlimmes Leben ersparen, daß ich nicht ein Bettelkind werden sollte wie die vielen anderen, die es dort geben soll. Vielleicht war sie sehr jung und sehr allein. Sie hatte sich verführen lassen von einem, der sie dann im Stich gelassen hat.
So dachte sie hin und her, im verzweifelten Ringen um Verstehen, warum jene sie nicht hatte haben wollen.
Manchmal führten sie ihre Schritte zum Teegeschäft von Idris Naval. Sie sah durch die Schaufenster hinein. Manchmal war Jamila ja auch da. Sie wollte sie so gern wiedersehen. Was würde sie zu ihr sagen?
»Ich stamme auch aus deinem Land, Jamila«, würde sie sagen. »Darum haben wir uns auch so zueinander hingezogen gefühlt. Weißt du noch, wir waren noch Kinder, als du auf mich zugekommen bist und mich mit einem lieben Lächeln angesprochen hast.«
Aber sie sah Jamila nicht, und einfach hineinzugehen, traute sie sich nicht. Doch irgendwann mußte Jamila es wissen!
Eines Tages verharrte Désirée in heißem Erschrecken vor dem Laden: Da waren die Schaufenster verhängt, die Tür verschlossen.
Was war passiert? So hatte das noch nie ausgesehen.
Vom nächsten öffentlichen Fernsprecher aus rief Désirée die Privatnummer der Navals an. Sie hatte nicht erwartet, Jamila gleich am Apparat zu haben.
»Désirée! Wir haben lange nichts voneinander gehört«, sagte das Mädchen, und es klang erfreut.
»Ja, ich bin schon öfter mal an eurem Geschäft vorbeigegangen, in der Hoffnung, dich zu sehen. Aber du warst nie da, und heute ist alles geschlossen. Aber vielleicht wird nur umdekoriert?«
»Nein, wir geben das Geschäft auf, wir gehen zurück«, antwortete Jamila.
»Oh…« Nur diesen kleinen Laut brachte Désirée hervor.
»Adieu müssen wir uns schon noch sagen, du. Willst du nicht mal kommen?«
»Ja. Wann denn?«
»Kannst du gleich? Ich bin heute nachmittag allein. Mama ist mit Papa im Büro. Es gibt jetzt viel zu regeln.«
Da gab es nicht viel zu überlegen für Désirée. Sie hatte in die Stadtbibliothek gehen wollen, Bücher für sich und Gaby besorgen. Aber das war nun unwichtig. »Ich komme«, sagte sie.
Zwanzig Minuten später betrat sie das Wohnzimmer, das nicht so eingerichtet war wie deutsche Wohnzimmer, sondern einen Hauch von Orient vermittelte. Aus ihren Schuhen war sie vorher geschlüpft, Jamila hatte ihr ein Paar marokkanische Pantöffelchen von sich gegeben, die paßten.
»Hast du die roten noch, die ich dir mal geschenkt habe?« fragte sie.
»Natürlich. Nur daß sie mir mit den Jahren viel zu klein geworden sind.«
»Dann behalte die, als Erinnerung an mich«, sagte Jamila.
»Ich danke dir.« Désirée senkte den Kopf. »Ihr geht also fort…«
»Ja. Mein Großvater ist gestorben. Papa muß als sein ältester Sohn die Geschäfte übernehmen.«
»Tut es dir nicht leid?«
»Ich habe ihn kaum gekannt. Wir sind eine sehr große Familie.«
»Ich meine, daß du fortgehen mußt. Du lebst doch auch schon lange hier.«
»O nein!« Jamila warf den schweren Zopf zurück, der ihr fast bis zur Hüfte fiel. »Unsere Heimat ist immer Marokko geblieben. Dort ist es viel wärmer als hier, und das meine ich nicht nur vom Klima her.«
»Die Menschen, meinst du?« fragte Désirée zaghaft.
»Ja! Sie halten ganz anders zusammen. – Aber setz dich doch, Désirée.« Sie deutete auf eine der Polsterbänke, mit den breiten brokatenen Kissen als Rückenlehnen. »Warte, ich bereite uns einen Minztee. Es geht ganz schnell.« – Jamila brachte ihn in einer silbernen Kanne auf den Tisch, schenkte ein in dickwandige dunkelblaue Gläser, die in goldener Verzierung arabische Schriftzeichen trugen.
Désirée betrachtete sie.
»Sie gefallen dir wohl?« fragte Jamila lächelnd.
»Sehr. Mir gefällt alles bei euch.«
»Hier halten wir an unserer Tradition fest, weißt du. In einem fremden Land muß man sich ein Stück Heimat schaffen und wenn es nur in vier Wänden ist. Wir hatten alles mitgebracht. Bald wird es nun verpackt und verladen. – Bist du traurig, Désirée?« fragte sie unvermittelt.
»Ja, irgendwie schon…« Désirée nahm einen Schluck von dem duftenden Tee, er war heiß und sehr süß. Langsam stellte sie das Glas zurück. Ihr Blick blieb daran haften. »Ich muß dir etwas sagen, Jamila…«
Nur einen Moment zögerte sie noch, dann kam es: »Meiner Herkunft nach bin ich auch Marokkanerin, Jamila. Meine deutschen Eltern haben mich nur als ihr Kind angenommen.«
Jamilas Lippen öffneten sich leicht vor Erstaunen. »Deshalb siehst du auch so aus! Aber warum sagst du mir das erst jetzt?«
»Ich weiß es auch erst seit kurzem. Da haben sie es mir gesagt, daß sie einmal in Marokko gewesen waren und mich verlassen, abseits von menschlichen Behausungen gefunden haben. Ja, ich bin ein Findelkind, Jamila.«
Rückte die andere von ihr ab? Aber sie konnte doch nichts dafür! Sie war deshalb doch die Désirée, und dazu verband sie nun noch die gleiche Rasse. Sie lächelte schüchtern. »Wir haben es doch immer gespürt, daß wir uns, nicht nur vom Äußeren her, nahe waren, nicht?«
Als die andere immer noch nichts sagte, nur mit undeutbarer Miene an ihr vorbeisah, fuhr sie hastig fort: »Meine leibliche Mutter war so arm und verlassen, daß sie ihrem Baby nicht das Notwendigste hätte geben können. Sie war in einer verzweifelten Lage, als sie mich aussetzte. Lieber sollte ich tot sein als ein elendes Leben haben.«
»Deine Mutter war eine schlechte Frau«, sagte Jamila endlich mit einer Härte, die Désirée zusammenzucken ließ. Ihr Kopf sank herab. Sie hatte es Jamila so dargestellt, wie sie es sich oft und oft eingeredet hatte, um dem Geschehen ein wenig von seiner Furchtbarkeit zu nehmen.
»Wenn sie doch keinen anderen Ausweg mehr wußte«, flüsterte sie.
Jamilas Miene blieb starr. »Sie hat Schande über ihre Familie gebracht.«, sagte sie im gleichen Ton wie vorher.
»Sie wird keine gehabt haben, und keinen Mann für ihr Kind, und damit in unvorstellbarer Armut leben zu müssen –« wandte Désirée ein.
»Die Armen«, Jamila zuckte die Achseln, »die behalten ihre Kinder. Sie haben nur noch einen mehr zum Betteln und Stehlen. In ordentlichen Familien ist es die größte Unehre und Schande, wenn eine Tochter sich vor der Ehe einem Mann hingibt.«
»Aber, aber so ist das doch nicht mehr«, stammelte Désirée.
Mit einem kühlen Blick sah die junge Marokkanerin sie an. »Bei euch«, sagte sie hochmütig und kräuselte die Lippen, »bei euch ist das nicht mehr so. Das erlebe ich zur Genüge in der Schule. Tugendhaftigkeit ist hier ein Fremdwort geworden, und die Eltern sehen zu. WIR bleiben jungfräulich bis zur Hochzeitsnacht.«
Verwirrt sah Désirée vor sich nieder. »Und wenn es doch geschieht, und wenn ein Kind kommt«, brachte sie stockend hervor, während ein leiser Schauder sie überlief.
Schweigen. Tiefes, abweisendes Schweigen. Eine Mauer zwischen ihnen.
Ich hätte nicht herkommen sollen, ging es Désirée durch den Sinn. Sie raffte sich empor.
»Danke für den Tee, Jamila. Ich muß jetzt gehen.«
Jamila hielt sie nicht zurück. Im Hinausgehen sah Désirée auf einer hohen Konsole ein ledergebundenes dickes Buch liegen, einer Bibel gleich. Es war der Koran, das heilige Buch des Islam.
In der Diele schlüpfte sie aus ihren geliehenen Pantöffelchen und zog ihre Stiefel an. Sie wollte sie nun nicht mehr geschenkt haben. Sie fühlte sich gedemütigt. Es war ihr Salz in die Wunde gerieben worden.
Sie wandte sich ab und legte ihren Schal um, schlüpfte in ihre dreiviertellange Jacke, setzte die Mütze auf, tat dies alles mit ungewohnt müden Bewegungen. Dann drehte sie sich zu Jamila um.
»Lebe Wohl, Jamila. Ich wünsche dir alles Glück für deine Zukunft.«
»Ich dir auch, Désirée.« Die andere hob die Hand und berührte leicht ihren Arm. Sie schien noch etwas sagen zu wollen – aber sie ließ die Hand wieder sinken und trat zurück, öffnete die Tür. »Adieu.«
Wie blind tappte Désirée die Treppenstufen hinab. Jamila Naval. Das war nun vorbei. – Erst als sie ein Stück gegangen war, bemerkte sie, daß sich in ihrer Tasche etwas befand, das vorher nicht darin gewesen war.
Es waren die marokkanischen Pantöffelchen. Jamila hatte sie ihr heimlich hineingetan.
Wieder zu Hause, fragte ihre Mutter sie: »Nun, hast du die Bücher bekommen?«
Stumm schüttelte Désirée den Kopf. An die Bücher hatte sie gar nicht mehr gedacht. Sie war einfach nur so durch die Straßen gegangen, des ungemütlichen naßkalten Wetters nicht achtend.
»Da wird Gaby enttäuscht sein«, bemerkte ihre Mutter.
»Ich war nicht in der Bibliothek«, sagte Désirée tonlos. »Ich war bei Jamila Naval. Sie geben ihr Geschäft auf.«
»Ja, es stand in der Zeitung.« Aufmerksam sah Carola Brencken ihre Tochter an. Sie sah verfroren und unglücklich aus. Aber sie sagte nur, sich halb abwendend: »Es gibt heute früher Abendessen. Papa muß noch zu einer Versammlung.«
»Mama?« Dünn klang die Mädchenstimme.
»Ja, Kind?«
»Ich habe es Jamila gesagt –«
»Das denke ich mir«, gab die Mutter ruhig zurück.
»Sie ist der Meinung«, Désirée schluckte hart, »die müßte gar nicht bettelarm gewesen sein, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und du doch auch. Die Armen, die behielten ihre Kinder. Die Bessergestellten, für die gäbe es keine größere Schande, als wenn eine unverheiratete Tochter ein Kind bekommt.«
»So, hat sie das gesagt. Und was soll man daraus schließen?«
»Dazu hat Jamila geschwiegen. Man wird wohl – nicht darüber sprechen – in Marokko…« Sie schloß die Augen, ihre Lippen verkrampften sich. Was war das für ein Land, wo sie herkam?
Als ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht wurde es in Touristenbüros angepriesen. Sie besaß einen Kunstband, deren wundervolle Bilder es zu bestätigen schienen.
Aber wie war es wirklich? Grausam? Unerbittlich?
Sie hörte den Vater heimkommen, und sie riß sich zusammen.
»Nicht weinen, Liebes«, bat Carola und strich ihr über die Wange.
»Ich weine nicht«, sagte das Mädchen.
Es gab Tränen, die weinte man nicht mit den Augen, nur mit dem Herzen.
*
»Drei Tage in der Woche«, überlegte Jutta Ronacher laut. »Montags, dienstags und donnerstags, sagst du?«
»Ja, das sind die langen Tage, an denen die Praxis voll ist«, erklärte Andrea lebhaft. »Da sollte ich den Chef wirklich entlasten. Er gehört Gott sei Dank nicht zu den Ärzten, die sich nur fünf Minuten Zeit für ihre Patienten nehmen.«
»Das weiß ich doch«, sagte die Mutter.
Dr. Mertens war der langjährige Hausarzt der Familie Ronacher, er wußte um das wechselvolle Schicksal der beiden Töchter. Es erfüllte sie mit mütterlichem Stolz, daß ihre Tochter Andrea dem beliebten Arzt eine tüchtige Hilfe geworden war.
»Dann hole ich Anja vom Kindergarten ab und nehme sie zu mir, bis du sie abholen kannst, ja, das läßt sich schon machen«, nickte sie.
»Du bist doch die Beste, Muttchen!« Andrea umarmte sie. »Was machten wir nur, wenn wir die Omas nicht hätten. Es ist ja nicht zum ersten Mal, daß du Enkelkinder hüten mußt, nicht?« fügte sie mit leiser Verschmitztheit hinzu. Sie spielte damit auf Gaby an, die sie als Kleinkind oft genug bewahrt hatte, als Corinna noch nicht ans Heiraten gedacht und als Vaters Sekretärin gearbeitet hatte.
»Ja, ja.« Jutta lachte ein wenig. »Was sagt Rolf denn dazu, daß du nun teilweise ganztags tätig sein willst? – Schließlich hast du ja auch genug Arbeit mit deinem Haus«, gab sie zu bedenken.
»Dafür habe ich zweimal in der Woche die gute Frau Scholl, und Rolf ist mit allem einverstanden«, behauptete Andrea.
»Du kannst von Glück sagen, daß du so einen verständnisvollen Mann hast«, meinte Jutta. »Euer Vater stand noch auf dem Standpunkt, daß eine Frau ins Haus gehört.«
»Du hattest ja auch zwei, Mutti, und die Zeiten haben sich doch grundlegend geändert.«
Es ließ sich alles gut an in den folgenden Wochen und Monaten. Meistens holte Rolf Hardenberg sein Töchterchen bei der Oma ab, denn in der ARIANA-Werbeagentur, in der er eine leitende Stellung innehatte, war um 17 Uhr Dienstschluß. Bei Andrea wurde es später. Aber er war zufrieden, weil seine Frau mit Freuden ihrem Beruf nachging.
Und Anja? Anja sagte altklug: »Bei uns«, sie meinte damit den Kindergarten, »gehen von allen die Mütter ins Geschäft oder ins Büro. Aber keiner hat eine Mama so wie ich, die ein Doktor ist und die Leute wieder gesund machen kann.«
Das war doch was!
An diesem Dienstagabend kam Andrea mit einem hübschen Blumenstrauß nach Hause. Ihr Mann verzog drollig-schuldbewußt die Miene. »Hast du dir die nun selber gekauft, weil dein alter Ehemann viel zu selten daran denkt, dir Blumen mitzubringen?«
»Nein, mein Schatz«, sagte Andrea heiter, »die hat mir ein dankbarer Patient gebracht, weil seine Behandlung endlich erfolgreich abgeschlossen ist.«
»Was hat der denn gehabt, und was hast du mit ihm gemacht?« erkundigte sich das Töchterchen neugierig.
»Über Patienten spricht man nicht, Süße«, lachte ihre Mama und tippte ihr mit dem Zeigefinger auf das Stubsnäschen.
»Och, mir kannst du es doch sagen…«
Rolf, ein kariertes Handtuch in den Hosenbund gesteckt und den Kochlöffel in der Hand, verschwand eilig in der Küche, wo die Spaghetti überkochten.
»Tischdecken, Anja!« rief er.
Als ihre Kleine im Bett war, begann für das Ehepaar der gemütliche Feierabend. »Weißt du, Rolf«, sagte Andrea unvermittelt, »ich bin froh, daß ich bei Mertens bin und nicht in irgendeiner Klinik.«
»Mit Tag- und Nachtdienst, womöglich«, warf ihr Mann ein. »Das würde mir auch nicht behagen.«
»Es ist viel persönlicher«, redete Andrea weiter, »und man muß nicht die Launen des einen oder anderen Vorgesetzten ertragen, die sich als Halbgötter in Weiß betrachten. Ich weiß das noch von Katarina in Heidelberg. Die Arme war manchmal ganz geschafft, wenn sie nach Hause kam, obwohl sie nicht gerade dünnhäutig ist.«
»Was macht deine Freundin eigentlich?« erkundigte sich Rolf.
»Du, ich weiß es gar nicht. Ich habe lange nichts von ihr gehört.«
Mit etwas schlechtem Gewissen sah Andrea vor sich nieder. Sie hatte bei Ina gewohnt, als sie ihr Studium in Heidelberg fortsetzte. Ihre Freundschaft datierte noch aus ihrer ersten Studentenzeit.
Dann hatte sie, Andrea, geheiratet, Glück und Leid war ihr zuteil geworden, indessen Katarina Holl ihr Berufsziel verfolgte und bereits eine Anstellung als Assistenzärztin hatte.
Ina hatte sich ihrer angenommen, sie hatte ihr über die schwere Krise ihres Lebens hinweggeholfen, zumindest hatte sie viel dazu beigetragen.
Inzwischen hieß sie nicht mehr Holl, sondern Eschbach. Jenen Markus hatte sie geheiratet, der ihr ganzes Herz gehörte.
Aber wie lange hatte es gedauert, bis es dazu gekommen war!
Der Chirurg Dr. Markus Eschbach war nach einer Liebesenttäuschung der Organisation »Ärzte ohne Grenzen« beigetreten. In einem der fernen Kriegsgebiete, wo unsagbares Elend herrschte, hatte er sich eine schwere Krankheit geholt, die ihn für lange Zeit niederwarf. Ein unbekannter Virus drohte ihn zu vernichten.
Ina hatte um ihn gekämpft. Ihre Liebe hatte ihm wohl auch die Kraft gegeben, mitzukämpfen. Ganz gesund war er nicht mehr geworden. Aber immerhin war er soweit gekommen, daß er, wenn auch nicht mehr als Chirurg – undenkbar, drei, vier, fünf Stunden an einem Operationstisch zu stehen! – so doch mit halber Kraft in einem Ärzteteam arbeiten zu können.
Ina umsorgte ihn. Sie schien, trotz allem glücklich mit ihrem Markus zu sein. – Aber wir sollten, so dachte Andrea jetzt, doch nicht nur in großen Abständen mal etwas voneinander hören.
Gewiß, sie übten beide ihren Beruf aus, jeder hatte darüber hinaus seine Aufgabe, und die Zeit flog nur zu schnell dahin.
Dennoch sollte die herzliche Zuneigung, die sie immer verbunden hatte, sich nicht nur auf ein gelegentliches aneinanderdenken beschränken. – Sie warf einen Blick auf die Uhr. Kaum neun.
»Ich werde Ina jetzt einmal anrufen!« sagte sie spontan.
Rolf nickte dazu. Er griff nach der Fernsehzeitschrift. Vielleicht gab es ja irgendwo etwas Sehenswertes. Denn, wenn Freundinnen zusammen telefonierten, konnte das eine Weile dauern. Vorausgesetzt, Andrea erreichte sie.
Diese nahm das Telefon und ging ins andere Zimmer.
Katarina war da. »Hallooo, Andrea! Ich dachte schon, du hättest mich ganz vergessen.«
»Wie könnte ich, Ina«, erwiderte Andrea mit Wärme. »Aber ich finde auch, es ist höchste Zeit. Du hättest dich ja auch mal melden können, meine Liebe!«
Eine Sekundenpause, dann kam es etwas leiser zurück: »Man zögert, wenn man nichts Gutes zu berichten hat. Da macht man dem anderen das Herz nur schwer.«
Andrea schwieg bestürzt.
»Geht es deinem Mann nicht gut?« fragte sie dann bang.
»Markus ist wieder im Krankenhaus. Er liegt auf der Isolierstation. Sein Zustand ist virulent.« Sie sprach beherrscht, aber es war ein Unterton von Verzweiflung in ihrer Stimme.
»Oh… Ina…«, flüsterte Andrea, und mehr brachte sie im Moment nicht hervor.
»Markus wollte nicht wieder in diese Spezialklinik in Hamburg, er wollte hierbleiben«, fuhr Katarina Holl fort. »Dort werden sie auch nicht mehr für ihn tun können als hier. Der Chef der Virologie sagte damals schon, daß Spätfolgen nicht auszuschließen seien.«
Andrea legte ihre Hand gegen die Stirn. »Ich kann dir nicht sagen, wie leid mir das tut. Ich war immer so froh, wenn ich hörte, daß alles gutging.«
»Ja, wir konnten damit leben, daß Markus in seiner Gesundheit eingeschränkt war. Natürlich gab es Tage, wo ihm das bitter aufstieß. Aber ich konnte ihn immer wieder aufrichten –«
»Das vermagst du, du Gute, wer wüßte das nicht besser als ich«, warf Andrea ein. Wie tief unten war sie gewesen…
»Das Leben an sich war kostbar und wir waren zusammen«, schloß Ina.
»Ihr werdet es auch wieder sein!« Andrea versuchte, alle Zuversicht in ihre Stimme zu legen. »Markus wird alle ihm verbleibenden Kräfte mobilisieren, um es durchzustehen. In unserem Beruf wissen wir doch, wieviel es ausmacht, wenn der Patient mithilft.«
Worte, Worte… Ach, daß es nicht nur Worte wären! Andrea wünschte es heiß. Die Freundin sagte nichts darauf. Sie verharrte in einem schweren Schweigen. Bis es sich ihr endlich entrang: »Und wie geht es dir, Andrea, ist alles in Ordnung? Bist du noch bei dem Dr. Mertens, den ich auch mal kennengelernt habe? Das war nach deinem Staatsexamen, erinnerst du dich?«
»Wo meine Mutti es sich nicht nehmen ließ, ein Fest zu geben«, vollendete Andrea. »Ja, ich bin noch bei ihm und nach wie vor gern. Meine Anja geht in den Kindergarten, sie hat dort Freundinnen gefunden, und dann hat sie auch einen Spielkameraden in ihrem Kusin Mathias, dem Brüderchen meiner Schwester Corinna. Wir sind eine glückliche Familie –«
Sie stockte. Durfte sie von Glück sprechen, wenn die andere litt?
Aber Ina sagte mit dunkler Stimme: »Ich gönne es dir von Herzen, Andrea.«
»Ich weiß«, sagte Andrea weich. Und dann, spontan, »soll ich mal zu dir nach Heidelberg kommen, an einem Sonntag?«
»Darüber können wir noch reden«, wich die Freundin aus.
Andrea nickte. Sie verstand. Ein paar Abschiedsworte noch, alle guten Wünsche, und diesmal bestimmt: AUF BALD.
Wieder im Wohnzimmer bei ihrem Mann, sagte Andrea laut und heftig: »Dieses verdammte Virus!« Sie starrte zu Boden. Fragend blickte Rolf Hardenberg auf seine Frau. Da erzählte sie es ihm.
»Wie alt ist der Mann denn?« wollte er wissen.
Andrea zuckte die Schultern. »Ende Dreißig, denke ich.«
»Das ist kein Alter. Er wird es schon schaffen«, meinte Rolf tröstend.
Andrea blieb stumm. Rolf verstand nichts von medizinischen Dingen. Sie als Ärztin wußte ebenso wie Ina, daß es nicht gut aussah.
*
Dr. Markus Eschbach schaffte es nicht.
Mehrmals in den vergangenen drei Wochen hatte Andrea die Hand nach dem Hörer ausgestreckt, und hatte sie wieder zurückgenommen. Wenn eine Besserung eingetreten wäre, hätte Ina ihr das bestimmt mitgeteilt. Und anders war es doch so schwer, Worte zu finden, die nicht ins Leere gingen.
Nun hielt sie schon die Todesanzeige in ihrer Hand. Ein schwarzumrändertes Blatt Papier, ein Kreuz, sein Name, und darunter ihr Name, Katarina Eschbach, geb. Holl.
Schlichter ging es nicht. Aber wie schwer wog es doch.
Andrea fuhr zur Beerdigung. Die Freundin sollte nicht allein am Grab stehen. Ihr war bekannt, daß der Verstorbene keine näheren Verwandten gehabt hatte. Doch Inas Mutter war angereist, und ihre Schwester mit Ehemann. Zwei Kollegen von Markus Eschbach drückten der Witwe ihr Beileid aus.
Ingrid Holl, die Mutter, war sehr gefaßt.
»Gott hat ihn zu sich genommen, und das war gut so. Anders hätte sein Leiden kein Ende gefunden«, vertraute sie der Freundin ihrer Tochter an.
Andrea konnte nur stumm dazu nicken. Und viel mehr als eine stumme Umarmung konnte es auch zwischen ihr und der wie versteinert wirkenden Ina nicht geben. Erst als sie sehr bald zurückfuhr, sagte sie: »Du kannst jederzeit zu uns kommen, Ina.«
»Danke. Aber mir kann jetzt nur noch meine Arbeit helfen«, kam die Erwiderung von den blassen Lippen.
Tatsächlich zog Katarina Eschbach bereits zwei Tage später den weißen Kittel wieder an.
Erst ein halbes Jahr später, Ende August, sahen sich die Freundinnen wieder. Ina hatte ihren Jahresurlaub genommen. Auf der Fahrt nach Süden machte sie für ein Wochenende bei dem Ehepaar Hardenberg Station.
»Das wurde aber auch Zeit, daß du aus der Tretmühle herauskommst«, sagte Andrea. »Durchzuarbeiten nach den schweren Wochen und Monaten, die du hinter dir hattest…« Ein sanfter Vorwurf lag in ihren Worten.
»Ich brauchte das, Andrea, es war mir ein Halt«, erwiderte die andere. Und, Sekunden später: »Warum hast du dich denn seinerzeit in dein Studium gestürzt?«
Andrea machte eine Kopfbewegung.
»Das war etwas anderes. Es war ein Neubeginn, es war der erste Schritt in ein neues Leben. Als ich mein Liebstes verloren hatte, habe ich mich fallenlassen. Aber du bist nicht der Mensch, der sich fallenläßt. An dir kann man sich nur ein Beispiel nehmen.«
»Ach«, machte Katarina nur, und um ihren Mund zuckte ein seltsames Lächeln. Soviel Kraft hatte es gekostet, viel Kraft. Aber sie hatte es durchgestanden.
Anja kam aus dem Garten herbeigelaufen. »Ist das die Tante, von der du mir erzählt hast, daß sie ganz lieb ist?« fragte sie mit einem Augenaufschlag zu der Besucherin hin.
Inas Gesicht wurde hell. »Anja Emily Hardenberg«, sagte sie mit scherzhafter Betonung, »so ein großes Mädchen bist du geworden! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du noch so klein.« Sie deutete es mit der Hand über dem Boden an.
»Dann mußt du eben öfter mal kommen«, sagte das Kind.
Sie nahmen den Nachmittagskaffee im Garten ein. Man mußte die schönen Tage doch ausnutzen.
»Sie wollen ans Mittelmeer, Frau Eschbach«, wandte sich der Hausherr an den Gast. »Wird es nicht noch sehr heiß und überlaufen dort sein?«
»Die Ferien sind größtenteils vorbei, so hoffe ich doch, einen ruhigen Platz zu finden abseits der allzu bekannten Orte. Ich fahre einfach aufs Geratewohl, Herr Hardenberg.«
Rolf nickte. »Vielleicht können wir Ihnen einen Tip geben«, fiel es ihm ein, »wir waren doch voriges Jahr in Italien.«
Er holte eine Karte, sie breiteten sie aus, und ein lebhaftes Gespräch entspann sich. Anja gab ihren Kommentar dazu.
»Nur kein Museum – nur nicht!« sagte sie in beschwörendem Ton.
Ihr Vater lachte herzlich: »Das haben wir dir auch nur einmal angetan, meine Süße!«
»Lieber so bunte Märkte, Tante Ina, da is’ was los, und man kann ganz schöne Sachen kaufen. Mußt du dir unbedingt angucken.«
»Mach ich, Anja, und davon bringe ich dir auch etwas mit«, versprach Ina.
»Au ja.« Das Kind nickte eifrig, doch plötzlich sagte es: »Guckt mal, wer da kommt.«
Zwei hübsche junge Mädchen kamen ums Haus, blond und dunkel, die eine langbeiniger und schlanker als die andere.
»Ja, Gaby, Désirée, wo kommt ihr denn her?« rief Andrea überrascht aus.
»Wir waren im Schwimmbad«, erklärte ihr die Nichte. »Dann sind wir noch ein bißchen herumgeradelt, und ich dachte, wir könnten mal bei euch hereinschauen. Aber ich sehe, ihr habt Besuch.«
»Ja, da wollen wir nicht stören«, sagte Désirée etwas geniert.
»Ach was, ihr stört doch nicht.« Andrea stellte vor. Die Mädchen mußten sich zwei Gartenstühle herbeiholen, es war noch Pflaumenkuchen da, den durften sie verspeisen. Gaby erzählte vom Chiemsee, wo sie im Urlaub gewesen waren.
»Ist mehr was für ältere Herrschaften«, behauptete sie. »Aber wenigstens kann Mathi jetzt schwimmen.«
»Wart ihr auch verreist?« erkundigte sich Andrea freundlich bei der Freundin ihrer Nichte.
»Ja, an der Nordsee«, antwortete Désirée. »Meine Eltern mögen die friesischen Inseln.«