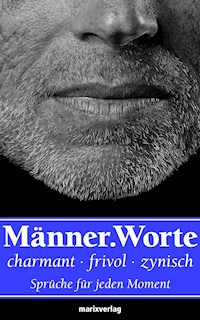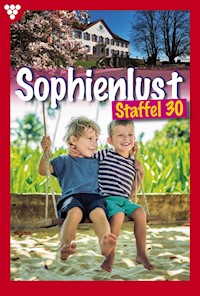
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. E-Book 1: Spät erwachte Mutterliebe E-Book 2: Unerwartetes Wiedersehen E-Book 3: Eine auswegslose Flucht E-Book 4: Dem Vater eine Last E-Book 5: Teddy weiß sich zu helfen E-Book 6: Mutters kleiner Goldschatz E-Book 7: Nur Simon überlebte E-Book 8: Unerwünscht und doch geliebt E-Book 9: Verwaist zu sein ist bitter E-Book 10: Komm bald wieder, Papi!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Spät erwachte Mutterliebe
Unerwartetes Wiedersehen
Eine auswegslose Flucht
Dem Vater eine Last
Teddy weiß sich zu helfen
Mutters kleiner Goldschatz
Nur Simon überlebte
Unerwünscht und doch geliebt
Verwaist zu sein ist bitter
Komm bald wieder, Papi!
Sophienlust – Staffel 30 –E-Book 301-310
Diverse Autoren
Spät erwachte Mutterliebe
Endlich findet Aglaja den Mut, sich zu Niki zu bekennen
Roman von Swoboda, Elisabeth
»Ich muss unbedingt noch einen Sprung in die Firma machen, nachschauen, ob die Badeanzüge endlich eingetroffen sind. Soll ich dich zu Hause absetzen oder möchtest du mitkommen?«, fragte Lydia Hirtl ihren langjährigen Verlobten und frischgebackenen Akademiker Dr. Dieter Kadletz.
»Weder noch«, entgegnete der junge Mann niedergeschlagen.
»Ich bitte dich, Dieter, reiß dich zusammen. Ich begreife ja, dass das alles für dich ganz schrecklich war – aber das Leben geht schließlich weiter. Du bist ein erwachsener Mann, kein armer kleiner Waisenknabe, der nicht weiß, was er nun beginnen soll. Jeden Menschen trifft irgendwann einmal ein harter Schicksalsschlag. Damit muss man eben fertig werden.«
»Das sagt sich so leicht«, murmelte Dieter.
»Hältst du mich für gefühllos? Ich respektiere deine Trauer. Auch mir tut es leid, dass deine Eltern so plötzlich sterben mussten. Aber es nützt nichts, hier beim Friedhofstor zu stehen und den Kopf hängen zu lassen. Das Begräbnis ist vorbei, deine Eltern ruhen in Frieden. Komm endlich! Wir haben noch eine stundenlange Autofahrt vor uns. Ich sehe ein, dass dich die Badeanzüge nicht interessieren. Ich wollte dich ja auch nur ablenken.«
Dieter blickte in Lydias hübsches Gesicht und fragte sich, was hinter der glatten runden Stirn wohl wirklich vorging. Warum drängte sie so zur Heimfahrt? Sie musste doch wissen, dass er Frankfurt nicht so einfach verlassen konnte, jedenfalls nicht, ohne zuvor noch einmal nach seinem kleinen Sohn Nikolaus gesehen zu haben. Natürlich war die Existenz des Jungen für Lydia eine ständige Quelle der Bitterkeit.
Trotzdem hätte sie verstehen müssen, dass er sich um das Kind sorgte.
»Wovon wolltest du mich ablenken?«, erkundigte sich Dieter.
»Von deinem Kummer. Wovon denn sonst? Der tragische Unfall hat dich ganz schön mitgenommen. Du warst in den letzten Tagen kaum ansprechbar. Die ganze Arbeit hast du mir überlassen. Ich musste das Begräbnis regeln, musste mich um die Hinterlassenschaft kümmern und den Haushalt auflösen. Du bist wie ein Schlafwandler herum gegangen, hast kein vernünftiges Wort gesprochen.«
»Entschuldige, Lydia …«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich habe das alles gern getan. Nein, natürlich nicht«, verbesserte sich Lydia. »Wer kümmert sich schon gern um ein Begräbnis? Es war deprimierend, und eben deshalb möchte ich das alles abschütteln und möglichst schnell nach Hause fahren. Die vergangene Woche war auch für mich ziemlich nervenaufreibend.«
Dieter nickte geistesabwesend. Alles, was Lydia da vorbrachte, klang logisch und vernünftig. Trotzdem waren es für ihn leere Worte, die an seinem Gemüt abprallten.
Ein heftiger Windstoß fegte durch die kahlen Bäume, die die kurze Auffahrt zum Friedhof auf beiden Seiten flankierten. Staub und Papierfetzen wirbelten auf. Einer davon blieb an Lydias elegantem schwarzem Breitschwanzmantel hängen. Angewidert löste sie ihn ab und ließ ihn zu Boden flattern. »Mir reicht es«, teilte sie ihrem Gefährten mit. »Kommst du jetzt oder willst du noch stundenlang hier stehenbleiben?«
»Ich muss mit dir reden, Lydia«, sagte Dieter, ohne auf ihre gereizte Frage einzugehen.
»Meinetwegen. Sobald wir zu Hause sind, sprechen wir uns aus. Ich verzichte darauf, heute noch in die Firma zu schauen«, erklärte Lydia freundlich. Sie sprach in einem Tonfall, als ob sie ein widerspenstiges Kind vor sich habe.
Dieter merkte es nicht, oder er wollte es nicht bemerken. »Ich muss jetzt mit dir sprechen«, beharrte er.
»Jetzt? Hier?«
»Setzen wir uns in den Wagen.«
»Na schön. Im Wagen weht wenigstens kein Wind«, gab Lydia sich geschlagen. »Aber fasse dich bitte kurz.«
Trotz dieser Aufforderung blieb Dieter einige Minuten stumm neben der jungen Frau sitzen, hin und her gerissen von den widersprechendsten Gefühlen. Er wusste, die Bitte, die er an Lydia richten wollte, war eine Zumutung, aber er hatte keine andere Wahl.
Lydia nahm ungeduldig den breitrandigen schwarzen Hut, den sie extra für das Begräbnis gekauft hatte, ab und warf ihn auf den Rücksitz. Dann rückte sie den Spiegel oberhalb des Fahrersitzes so zurecht, dass sie sich darin betrachten konnte, zog ihre Lippen nach, glättete ihr straff zurückgekämmtes Haar und puderte sich die Nase.
Dieter beobachtete diese Maßnahme halb ärgerlich, halb bewundernd. Seine Lydia war eine schöne Frau, eine Frau, auf die jeder Mann stolz sein konnte. Sie war eher klein, besaß jedoch eine tadellose Figur und regelmäßige Gesichtszüge, eine kurze gerade Nase, volle Lippen, schön gewölbte dunkle Brauen und einen bräunlichen makellosen Teint. Ihre dunklen Augen strahlten Selbstsicherheit und ein gewisses Maß von Arroganz aus. Lydia wusste, dass sie den Männern gefiel. Bis auf Dieters Seitensprung vor dreieinhalb Jahren hatte sie in einer Beziehung nie Probleme gehabt – und auch bei dieser Angelegenheit war sie letztlich als Siegerin hervorgegangen. Dieter hatte sie um Verzeihung angefleht, die sie ihm schließlich gnädig gewährt hatte.
Lydia hatte ihre Schönheitsprozedur jetzt beendet und wandte sich dem Mann an ihrer Seite zu. »Ich dachte, du wolltest etwas Dringendes mit mir besprechen? Hast du es dir anders überlegt? Kann ich nun fahren?«
»Nein. Warte. Ich fahre nicht mit dir zurück nach Maibach. Noch nicht. Ich habe in Frankfurt noch etwas zu erledigen«, erwiderte Dieter hastig.
Lydia zog die Brauen hoch. »Ich wüsste nicht, was es hier für dich zu erledigen gäbe«, bemerkte sie ruhig. Doch hinter dieser äußeren Ruhe lag Unmut und Gereiztheit. »Wir sind übereingekommen, dass du die Möbel und den Hausrat, den du unbedingt übernehmen willst, von einem Spediteur abholen lässt«, fuhr sie fort. »Für das Übrige Zeug habe ich bereits einen Trödler ausfindig gemacht, und mit dem Hausherrn habe ich vereinbart, dass ich ihm Bescheid gebe, sobald die Wohnung leer ist. Alles ist also geregelt.«
»Das Wichtigste ist nicht geregelt«, warf Dieter ein.
»Das Wichtigste?«, wiederholte Lydia fragend, obwohl sie ahnte, worauf ihr Verlobter hinauswollte.
»Nikolaus«, sagte Dieter auch prompt. »Was soll aus dem Kind werden?«
»Aber, Dieter, auch dieses Problem ist doch auf das beste geregelt«, erwiderte Lydia schnell. »Er ist bei deiner Tante sehr gut untergebracht. Die Schwester deiner Mutter ist eine äußerst sympathische Frau. Ich bin überzeugt, sie wird vorbildlich für den Jungen sorgen. Sie hat ja sonst nichts zu tun. Sie ist Witwe, lebt in angenehmen Verhältnissen und hat massenhaft Zeit. Eigentlich kann sie sogar dankbar sein, dass sie jetzt den Jungen hat. Er wird etwas Abwechslung in ihr eintöniges Leben bringen. Ja, die Sorge für das Kind könnte zu einem beglückenden Lebensinhalt für Tante Maria werden«, redete sie sich schwungvoll in Begeisterung.
»Du übertreibst, meine Liebe«, stellte Dieter trocken fest. »Man kann die Angelegenheit auch anders herum betrachten.Tante Maria führt seit dem Tod ihres Mannes ein beschauliches, aber nicht unausgefülltes Dasein. Sie hat ihre Freundinnen, mit denen sie sich auch zu gelegentlichen Theater- und Konzertbesuchen trifft, sie hat ihre Bridgerunde und den Schachklub. Ich fürchte, Niki wird nicht nur Abwechslung, sondern auch Aufregung und Unruhe in Tante Marias wohlgeordneten Alltag bringen.«
»Du machst dir zu viele Gedanken. Du siehst Schwierigkeiten, wo es gar keine gibt. Deine Tante wird mit dem Jungen bestens zurechtkommen. Er ist an ältere Leute gewöhnt, da er ja bisher von seinen Großeltern betreut wurde. Da hat doch immer alles geklappt. Oder hat deine Mutter je über den Jungen geklagt?«
»Nein. Aber Mutter war ein völlig anderer Typ als Tante Maria. Sie konnte mit Kindern umgehen. Bei Tante Maria bin ich dessen nicht so sicher. Ach, Lydia, kannst du nicht verstehen, dass mir die Sache keine Ruhe lässt? Ich bin Nikis Vater, bin für ihn verantwortlich. Anstatt … anstatt mich zu dieser Verantwortung zu bekennen, habe ich den Jungen meiner alten Tante aufgebürdet.«
»Aufgebürdet? Jetzt bist du derjenige, der übertreibt. Deine Tante war von sich aus dazu bereit, den Jungen zu übernehmen. Er war ja sogar schon in ihrer Obhut, als wir von dem Unfall erfuhren. Und sie hat sofort erklärt, dass sie ihn behalten wolle.«
»Ich fürchte, ihr war nicht klar, worauf sie sich eingelassen hatte«, sagte Dieter. »Sie sah meine Ratlosigkeit, und nachdem sie mit den Verhältnissen vertraut war, bot sie eben an, Niki zu behalten. Vielleicht bereut sie ihren vorschnellen Entschluss bereits. Auf alle Fälle muss ich noch einmal zu ihr gehen und nach Niki sehen.«
»Hm – ich will dich nicht daran hindern. Du kannst ja dann einen Zug nach Maibach nehmen. Bloß – was machst du, wenn deine Tante ihren Entschluss tatsächlich bereut und den Jungen wieder loswerden will?«, fragte Lydia, diesmal ohne ihre wachsende Gereiztheit zu verbergen.
»In diesem Falle werde ich Niki mit nach Maibach nehmen«, erwiderte Dieter mit einer Festigkeit, die Lydia vollends aus dem Gleichgewicht brachte.
»Wie stellst du dir das vor?«, zischte sie. »Was willst du in Maibach mit dem Jungen anfangen? Wer soll sich um ihn kümmern? Auf mich kannst du nicht zählen. Ich habe meinen Beruf und denke nicht im Traum daran, ihn wegen deines unehelichen Sohnes aufzugeben. Noch dazu jetzt, wo ich mich endlich zur Einkäuferin in einem renommierten Warenhaus emporgearbeitet habe. Du hast nicht das Recht, von mir zu verlangen …«
»Ich verlange nichts von dir«, unterbrach Dieter die aufgebrachte Frau. »Ich selbst werde mich um Niki kümmern.«
»So? Da bin ich aber neugierig. Hast du vergessen, dass du in vierzehn Tagen nach München fahren musst, um diese komische Ausstellung vorzubereiten? Und danach wolltest du nach Nordafrika! Hast du vor, Niki überallhin mitzuschleppen?«
Dieter seufzte.
»Du müsstest ein Kindermädchen engagieren. Aber dazu reicht dein Verdienst leider nicht aus, obwohl du endlich den Doktor geschafft hast«, fuhr Lydia überlegen fort, um die Oberhand zu behalten.
»Mein Verdienst würde für uns drei reichen«, sagte Dieter. »Würdest du Niki und mich begleiten …«
»Schönen Dank für dieses großzügige Angebot«, fiel Lydia ihm ins Wort. »Ich habe nicht die geringste Lust, unbezahltes Kindermädchen zu spielen. Und ich denke auch nicht daran, ein Zigeunerleben zu führen. Einmal in Griechenland, dann wieder in der Türkei oder in Italien oder gar in Afrika! Da wir schon einmal dabei sind, können wir uns auch über dieses Thema unterhalten.«
»Lydia! Mein Beruf bringt dieses Zigeunerleben mit sich. Diese Tatsache ist dir nicht unbekannt. Ich war ja schon während meines Studiums häufig unterwegs.«
»Ja. Vor allem warst du in der Türkei«, betonte Lydia mit einem bösartigem Unterton.
Dieter stieß einen langen Seufzer aus. In seinen braunen Augen lag ein Ausdruck der Resignation. Bis an sein Lebensende würde Lydia ihm diese dumme Geschichte, die damals bei den Ausgrabungsarbeiten in der Türkei vorgefallen war, zum Vorwurf machen. Und dabei war er damals ein freier Mensch gewesen, genau wie jetzt.
Hm, ganz so frei natürlich nicht, weder jetzt noch damals. Lydia war seit fünf Jahren seine feste Freundin. Er hatte sich in diesen fünf Jahren zwar teilweise im Ausland aufgehalten, aber wenn er in Deutschland gewesen war, hatte er bei Lydia gewohnt. Bis vor kurzem in Frankfurt, aber dann hatte Lydia ein günstiges Angebot in einem Maibacher Kaufhaus erhalten und Arbeitsplatz und Wohnort gewechselt. Da Dieter mittlerweile sein Studium beendet hatte, war er mit Lydia nach Maibach gezogen. Einige Male war von Heirat die Rede gewesen, aber Lydia hatte gezögert und gemeint, dass sie es damit nicht so eilig habe. Sie war zwar im November dreißig geworden, aber an Bewunderern mangelte es ihr nicht. Und ihn, Dieter, hatte sie sicher. Schon allein aus Dankbarkeit war es ihm unmöglich, sich von ihr zu trennen.
Dieters Eltern waren nicht begütert gewesen. Der Vater war von allem Anfang an gegen das Archäologiestudium seines Sohnes gewesen. Er hätte es lieber gesehen, wenn Dieter nach dem Abitur eine Stelle in einer Bank oder einer staatlichen Institution angenommen hätte. Aber Dieter hatte seinen Willen durchgesetzt. Er hatte sein Studium mit Gelegenheitsarbeiten finanziert, wodurch es sich allerdings beträchtlich in die Länge gezogen hatte. Als er sechsundzwanzig geworden war, hatte er die um ein Jahr jüngere Lydia Hirtl kennengelernt und sich Hals über Kopf in die attraktive, selbstsichere junge Frau verliebt. Lydia war vom Wesen her ganz anders geartet als er. Wissenschaftliche Arbeit interessierte sie herzlich wenig. Dieters Bestreben, die Reste alter Kulturen und vergessener Völker wieder ans Tageslicht zu bringen, entlockte ihr nur ein Kopfschütteln. Doch eines hatten Dieter und Lydia gemeinsam: Den glühenden Ehrgeiz, ein einmal gestecktes Lebensziel auch zu erreichen.
Die beiden waren zusammengezogen, und Lydia hatte darauf bestanden, von ihrem Verdienst den gemeinsamen Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese Großzügigkeit hatte für Dieter eine fühlbare Erleichterung mit sich gebracht, und trotzdem hatte er sich ungefähr eineinhalb Jahre später eine unentschuldbare Entgleisung geleistet, für die er selbst nur vage Rechtfertigungen vorbringen konnte. Er hatte sich bei Ausgrabungsarbeiten in der Türkei mit einer jungen Kollegin eingelassen, und diese Beziehung war nicht ohne Folgen geblieben. Lydia war wütend gewesen, aber letzten Endes hatte sie Dieter dann doch verziehen. Seither fühlte er sich mehr denn je an sie gefesselt, obwohl er argwöhnte, dass auch Lydia es mit der Treue nicht so genau genommen hatte. In Frankfurt hatte es da irgendeine Geschichte mit dem Ehemann einer Stammkundin gegeben, aber Lydia war vorsichtiger gewesen als er. Es hatte keine Beweise gegeben. Nur Getuschel unter den Verkäuferinnen, die ihm gegenüber mit Andeutungen nicht gespart hatten. Er war dumm genug gewesen, Lydia zur Rede zu stellen. Sie hatte alles empört abgestritten und ihm entgegengehalten, dass er sie nur deshalb verdächtigte, weil er seinen eigenen Fehltritt beschönigen wolle.
»Was ist? Schwelgst du in Erinnerung?«
Lydias spöttische Frage brachte Dieter wieder in die unmittelbare Gegenwart zurück.
»Erinnerungen? Nein. Ich dachte eher an die Zukunft«, erwiderte er nicht ganz wahrheitsgemäß. »Wie stellst du dir unsere Zukunft vor? Wenn du dich nicht entschließen kannst, mich auf meinen Reisen ins Ausland zu begleiten, werden wir monatelange Trennungen in Kauf nehmen müssen.«
»Wieso? Es stimmt nicht, dass dein Beruf dich dazu zwingt, in abgelegenen Winkeln in der Erde herumzubuddeln. Lass andere buddeln und werte dann ihre Ergebnisse aus. Oder nimm einen Posten in einem Museum an, oder halte Vorlesungen. Das alles kannst du auch in Deutschland machen. Ich verlange ja nicht, dass wir in Maibach bleiben. Die Firma hat Warenhäuser in ganz Deutschland. Ich könnte mich in eine andere Stadt versetzen lassen, aber meinen Beruf ganz aufzugeben – das kommt für mich nicht infrage. Ist damit alles klargestellt?«
Dieter schüttelte den Kopf. »Nichts ist klar«, stellte er bekümmert fest. »In meinem Inneren geht es drunter und drüber. Ich bin im Moment außerstande, mich auf Postensuche zu begeben. Ich bleibe lieber bei meinem alten Team.«
»Wahrscheinlich befinden sich einige hübsche Studentinnen darunter«, murmelte Lydia.
»Du hast keinen Grund zur Eifersucht. Seit damals habe ich keine Studentin mehr angesehen. Auch sonst keine Frau – außer dir«, versicherte Dieter.
»Entschuldige, ich wollte nicht auf dem leidigen Thema herumreiten«, meinte Lydia versöhnlich. »Könnte ich jetzt endlich fahren?«
»Selbstverständlich.« Dieter schickte sich an auszusteigen, wurde jedoch von Lydia zurückgehalten.
»Willst du tatsächlich deine Absicht wahrmachen und Tante Maria aufsuchen?«, fragte sie ungehalten.
»Ja. Ich muss feststellen, ob Niki sich bei Tante Maria auch wirklich wohl fühlt.«
»Gut, stelle es fest«, sagte Lydia kühl. »Aber merke dir bitte: Falls der Junge sich bei deiner Tante nicht wohl fühlt, wirst du ihn in ein Heim stecken müssen. Auf mich darfst du nicht zählen. Ich weigere mich, deinen unehelichen Sohn zu betreuen. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich keine Kinder haben will. Ich will kein eigenes Kind, geschweige denn ein fremdes. Übrigens …« Lydia stockte und presste ihre roten Lippen fest zusammen.
»Was ist übrigens?«
»Äh – ich möchte bei dir nicht unbedingt die Erinnerung an Nikis Mutter heraufbeschwören«, sagte Lydia nach kurzem Zögern, »aber etwas sollte doch ausgesprochen werden: Der Junge hat eine Mutter. Sie lebt und erfreut sich vermutlich bester Gesundheit. Soll sie sich doch um Niki kümmern und ihn zu sich nehmen.«
»Nein. Das ist ausgeschlossen. Ich habe Aglaja versprochen, sie niemals zu behelligen …«
»Aha! Aber mir gegenüber bist du weniger zartfühlend!«, rief Lydia aufbrausend aus.
»Lydia, versteh mich doch! Bei dir ist das etwas anderes. Von Aglaja habe ich mich getrennt, noch ehe das Kind zur Welt kam. Ich habe sie nie wiedergesehen, habe sogar mit Mutter nicht über sie gesprochen. Ich weiß, dass sie meine Eltern und Niki manchmal besucht hat, aber … aber ich hatte Mutter gebeten, mir nie etwas über den Verlauf dieser Besuche zu erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie es Aglaja geht. Vielleicht ist sie längst verheiratet. Ich kann nicht von ihr verlangen, dass sie Niki zu sich nimmt. Sie hat ihren Angehörigen die Existenz des Jungen verheimlicht. Aber das alles ist dir ja bekannt. Warum quälst du mich so?«
»Ich quäle dich? O nein, es verhält sich genau umgekehrt. Du quälst mich!«, hielt Lydia ihm entgegen.
»Das tut mir leid«, sagte Dieter ton los. »Ich war der Meinung, du hättest mir meine … meine Unbesonnenheit von damals vergeben.«
»Aber das habe ich ja!«, rief Lydia. »Es ist nur so, dass ich mich einfach nicht zum Hausmütterchen eigne. Ich bin nun einmal nicht kinderliebend. Aber wozu streiten wir uns? Ich bin überzeugt, dass deine Tante und dein Sohn prächtig miteinander auskommen. Meinetwegen, besuche die beiden. Danach wirst du meine Überzeugung gewiss teilen.«
*
Eine einigermaßen aufgelöste Tante öffnete Dieter auf sein Klingeln. »Sei bitte leise«, sagte sie zu Dieter anstelle einer Begrüßung. »Niki ist vor fünf Minuten endlich eingeschlafen.«
Sie führte den Mann in ihr Wohnzimmer, in dem nicht die mustergültige Ordnung herrschte, die er von früheren Besuchen her kannte. Einige Zierkissen lagen auf dem Parkettboden, der Perserteppich, auf den die Tante so stolz war, lehnte zusammengerollt in einer Ecke. Der Tisch war mit aufgeschlagenen Bilderbüchern, angebissenen Äpfeln und zerrissenen Papiertaschentüchern bedeckt.
»Setze dich. Die … O Gott, der Zucker!«, unterbrach die Tante ihre freundliche Aufforderung an den Neffen, Platz zu nehmen.
Dieter sah mit Verwunderung, dass auf sämtlichen Sitzgelegenheiten Würfelzucker herumlag, teilweise zu kleinen Bauwerken zusammengefügt.
»Nikis Werk«, seufzte die Tante, während sie den Zucker einsammelte. »Waren viele Leute bei dem Begräbnis?«, fragte sie dann. »Ich wollte selbstverständlich auch hinkommen, aber Niki … Niki war so quengelig, dass ich auf halbem Weg wieder umgekehrt bin. Stell dir vor, er hat sich mitten auf der Straße auf den Boden geworfen und war nicht dazu zu bewegen, aufzustehen und weiterzugehen. Ich musste ihn ein Stück tragen. Hat er das früher auch schon gemacht?«
Dieter war um eine Antwort verlegen. Er merkte plötzlich, dass er sehr wenig über seinen Sohn wusste.
»Ich hatte gar nicht mit eurem Kommen gerechnet«, erwiderte er schließlich ausweichend. »Der Kleine wäre möglicherweise durch die Beerdigung überfordert gewesen. Er hätte die Vorgänge nicht verstanden.«
»Ja, das habe ich mir auch gesagt, als ich mit ihm glücklich wieder zu Hause war«, stimmte die Tante ihm zu. Sie warf die Zuckerstücke in einem Emailletopf und sank auf einen Fauteuil.
Maria Rupp war eine hübsche, etwas mollige Frau. Sie hatte die Fünfzig bereits überschritten, aber da sie ihrem Äußeren eine sorgfältige Pflege hatte angedeihen lassen, wirkte sie jünger. An diesem Tag allerdings nicht. Jetzt lagen Ringe unter ihren Augen, ihre Haut war fahl, ihr Haar strähnig. Ihre Blicke schweiften hastig durch den Raum, und plötzlich stand sie wieder auf und hob lauschend den Kopf.
»Was ist?«, fragte Dieter. Seine Tante kam ihm seltsam verändert vor. Bisher hatte er sie für die Ruhe in Person gehalten, doch jetzt benahm sie sich fahrig und nervös.
»Nichts ist. Ich dachte, ich hätte Niki rufen hören. Nein, es ist still. Oder soll ich doch nachsehen? Nein, lieber nicht. Falls er schläft, wecke ich ihn womöglich auf.«
Dieter räusperte sich. Die Frage, die er hatte stellen wollen, erübrigte sich beinahe. Es lag auf der Hand, dass Niki nicht eitel Glück und Wonne in Tante Marias Leben gebracht hatte. Was er insgeheim befürchtet hatte, war eingetreten. Tante Maria war deutlich überfordert. Sie hatte sich mittlerweile wieder hingesetzt. Ihre Haltung drückte schlaffe Müdigkeit aus.
»In den letzten Tagen frage ich mich ständig, wie andere Frauen das schaffen«, sagte sie plötzlich, als ob sie Dieters Gedanken erraten hätte. »Ich hätte niemals gedacht, dass ein einziges Kind so viel Mühe machen kann.«
Dieter blickte betreten auf den kahlen, teppichlosen Boden. »Sobald ich eine andere Möglichkeit gefunden habe, werde ich dir den Jungen abnehmen«, murmelte er. »Ich weiß, es war eine Unverschämtheit von mir, ihn dir aufzuhalsen. Aber ich war so durcheinander, dass ich nicht daran dachte, was für eine Last das Kind für dich sein muss.«
»Ach, Dieter!«, rief Maria Rupp in einem kläglichen Tonfall aus. »Du brauchst dicht nicht zu entschuldigen! Ich habe mich ja erboten, Niki zu mir zu nehmen. Es geschah aus der besten Absicht heraus.Vor zwanzig Jahren war ich sehr, sehr traurig, weil ich keine Kinder bekommen konnte. Jetzt … jetzt sehe ich allmählich ein, dass es so am besten war. Wer weiß, ob ich ihnen eine gute Mutter gewesen wäre. Oder vielleicht ist es jetzt zu spät, vielleicht bin ich zu alt. Tatsache ist, dass ich mit Niki einfach nicht zu Rande komme. Ich hielt ihn für ein braves, ruhiges Kind. Wenn ich deine Mutter besuchte, kletterte er auf meinen Schoß, blieb still sitzen und ließ sich liebkosen und Geschichten erzählen. Aber seit er bei mir ist, ist er wie ausgewechselt. Ich beschäftige mich pausenlos mit ihm, und trotzdem ist er nicht zufrieden.«
»Vielleicht bist du zu nachsichtig«, warf Dieter ein.
»Wie könnte ich zu einem so kleinen Kind streng sein!«, rief die Tante. »Er versteht es ja nicht, wenn ich ihm etwas verbiete oder befehle. Und ich verstehe ihn nicht«, fügte sie nach einer kurzen Pause hinzu. »Er redet so undeutlich. Und wenn ich nicht sofort begreife, was er will, beginnt er laut zu schreien und verlangt nach seiner Oma. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass Oma und Opa im Himmel sind, aber ich bezweifle, dass er auch nur ein Wort meiner Ausführungen richtig begriffen hat.«
Dieter nickte gedankenvoll. Es war nicht erstaunlich, dass Niki nach seinen Großeltern verlangte. Schließlich handelte es sich bei ihnen um die beiden Menschen, die ihn in ihre Obhut genommen hatten, als er ein winziger Säugling gewesen war. Sie waren seine eigentlichen Eltern gewesen, die er mit einem Schlag verloren hatte. Wie durch ein Wunder war er selbst – angeschnallt in seinem Kindersitz – bei dem schrecklichen Autounfall, der seinen Großeltern das Leben gekostet hatte, unverletzt geblieben. Nicht ein Haar war ihm gekrümmt worden. Er schien das grässliche Geschehen gar nicht mitbekommen zu haben.
Erst jetzt überlegte Dieter, ob sein Sohn nicht einen Schock erlitten haben könnte, ohne jedoch zu einem Ergebnis zu gelangen. Lydia hatte ihre Abneigung, den Jungen aufzunehmen, klar und deutlich ausgedrückt. Im Gegensatz zu seiner Verlobten zeigte Tante Maria zwar guten Willen, aber sie war gänzlich ungeeignet, Niki auf die Dauer zu versorgen.
»Mir wird eine Lösung einfallen«, sagte Dieter beschwörend halb zu sich selbst, halb zu Tante Maria.
Die Tante brachte ein mühsames Lächeln zustande und meinte tapfer: »Wir sollten diese Anfangsschwierigkeiten nicht überbewerten. Gewiss wird sich alles einrenken, sobald Niki sich an mich gewöhnt und seine Großeltern vergessen hat.«
Dieter schüttelte mutlos den Kopf. »Nein, Tante Maria. Ich kann nicht von dir verlangen, dass du dein ganzes Leben umkrempelst. Wenn ich nur Lydia dazu bringen könnte, den Jungen zu akzeptieren!«
Maria Rupp warf ihrem Neffen einen skeptischen Blick zu. »Ich glaube nicht, dass du deine Verlobte dazu bringen kannst, dass sie Niki betreut. Nur eine sehr selbstlose Frau wäre fähig, die Folge eines Seitensprungs ihres Mannes so zu lieben wie ein eigenes Kind. Ich wundere mich über dich. Wieso vermeidest du es, Nikis Mutter in deine Erwägungen mit einzubeziehen?«, fragte sie.
»Aglaja? Nein! Aglaja will mit Niki nichts zu tun haben.«
»Aber sie ist seine Mutter! Ich bin ihr einmal bei deinen Eltern begegnet und fand …«
»Bitte, erzähle mir nichts über Aglaja. Ich will nichts über sie hören«, schnitt Dieter seiner Tante heftig das Wort ab.
Doch so leicht ließ sich Maria Rupp nicht einschüchtern. »Hast du sie überhaupt über den Tod deiner Eltern informiert?«, erkundigte sie sich.
»Nein. Nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht«, musste Dieter zugeben.
»Dann solltest du dieses Versäumte schleunigst nachholen. Demnach weiß sie auch noch gar nicht, dass ihr Sohn jetzt bei mir lebt.«
»Du meinst, ich soll mit Aglaja Verbindung aufnehmen?«
»Du sollst nicht nur, du musst. Ist dir ihre Anschrift bekannt?«
»Hm – ja. Falls sie nicht mittlerweile umgezogen ist. Du meinst also …« Dieter stockte, denn aus dem Nebenzimmer kam ein Geräusch, das zuerst wie ein Glucksen klang, jedoch sehr schnell in ein Brüllen überging.
»Ist das Niki?«, fragte Dieter erschrocken.
»Ja. Kennst du denn die Stimme deines Sohnes nicht?«
»Dass sie eine solche Lautstärke erreichen kann, wusste ich nicht«, gestand Dieter und eilte hinter Tante Maria in den Nebenraum.
Niki hing über den Rand seines Gitterbettchens, drauf und dran, jeden Augenblick kopfüber hinunterzustürzen. Dieter erreichte ihn noch vor der Tante und hob ihn heraus. »Niki, was fällt dir ein, dich so weit aus deinem Bettchen zu beugen! Beinahe wärest du herausgefallen!«, rief er dabei.
Niki ging jedoch nicht darauf ein. »Will fort! Will zu Oma! Will zu Opa!«, schrie er und ruderte wild mit den Armen.
»Aber, Nikilein«, suchte Tante Maria das Kind zu beschwichtigen. »Du kannst nicht zu Opa und Oma. Sie sind im Himmel. Das habe ich dir schon oft genug erklärt.«
»Will auch in Himmel«, forderte Niki.
»Nein, das geht nicht. Schau, dein Vati ist gekommen«, bemühte sich Maria Rupp das Kind abzulenken. »Hast du deinen Vati lieb? Gib ihm ein schönes Küsschen. Da freut er sich.«
»Mag nicht Küsschen geben. Mag nicht Vati! Mag nicht Tante Maria! Vati ist böse, Tante Maria ist böse. Will zu Oma. Will zu Opa!«
»Was sagt er? Ich verstehe ihn so schlecht. Er redet undeutlich«, wandte sich Dieter fragend an seine Tante, denn Niki hatte seine Abneigung gegen ihn und die Tante unzusammenhängend und von stoßweisem Schluchzen unterbrochen vorgebracht.
»Er mag uns beide nicht. Er findet, wir seien böse. Er will zu seinen Großeltern. So viel zumindest konnte ich aus seinem Gebrabbel heraushören. Ich habe dir ja gesagt, dass er undeutlich spricht. Nun, für sein Alter dürfte seine Ausdrucksweise normal sein. Aber ich merke immer stärker, dass kleine Kinder fremdartige und unberechenbare Wesen für mich sind«, seufzte Maria Rupp. »Deine Mutter wusste viel besser mit ihnen umzugehen. Manche Frauen haben diese Begabung, aber ich gehöre offenbar zu denen, denen sie fehlt.«
Lydia gehört auch zur zweiten Kategorie, setzte Dieter im Stillen hinzu. Laut sagte er: »Und ich gehöre zu den nachlässigen Vätern. Aber das wird sich ändern. Irgendwie werde ich es schon einrichten, dass ich Zeit finde, mich mit Niki zu beschäftigen. Wir beide werden noch die besten Freunde werden – gelt, Niki?«
»Will zu Oma!«, heulte der kleine Bub. »Böse Tante Maria – hat Oma versteckt!«
»Was meint er?«
»Er beschuldigt mich, dass ich seine Oma versteckt hätte«, dolmetschte Maria Rupp.
»Will spielen«, verlangte der kleine Junge jetzt und hatte, bevor ihn sein Vater oder seine Großtante daran hindern konnten, auch schon das Kistchen mit seinen Spielsachen umgestülpt. In buntem Durcheinander kollerten Bausteine, kleine Plastikmännchen, Holzkugeln, einige Plüschtiere, eine erkleckliche Anzahl von Plastikautos und einige Bälle von verschiedener Größe auf den Boden.
Dieter merkte, dass seine Tante auch in diesem Raum den Teppich weggenommen hatte. Die Bälle rollten sogleich in verschiedene Richtungen und verschwanden unter Möbelstücken. Der Rest der Spielsachen bildete einen wirren Haufen. Niki stürzte sich hektisch darauf, ergriff einen gelben Plüschhund und schleuderte ihn durch die Luft.
»Aber, Niki, das ist doch kein Ball. Das ist ein Hund. Ein Wauwau. Der Wauwau wird weinen, wenn du ihn so schlecht behandelst. Du hast ihm weh getan«, hielt die Tante dem Kind vor.
»Wauwau weint!«, rief Niki erfreut aus. Er eilte dem Hund nach, hob ihn auf und betrachtete ihn eingehend. Als er jedoch keine Spur von Tränen an ihm entdecken konnte, ließ er ihn enttäuscht wieder fallen und sagte vorwurfsvoll: »Wauwau weint nicht. Tante Maria lügt.«
Diesmal hatte Dieter jedes Wort genau verstanden. Er wusste nicht, ob er lachen oder mit seinem Sohn schimpfen sollte. Da seine Tante so tat, als ob sie nichts gehört habe, entschloss er sich, es ihr gleichzutun.
Niki wühlte mittlerweile in dem Spielzeughaufen, aber keines der Dinge schien bei ihm Anklang zu finden.
»Bauen wir ein schönes Haus?«, fragte Dieter, wobei er sich auf den Fußboden setzte und die bunten Bausteine zusammenzusuchen begann.
Niki sah seinem Vater aufmerksam zu, aber als Dieter mit seinem Bauwerk begann, forderte er: »Niki will Sucki!«
»Was will er?«
»Würfelzucker«, erwiderte Maria Rupp auf Dieters Frage. »Anstelle von Bausteinen verwendet er lieber Würfelzucker. Du hast ja den Zucker vorhin im Wohnzimmer herumliegen sehen.« Sie entfernte sich und kehrte gleich darauf mit dem Topf voll Würfelzucker zurück, den sie vor Niki hinstellte.
Niki wollte mit beiden Händen hineingreifen, aber Dieter war schneller. Er zog den Topf weg, stand auf und deponierte den Topf auf einem Schrank, wo er für Niki unerreichbar war.
Niki riss erst erstaunt die Augen auf, dann den Mund und gab ein wütendes Protestgeheul von sich.
»Dieter, ich bitte dich! Warum hast du ihm den Zucker weggenommen?«
»Aber, Tante Maria, du kannst dem Kleinen doch nicht ständig nachgeben«, rechtfertigte Dieter sein Verhalten. »Mit Zucker spielt man nicht. Zum Spielen hat Niki ohnedies Unmengen von Spielzeug. Die Bauklötzchen müssten ihm zum Häuschen bauen reichen.«
»Du hast leicht reden, Dieter. Vermutlich sind deine Nerven besser als meine. Ich halte dieses Geschrei nicht aus. Deine Strenge mag ja durchaus gerechtfertigt sein, aber ich … ich möchte mir am liebsten die Ohren zuhalten.« Maria Rupps Stimme hatte einen schrillen Tonfall angenommen, der im Grunde genommen wenig zu ihr passte.
»Entschuldige, Tante Maria«, bat Dieter beschämt. »Ich habe kein Recht, dir in Bezug auf Niki irgendwelche Vorschriften zu machen. Ich bin heilfroh, dass er überhaupt bei dir sein kann.«
»Aber du befürchtest, dass ich ihn zu sehr verziehe«, warf die Tante ein.
»Ich befürchte, dass er deine Nerven ruiniert«, sagte Dieter.
»Das ist leicht möglich«, seufzte die Frau. »Dabei kann er auch brav und manierlich sein«, fügte sie flüsternd hinzu und deutete mit dem Kopf auf Niki, der ebenso plötzlich, wie er mit seinem Geheul begonnen hatte, damit wieder aufgehört hatte. Er kauerte lächelnd auf dem Boden und streichelte einen braunen wuscheligen Teddy.
»Was für ein hübsches Kind Niki ist«, fuhr Maria Rupp im Flüsterton fort. »Wenn man ihn so sieht, traut man ihm gar nicht zu, dass er trotzig und laut sein kann. Die schönen grauen Augen hat er von seiner Mutter, nicht wahr?«
»Es wird wohl so sein«, murmelte Dieter.
»Ach so, an sie darf man dich ja nicht erinnern. Dir sieht er jedenfalls nicht ähnlich. Na ja, vielleicht hat er die breite Stirn von dir. Und die Form der Augenbrauen. Die Haarfarbe ebenfalls. Seine Mutter ist ja – äh – entschuldige.«
»Seine Mutter ist blond. Das wolltest du doch sagen!«
»Ja. Aber da du jedes Mal hochgehst, wenn ich sie erwähne, schließen wir dieses Thema lieber ab. Nur eines möchte ich nochmals betonen: Nikis Mutter muss unbedingt erfahren, dass ihr Sohn jetzt bei mir ist. Soll … soll ich ihr schreiben?«
»Nein, danke. Das erledige ich selbst.«
Eine Weile beobachtete Dieter seinen Sohn, der nun friedlich mit seinen Plüschtieren spielte. Er plapperte dabei halblaut vor sich hin. Für seinen Vater blieb dieses Geplapper jedoch meist unverständlich. Dieter erfasste nur so viel, dass sein Sohn einmal Niki war, dann wieder in die Rolle des Teddys oder des Plüschhundes schlüpfte. Zu seiner Verwunderung merkte Dieter, dass er darauf brannte, sich neben seinen Sohn zu kauern und an dem Spiel teilzunehmen, aber er wagte es nicht, das Kind zu unterbrechen.
Maria Rupp benutzte mittlerweile die günstige Gelegenheit, um ihr Wohnzimmer aufzuräumen. Als sie damit fertig war, atmete sie auf und meinte zu Dieter: »Seit Tagen habe ich mich danach gesehnt, wieder Ordnung in meine Wohnung zu bringen. Ich kam nicht dazu, weil ich mich nicht traute, Niki aus den Augen zu lassen. Bei einem so kleinen Kind weiß man ja nie, was ihm im nächsten Augenblick einfällt. Du warst vorhin selbst Zeuge, dass Niki sich waghalsig aus seinem Bettchen beugte. Es wäre schrecklich für mich, wenn ihm etwas zustieße, während er in meiner Obhut ist.«
»Du kannst aber nicht ununterbrochen auf ihn aufpassen.«
»Hm … Was hältst du von der Idee, ihn in einen Kindergarten zu schicken? Soll ich mich nach einem Platz für ihn erkundigen?«
»Die Idee ist nicht schlecht«, pflichtete Dieter seiner Tante bei. »Du wärst dann einigermaßen entlastet. Noch besser wäre es, wenn ich Niki zu mir nehmen würde. Er ist mein Sohn. Ich habe mich lange genug vor der Verantwortung gedrückt.«
*
Diese Einsicht, zu der Dieter am Tag der Beerdigung seiner Eltern gelangt war, half ihm leider nicht, das Problem zu lösen. Während der nächtlichen Bahnfahrt von Frankfurt nach Maibach zermarterte er sich den Kopf, wie es nun weitergehen solle. Er war bis zum Abend bei seiner Tante geblieben und hatte geholfen, Niki das Abendessen zu verabreichen und ihn zu Bett zu bringen. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er am Bett seines Sohnes gesessen, hatte ihm eine lange Gute-Nacht-Geschichte erzählt und gewartet, bis der Kleine vom Schlaf übermannt worden war. Dabei hatten sich sich seltsame Gefühle in ihm geregt. Er hatte nicht nur bedauert, dass er sich bisher kaum um seinem Sohn gekümmert hatte, sondern auch, dass er voraussichtlich keine weiteren Kinder in die Welt setzen würde. Lydia hatte aus ihrer diesbezüglichen Einstellung kein Hehl gemacht. Sie wollte keine Kinder, und er sah keine Möglichkeit, sie umzustimmen.
Das Traurige an der Situation war, dass der schuldlose kleine Bub nun Elternliebe und Geborgenheit entbehren musste. Dieter war zwar fest entschlossen, Niki von Tante Maria wegzuholen, aber er hatte nicht die geringste Ahnung, wo er seinen Sohn unterbringen sollte. Wider besseres Wissen nährte er in seinem tiefsten Inneren immer noch die Hoffnung, dass Lydia Einsicht zeigen würde. Gewiss, sie wollte keine Kinder, aber Niki war nun einmal vorhanden. Jeder, dessen Herz nicht völlig verhärtet war, musste Mitleid mit dem Kind haben, das durch den plötzlichen Tod seiner Großeltern so etwas wie eine Waise geworden war.
Dieter kam spät in der Nacht in Maibach an. Mit einem Taxi ließ er sich zu seiner Wohnung, die eigentlich Lydia gemietet hatte, bringen. Finsternis und Stille empfing ihn. Lydia war natürlich längst zu Bett gegangen. Leise, um sie nicht zu wecken, legte sich auch Dieter nieder, aber er konnte lange nicht einschlafen.
Erst am nächsten Abend ergab sich für Dieter eine Gelegenheit, mit seiner Verlobten über Niki zu sprechen. Nach dem Abendessen begann Lydia von Frühjahrskostümen, neuen aktuellen Stofffarben und mustern und von den während ihrer Abwesenheit eingetroffenen Badeanzügen zu reden.
Dieter ging darauf nicht ein. Er war nahe daran, die Beherrschung zu verlieren. Lydia verlor kein Wort über seinen Besuch bei Tante Maria und Niki, sie stellte ihm keine Frage über das Ergehen seines Sohnes, sondern plauderte heiter und gelassen über das neue blasse Blaugrün, das in der kommenden Sommersaison der letzte Schrei sein würde.
»Bist du tatsächlich so herzlos und oberflächlich, wie du dich im Moment gibst?«, entfuhr es Dieter.
»Wie bitte?« Lydia glaubte nicht richtig gehört zu haben.
Dieter sprang auf und lief gereizt in dem nicht großen, aber sehr geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer auf und ab.
»Was willst du?Warum rennst du wie ein gereizter Tiger hin und her?«, fragte Lydia in einem lässigen, leicht spöttischen Tonfall.
»Da fragst du noch?«, konterte Dieter aufgebracht. »Ich kann in der Nacht vor Sorgen nicht schlafen, grübele den ganzen Tag darüber nach, was aus Niki werden soll, und du hast nichts anderes im Kopf als die neue Frühjahrs- und Sommermode und ob der Absatz von all dem Plunder zufriedenstellend ausfallen wird.«
»Was sollte ich sonst im Kopf haben? Mein Beruf ist mir eben wichtig! Wenn der Absatz von all dem Plunder, wie du es nennst, nicht zufriedenstellend ausfällt, wird man mir die Schuld in die Schuhe schieben. Dann kann ich zittern, dass man mir kündigt oder mich auf irgendeinen untergeordneten Posten abschiebt. Das ist die hässliche Wahrheit, die ich dir nicht so ungeschminkt unter die Nase reiben wollte. Ich habe in einem fröhlichen Plauderton gesprochen, weil ich ja weiß, dass es keinen Sinn hat, dir etwas vorzujammern. Du hast noch nie Anteil an meinen beruflichen Sorgen genommen, obwohl wir jahrelang hauptsächlich von meinem Verdienst gelebt haben.«
Wieder einmal hatte Lydia ihre Worte geschickt so gewählt, dass Dieter in die Defensive gedrängt war. Diesmal ließ er sich jedoch nicht einschüchtern. Langsam bekam er es satt, ständig daran erinnert zu werden, dass Lydia eine Zeitlang seinen Lebensunterhalt bestritten hatte.
»Im Vergleich mit meinen Sorgen sind die deinen weniger gravierend«, brummte er.
»Weniger gravierend? Du denkst also, weil ich eine Frau bin, soll ich mich mit einer untergeordneten Stellung zufriedengeben, während du alles erreicht hast, was du angestrebt hast! Du hast dein Studium erfolgreich beendet. Aus einem mittellosen Studenten ist ein angesehener Akademiker geworden, der natürlich die beruflichen Kümmernisse einer ehemaligen Verkäuferin als geringfügig beiseite schiebt. Du bist jetzt etwas Besseres als ich – halte mir das nur ständig vor!«
»Aber, Lydia, davon war nie die Rede!«
Dem schlauen Manöver seiner Verlobten war Dieter nicht gewachsen. Auch diese Auseinandersetzung würde so wie alle früheren enden: Er war derjenige, der Unrecht hatte. Flüchtig ging ihm durch den Sinn, ob es nicht klüger gewesen wäre, wenn er auf die akademische Laufbahn verzichtet, Aglaja geheiratet und sich irgendeine Arbeit gesucht hätte. Damals, vor dreieinhalb Jahren, war ihm ein solcher Gedanke nicht gekommen, vor allem deshalb nicht, weil er sich fest an Lydia gebunden gefühlt hatte. Jetzt drängte sich ihm plötzlich die Überlegung auf, ob er damals richtig gehandelt hatte.
»Woran denkst du?«, fragte Lydia argwöhnisch.
Dieter blieb abrupt stehen. In seinen ehrlichen braunen Augen lag ein gequälter und zugleich beschämter Ausdruck. Hatte Lydia einen Teil der Überlegungen, die er soeben angestellt hatte, erraten? Ahnte sie, dass er seine Bindung an sie als Fessel zu empfinden begann?
Lydia war schön, Lydia war tüchtig. Sie hatte ihm viel geholfen, und er war ihr zu Dank verpflichtet. Aber liebte er sie noch? Hatte er sie überhaupt jemals geliebt? Wieso war es damals zu dem Zwischenfall gekommen? Wieso hatte er Lydia betrogen? Schließlich war er alles andere als ein flatterhafter Mensch, der eine zeitweilige Trennung von der Partnerin sogleich zu einem Seitensprung ausnutzte.
»Woran denkst du?«, fragte Lydia noch einmal, diesmal drängender und mit einer Spur von Besorgnis.
»Ich – äh – vor allem an Niki«, erwiderte Dieter stockend.
»Aha.« Nur mit Mühe unterdrückte Lydia den Ärger, der in ihr hochwallte. Niki war ihr vollkommen gleichgültig. Bisher hatte sie kaum Gefühle für ihn verschwendet. Dieters Untreue hatte sie empfindlich gestört – bis sie gemerkt hatte, dass sich daraus Vorteile für sie herausschlagen ließen. Hin und wieder ein geschicktes Wort,eine kurze Andeutung – und Dieter wurde von Gewissensbissen gequält und ordnete sich ihr gefügig unter. Aus diesem Grund hatte sie Nikis Dasein nicht allzu sehr gestört. Er war ja von seinen rüstigen Großeltern gut versorgt worden. Die Möglichkeit, dass sich daran etwas ändern könnte, war ihr nie in den Sinn gekommen.
»Kannst du nicht an den Jungen denken, ohne dabei herumzurennen?«, fragte Lydia, denn Dieter hatte seinen Marsch durch den Wohnraum wieder aufgenommen.
»Ich kann nicht ruhig sitzen«, stieß er hervor. »Du hast ja keine Ahnung, was es heißt, für ein Kind verantwortlich zu sein und keinen Rat zu wissen.«
»Dramatisierst du die Angelegenheit nicht ein bisschen? Bisher hat dich deine Verantwortung nicht sonderlich belastet.«
»Weil ich Niki in bester Obhut wusste. Aber jetzt – meine Befürchtung hat sich leider bestätigt. Tante Maria wird mit Niki nicht fertig. Sie kann mit Kindern nicht umgehen, sie behandelt Niki falsch.«
»Sie wird es noch lernen«, warf Lydia begütigend ein.
»Nein. Tante Maria ist mit dem Kind eindeutig überfordert. Sie muss auf ihre gewohnte Bequemlichkeit, auf ihre gepflegte Wohnung und auf den Umgang mit ihren Freunden und Bekannten verzichten. Ich kann ihr das nicht länger zumuten.«
»Aha, nun wären wir glücklich wieder so weit«, rief Lydia aufbrausend aus. »Deiner Tante willst du einen Verzicht auf ihre gewohnte Bequemlichkeit nicht zumuten, bei mir bist du weniger rücksichtsvoll. Wobei ich allerdings nicht auf Bequemlichkeit verzichten müsste – die leiste ich mir sowieso nicht –, sondern auf meinen Beruf.«
»Würde dir das wirklich so schwerfallen? Du brauchtest keine Misserfolge, keine Kündigung und keine Versetzung mehr zu fürchten. Du bist und, du könntest dich viel besser auf das Kind einstellen als Tante Maria.«
»Ich will aber nicht«, entgegnete Lydia heftig. »Ich will mich nicht mit einem unfolgsamen Bengel herumplagen …«
»Niki ist kein unfolgsamer Bengel«, fiel Dieter seiner Verlobten beleidigt ins Wort.
Lydia besann sich. Ihr Instinkt riet ihr zur Vorsicht. Bisher hatte sich Dieter nie als ein in seinen Sohn vernarrter Vater gezeigt. Offenbar war da plötzlich eine Änderung eingetreten. Es brachte ihr nichts ein, wenn sie ihn vor den Kopf stieß, indem sie über das Kind schimpfte. Falls Dieter nicht lockerließ und Niki nach Maibach holte, würde sie sich den Jungen noch irgendwie vom Halse schaffen. Dazu war sie fest entschlossen.
»Also schön, Niki ist ein liebes, braves Kind«, lenkte sie ein. »Trotzdem bezweifle ich, dass ich je imstande sein werde, ihm die Mutter zu ersetzen. Du musst dich unbedingt mit deiner verflossenen Geliebten in Verbindung setzen und ihr das Problem vor Augen halten.«
»Hm – ja, Tante Maria war ähnlicher Meinung«, sagte Dieter.
»Vielleicht ist Nikis Mutter mit Freuden bereit, ihn zu sich zu nehmen«, wagte sich Lydia einen Schritt weiter vor. »Rede ihr gut zu, erzähle ihr, wie wenig deine Tante geeignet ist, den Jungen zu versorgen. Fahre so bald wie möglich nach Wien.« Sie setzte ein kokettes Lächeln auf, als sie fortfuhr: »Eigentlich sollte ich dir ja gar nicht gestatten, mit dieser Frau zusammenzukommen. Schließlich habe ich allen Grund, auf sie eifersüchtig zu sein.«
»Den hast du nicht«, widersprach Dieter ihr. »Aglaja ist mir gegenüber feindselig eingestellt – wofür sie allen Grund hat.«
Dieter scheute vor einem Wiedersehen mit Aglaja Bergmann zurück. Er fürchtete sich sogar davor – und doch, irgendwo tief in seinem Herzen steckte ein Funke, der nur darauf wartete, neu aufzulodern. Aber so weit durfte es niemals kommen. Dafür garantierten seine Gewissensbisse und eben Aglajas Feindseligkeit.
Dieter setzte sich endlich wieder neben Lydia auf das Sofa. Eine Weile verharrte er in nachdenklichem Schweigen, dann fragte er plötzlich: »Aber was machen wir, falls Aglaja sich weigert, Niki zu nehmen? Das wird sie höchstwahrscheinlich tun. Sie wird es niemals wagen, ihren Eltern ein Geständnis abzulegen. Bitte, Lydia, hilf mir!«
Lydia spürte, dass sie sich diesem Hilferuf nicht verschließen durfte. Ihre Gedanken waren inzwischen eigene Wege gegangen und hatten feste Gestalt angenommen. Ihr war die rettende Idee gekommen, wie sie sich Nikis entledigen konnte, ohne allzu viel Staub aufzuwirbeln. Sie wusste, es bestand nur eine geringe Aussicht, dass Aglaja Berg mann ihren Sohn zu sich nahm. Dennoch war es notwendig, dass Dieter umgehend nach Wien fuhr. Schließlich brauchte sie, Lydia, ein bis zwei Tage freie Hand, um Niki aus dem Weg zu schaffen.
»Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag«, sagte Lydia eindringlich. »Ich werde mir ein paar Tage Urlaub nehmen. Hole deinen Sohn Nikolaus her …«
»Lydia, Liebste, ich wusste ja, dass du Mitleid mit dem armen Kind haben würdest …«
»Nein, warte noch ein wenig mit deinen überschwänglichen Dankesbezeugungen«, bremste Lydia ihren Verlobten. »In diesen paar Urlaubstagen werde ich versuchen, Niki – so gut ich kann – zu versorgen. Allerdings unter der Bedingung, dass du nach Wien fährst und Nikis Mutter überredest, ihre Pflicht dem Kind gegenüber zu erfüllen. Das ist ein faires Angebot.«
»Aber wenn Aglaja ihre Pflicht – wie du es bezeichnest – nicht erfüllt? Wenn meine Überredungskünste nicht überzeugen?«
»Hör auf mit deinem ewigen ›wenn‹ und ›falls‹, ich halte das nicht mehr aus«, begann Lydia aufbrausend. Sie nahm sich jedoch rasch zusammen und fuhr ruhiger fort: »In diesem Falle werden wir beide eine zufriedenstellende Lösung finden. Darauf kannst du dich verlassen.«
*
»Es ist langweilig!«, jammerte Heidi Holsten. »Ich möchte viel lieber zur Schule gehen, wie die anderen, statt hier herumzusitzen und zu warten, bis sie zurückkommen. Hermann lässt sich heute mit dem Schulbus schrecklich viel Zeit. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt.«
»Male den Teufel nicht an die Wand«, wies die Kinderschwester Regine Nielsen das kleine Mädchen erschrocken zurecht. Durch einen Blick auf ihre Armbanduhr vergewisserte sie sich, dass bis zu der Heimkehr der Kinder noch ungefähr zehn Minuten Zeit blieben. Ein Umstand, den sie Heidi sofort mitteilte.
»Noch zehn Minuten?«, wiederholte das kleine Mädchen ungläubig. »So lange noch? Könnten wir beide nicht einstweilen mit dem Mittagessen anfangen? Ich bin schon schrecklich hungrig.«
»Nein, selbstverständlich warten wir mit dem Essen, bis alle da sind.«
»Aber ich bin hungrig! Ich werde in die Küche gehen und Magda bitten, mir ein Wurstbrot oder ein Stück Kuchen zu geben.«
»Halt! Du wirst schön brav hier im Aufenthaltsraum bleiben«, hielt Schwester Regine ihren Schützling zurück. »Vor dem Essen wird nicht genascht. Das gewöhnen wir uns gar nicht an.«
»Ich will ja gar nicht naschen«, widersprach Heidi ihr entrüstet. »Ich will ein Wurstbrot essen. Naschen ist, wenn man Schokolade oder Bonbons isst.«
»Danke für die Belehrung.« Die Kinderschwester lachte. »Trotzdem wirst du dir jetzt kein Wurstbrot holen, sondern warten, bis die anderen aus der Schule kommen.«
Das Wort ›Schule‹ brachte Heidi wieder auf den Ausgangspunkt ihre Quengeleien zurück. »Ich möchte so gern ebenfalls zur Schule gehen. In der Schule ist es lustig. Dort sind viele Kinder.«
»Hm, wer weiß, ob du die Schule noch lustig finden wirst, wenn du hingehen musst«, meinte Schwester Regine. »Glaubst du, du kannst dort den ganzen Vormittag hindurch spielen und schwätzen? Du wirst schreiben und lesen lernen müssen …«
»Ich kann schon schreiben«, unterbrach das kleine Mädchen die junge Frau. »Ich kann meinen Namen schreiben, und zählen kann ich bis zwanzig und zeichnen kann ich und singen. Soll ich dir ein Lied vorsingen?«
»Später. Zuvor müssen wir hier aufräumen. Du hast im ganzen Raum Papierschnitzel verstreut.«
»Das sind Schneeflocken«, erklärte Heidi. »Jetzt im Winter – aber draußen schneit es ja nie.«
»Aha, und da hast du zum Ausgleich hier herinnen ›Schneeflocken‹ ausgestreut«, meinte die Kinderschwester lächelnd.
»Leider kann man aus diesen Schneeflocken keinen Schneemann bauen«, seufzte Heidi. »Ach, Schwester Regine, mir ist schrecklich fad. Sind die zehn Minuten schon um?«
»Noch nicht ganz. Es können übrigens auch elf oder zwölf Minuten daraus werden. Oder sogar mehr. Die Kinder kommen nur selten auf die Sekunde pünktlich aus der Schule.«
»Mir ist so langweilig!«
Die Kinderschwester konnte diese Klage schon nicht mehr hören, obwohl sie Heidi bis zu einem gewissen Grad verstehen konnte. Was Heidi fehlte, waren gleichaltrige Spielkameraden. Sie war zurzeit das jüngste Kind von Sophienlust und das einzige, das noch nicht die Schule besuchte.
Unter den rund zwanzig Kindern, die in dem Kinderheim Sophienlust Platz hatten, befanden sich meist einige, die noch nicht schulpflichtig waren. Allerdings wechselten diese Kinder häufig. Sie wurden von ihren Eltern oder Angehörigen wieder nach Hause geholt. Heidi aber blieb in Sophienlust. Sie war Vollwaise und besaß keine Verwandten. Sophienlust war zu ihrer zweiten Heimat geworden.
Hin und wieder fragte sich Schwester Regine, ob bei Heidi nicht jedes Mal ein kleiner Stachel zurückblieb, wenn ein anderes Kind das Heim verlassen durfte. Heidis letzte kleine Freundin war erst vor wenigen Tagen von ihrer Mutter, die ein zweites Mal geheiratet hatte, abgeholt worden. Dieses kleine Mädchen ging Heidi jetzt sichtlich ab.
Aus diesen Gedanken heraus sagte die Kinderschwester: »Sobald wir wieder einen Neuzuwachs haben, wird dir nicht mehr fad sein. Gewiss wird es nicht lange dauern, bis wir wieder ein kleines Mädchen bekommen, das im Alter zu dir passt und gern mit dir spielt.«
Heidi horchte auf. »Weißt du das genau?«, fragte sie. »Hat Tante Isi dir vielleicht schon etwas von diesem Mädchen erzählt?«
»Ach, Heidi, du hast mich missverstanden. Ich dachte nicht an ein bestimmtes Mädchen. Ich wollte dir nur zu verstehen geben, dass du nicht traurig sein musst, weil du im Moment keine gleichaltrige Spielgefährtin hast. Ich bin halt doch nur ein schlechter Ersatz.«
»O nein, Schwester Regine!«, rief Heidi stürmisch und legte beide Arme um den Hals der jungen Frau, was ihr insofern leichtfiel, da die Kinderschwester am Boden kniete, um die letzten ›Schneeflocken‹ unter den Tischen hervorzuholen. »Du bist kein Ersatz. Ich habe dich sehr, sehr lieb. Ich bin froh, dass ich dich habe. Bist du froh, dass du mich hast?«
»Sehr froh«, bestätigte Schwester Regine lächelnd. »Wenn ich dich nicht hätte, wäre nämlich mir fad.«
»Ich werde immer in Sophienlust bleiben«, versprach Heidi feierlich.
»Hm.« Die Kinderschwester zögerte, aber dann sprach sie doch die Frage, die sie bewegte, vorsichtig aus. »Tut es dir nicht manchmal leid … Ich meine, bist du nicht manchmal traurig, weil du schon so lange in Sophienlust lebst, während die meisten anderen Kinder nur kurz bei uns sind?«
»Ich bin nie traurig. Nicht einmal dann, wenn mir fad ist.«
»Aber – hast du noch nie mit einem anderen Kind tauschen wollen?« Die junge Frau hatte diese Frage kaum gestellt, als sie sie auch schon bereute. Es war ein Fehler, Heidi auf solche Dinge zu bringen. Sie konnte ja mit niemandem tauschen. »Vergiss meine dumme Frage«, bat die Kinderschwester.
Heidi runzelte jedoch die Stirn und überlegte laut: »Mit Nick möchte ich schon tauschen. Er ist fast erwachsen und so gescheit. Er weiß fast alles. Hm – nein, eigentlich möchte ich doch nicht mit Nick tauschen. Ich mag kein Junge sein. Ich bin viel lieber ein Mädchen. Jetzt weiß ich, mit wem ich tauschen möchte: Mit Pünktchen. Pünktchen ist auch gescheit, und sie hat so lustige Sommersprossen auf der Nase. Und sie hat so schöne blonde Haare!«
»Du hast doch ebenfalls blonde Haare, Heidi.«
»Meine Haare sind gar so hell. Pünktchen hat schönere Haare. Und sie darf zur Schule gehen, kann stricken und Puppenkleider nähen. Warum lachst du, Schwester Regine?«
»Weil ich deinen Wunsch, ausgerechnet mit Pünktchen tauschen zu wollen, ziemlich überflüssig finde. Auch du wirst eines Tages zur Schule gehen und stricken und Puppenkleider nähen.«
»Warum hast du mich dann gefragt, ob ich gern mit einem anderen Kind tauschen würde? Außer Pünktchen fällt mir niemand ein.«
»Ich dachte … ich meinte, du wärst manchmal gern anstelle eines Kindes, das von seinen Eltern nach Hause geholt wird …«
»Aber ich bin ja zu Hause!«, rief Heidi und riss dabei ihre blauen Augen erstaunt auf. »Ich bin in Sophienlust zu Hause. Ich brauche keine Eltern, die mich wegholen. Ich habe ja dich und Tante Isi, und Tante Ma und Nick und Pünktchen.«
»Ja, ja«, unterbrach die Kinderschwester diese Aufzählung. Im Stillen atmete sie auf. Sie war erleichtert, dass Heidi so dachte, dass sie das Kinderheim als ihr Zuhause betrachtete.
»Schaust du noch einmal auf die Uhr, Schwester Regine?«, bat Heidi. »Jetzt müssen die zehn Minuten schon um sein.«
»Ja, sie sind um.«
»Wo bleiben dann – ha, sie kommen!« Heidi lief hinaus in die große Halle, den Schulkindern entgegen. »Endlich seid ihr da!«, begrüßte sie die Ankömmlinge. »Mir war schrecklich fad. Was spielen wir?«
»Spielen? Jetzt essen wir erst einmal. Zuvor müssen wir die Mäntel und Jacken ausziehen und uns die Hände waschen«, dämpfte Pünktchen die Ungeduld des kleinen Mädchens.
Heidi ließ sich jedoch nicht so leicht abschütteln. Sie folgte den größeren Mädchen in den Waschraum und plapperte dabei unaufhörlich über die diversen Möglichkeiten, wie sie den Nachmittag verbringen könnten.
»Nein, Heidi, draußen im Park ist es zu kalt zum Verstecken spielen«, verwarf Vicky ausgerechnet den Vorschlag, an dem Heidi am meisten lag.
»Aber es scheint die Sonne«, machte Heidi geltend. »Wenigstens hie und da«, schränkte sie ein.
»Hie und da ist gut«, sagte Angelika, Vickys ältere Schwester. »So ungefähr um zehn hat sie ein paar Minuten zwischen den Wolken hervorgeblinzelt, das war alles.«
»Vielleicht blinzelt sie wieder«, meinte Heidi hoffnungsvoll.
»Vielleicht – aber das würde nicht viel nützen.Trotz Sonnenschein wäre es eisig kalt im Park. Es weht nämlich ein ekelhafter Wind. Wir mussten nur das kurze Stück von der Auffahrt über die Freitreppe in die Halle laufen, trotzdem ist meine Nasenspitze rot geworden«, sagte Irmela, das älteste Mädchen, während sie sich kritisch im Spiegel musterte und an ihrer Nase herumrieb.
»Lass das lieber bleiben, Irmela«, rief Pünktchen. »Deine Nase wird nämlich immer röter.«
»Hu – hoffentlich ist sie nicht erfroren!«
»Unsinn.Von dem kurzen Stück Weg doch nicht«, bemühte sich Pünktchen die Ängste ihrer Freundin zu zerstreuen.
»Also, mich bringt ihr heute nicht mehr ins Freie«, sagte Vicky entschlossen. »Ich habe nicht die geringste Lust, mich da draußen in einen Eiszapfen zu verwandeln.«
»Aber wir können uns doch warm anziehen.«
»Ach, Heidi, du Quälgeist. Wir könnten uns dick vermummen, und trotzdem würden wir es nicht lange in den Verstecken aushalten. Ich bin auch gern draußen im Park, aber nicht bei so arktischen Temperaturen wie heute«, sagte Pünktchen.
Die Debatte wäre wahrscheinlich noch eine Weile weitergegangen, wenn die Kinderschwester nicht die Tür zum Waschraum geöffnet und die Mädchen zur Eile angetrieben hätte.
Heidi, die vor lauter Eifer, die anderen zum Verstecken spielen im Park zu überreden, das Händewaschen vergessen hatte, benetzte ihre Händchen schnell mit ein paar Wassertropfen und wollte kurz nach dem Handtuch greifen.
»O nein, so geht das nicht«, erhob die Kinderschwester, die genau aufgepasst hatte, Einspruch. »Du hast die Seife vergessen.«
»Nein, ich habe sie nicht vergessen. Ich wollte mich beeilen, damit die anderen nicht auf mich warten müssen«, rechtfertigte Heidi ihre Unterlassungssünde.
Schwester Regine verbiss sich ein Lächeln, während sie Heidis kleine Hände gründlich säuberte. Danach eilte das Kind davon, um die größeren Kinder einzuholen.
»Wir könnten auch im Haus Verstecken spielen«, brachte Heidi vor, als sie die Freundinnen erreicht hatte.
»Warten wir ab, was die Jungen dazu meinen«, sagte Pünktchen. Sie hatte gehofft, mit dieser Bemerkung Heidi zum Schweigen zu bringen, aber das kleine Mädchen schaffte es, noch ein halbes Dutzend weiterer Vorschläge vorzutragen, bis endlich alle um den Tisch saßen und ihre Suppe löffelten.
Kaum war Heidi mit der Nachspeise fertig, da ging es von neuem los. »Habt ihr euch jetzt entschieden?«, drängte sie. »Gehen wir in den Wintergarten und spielen Puppenjause? Oder verkleiden wir uns mit den Sachen aus der Kostümkammer oder spielen wir Schule?«
»Das ist alles uninteressant«, meinte einer der Jungen ablehnend. »Lauter Spiele, die nur euch Mädchen freuen.«
»Dann macht ihr einmal einen Vorschlag!«, rief Heidi.
»Gern«, ging Fabian Schöller auf diese Herausforderung ein. »Draußen ist es schön kalt …«
»Schön nennst du das?«, warf Irmela empört ein, noch bevor Fabian zu seinem eigentlichen Vorschlag gekommen war. »Ich nenne das scheußlich!«
»Mir macht die Kälte nichts aus«, behauptete Fabian. »Ich ziehe mir eben meine Mütze fest über die Ohren – aber dazu seid ihr Mädchen natürlich zu eitel.«
»Fabian beleidigt uns«, murrte Irmela und sah Hilfe suchend erst zu der Kinderschwester, dann zu Frau Rennert, der Heimleiterin, hinüber. Doch die erwartete Hilfe blieb aus.
»Hm, Fabian hat nicht so unrecht«, ließ Frau Rennert sich vernehmen. »Selbst bei klirrender Kälte weigert ihr euch, eure Wollmützen aufzusetzen, und geht ohne Kopfbedeckung ins Freie.«
»Wir haben ja Haare auf dem Kopf. Die schützen doch auch gegen die Kälte«, brachte Pünktchen – allerdings ziemlich zaghaft – vor. »Diese Wollmützen sind so lästig. Sie zerstören jede Frisur. Wenn man sie dann abnimmt, sieht man wie abgeschleckt aus.«
»Ha, ich habe es ja gewusst. Nur eure Eitelkeit ist schuld daran, dass ihr friert!«, rief Fabian triumphierend aus.
Von Tante Ma – wie die Heimleiterin von den Kindern liebevoll gerufen wurde – oder der Kinderschwester hätte Pünktchen sich eine derartige Rüge gefallen lassen, von einem Buben, noch dazu einem, der jünger war als sie selbst, jedoch nicht. »Wir frieren ja nicht am Kopf. Unsere Nasen frieren. Sollen wir uns etwa die Mützen bis über die Nasen ziehen?«, hielt sie Fabian vor.
Anstatt sich geschlagen zu geben, kicherte der Junge und meinte: »Das würde euch gar nicht so schlecht stehen. Wenigstens kann man dann eure Gesichter nicht sehen.«
»Was?«
»Du bist gemein!«
»Sind unsere Gesichter vielleicht nicht schön genug?«
Die beiden Erwachsenen blieben ruhig, aber die übrigen weiblichen Anwesenden fielen entrüstet über Fabian her.
»Bitte – ich habe nur einen Spaß gemacht«, zog der Bub sich in Verteidigungsstellung zurück. »Ihr seid alle wunderschön.«
»Ist das dein Ernst?«, fragte Pünktchen misstrauisch.
»Ja, ja, bestimmt. Darf ich jetzt endlich sagen, was wir heute unternehmen könnten?«
»Schieß los!«
»Wir könnten eislaufen. Auf dem Waldsee. Der ist sicher zugefroren.«
»Eine prima Idee«, nahmen die Jungen und einige Mädchen, darunter auch Heidi, Fabians Vorschlag begeistert auf.
»Wir müssten aber bald weggehen, sonst zahlt es sich nicht mehr aus. Es wird zeitig finster«, sagte Schwester Regine, der Fabians Idee nicht unwillkommen war, denn die unfreundliche Witterung der vergangenen Tage hatte den Kindern den Aufenthalt im Freien verleidet.
»Du bist mit Fabians Vorschlag einverstanden, Schwester Regine?«, fragte Irmela gedehnt. Es war ihr deutlich anzumerken, wie wenig sie davon hielt.
»Ja. Es schadet euch nichts, wieder einmal frische Luft zu schnappen. Sucht eure Eislaufschuhe hervor und zieht euch warm an. Handschuhe und Mützen nicht vergessen. Habt ihr verstanden?«
»Ja, Schwester Regine«, seufzte Irmela. Ihr fiel plötzlich ein, dass sie ja eigentlich vier Seiten Mathematikaufgaben zu erledigen hatte, und dass es deshalb vernünftiger wäre, daheim zu bleiben, aber davon wollte weder die Heimleiterin noch die Kinderschwester etwas hören.
»Ich habe ebenfalls noch Hausaufgaben zu machen«, sagte Fabian. »Wahrscheinlich haben wir alle etwas aufbekommen. Das erledigen wir eben nachher.«
»Aber kann es nicht sein, dass der See doch nicht ordentlich zugefroren ist?«, versuchte Irmela es mit einem letzten Einwand. »Stell dir vor, wir brechen ein.Tante Isi wäre das gewiss nicht recht.«
»Was wäre mir nicht recht?«, erklang in diesem Augenblick Denise von Schoeneckers Stimme. Sie war eben im Begriff, den Speisesaal zu betreten, gefolgt von ihren beiden Söhnen Dominik und Henrik.
»Dass wir im Waldsee untergehen, ertrinken und erfrieren«, beantwortete Irmela Denises Frage.
»Irmela ist viel zu pessimistisch!«, rief Fabian. »Sie bildet sich ein, der Waldsee sei nicht fest genug gefroren.
In Wirklichkeit will sie uns nur das Eislaufen vermiesen, weil sie eitel ist.«
»Da komme ich nicht mit. Das müsst ihr mir genauer erklären«, forderte Denise die Kinder auf.
Jetzt schwirrten die Buben- und Mädchenstimmen durcheinander.
»Einerseits hat Irmela recht«, meinte Denise, nachdem sie erfasst hatte, worum es ging. »Ich möchte unter keinen Umständen, dass einer von euch einbricht und ertrinkt. Andererseits aber ist der See so dick zugefroren, dass so etwas bestimmt nicht passiert. Ihr könnt also ruhig eislaufen gehen, vorausgesetzt, ihr zieht euch warm an. Und setzt eure Wollmützen auf«, schloss sie mit einem leichten Lächeln.
»Wir kommen selbstverständlich mit«, verkündete Henrik von Schoenecker. »Nicht wahr, Nick?«
»Hm, selbstverständlich«, pflichtete sein älterer Halbbruder Dominik – von allen kurz Nick genannt – ihm bei. »Lauf schnell nach Hause und hole unsere Eislaufschuhe!«
»Iiich?«, fragte Henrik gedehnt. »Lauf du doch! Du hast die längeren Beine.«
Die Parkanlagen von Nicks und Henriks Zuhause, dem Gut Schoeneich, grenzten unmittelbar an die von Sophienlust. Die Entfernung war nicht allzu groß, aber da die vereisten Wege die Benützung eines Fahrrades unmöglich machten, war Henriks mangelnde Begeisterung, die Eislaufschuhe holen zu müssen, begreiflich.
»Geht beide und trefft euch dann mit den Kindern von Sophienlust am See«, schlug Denise vor.
Ihre Söhne nickten und verschwanden. Auch die übrigen Kinder verließen den Speisesaal. Sie rannten hinauf in den oberen Stock, wo sich die Schlafräume befanden. Unter viel Gelächter wurden die Anoraks, Fäustlinge, Mützen und Eislaufschuhe hervorgekramt.
»Eigentlich steht mir die rote Wollmütze ganz gut«, meinte Irmela ein wenig selbstgefällig zu Pünktchen, während sie sich von allen Seiten im Spiegel betrachtete.
»Ja. Aber beeile dich bitte. Sonst frotzeln uns die Jungen. Langsam halte ich es für berechtigt, dass sie sich über deine Eitelkeit lustig machen. In letzter Zeit guckst du viel zu viel in den Spiegel. Komm endlich! Sicher sind alle anderen bereits in der Halle versammelt und warten auf uns.«
Pünktchen behielt recht. Sie und Irmela waren die letzten, die in der Halle eintrafen.
»So, jetzt sind wir vollzählig und abmarschbereit«, sagte die Kinderschwester.
Denise schloss das große Tor hinter dem letzten Kind und suchte dann das Büro der Heimleiterin auf. Es gab einiges zu besprechen. Frau Rennert war das Gerücht zu Ohren gekommen, dass im Maibacher Gymnasium mit Haschisch gehandelt werde. Denise glaubte nicht recht daran, hielt es aber doch für geraten, der Sache nachzugehen. Nicht nur ihr älterer Sohn, auch die meisten Kinder von Sophienlust besuchten diese Schule.
Nachdem die beiden Frauen eine Weile hin und her beraten hatten, was man unternehmen könnte, meinte Denise: »Ich halte zwar keines von unseren Kindern für gefährdet, trotzdem stört mich dieses Gerücht. Vielleicht ist doch etwas Wahres daran. Ich halte es für das Beste, den Stier bei den Hörnern zu packen.«
»Wie wollen Sie das tun? Wollen Sie mit den Kindern reden? Ich weiß nicht, ob das ratsam ist. Sie kommen dann womöglich erst recht auf dumme Gedanken.«
»Ich werde nicht mit den Kindern, sondern mit dem Direktor reden«, sagte Denise. »Er müsste Genaueres über die Angelegenheit wissen. Ich werde ihn demnächst in seiner Sprechstunde aufsuchen.«