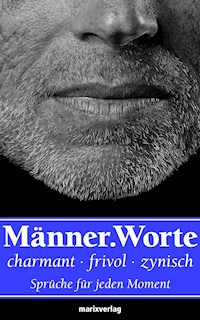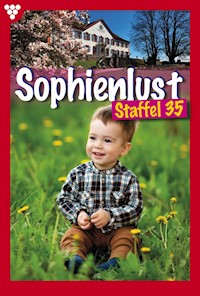
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. E-Book 1: Im Schatten der Angst E-Book 2: Der blonde Engel E-Book 3: Alles nur ein Spiel E-Book 4: Jahrelang von der Mutter getrennt E-Book 5: Die fromme Liebe E-Book 6: Das geheimnisvolle Waldhaus E-Book 7: Ein Pony - ihr bester Freund E-Book 8: Trotzig auf Eifersucht E-Book 9: Wir und unsere große Schwester E-Book 10: Getrennt für immer?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Im Schatten der Angst
Der blonde Engel
Alles nur ein Spiel
Jahrelang von der Mutter getrennt
Die fromme Liebe
Das geheimnisvolle Waldhaus
Ein Pony - ihr bester Freund
Trotzig auf Eifersucht
Wir und unsere große Schwester
Getrennt für immer?
Sophienlust – Staffel 35 –E-Book 351-360
Diverse Autoren
Im Schatten der Angst
Der kleine Markus muss einen schweren Schock überwinden
Roman von Svanberg, Susanne
Aus großen blauen Augen sah Angelika ihre Freundin an. »Achtundzwanzig?« wiederholte sie erstaunt. »So alt ist Toni?«
Schwester Regine, die das Gespräch der beiden Mädchen unbeabsichtigt belauschte, schmunzelte. Die Ansicht über ›alt‹ und ›jung‹ änderte sich mit den Lebensjahren. Wenn man noch ein halbes Kind war wie Angelika, war die Reaktion verständlich. Irmela, um einige Jahre älter und vernünftiger, dachte bereits anders.
»Saschas Freund hat ja auch seine Ausbildung fast beendet. Nach den Ferien macht er das Staatsexamen. Dann ist er Zahnarzt. Ich finde das ganz toll. Er ist überhaupt super.« Irmela ließ ihr Strickzeug sinken.
In diesen Wochen setzten die Mädchen von Sophienlust all ihren Ehrgeiz dafür ein, sich fürs kommende Frühjahr leichte Pullis zu stricken. Selbst Schwester Regine war von dem allgemeinen Arbeitseifer angesteckt. Sie saß bei ihren Schützlingen im Wintergarten, ließ ebenfalls die Nadeln klappern und war den Mädchen behilflich, wenn etwas nicht ganz stimmte.
»Er ist groß, fast größer als Sascha, hat lockiges blondes Haar und die schönsten blauen Augen, die du dir vorstellen kannst.« Irmela schaute verträumt auf die prächtig gedeihenden Pflanzen des Wintergartens und lächelte.
»Mann, du hast dich ja verknallt«, mischte sich Pünktchen, ein hübsches blondes Mädchen, ein. Eigentlich hieß sie Angelina. Doch die vielen Sommersprossen auf ihrem Stupsnäschen hatten ihr den Spitznamen Pünktchen eingebracht. Schon seit vielen Jahren war das ehemalige Zirkuskind, das seine Eltern bei einem Brand verloren hatte, in Sophienlust. Pünktchen betrachtete das Kinderheim als ihre Heimat und fühlte sich wie so viele Buben und Mädchen hier wohl.
»Mir gefällt Saschas Freund. Aber deshalb muß ich doch noch lange nicht verliebt in ihn sein«, wehrte sich Irmela, wurde dabei aber zu ihrem Ärger über und über rot. Hastig beugte sie sich über ihr Strickzeug. »Du hast Toni ja noch nicht gesehen, sonst würdest du mich sicher besser verstehen. Du kannst ihn dir etwa wie einen Tennis-Profi vorstellen. Schlank, aber muskulös, stark, sportlich, sonnenbraune Haut. Ein verdammt hübsches Gesicht und überhaupt topfit.«
»Jetzt hört euch das an«, ächzte Nick und stöhnte, als habe er Schmerzen. »Da hilft kein Leugnen. Du hast dich ganz schön in den flotten Studenten, den mein Bruder mitgebracht hat, verguckt, Irmela. Ich finde das ausgesprochen albern. Dieser Anton Mühlen ist doch eine Generation älter als wir.«
Nick, dem seine Urgroßmama vor vielen Jahren das ehemalige Gut Sophienlust vererbt hatte, ärgerte sich ohnehin über die Handarbeitswut der Mädchen. Seit sie diese albernen Pullis strickten, war nichts mehr mit ihnen anzufangen. »Für dich vielleicht. Für mich nicht«, antwortete das große Mädchen selbstbewußt. Irmela war eine fleißige Schülerin und wollte später einmal Medizin studieren. Schon deshalb imponierte ihr Anton Mühlen, der das Studium bereits geschafft hatte.
»Sascha und Toni bleiben ja doch nur einige Tage«, triumphierte Nick, der sich ein bißchen aus der Rolle des Überlegenen gedrängt fühlte. Als Schüler der Oberstufe war er für die jüngeren Kinder so etwas wie ein sehr vernünftiger, liebenswerter Junge, wenn auch hin und wieder der Lausbub in ihm zum Vorschein kam. »Sie wollen zum Wintersport in die Schweiz. Vati hat Sascha diesen Urlaub als Belohnung für seine guten Semester-Abschlußarbeiten geschenkt.«
»Wintersport kann man doch auch hier betreiben«, antwortete Irmela.
»Pah«, meinte Fabian, der das Gespräch aufmerksam verfolgt hatte. Der schmächtige Junge mit dem mittelblonden Haar und den graugrünen Augen gehörte auch zu den Kindern, die in Sophienlust Zuflucht und Geborgenheit gefunden hatten. »Bei uns schmilzt doch der Schnee schon. Es ist immerhin Ende März.«
Fabian stand neben der Stange, auf der der Papagei Habakuk saß und sich zutraulich kraulen ließ. Der große bunte Vogel gab gurrende Laute der Zufriedenheit von sich.
»Aber der Waldsee ist noch zugefroren. Man kann dort fabelhaft Schlittschuh laufen. Nur müßte man ihn von Tannennadeln und Ästen reinigen.« Irmela hatte jetzt Schwierigkeiten mit ihrer Handarbeit.
Nick sah endlich eine Möglichkeit, die Mädchen für etwas anderes zu begeistern als für die in seinen Augen langweilige Strickerei. Deshalb griff er Irmelas Vorschlag sofort auf.
»Das könnten wir machen. Wir nehmen einen Schneeschieber und einige große Besen mit. Wenn die Eisbahn wieder in Ordnung ist, bleiben Sascha und sein Freund vielleicht hier.«
Auch Nick legte sehr viel Wert auf die Gesellschaft der beiden jungen Leute, die in Heidelberg studierten und in den Semesterferien drüben auf Gut Schoeneich, seinem Elternhaus, wohnten.
»Die Idee ist spitze. Wenn alles fertig ist, nehmen wir einen Kassettenrekorder mit hinaus und lassen ein paar gute Bänder laufen. Mit Musik ist das dann wie auf einer richtigen Eisbahn.« Irmelas Augen strahlten. Sie sah sich schon in Tonis Armen über die spiegelblanke Fläche gleiten.
»Klasse!« schrie Fabian. Er ließ den Papagei im Stich, der empört krächzte. »Wenn wir noch einige Eimer Wasser auf dem Eis verteilen und wenn das Wasser in der Nacht festfriert, haben wir morgen eine Superbahn.«
Auch den übrigen Mädchen erschien die Aussicht, die Freuden des Winters noch etwas zu verlängern, verlockend. »Ich möchte auch mitmachen«, meldete sich Vicky, Angelikas jüngere Schwester, jetzt zu Wort. Sie war zu ungeschickt, um einen Pullover zu stricken. Deshalb begnügte sie sich damit, aus knallroter Baumwolle Topflappen zu häkeln. Das Produkt ihrer Arbeit wollte sie Tante Isi, der beliebten Gründerin von Sophienlust, schenken.
Denise von Schoenecker, die von ihren Schützlingen Tante Isi genannt wurde, lebte mit ihrem zweiten Mann sowie Nick und dem Nesthäkchen Henrik auf Gut Schoeneich. Sie kam jedoch täglich nach Sophienlust, um die Arbeit der Heimleiterin, Frau Rennert, zu unterstützen. Jetzt, da Sascha, ein Sohn aus der ersten Ehe ihres Mannes, zu Hause war, mußte sie ihre Tätigkeit in Sophienlust etwas einschränken.
»Schwester Regine, dürfen wir?« Auch Pünktchen hatte die Handarbeit weggelegt.
Regine Nielsen sah durch die wandhohen Fensterscheiben, vor denen tropische Pflanzen gediehen. Manche von ihnen reichten vom Boden bis zur Decke. Draußen war es kalt, aber sonnig. Die frische Luft würde den Kindern guttun.
»Ich komme mit. Denn ich möchte mich davon überzeugen, daß das Eis noch trägt.« Die gewissenhafte Kinderschwester sah ihre Schützlinge freundlich an. Viele hielten es für schwierig, Jungen und Mädchen dieses Alters zu betreuen. Für Regine Nielsen gab es keine Probleme. Sie brachte den Jugendlichen Vertrauen und Achtung entgegen und wurde mit Zuneigung und Gehorsam belohnt. In Sophienlust gab es keinen, der heimlich rauchte, der Alkohol trank oder gar Drogen probierte. Hier wurde über Probleme offen geredet und an die Vernunft appelliert. Die Buben und Mädchen von Sophienlust wußten sich geliebt und akzeptiert und kamen deshalb vertrauensvoll mit allen Sorgen zu ihren Betreuern.
»Hilfst du uns?« erkundigte sich Vicky erfreut.
»Ich will auch mitkommen.« Heidi, das jüngste Dauerkind von Sophienlust, hatte mit zwei kleinen Buben in einer Ecke des Wintergartens mit Lego-Steinen gespielt. Jetzt kam sie angerannt und schmiegte sich schutzsuchend an Schwester Regine.
Die jugendliche Frau legte mütterlich den Arm um das schmächtige Körperchen. »Alle dürfen mitgehen«, bestimmte sie in fröhlichem Ton.
So gut es Schwester Regine mit den größeren Kindern verstand, sie fühlte sich trotzdem mehr zu den jüngeren hingezogen. Ihr eigenes Töchterchen war zwei Jahre alt gewesen, als sie es durch ein tragisches Schicksal verloren hatte. Gleichzeitig hatte sie auch von ihrem Mann für immer Abschied nehmen müssen. Sophienlust bot ihr seitdem Ersatz für die Familie.
Niemand hatte etwas gegen Schwester Regines Vorschlag einzuwenden, obgleich man genau wußte, daß die Kleinen die Arbeiten nur behindern würden. Doch in Sophienlust war man eine große Gemeinschaft. Aufeinander Rücksicht zu nehmen, war oberstes Gesetz.
»Auch mitkommen!« äffte der Papagei Habakuk den Tonfall der kleinen Heidi nach und schlug mit den prächtig schillernden Flügeln.
»Habakuk, für dich ist es viel zu kalt. Du mußt schon warten, bis es Frühling wird. Dann stellen wir dich im Park unter die Linde.« Fabian streichelte den gefiederten Freund.
Die Mädchen steckten die Stricknadeln durch die Wollknäuel, packten alle Handarbeiten in einen flachen Korb und verließen den Wintergarten.
*
Am nächsten Morgen war Irmela schon munter, bevor es richtig hell wurde. Sie schlich auf Zehenspitzen ans Fenster und erschrak. Draußen regnete es in Strömen. Es war über Nacht wärmer geworden.
Die Eisbahn! war Irmelas erster Gedanke. Die Arbeit des gestrigen Tages war umsonst gewesen. Denn bei diesem Wetter war das Eis sicher brüchig geworden. Aus war der Traum vom fröhlichen Schlittschuhlauf mit Anton Mühlen.
Irmela hätte weinen mögen vor Enttäuschung. Denn sie hatte sich alles so schön ausgemalt, hatte sich auf den Nachmittag unbändig gefreut.
Traurig schlich sie in Pünktchens Zimmer. »Wach auf, es regnet.«
Das blonde Mädchen mit den reizvollen Sommersprossen drehte sich schläfrig auf die andere Seite. »Wie spät ist es?«
»Kurz nach sechs.«
»Und da weckst du mich? Mach bloß, daß du wegkommst. Ich will noch schlafen.« Pünktchen zog sich die Decke über die Ohren.
»Sollst du aber nicht. Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun.«
»Nichts. Wenn es wirklich regnet, kannst du das Eis vergessen. Es hat schon gestern geknistert. Ein Glück, daß Schwester Regine es nicht gehört hat«, murmelte Pünktchen mit geschlossenen Augen. Sie erwartete, daß Irmela sich in ihr Zimmer zurückziehe, doch das ältere Mädchen dachte nicht daran.
»Ich will nicht, daß Sascha und Toni wegfahren. Wir könnten doch etwas anderes unternehmen.«
»Laß mich endlich in Ruhe und schlag dir den Zahnarzt aus dem Kopf.«
»Du, ich höre ja auch zu, wenn du von Nick schwärmst«, revanchierte sich die sonst so sanfte Irmela.
»Iiich? Von Nick schwärmen? Ist dir nicht gut?« Pünktchen war schlagartig hellwach. Sie fuhr hoch und blitzte Irmela empört an.
»Du meinst vielleicht, es merkt niemand, daß du ihn ansiehst wie die Henne das Ei, aber…«
»Du bist gemein, Irmela«, schnupfte Pünktchen und fuhr sich durch das vom Schlaf zerzauste blonde Haar. »Ich finde Nick nett, sonst nichts«, verteidigte sie sich. Niemand sollte wissen, daß sie manchmal davon träumte, später einmal Nicks Frau zu werden.
»Eben. Dir gefällt Nick und mir Toni. Da gibt es doch nichts zu streiten. Ich möchte nur, daß wir gemeinsam überlegen, wie wir den Nachmittag am interessantesten gestalten können. Was hältst du von einer Kartenrunde im Wintergarten? Vielleicht spendiert uns Magda ein paar Gläser Cola.«
»Karten, das ist doch langweilig. Ich bin mehr für ›Mensch ärgere dich nicht‹.« Pünktchen zog die Beine an und schlang die Arme darum.
»Das ist doch ein Kinderspiel«, rügte Irmela die Kameradin. »Aber Roulette wäre vielleicht etwas. Ich spendiere der Kasse mein gesamtes Taschengeld.«
»Ich nicht. Denn ich möchte mir noch Wolle für einen zweiten Pulli kaufen. Überhaupt finde ich die Idee nicht besonders gut. Warte doch ab! Vielleicht hat Nick einen besseren Vorschlag.«
Nick saß um diese frühe Stunde mit seinen Eltern bereits am Frühstückstisch. Auf dem Gutshof begann der Arbeitstag um sieben Uhr, und Alexander von Schoenecker ging seinen Mitarbeitern mit gutem Beispiel voran.
»Das Wetter ist Sch…«, maulte der Halbwüchsige mit einem zornigen Blick zum Fenster.
»Aber Nick«, rügte Denise in ihrer heiteren, gelassenen Art.
»Ist doch wahr. Da haben wir gestern die Eisenbahn auf Hochglanz gebracht, und nun taut die ganze Herrlichkeit ab.«
»Hoffentlich haben wir in der Schweiz mehr Glück«, meinte Sascha, der älteste Sohn des Gutsbesitzers. Der junge Mann war seinem Vater äußerlich und auch im Wesen sehr ähnlich. Er hatte den ausgeglichenen, gemütvollen Charakter Alexanders, dessen beachtliche Größe und den dichten braunen Haarschopf.
Denise von Schoenecker hatte sich mit dem bei ihrer Heirat schon fast erwachsen gewesenen Stiefsohn und der Stieftochter Andrea, die inzwischen mit einem Tierarzt verheiratet war, auf Anhieb verstanden. Die gegenseitige Sympathie hatte sich in all den Jahren noch vertieft.
»Das wünsche ich euch auch.« Alexander war stolz auf seine Kinder, und auf Sascha ganz besonders. Denn der junge Mann hatte ihnen noch nie Schwierigkeiten gemacht. Er war ein guter Schüler, ein fleißiger Student und ein anhänglicher, dankbarer Sohn, der bei jeder Gelegenheit gerne nach Hause zurückkam.
»Wir haben gestern beschlossen, schon heute zu fahren. Natürlich nur, wenn es euch nichts ausmacht.« Sascha schaute abwechselnd auf Denise und Alexander.
»Es ist zu befürchten, daß auch in den Alpen Tauwetter einsetzt. Deshalb möchten wir zuvor noch so viel wie möglich auf die Pisten gehen«, ergänzte Anton Mühlen, der von seinen Freunden nur Toni genannt wurde.
»Selbstverständlich. Wir hätten euch natürlich gern noch länger hier gehabt, doch vielleicht läßt sich das im Anschluß an den Skiurlaub realisieren«, meinte Alexander voll Herzlichkeit. Er fühlte sich richtig wohl, wenn die große Familie um den ovalen Tisch im Eßzimmer des Gutshauses versammelt war.
»Die Kinder von Sophienlust werden enttäuscht sein. Denn sie haben fest damit gerechnet, daß ihr ihnen heute Gesellschaft leistet.« Denise lächelte die beiden Studenten gewinnend an.
»Das wird nachgeholt«, versprach Sascha lebhaft.
Nick schob sein Gedeck weg. »Och, ich möchte auch zum Skifahren in die Schweiz. Warum müßt ihr eigentlich gerade dann hinfahren, wenn ich in die blöde Schule muß?«
»Du willst nur bedauert sein. Dabei muß ich auch verzichten«, jammerte Henrik, das jüngste der Schoenecker-Kinder. Auf Sascha war der Kleine etwas eifersüchtig. Denn der Student verdrängte ihn bei seinen Besuchen aus der Rolle des meistbeachteten Familienmitglieds.
»Wenn ihr beide einmal studiert, habt ihr auch im März Semesterferien«, tröstete Sascha die beiden Jüngeren. »Aber dann werdet ihr euch vermutlich wieder nach der ruhigen Schulzeit zurücksehnen.«
»Auf keinen Fall. Die blöde Penne stinkt mir. Besonders wenn ich höre, daß andere in Urlaub fahren.« Nick spielte den Beleidigten. Doch jeder, selbst Toni, wußte, daß er es nicht so meinte.
*
Mit eleganten Schwüngen fuhr Sasche den Steilhang hinab. Leicht und spielerisch sah er aus. Er war nicht übermäßig schnell, sondern genoß die Abfahrt. Neben der sportlichen Bewegung erfreute er sich an der schneebedeckten Berglandschaft, an den sonnenüberfluteten Südhängen, an den Gletscherspalten und den Nordhängen, über die der kalte Wind pfiff. Hier oben fühlte er sich dem Himmel näher, spürte er die Größe der Schöpfung, sah auf lauter verschneite Berggipfel. Hier, oberhalb der Baumgrenze, war die Welt weit und still. Kein Laut störte die Vollkommenheit der Natur.
Toni Mühlen, im Skilauf nicht ganz so geübt wie Sascha, hielt sich hinter dem Freund. Auch er nahm das schöne Bild der Landschaft mit wachen Sinnen in sich auf.
An einem flacheren Stück der kilometerlangen Abfahrt hielt Sascha an. Er stützte sich auf seine Skistöcker und sah sich mit blanken Augen um.
»Ist das nicht herrlich?«
»Phantastisch! So schön hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ich werde dieses Panorama niemals vergessen.« Toni, der neben Sascha stehengeblieben war, wies mit dem ausgestreckten Arm in die Runde. »Du, das würde deinem Bruder auch gefallen.«
»Nick? Natürlich. Übrigens ist er nicht einmal mit mir verwandt. Er stammt aus der ersten Ehe meiner Stiefmama. Sein Vater kam ums Leben, als er noch ganz klein war. Nur Henrik ist mein Halbbruder. Nick ist mein Stiefbruder. Ja, wir sind schon eine merkwürdige Familie.« Sascha sagte es mit unüberhörbarem Stolz.
»Ihr seid eine großartige Familie«, bestätigte Toni, den dieses Thema seit der Abreise von Gut Schoeneich beschäftigte. »Bei euch spürt man die gegenseitige Zuneigung, den Zusammenhalt und die Kameradschaft. Das alles gibt es bei uns zu Hause nicht. Mein Vater ist ein vielbeschäftigter Manager, und meine Mutter hat alle Hände voll zu tun, das Geld unter die Leute zu bringen. Obwohl sie nicht arbeitet und genügend Hausangestellte hat, kannst du mit ihr nie reden, weil sie nie Zeit hat. Sie telefoniert den halben Tag, empfängt die Masseuse, den Friseur oder die Schneiderin – und abends muß sie auf Empfänge, zu Partys oder ins Theater. Sie ist so in Anspruch genommen, daß ich sie kaum zu Gesicht bekomme, wenn ich zu Hause bin. Deshalb ziehe ich es seit Jahren vor, nur noch mit ihr zu telefonieren. Sonderbarerweise kann ich sie so eher erreichen als persönlich.«
»Das kann ich mir gar nicht vorstellen«, murmelte Sascha und dachte daran, daß seine Stiefmama auch in Sophienlust stets für jedes Kind Zeit hatte. Allerdings hatte er auf Gut Schoeneich noch nie eine Masseuse, einen Friseur oder eine Schneiderin gesehen. Trotzdem war Denise immer sehr gut und sehr geschmackvoll gekleidet, sah jung und bemerkenswert hübsch aus.
»Weißt du, schon als kleiner Junge habe ich von einer Familie geträumt, in der man sich wohl fühlt, in der man geborgen ist, auf die man sich verlassen kann. Daß es so etwas wirklich gibt, habe ich erst auf Gut Schoeneich erfahren. Ich beneide dich, Sascha.«
»Ausgerechnet du, der einzige Sohn schwerreicher Eltern? Du bekommst doch alles, was du willst. Ein eigenes Auto, eine Weltreise und demnächst eine modern ausgestattete Praxis.«
»Alles«, wiederholte Toni traurig, »nur keine Liebe. Das hört sich undankbar an, aber die Liebe ist nun einmal ein Bestandteil unseres Lebens. Ich habe sie immer vermißt. Wenn ich einmal eine Familie gründe, werde ich alles anders machen. Ich werde meine Kinder nicht fremden Leuten anvertrauen, wie man es einst mit mir gemacht hat. Ich will ihnen Zeit schenken, soviel und sooft ich nur kann.«
»Ja, das ist sehr wichtig«, meinte Sascha nachdenklich. Er erinnerte sich in diesen Minuten an manche vertrauliche Aussprache mit seinen Eltern. Und noch heute redete er gern über seine Probleme mit ihnen. Oft waren ihre und seine Ansichten verschieden. Doch auch das war eine wertvolle Erfahrung.
»Es hört sich sentimental an, aber ich muß es dir trotzdem sagen: Wenn man bei euch zu Gast ist, spürt man sofort, daß sich deine Eltern lieben. Man bemerkt es aus ihren Blicken, ihren Gesten und ihren Worten. Und das nach so vielen Ehejahren. Ich finde das einfach klasse. Bei uns zu Hause habe ich so etwas nie empfunden. Da geht jeder seiner Wege. Mein Vater ist häufig unterwegs, meine Mutter hat eine Menge Freunde. Ob sie einander betrügen, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, daß es schon seit vielen Jahren nichts Gemeinschaftliches mehr zwischen ihnen gibt. Wenn ich einmal heirate…«
»… dann hältst du dich an das Rezept meiner Eltern, nicht wahr?« unterbrach Sascha ihn lachend.
»Ja, du Grünschnabel. Für dich sind diese Gedanken noch nicht aktuell. Aber ich bin schließlich einige Jahre älter als du.«
»Dafür bist du auch schon fast fertiger Zahnmediziner, und ich armes Würstchen muß mich noch einige Semester abquälen.«
»Willst du bedauert werden? Da ich das für Zeitverschwendung halte, fahren wir lieber weiter.« Toni stieß sich ab. Seine Skier glitten rasch und immer rascher durch den knirschenden Schnee. Die Abfahrt wurde wieder steiler, der junge Mann schwang gekonnt nach rechts.
In diesem Moment überholte Sascha ihn. Der Sohn des Gutsbesitzers war wendiger und schneller. »Auf geht’s«, rief er.
Toni fuhr in Saschas Spur. Ihm machte es nichts aus, daß der Freund zwei Minuten vor ihm bei der Liftstation war.
Sascha fuhr zu dem rundum offenen Gebäude, von dem aus die Gondeln nach unten starteten. »Warum läuft hier nichts mehr?« fragte er den Mann, der die Anlage bediente.
»Lawinengefahr. Der Betrieb ist vorerst eingestellt«, antwortete der Schweizer in seiner gemütlich klingenden Muttersprache.
»Lawinengefahr? Bei diesem herrlichen Wetter?« fragte Sascha.
»Darin liegt ja die Gefahr«, erklärte der Mann gelassen. »Die Touristen wollen es oft nicht einsehen und setzen sich über jede Vorsichtsmaßnahme hinweg. So passieren die schlimmsten Unglücke. Ich rate Ihnen, seien Sie vernünftig und fahren Sie für den Rest des Tages auf den Hängen unten beim Ort. Die sind lawinensicher.«
»Und wann, glauben Sie, kann man wieder herauffahren?« Sascha war etwas verärgert. Sie waren in die Alpen gekommen, um endlich richtig Ski laufen zu können, und nun sollten sie mit den Abfahrten für Anfänger vorliebnehmen.
Der biedere Schweizer zuckte die Achseln. »Das weiß man nicht. Es sieht nicht besonders gut aus.«
»Hören Sie mal, es scheint ringsum die Sonne. Besser könnte es doch gar nicht sein.« Sascha wies auf den tiefblauen Himmel.
»So wie Sie lassen sich viele täuschen. Aber wer fünfzig Jahre hier oben lebt, weiß, daß dies die Ruhe vor dem Sturm ist.«
»Schwierigkeiten?« fragte Toni, der seine Fahrt durch einen kräftigen Schwung abgebremst hatte. Der Schnee stob zur Seite. Toni drehte bei und glitt langsam zur Liftstation.
»Ja, dank deiner miesen Fähigkeiten werden wir auf den Idiotenhügel verwiesen. Ich hab’s ja geahnt.« Sascha verzog in gespieltem Schmerz das Gesicht.
»Ich glaube eher, man befürchtet, daß du durch deine Raserei hier einen kostspieligen Unfall verursachst.«
Der Schweizer, dem die beiden Studenten gefielen, trat aus seiner Unterkunft und stellte sich neben sie. »Wenn Sie ganz ruhig sind, hören Sie ein leises Grollen in den Bergen.«
»Vermutlich der beleidigte Berggeist. Er hat dich gesehen.« Sascha stieß seinen Freund unsanft in die Seite.
»Ich glaube eher, daß er über deine Anwesenheit sehr empört ist.«
»Lauschen Sie!« Der Schweizer hob den Arm und streckte achtungsgebietend den Zeigefinger hoch.
»Tatsächlich. Bleiben Sie denn hier oben?«
»Nein. Ich warte nur noch die letzten Skiläufer ab, dann fahre ich ins Tal. Fünf Leute sind noch am Berg.«
»Ich glaube, wir starten.« Sascha schwang herum und sauste in Schußfahrt den nächsten Abhang hinunter.
Toni verabschiedete sich von dem Mann der Bergwacht und startete ebenfalls zur Abfahrt. Am Vormittag waren sie mit dem Sessellift bis zu dieser Höhe und von dort mit der Kabine weiter zum Gipfel gefahren. Jetzt hingen die Sessel unbeweglich an dem dicken Drahtseil.
Oberhalb der Übungshänge, die zum Dorf gehörten, hielt Sascha an und blickte begeistert hinunter ins Tal. Von hier konnte man drei kleinere Orte sehen. Wie Spielzeug sahen Häuser und Kirchen von hier oben aus. Mächtig erhoben sich ringsum die bewaldeten Bergriesen.
»Hier!« Toni, der neben den Freund getreten war, wies mit dem ausgestreckten Arm auf einige Rehe, die an einer Futterstelle weiter unten ästen. Sie mußten die beiden Skiläufer längst bemerkt haben, störten sich aber nicht an ihnen.
*
In der kleinen Pension, in der die beiden Studenten ein Doppelzimmer gemietet hatte, war es urgemütlich. Die Wirtin selbst kochte für ihre Gäste, und das hübsche Töchterchen servierte die wohlgefüllten Platten. Man saß an blankgescheuerten Holztischen, über denen schmiedeeiserne Lampen mit karierten Schirmchen hingen.
Das schmackhafte Abendbrot versöhnte Sasche und Toni mit der Enttäuschung des Nachmittags. Von der frischen Luft und der ungewohnten sportlichen Betätigung müde, gingen die jungen Leute früh schlafen.
Toni erwachte von einem dumpfen Donnerschlag. Er hallte von den Berghängen wider, grollte und rumorte im Tal. In der dunklen, finsteren Nacht hörte sich das schauerlich an.
Erschrocken setzte sich der Student auf. Obwohl sie die Fensterläden nicht geschlossen hatten, konnte man keinen einzigen Gegenstand im Raum erkennen.
»Hörst du das?« flüsterte Toni seinem Freund zu. Er war nicht ängstlich, aber was da draußen die Luft erfüllte, hörte sich an wie die Ankündigung des Weltuntergangs.
»Glaubst du, ich bin taub?« Sascha horchte mit angehaltenem Atem auf die krachenden, polternden Geräusche, in die sich jetzt das Heulen und Toben des Windes mischte. »Ich vermute, daß der ganze Berg ins Rutschen gekommen ist. Es müssen gewaltige Felsen sein, die da zu Tal donnern.«
Jetzt richtete sich auch Sascha vorsichtig auf. Unbewußt zog er das dicke Federbett in dem karierten Überzug fröstelnd um seine Schultern.
»Der Ort soll angeblich lawinensicher sein. Glaubst du, daß es stimmt?« Der letzte Teil von Tonis Frage ging in einem gewaltigen Knall unter. Das Echo kam mehrfach von den Bergen zurück.
»Keine Ahnung«, stöhnte Sascha, als es wieder etwas ruhiger wurde. »Der Strom scheint jedenfalls bereits unterbrochen zu sein. Die Nachttischlampe brennt nicht.«
»Das habe ich auch bemerkt.« Toni fühlte sich in dem Bauernbett, das er noch wenige Stunden zuvor als äußerst gemütlich empfunden hatte, nicht mehr wohl. »Was hältst du davon, wenn wir aufstehen und hinuntergehen?«
Sascha hütete sich davor, seinen Freund als ängstlich zu bezeichnen. Angesichts der heulenden, donnernden Naturgewalten verließ ihn der Humor. »Das kann nicht schaden. Vielleicht haben sich die anderen Gäste schon in Sicherheit gebracht.«
»Du meinst, man hat uns im Stich gelassen?« Anton Mühlen tastete nach dem Skianzug und den warmen Wollsocken.
Erneut grollte der Donner, heulte der Sturm. Fensterläden schlugen, Holzbalken ächzten. Es schien, als schwanke der Erdboden, als zittere das Haus. Sascha griff in aller Eile nach dem warmen Anorak. »Die Skistiefel sind im Abstellraum. Hoffentlich kommen wir ran.«
»Du meine Güte, wer hätte am Nachmittag gedacht, daß so ein schreckliches Unwetter losbrechen könnte.« Toni suchte im Dunkeln nach seinen Handschuhen.
»Der Schweizer an der Liftstation hat es gewußt.«
»Aber daß es so schrecklich wird, hat er auch nicht geahnt.« Toni zuckte zusammen, denn schon wieder knallte es, als explodiere eine Bombe. Die Fensterscheiben klirrten, die Dorfhunde jaulten vor Angst.
Sascha öffnete die Tür und lief zur Treppe. Toni, der inzwischen seine Handschuhe gefunden hatte, ging ihm nach.
Im Eßzimmer der Pension brannten zwei dicke Kerzen. Die Wirtsleute und einige Hausgäste saßen schweigend um den mächtigen Kachelofen.
»Was ist das?« fragte Sascha in einer Donnerpause.
»Ein schweres Unwetter«, erklärte der Gastwirt mit sorgenvollem Gesicht. »Im Frühjahr, wenn das Wetter wechselt, haben wir das oft. In den Bergen oben muß eine Lawine niedergegangen sein. Man hat keine Nachricht vom Gipfelhaus. Die Telefonverbindung ist unterbrochen.«
»Irgendwo in der Nähe muß auch ein Flugzeug abgestürzt sein«, berichtete die Wirtin bekümmert. »Die Bergwacht hat den Hilferuf einer Cessna aufgefangen. Die Männer werden hinaufsteigen, sobald das Unwetter nachläßt. Unser Sohn ist auch bei ihnen.«
»Mein Gott, wenn eine kleine Privatmaschine bei diesem Wetter in den Bergen abstürzt, gibt es da noch Hoffnung?« Toni fühlte sich mit den Bewohnern des Alpendorfs, die von jeher unter Naturkatastrophen zu leiden hatten, eng verbunden. Diese Menschen wehrten sich tapfer gegen Naturgewalten. In solchen Nächten konnten sie allerdings nur warten, bangen und hoffen.
»Wenn sie auf einem Schneefeld aufschlägt…« Die Schweizerin faltete die Hände. Ihre fünfzehnjährige Tochter schmiegte sich bleich und verängstigt an sie.
»Aber wird der Schneesturm nicht innerhalb ganz kurzer Zeit alles zuwehen? Für die Menschen, die den Absturz überlebt haben, muß das ja die Hölle sein.«
Der Wirt nickte ernst. »Es kommt immer wieder vor, daß ein Flugzeug hier in der Nähe abstürzt. Bei Nebel und schlechter Sicht streift es die Gipfel oder verliert die Orientierung, weil der Sturm es abtreibt. Es ist Wahnsinn, was sich dann da oben abspielt. Die Überlebenden beneiden die Toten. Sie versuchen davonzurennen und kommen doch nur wenige Meter weit, weil sie bis zu den Hüften in den Schnee einsinken.«
»Es muß furchtbar sein. Man muß diesen Menschen zu Hilfe kommen.« Toni fröstelte.
»Das ist im Moment nicht möglich.« Der Mann auf der Ofenbank schüttelte den Kopf.
»Kann man denn keinen Hubschrauber…?« Sascha wußte im gleichen Augenblick, wie dumm seine Frage war.
»Bei diesem Wetter? Morgen vielleicht.«
»Glauben Sie, daß die Bergwacht noch Leute brauchen kann?« Toni Mühlens Stimme klang entschlossen.
»Für derartige Aktionen hat man nie genug Leute.«
»Dann komme ich mit.«
»Ich auch.« Entschlossenheit war in Saschas Blick. »Wo können wir uns melden?«
»Bei der Rettungsstation der Bergwacht. Aber Sie können im Moment nicht hinaus. Wir müssen warten, bis das Unwetter nachläßt. Haben Sie denn Bergerfahrung?«
»Ein wenig. Nur mit der Ausrüstung hapert es.«
»Die bekommen Sie bei der Bergwacht.« Dem Schweizer imponierten die beiden Studenten aus Deutschland. Denn sie bewiesen Mut und Verantwortungsgefühl.
*
Mut brauchten Sascha und Toni tatsächlich, als sie zwei Stunden später, ausgerüstet mit warmen wetterfesten Anzügen und Bergstiefeln, in der Rettungsmannschaft den Berg hinaufstapften.
Man führte Seile, Eispickel, Tragbahren und einen leichten Schlitten mit, auf den man warme Getränke geschnallt hatte. Zwei Suchhunde begleiteten den Trupp.
Es war stockfinster. Die Fackeln, die man mitgenommen hatte, wollte man im unteren Teil des Berges noch nicht benutzen, denn dieses Stück kannten die Einheimischen sehr gut. Sie wußten um jeden Graben, um jeden Weidezaun und um die Abhänge, an denen die Schneeverwehungen mehrere Meter weit über den Abgrund ragten. Wer diese Wächten betrat, stürzte unweigerlich in die Tiefe. Bei Nacht war die Gefahr besonders groß.
Sascha und Toni hielten sich dicht in der Gruppe. Doch das war gar nicht so einfach. Für die Männer der Bergwacht waren diese Aufstiege etwas Alltägliches. Deshalb bewegten sie sich in dem tiefen Schnee verhältnismäßig wendig und sicher. Die beiden Studenten dagegen quälten sich mit den schweren Stiefeln und den Skiern auf ihren Schultern ab, schwitzten in den warmen Anzügen und fühlten sich schon nach dem ersten Steilhang müde und erschöpft. Doch an eine Rast war überhaupt nicht zu denken. Die Rettungsmannschaft stieg unbeirrt weiter bergan. Wie Roboter setzten die Männer einen Fuß vor den anderen.
»Du, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte«, stöhnte Sascha. Er schob die Schneebrille hoch und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Wir haben schätzungsweise noch nicht einmal ein Zehntel des Weges zurückgelegt.« Auch Toni keuchte. Ihm war, als habe er Blei an den Füßen. Obwohl er in den Spuren der Einheimischen ging, fiel es ihm schwer, immer wieder die Stiefel aus dem hohen Schnee zu ziehen. Jeder Schritt wurde zur Qual.
»Du weißt ja, daß man uns gewarnt hat. Umkehren ist nicht drin. Also müssen wir durchhalten. Wir dürfen nur nicht langsamer werden. Beißen wir die Zähne zusammen.«
Das dumpfe Grollen der verhallenden Donnerschläge störte Sascha jetzt nicht mehr. Der Sturm hatte sich gelegt. Doch die Schneeverwehungen, die er gebracht hatte, waren beträchtlich. An manchen Stellen wurde der Weg dadurch unpassierbar. Man mußte Umwege machen. Sorgfältig prüfte dabei der Führer der Gruppe die Tragfähigkeit der Schneedecke. Aber in der herrschenden Finsternis hatte auch er Schwierigkeiten. Die Lampe, die er auf der Brust trug, schaltete er nur selten ein. Man mußte Batterien sparen, denn hier in den Bergen war man vor Überraschungen nie sicher. Schon manche Rettungsmannschaft war in einen Schneesturm geraten und hatte nur durch die Lichtsignale der Suchscheinwerfer wieder zusammengefunden.
Die Position des abgestürzten Flugzeugs war zwar bekannt, trotzdem war es unter den herrschenden Umständen schwierig, sich zu orientieren. Starke Schneeverwehungen und die Schneemassen der niedergegangenen Lawinen veränderten die Berghänge und machten lange Umwege erforderlich.
Sascha und sein Freund folgten stumm dem Trupp. Auch sie bewegten sich jetzt mechanisch. Nur nicht stehenbleiben, war die Devise. Heimlich bewunderten beide die Kondition der Männer, in deren Spuren sie gingen.
Plötzlich, von einer Minute zur anderen, setzte Schneefall ein. Zuerst segelten die Flocken groß und leicht auf die vermummten Männer, die sich den Berg hinaufquälten. Doch rasch wurde ein Schneetreiben daraus. Es war so dicht, daß die Männer ihren Vordermann nicht mehr erkennen konnten. Die Schneebrille setzte sich zu, das Atmen fiel schwer.
Der Anführer des Rettungstrupps blieb stehen und rief die Hunde zu sich. Er befestigte die Leine an ihrem Halsband und schaltete die Lampe ein, die in regelmäßigen Abständen blinkte.
»Wir müssen zurück«, rief er seinen Männern zu. »Das gibt einen Schneesturm, in dem wir uns nicht halten können. Wir müssen uns beeilen, sonst wird der Abstieg unmöglich.«
Toni Mühlen hätte dem Bergführer gern gezeigt, daß es unsinnig sei, umzukehren, nachdem man den Weg schon zu gut einem Drittel bezwungen hatte. Doch er war so erschöpft, daß er keinen einzigen Laut über die Lippen brachte. Er hätte sich am liebsten in den Schnee sinken lassen, um von den immer dichter werdenden Flocken zugedeckt zu werden.
Sascha erging es nicht anders. Er atmete schwer und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten.
»Beisammenbleiben, dicht beisammenbleiben«, ordnete der Bergführer an.
Wie wichtig die Befolgung dieses Ratschlags war, zeigte sich rasch. Denn nur die ausgebildeten Suchhunde fanden in dem aufkommenden Sturm noch den Weg durch das dichte Schneetreiben. Ein einzelner Mensch war in diesem Inferno hoffnungslos verloren. Deshalb war es auch nicht möglich, für den Abstieg die mitgenommenen Skier anzuschnallen. Denn jeder Sturz, jedes geringfügige Entfernen von der Gruppe brachte den betreffenden Mann in Lebensgefahr.
Schon nach wenigen Metern Rückmarsch war an eine Verständigug durch Rufen nicht mehr zu denken. Mit immer höherer Geschwindigkeit jagte der eisige Schneewind über die Berghänge, wurde lauter und lauter und entwickelte sich rasch zum Sturm, gegen den sich die Männer mit aller Kraft stemmen mußten, um nicht umgeweht zu werden. Sie sahen überhaupt nichts mehr, mußten an den Vordermann möglichst nah heranrücken, um ihn nicht zu verlieren.
Toni und Sascha tappten in völliger Nacht im Trupp. Der heulende Schneesturm tobte über ihnen, riß an ihrer Kleidung und vor allem an den Skiern, die sie trugen. Obwohl die zugezogenen Kapuzen ihre Gesichter fast völlig verdeckten, spürten sie die eisige Schneeschicht auf ihrer Haut, mußten sie die Köpfe zur Seite drehen, um Atem schöpfen zu können.
Sascha und Toni hätten zuvor niemals geglaubt, daß ein Schneesturm in den Alpen solche Gewalt entwickeln konnte. Jetzt sahen sie ein, wie richtig die Entscheidung des Bergführers, umzukehren, gewesen war. Weiter oben, in den schroffen Felswänden, wären sie bei diesem unerbittlich tobenden Unwetter verloren gewesen.
Immer langsamer kämpfte sich der Trupp vorwärts. Sascha und Toni stolperten mehrmals, rafften sich aber schnell wieder auf und torkelten weiter. War es Todesangst, die ihnen fast übermenschliche Kräfte gab? Würden sie das Dorf überhaupt erreichen, oder gingen sie längst einen falschen Weg bergab? Keiner der Männer wagte daran zu denken. Denn jeder wußte, daß dann kaum einer von ihnen den Morgen erleben würde.
*
Ingo Fehringer war nach dem tragischen Tod seiner Eltern vor knapp drei Jahren zusammen mit seiner Schwester Ingrid zum Erben des riesigen Stahlkonzerns geworden. Es war eines der größten Unternehmen in privater Hand. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland besaß der Fehringer-Konzern Niederlassungen. Er belieferte den Nahen und den Fernen Osten, ja, sogar die Vereinigten Staaten.
Der Konzernchef war vierunddreißig Jahre alt, wirkte aber älter. Er hatte eine schlanke, fast hagere Statur, ein schmales, strenges Gesicht mit grauen Augen. Eine Stirnglatze unterstrich die hohe, etwas eckige Stirn und ließ ihn noch unnahbarer erscheinen. Der spärliche Haarkranz war von hellem Braun und wirkte in seiner Dürftigkeit ein bißchen lächerlich. Doch Ingo Fehringer war selbstbewußt genug, sich nicht darum zu kümmern. Er kleidete sich mit ausgesuchter Eleganz, umgab sich mit teuren Duftwässerchen und war im übrigen der Ansicht, daß sein Geld allein schon genüge, ihn zu einem äußerst interessanten Mann zu machen.
Niemals hätte er für möglich gehalten, daß seine Angestellten über seinen sprichwörtlichen Geiz lachten, daß man sich heimlich bereits jetzt allerhand amüsante Geschichten über ihn erzählte.
Nach dem Tod seines Vaters hatte Ingo Fehringer im Konzern eine Menge Sparmaßnahmen eingeführt. Er hatte die Sozialleistungen zusammengestrichen, hatte die Akkordzeiten gedrückt und Einsparungen vorgenommen, die auf Kosten der betrieblichen Sicherheit gingen. Stur hatte er sich gegen den Betriebsrat durchgesetzt und den Konjunkturrückgang ausgenutzt, um seine Mitarbeiter mit dem Gespenst der Arbeitslosigkeit zu schrecken.
Nur er selbst und einige Direktoren wußten, daß der Konzern gegenwärtig mehr Gewinn ausschüttete als je zuvor. Ingo Fehringer konnte mit sich zufrieden sein.
Sosehr er im geschäftlichen Bereich sparte, privat war ihm nichts zu teuer. Er hatte die Villa seiner Eltern umbauen, vergrößern und modernisieren lassen. Sie verfügte über jeden nur erdenklichen Luxus und war mit vielen kostbaren Kunstgegenständen ausgestattet.
Auch bei Frauen hatte Ingo Fehringer einen sehr anspruchsvollen Geschmack. Vor einigen Monaten hatte er sich das Star-Mannequin Carina Schöllhoff zur Freundin auserkoren.
Carina war dreiundzwanzig Jahre alt und eine ausgesprochene Schönheit. Sie hatte eine schlanke Figur mit aufregenden Rundungen, eine goldbraune, makellose Haut, große schwarze Augen und ein verführerisches Lächeln. Ihre langen schwarzen Haare fielen in reizvollen Löckchen bis weit über die Schultern.
Der reiche Unternehmer hatte ihre Zuneigung mit einem italienischen Sportwagen, mit verschiedenen Modellkleidern und teurem Schmuck belohnt. Trotzdem kamen Carina immer öfter Zweifel an der Dauerhaftigkeit dieser Beziehung. Es gab so manches, das ihr an Ingo nicht gefiel.
An diesem Abend holte Ingo das Mannequin in seiner Stadtwohnung ab. Er klingelte lange und kräftig und nahm Carina zur Begrüßung fest in die Arme. Hart und fordernd war sein Kuß.
»Ich habe schon gestern auf dich gewartet. Warum bist du nicht gekommen?« Prüfend schaute Ingo in das reizvolle Mädchengesicht.
»Eine Freundin hat mich besucht. Ich konnte sie nicht wegschicken«, entschuldigte sich die junge Dame. Sie befreite sich aus Ingos Griff und schüttelte ordnend die Flut der dunklen Haare.
»Es kann doch nicht sein, daß dir die Freundin wichtiger war als ich.«
»Natürlich nicht.« Carina versöhnte Ingo durch ein charmantes Lächeln.
»Komm, wir fahren zu mir.« Ingo Fehringer hatte sich in der geräumigen Dreizimmerwohnung seiner Freundin noch nie wohl gefühlt. Er hatte hier immer das Gefühl, in einem engen Käfig eingesperrt zu sein. Denn in seiner Villa hatte allein die Wohnhalle Ausmaße, die dem Grundriß dieser ganzen Wohnung entsprachen.
»Ich habe eine chinesische Vase erstanden, die ich dir unbedingt zeigen muß.« Ingo bemerkte das Zögern der jungen Frau. Er wußte längst, daß sein Reichtum auf Carina keinen Eindruck machte. Doch gerade das gefiel ihm so sehr, daß er mit dem Gedanken spielte, dieses schöne junge Mädchen zu seiner Frau zu machen.
»Moment, ich hole nur meinen Mantel.« Carina lief davon und kam gleich darauf mit einem wundervoll verarbeiteten Blaufuchsfell wieder. Es paßte großartig zu der jungen, fast kindlich wirkenden Carina.
»Du siehst aus wie eine Königin.« Ingo war stolz darauf, daß diese Frau zu ihm gehörte. Stolz wie auf jeden Besitz. »Meine Königin«, ergänzte er egoistisch.
»Wollten wir nicht zum Abendessen ins Markgrafen-Hotel gehen?« erinnerte Carina ihn, als sie neben Ingo in der Luxuslimousine saß.
»Heute nicht. Heute haben wir es zu Hause viel schöner. Da sind wir völlig ungestört. Ingrid ist mit Markus in Urlaub gefahren, und mein Butler ist die Diskretion in Person. Endlich bin ich den kleinen Schreihals los.«
»Magst du denn deinen Neffen nicht?« erkundigte sich Carina, die sich nicht vorstellen konnte, daß jemand einen so süßen kleinen Jungen wie Markus ablehnte.
»Reden wir nicht darüber.« Ingo Fehringer behauptete sich rücksichtslos im Straßenverkehr. Er drängte kleinere Fahrzeuge zur Seite, nahm ihnen die Vorfahrt und gefährdete Fußgänger. An roten Ampeln hielt er nur, wenn andere Autos vor ihm waren.
»Es interessiert mich aber«, bohrte Carina.
Der Mann im eleganten dunklen Anzug zuckte gleichgültig die Achseln. »Meine Schwester hat sich seinerzeit leider sehr dumm verhalten. Sie war mit einem Mann befreundet, der eine Leidenschaft für schnelle Autos hatte. Er fuhr Rennen und kam dabei um. Es war kurz vor der Hochzeit der beiden. Die Gäste waren schon eingeladen. Ingrid muß gewußt haben, daß sie schwanger war. Doch statt die Sache durch eine Abtreibung aus der Welt zu schaffen, wollte sie das Kind austragen. Dummerweise wurde sie in dieser Absicht von meinen Eltern noch unterstützt. Sie störte es nicht, daß der Enkel unehelich zur Welt kam. Mich dagegen ärgert das heute noch.«
»Und deshalb magst du Markus nicht?« Carina schüttelte erstaunt den Kopf.
»Sehr richtig. Ich bin ein sehr korrekter Mensch und erwarte das auch von meinen nächsten Angehörigen.« Selbstherrlich erzwang sich Ingo gerade wieder die Vorfahrt an einer Kreuzung.
»Aber der Junge kann doch nichts dafür, daß sein Vater noch vor der Hochzeit verunglückt ist.«
»Ach, ich möchte mich überhaupt nicht mit ihm befassen. Für mich gehört er nicht zur Familie. Er ist ein Kuckucksei.« Ingo Fehringer bog auf die Privatstraße ein, die zu seinem Haus führte. Es ging eine kleine Anhöhe hinauf. Auf der Kuppe schloß ein hohes schmiedeeisernes Tor den Park für die Öffentlichkeit ab. Mächtige alte Bäume verwehrten die Sicht auf die weiße Villa.
Ingo nahm ein kleines graues Kästchen zur Hand, das griffbereit auf dem Armaturenbrett lag. Per Fernbedienung öffnete er das Tor, das sich hinter ihnen wieder automatisch schloß.
Der schwere Wagen rollte über eine geteerte Straße, vorbei an riesigen Rasenflächen mit gepflegten Blumenbeeten. Im Sommer waren hier zwei Gärtner damit beschäftigt, die bunte Pracht zu pflegen. Jetzt, in diesen ersten Frühlingstagen, gab es dicke Büschel von Krokussen in allen erdenklichen Farben. Dann tauchte das Haus auf, umgeben von dekorativen Nadelgehölzen. Es war ein verwirklichter Traum. Architektonisch außerordentlich interessant, harmonisch in der Gestaltung, edel im Material.
Ingo Fehringer freute sich immer wieder über den Anblick. Doch er zeigte es nicht. Er tat, als wäre das alles selbstverständlich. Auch den Butler, der ihnen entgegenkam, um die Türen zu öffnen und die Mäntel abzunehmen, beachtete er nicht.
Carina folgte Ingo in den großen Wohnraum, der mit verblüffender Eleganz ausgestattet war. Durch vier breite Fenster hatte man einen herrlichen Blick über die Stadt und die nähere Umgebung.
Jetzt, da es bereits düster wurde, flammten in den Straßen die Laternen auf, lag ein Hauch von Romantik über der Stadt.
Die Klimaanlage in Ingos Haus war vortrefflich eingestellt. Alle Räume waren angenehm warm und gut durchlüftet. Carina blieb auf dem echten Perserteppich mit den herrlichen Farben stehen. Es war ein ausgesucht schönes, sündhaft teures Stück.
»Wie findest du sie?«
»Wen, deine Schwester?« Carina war mit ihren Gedanken noch immer bei dem Gespräch, das sie im Auto geführt hatten.
»Die chinesische Vase natürlich.« Stolz deutete Ingo auf das niedrige Tischchen neben einer halbrunden Couch. Darauf stand ein imponierendes Gebilde aus kostbarem Porzellan, reich mit goldenen Ornamenten verziert.
Carina trat hinzu und berührte vorsichtig das glatte, kühle Material. »Sie ist einzigartig schön.«
»Magst du sie?«
»Nein, sie paßt besser hierher als in meine Wohnung.«
»Du paßt auch besser hierher. Schöne Frauen brauchen den entsprechenden Rahmen, genau wie schöne Gegenstände.« Ingo betrachtete entzückt seine Freundin und das neu erworbene Schmuckstück. Beide konnten nicht besser zueinander passen. »Warum bleibst du nicht hier? Dieses Haus hat so viel Platz. Du kannst dir jedes Zimmer aussuchen, das du magst, kannst über alles verfügen.«
Ingos Angebot war tatsächlich sehr reizvoll. Denn die luxuriöse Atmosphäre dieses Hauses mit all seinen Freizeiteinrichtungen war kaum zu überbieten. Vom Hallenbad bis zum Tennisplatz war an alles gedacht.
»Was würde deine Schwester sagen? Schließlich gehört das Haus auch ihr«, antwortete Carina unsicher.
»Ingrid ist für vier Wochen in Urlaub geflogen. Wer weiß, vielleicht gefällt es ihr so gut, daß sie auch länger bleibt. Ich habe ihr unsere Privatmaschine und den Piloten zur Verfügung gestellt. Außerdem wird sie von einem befreundeten Ehepaar begleitet. Sie wird sich nicht langweilen. Dafür sorgt schon der Junge.«
»Wohin ist sie geflogen?« fragte Carina besorgt.
»Nach Sizilien wollten sie. Dort ist es jetzt schon schön warm. Markus badet doch so gern.«
Die schöne junge Frau wandte sich zu Ingo um. Ihr Gesicht war ernst. »Du, ich habe da eine Meldung im Radio gehört. In der Schweiz ist in der vergangenen Nacht eine Privatmaschine abgestürzt. Es soll eine Cessna gewesen sein.«
Ingo zuckte die Schultern. »So etwas kommt leider vor, Flugzeuge dieses Typs werden sehr häufig von Privatleuten benutzt. Diese Meldung ist kein Anlaß zur Sorge.«
»Wann ist deine Schwester abgeflogen?« bohrte Carina. Sie hatte Ingrid Fehringer und deren kleinen Sohn in Ingos Ferienhaus kennengelernt. Ingrid war genau das Gegenteil ihres Bruders: bescheiden, fröhlich und sehr sympathisch. Sie hing mit zärtlicher Liebe an dem kleinen Markus, einem süßen blonden Jungen. Ingrid und Carina hatten sich sofort verstanden und viele gemeinsame Interessen entdeckt. In den wenigen Stunden ihres Beisammenseins waren sie Freundinnen geworden.
Ingo war von dieser Entwicklung nicht begeistert. Es paßte ihm auch nicht, daß Carina jetzt so viele Fragen stellte. »Gestern, am Spätnachmittag. Aber bitte, reden wir doch von etwas anderem. Ich habe dir so viel zu sagen.« Er legte den Arm um Carinas schmale Taille und führte sie zum schönsten Platz des Zimmers.
»Mein Gott, zeitlich könnte das doch fast stimmen.« Die zierliche Frau mit den langen schwarzen Locken biß sich auf die Lippen. »Du solltest unbedingt in Sizilien anrufen und nachfragen, ob deine Schwester gut angekommen ist.«
»Ja, gut, ich mache das später«, erklärte Ingo ungeduldig. »Zwei Aperitifs, und lassen Sie das Essen servieren«, befahl er dem Butler, der frische Buchenscheite auf das Feuer im Kamin schichtete.
»Nicht später. Gleich mußt du es tun«, flehte Carina. »Ich bin so unruhig.«
»Schäfchen«, rügte Ingo lächelnd. »Du solltest dir keine Gedanken machen. Unser Pilot ist sehr erfahren. Er hat Ingrid und ihren Schreihals bestimmt gut zu ihrem Urlaubsdomizil gebracht.«
»Ich glaube, du magst keine Kinder.« Carina sah dem Unternehmer forschend ins Gesicht.
Gerade stellte der Butler die beiden Drinks auf den niedrigen Marmortisch. Ingo machte eine rasche Handbewegung, die dem Angestellten andeutete, daß er zu verschwinden habe. »O doch, aber nur eigene.« Er sah bewundernd auf die Frau an seiner Seite. »Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Für einen Mann wie mich ist ein Erbe sehr wichtig. Das weißt du ja.«
»Du hast doch Markus«, bemerkte Carina mit unschuldiger Miene.
»Hör auf damit. Ich bitte dich. Du bist wunderschön, Carina. Wenn ich dein Haar berühre, überkommt mich eine nie gekannte Zärtlichkeit, und wenn ich in deine Augen sehe, wünsche ich mir, daß du immer bei mir bist. Du mit deinem süßen Gesicht, deinem verlockenden Lächeln, mit deinem herrlichen Körper.«
»Ich werde aber nicht immer schön sein. Ich werde graue Haare bekommen, Falten im Gesicht und häßliche Zähne.«
»Niemals. Du wirst so viel Geld zur Verfügung haben, daß du dich pflegen kannst wie eine Fürstin. Ich will immer stolz auf dich sein. Außerdem bin ich elf Jahre älter als du. Mit vierunddreißig wird es Zeit, eine Familie zu gründen. Nachkommen zu haben. Ich möchte dich heiraten, Carina. Du sollst die Mutter meiner Kinder sein.« Ingo sagte es so, als vergebe er eine große Auszeichnung.
»Ich?« Carina hatte nie damit gerechnet, daß der reiche Industrielle sie heiraten würde. »Aber ich habe doch weder Geld noch Beziehungen. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Mutter putzt Büros.«
»Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Geld und gute Beziehungen habe ich selbst. Ich brauche eine Partnerin, die mir gefällt, in die ich mich Tag für Tag neu verlieben kann. Eine Frau wie dich, Carina.« Ingo strich mit den Fingerspitzen über die reine, weiche Haut des Mädchens. »Sag ja!« Es klang wie ein Befehl.
Dieser Ton berührte Carina unangenehm. Sie drehte den Kopf zur Seite. »Ich weiß nicht… Es kommt so überraschend. Wir kennen uns doch noch nicht sehr lange. Ich muß mir das überlegen.«
»Was gibt es da zu überlegen? Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen, Carina. Alle werden dich beneiden. Du wirst das Leben einer Prinzessin führen. Deine Mutter wird keine Büros mehr putzen, dein Vater kann sich seinen Hobbys widmen. Na, bin ich großzügig?«
»Hm… Trotzdem möchte ich dich bitten, mir etwas Zeit zu lassen.« Carina fand den Gedanken, ein Leben lang mit Ingo Fehringer zusammen zu sein, nicht besonders reizvoll. Sie spürte, daß sie ihn nicht genug liebte, um ihn viele, viele Jahre ertragen zu können. Sie war seine Freundin geworden, weil er ihr mit kostbaren Geschenken imponiert hatte. Aus Neugierde hatte sie ihn zu verschiedenen Partys begleitet, hatte mit ihm einige Reisen unternommen. Daraus hatte Ingo Fehringer dann einen Besitzanspruch abgeleitet, und Carina hatte sich überrumpeln lassen. Doch nun wurde es Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wollte und was nicht.
»Auf unsere Liebe und unsere Zukunft.« Ingo hatte Carina das Glas in die Hand gedrückt und stieß nun mit ihr an. Daß die junge Frau nicht spontan auf seinen Antrag eingegangen war, daß sie sich ein wenig zierte, fand er ganz in Ordnung.
Das ehemalige Mannequin Carina nippte vom Alkohol und stellte dann das Glas zurück. Selbstverständlich wußte sie, daß man ihr nie ein besseres Angebot machen würde, als es Ingo eben getan hatte. Ihr Beruf war hart, und die Konkurrenz groß. Sich nicht mehr darum kümmern zu müssen und trotzdem Modellkleider tragen zu können, mußte himmlisch sein.
»Das Essen ist angerichtet«, meldete der Butler in dem unterwürfigen Ton, den Ingo Fehringer schätzte.
»Komm, gehen wir hinüber.« Ingo reichte seiner Freundin galant die Hand.
»Wolltest du nicht zuerst in Italien anrufen?« erinnerte das dunkelhaarige Mädchen.
»Nein, das wollte ich nicht. Ich werde die Nummer später heraussuchen.« Ingo Fehringer ärgerte sich über Carinas Hartnäckigkeit. Er hütete sich jedoch, seinen Unwillen zu zeigen. »Ich bin ganz sicher, daß es Ingrid und meinem Neffen gutgeht. Das sollte auch dir genügen.«
»Aber wenn etwas passiert ist, könntest du doch sofort nach den Verunglückten suchen lassen.«
»Schlage dir doch endlich diese albernen Gedanken aus dem Kopf. Meine Schwester benutzte ein erstklassiges Flugzeug, das wiederum von einem sehr erfahrenen Piloten gesteuert wurde. Da ist jede Sorge überflüssig.«
Carina blieb für den Rest des Abends sehr schweigsam. Sie kostete von den erlesenen Gerichten, die der Butler servierte, nur kleine Happen und trank auch kaum etwas. Mit gemischten Gefühlen ließ sie zu, daß Ingo sie später in die Arme nahm, daß er sie küßte und streichelte.
*
So plötzlich, wie das Unwetter über den Schweizer Alpen aufgezogen war, so plötzlich verschwand es auch wieder. Nach zwei Tagen und zwei Nächten Schneesturm schien morgens die Sonne.
Die Männer der Bergwacht schlüpften in ihre Anzüge und packten ihre Ausrüstung zusammen. Auch Sascha und Toni waren wieder mit von der Partie. Sie hatten sich in jener Nacht nach dem erfolglosen Aufstieg mit den selbstlosen Helfern angefreundet und wollten sie jetzt nicht im Stich lassen.
Obwohl es achtundvierzig Stunden ununterbrochen geschneit hatte, fiel der Aufstieg nun leichter. Es war hell, man konnte sich besser orientieren und hatte weniger Schwierigkeiten mit dem Gepäck.
Die düstere Ahnung, daß die Rettungsaktion zu spät kommen würde, belastete dagegen alle Mitglieder der Gruppe. Schweigend stiegen die Männer bergan. Unterhalb des gefährlichsten Stücks machten sie kurz Rast, um etwas zu trinken und sich etwas auszuruhen.
Die beiden deutschen Studenten hatten die Erholungspause am nötigsten. Völlig erschöpft sanken sie in den Schnee und schlossen die Augen. Beide waren überzeugt, daß sie die Strapazen bis zum Gipfel nicht durchstehen würden. Doch schließlich schafften sie es doch.
»Dort oben!« Der Bergführer wies auf eine Schneehalde unterhalb des steilsten Grats.
Sascha blieb stehen und legte schützend seine Hände über die Augen. »Tatsächlich! Da oben liegt etwas«, murmelte er, von der Anstrengung keuchend.
»Das ist das Wrack!« Toni war neben ihn getreten und stützte sich schwer auf den Eispickel. »Eine Tragfläche ist abgebrochen. Das erkennt man deutlich.«
Es lief Toni kalt über den Rücken, denn er dachte an die Menschen, die in dieser Maschine verunglückt waren. Vermutlich lebte niemand mehr von ihnen.
»Heilige Maria!« Einer der biederen Bergbewohner bekreuzigte sich. »Da wird nichts mehr zu machen sein. Die Trümmer liegen überall verstreut.«
»Trotzdem müssen wir rauf.« Der Bergführer sah zum Gipfel.
»Weißt du, daß hier die meisten Gletscherspalten sind?« fragte sein Kamerad ihn. »Die Toten liegen gut da oben. Die kann man auch in sechs Wochen noch bergen, wenn der Schnee geschmolzen ist.«
»Woher weißt du, daß es keine Überlebenden gibt?« Der Bergführer sah seinen Landsmann streng an.
»Du weißt doch, was in den vergangenen zwei Tagen und Nächten hier los war. Glaubst du wirklich, daß das jemand überstanden hat, auch wenn er nicht verletzt war?«
»Was wir glauben, spielt keine Rolle. Wir müssen uns überzeugen.«
»Und was ist, wenn wir dabei draufgehen?« Der Mann blickte in die Runde. »Die Gletscherspalten sind doch alle zugeweht. Du trittst auf den Schnee, sinkst ein und stürzt ab. So einfach ist das.«
»Ich werde als erster gehen. Wenn der Schnee mich trägt, kommt auch ihr hinüber.« Der Bergführer preßte die Lippen zusammen. Er wußte, daß sein Kamerad recht hatte. Sie riskierten ihr Leben und wußten nicht einmal, ob es einen Sinn hatte.
»Das ist nicht sicher«, schrie der andere dem Bergführer nach.
Toni Mühlen und Sascha schauten sich kurz an, zuckten die Achseln und folgten dann der Gruppe. Es war ihnen klar, daß sie als Neulinge am gefährdetsten waren. Doch sie wollten die Männer der Bergwacht nicht enttäuschen.
Für das letzte Stück des Aufstiegs brauchte man verhältnismäßig lange. Mehr als einmal brach vor dem Bergführer eine Schneebrücke und stürzte tosend in die Tiefe. Und jedes Mal wurde der Mann, der schon so viele Touren gemacht hatte, bleich.
Endlich hatte man das Schneefeld unterhalb des Grats erreicht. Den mutigen Männern, die ihr Leben gewagt hatten, bot sich ein schreckliches Bild. Weit verstreut lagen Teile des Flugzeugwracks, halb vom Schnee bedeckt. Der Schneesturm hatte eine weiße Decke über das Bild des Grauens gebreitet. Doch die Sonne, die seit dem frühen Morgen schien, ließ die Schneeschicht von den Blechteilen, den Flugzeugsitzen und den herausgeschleuderten Koffern abrutschen. Nur die Leichen blieben bedeckt.
Die Reiter sahen eine Hand aus der glitzernden weißen Pracht ragen, einen Schuh oder ein Stück der Kleidung. Den Piloten, der unter einer Schneeverwehung lag, fanden die Hunde. Äußerlich war er nicht verletzt. Er war vermutlich erfroren.
Angesichts des Dramas, das sich hier, hoch oben in den Bergen, abgespielt hatte, sprach niemand ein Wort. Ernst waren die Gesichter der Leute, die schon zu manchem schlimmen Unfall gerufen worden waren. Im vergangenen Jahr hatten sie elf Lawinentote geborgen.
Sascha und Toni halfen alles einzusammeln, was Aufschluß über die Verunglückten geben konnte. Gerade zog Toni mit zusammengepreßten Lippen eine Handtasche unter der abgerissenen Tür der Cessna hervor. Er reichte sie dem Bergführer.
Der Schweizer nickte. »Jetzt haben wir wenigstens Paß und Führerschein einer Person. Seht mal im Innern des Wracks nach. Vielleicht findet sich dort noch mehr.«
Es kostete Sascha und Toni Überwindung, durch die Öffnung des demolierten Flugzeugs zu kriechen. Was hatte sich hier abgespielt, bevor die Maschine am Berg zerschellte und auf dem Schneefeld aufschlug? Hatten die Passagiere gewußt, daß sie sterben mußten? Hatte der Pilot erkannt, daß er mit dem Berggipfel kollidieren würde?
Das Innere des Flugzeugs bot ein Bild der Zerstörung. Die Wandverkleidung hatte sich gelöst und war über die restlichen Sitze gefallen. Kabel, Isoliermaterial und Stoffetzen hingen von der Decke. Gepäckstücke waren verstreut. Der Inhalt eines Koffers lag unmittelbar vor dem Einstieg. Kleider, Wäsche und Badesachen waren von auffallend guter Qualität.
Die beiden Studenten scheuten sich, etwas anzufassen. Sie standen in gebückter Haltung in der Nähe der Pilotenkanzel und schauten sich alles an. Trostlos sah es aus. Weder Sascha noch Toni hatten je zuvor etwas so Furchtbares gesehen. Sie fühlten sich hilflos. Hier hatte sich das Schicksal von einigen Menschen erfüllt, die allem Anschein nach sehr vermögend waren. Nun konnte ihnen das Geld nichts mehr nützen. Vielleicht war es ihnen sogar zum Verhängnis geworden.
»Habt ihr etwas gefunden?« rief von draußen der Bergführer.
»Noch nicht«, antwortete Sascha. Dann sah er Toni an. »Komm, wir können nicht hier herumstehen. Wir müssen zupacken.« Er zerrte an der Wandverkleidung.
Toni half ihm, sie zur Seite zu ziehen. »Schau mal, kein einziger Sicherheitsgurt ist eingerastet«, meinte er seufzend. »Bedeutet das nicht, daß man es nicht für nötig hielt, sich anzuschnallen, daß der Absturz unerwartet erfolgte?«
Sascha gab keine Antwort. Er war auf die Knie gegangen und streckte seine Arme unter die Sitze. Sein Herz schlug in diesem Moment so hart und laut, daß er glaubte, der Freund müßte es hören.
»Hilf mir«, stöhnte er, ohne sich nach Toni umzusehen.
Der Freund ging in die Hocke und sah über Sachas Schulter.
»O Gott, ein Kind«, flüsterte er fast ehrfürchtig.
»Es ist zwischen den Halterungen der Sitze eingeklemmt.«
»Lebt es?« Angst, Hoffnung und Trauer lagen in den beiden Worten.
»Ich weiß es nicht. Wir müssen sehr vorsichtig sein«, keuchte Sascha aufgeregt. Er schob eine Pelzjacke, die auf den kleinen Körper gefallen war, beiseite.
»Warte, ich hole ein Stemmeisen.« Toni, der sehr praktisch veranlagt war, erinnerte sich, in der Nähe der Pilotenkanzel etwas Passendes gesehen zu haben. Tatsächlich fand er den Stab ohne Mühe. Er kletterte über die Trümmer im Mittelgang zurück und setzte sein Werkzeug an. Die Erregung gab ihm Kraft. Nach zwei Versuchen schon wuchtete er den Sitz zur Seite.
Der kleine Körper kam frei. Sascha zog ihn behutsam unter den verbogenen Teilen hervor. Kalt und steif fühlte sich das Kind an. Es trug eine Skihose und einen Pullover. Sein rundes Gesichtchen war bleich, die Augen hielt es fest geschlossen.
Sorgsam nahm Sascha den kleinen Kerl in seine Arme und betrachtete ihn wehmütig.
»Ein Junge«, flüsterte er ergriffen. »Er scheint nicht verletzt zu sein. Aber wir sind wohl trotzdem zu spät gekommen.«
Toni, der Zahnmediziner, griff nach dem schmalen Handgelenk.
»Kein Puls fühlbar«, seufzte er.
»Er ist tot«, erklärte Sascha. Die Feststellung tat ihm weh. Er hätte weinen mögen vor Enttäuschung, Kummer und Erschöpfung.
Toni war erneut neben seinem Freund niedergekniet. Er beugte sich über das Kind in Saschas Armen, hob dessen Augenlider an und horchte auf den Herzschlag. Mit zittrigen Händen holte er einen kleinen Taschenspiegel aus der Jacke, rieb ihn sorgfältig ab, hielt ihn dem Kind vor Mund und Nase.
Toni hielt den Atem an. Er spürte die eisige Kälte plötzlich nicht mehr. Ihm war plötzlich heiß.
»Du, Sascha, schau doch! Der Spiegel beschlägt.«
»Das ist eine Täuschung.« Traurig schüttelte Sascha den Kopf.
»Sieh her!« befahl Toni aufgeregt. Er hatte den kleinen Spiegel nochmals abgewischt und wiederholte den Versuch. »Das Kind atmet noch. Wir müssen sofort etwas unternehmen.«
»Du hast recht.« Jetzt zitterte auch Sascha. Man mußte verhindern, daß der Kleine in seinen Armen starb. »Der Bergführer ist in Erster Hilfe ausgebildet.« Sascha kroch hoch. Er fühlte sich plötzlich so schwach, daß er den Eindruck hatte, seine Beine könnten den Körper nicht länger tragen.
Später hätte er nicht mehr sagen können, wie er ins Freie gelangt war. Draußen taumelte er auf die Männer der Bergwacht zu.
»Ein Kind! Ein Kind, das lebt!« schrie Toni hinter ihm.
*
»Schneesturm über den Schweizer Alpen«, las Nick aus der Zeitung vor. »Bekannter Wintersportort von der Außenwelt abgeschnitten.«
Irmela ließ ihr Strickzeug fallen und schnellte hoch. Sie lief zu Nick.
»Du, das ist doch das Dorf, in dem Toni Mühlen Urlaub macht.« Irmelas Stimme klang vor lauter Aufregung verändert.
»Sascha macht dort Urlaub«, verbesserte Nick aufreizend ruhig.
»Wir müssen Toni sofort anrufen.« Irmelas Augen waren groß und weit vor Angst.
»Das hat meine Mutti gestern schon versucht. Es ist aussichtslos. Die Telefonverbindungen sind unterbrochen.«
»Heißt das, daß… daß Toni etwas passiert ist?« stotterte das Mädchen aufgeregt.
»Mach dich doch nicht verrückt, Irmela«, kritisierte Pünktchen. »Die Zeitungen übertreiben immer. Es ist sicher nur halb so schlimm.«
»Aber man muß doch etwas tun.« Irmela sah Nick flehend an.
»Von hier aus hat man doch überhaupt keine Möglichkeit«, brummte Nick. »Meine Mutti hat sogar in Bern angerufen. Man hat ihr versichert, daß bis jetzt keine Opfer gemeldet sind. Es gibt vermutlich hohe Sachschäden.«
»Das sind doch alles nur Annahmen. Wenn das Dorf von allen Verbindungen abgeschnitten ist, weiß man überhaupt nichts. Stell dir vor, Toni und Sascha wären mit den Skiern unterwegs gewesen.« Irmela begriff nicht, daß ihre Freunde so ruhig bleiben konnten.
»Der Schneesturm brach nachts los. Es ist kaum anzunehmen, daß um diese Zeit noch Skiläufer unterwegs waren.«
Das waren fast dieselben Worte, mit denen Alexander von Schoenecker am Abend zuvor seine Frau getröstet und ihr die Angst genommen hatte. Wie schon so oft hatte Nick seinen Stiefvater sehr bewundert. So ruhig, so überlegen, sachlich und klug wollte auch er später einmal handeln. Ob man es lernen konnte? Ob man lernen konnte, eine so vorbildliche Ehe zu führen wie seine Eltern?
»Kann man Toni denn wirklich nicht erreichen?« jammerte Irmela. Gewöhnlich wußte Nick immer Rat, sah immer einen Ausweg. Deshalb vertraute Irmela ihm.
»Vielleicht am Abend oder morgen. Mach dir keine Sorgen. Sascha und Toni sind ja keine Anfänger. Und leichtsinnig sind sie auch nicht.«
»Steht auch etwas von dem Flugzeugabsturz in der Zeitung?« wollte Fabian wissen. »Wir haben die Meldung im Radio gehört.«
Nick hielt das Blatt höher und las. Irmela versuchte wieder zu stricken. Doch die Nadeln und die Maschen verschwammen vor ihrem Blick.
»Es soll eine deutsche Maschine gewesen sein, heißt es hier. Wahrscheinlich sind die Passagiere alle ums Leben gekommen.«
*
Voll Unruhe warteten die beiden Studenten auf dem Flur des kleinen Krankenhauses. Sie trugen noch die Bergstiefel und die orangeroten wetterfesten Anzüge. Ihre jungen Gesichter waren gezeichnet von den fast übermenschlichen Anstrengungen der vergangenen Stunden. Müde und übernächtigt sahen sie aus. Und dennoch war an Ruhe nicht zu denken. Die schrecklichen Erlebnisse dieses Tages hatten Sascha und Toni aufgewühlt und erschüttert. Noch lange würden sie die gräßlichen Bilder, die sich ihnen oben am Berg geboten hatten, nicht vergessen.
Nachdem die beiden das Kind im Flugzeugwrack gefunden hatten, war kaum etwas geredet, sondern nur gehandelt worden. Es war ein Wettlauf mit dem Tod gewesen.
»Glaubst du, daß sie es schaffen?« fragte Toni nun schon zum dritten Mal.
Auch Sascha konnte an nichts anderes denken. Er fand es ganz normal, daß sein Freund die Frage ständig wiederholte. »Ich hoffe es… ich hoffe es.«
»Man hätte das Kind lieber in eine größere Klinik bringen sollen. Dort ist man ganz anders ausgerüstet«, stöhnte Toni, dem die Zeit, in der man den Jungen behandelte, viel zu lang vorkam.
»Es wäre zu spät gewesen. Das weißt du doch. Aber ich vertraue den Ärzten hier. Die Einheimischen sagen, daß sie außergewöhnlich tüchtig sind.«
»Können sie Wunder vollbringen? Ein Wunder müßte doch wohl geschehen, wenn in diesen steifen kleinen Körper wieder Leben käme.« Angstvoll sah Toni auf die breite Tür, hinter der der Operationssaal war. Ruhe bitte! stand in Leuchtschrift auf einer Glastafel und darunter: Zutritt verboten! Immer wieder starrten die beiden Studenten auf dieses Schild und warteten darauf, daß das Licht erlosch.