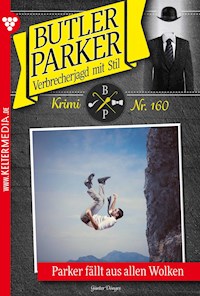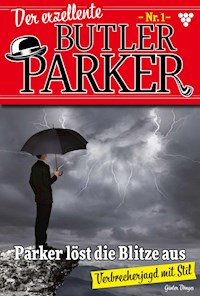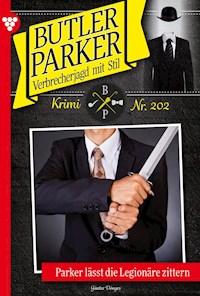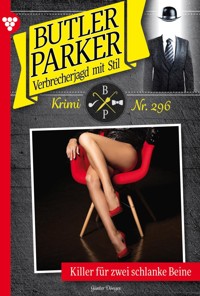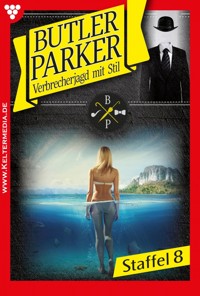
30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Butler Parker Staffel Staffel
- Sprache: Deutsch
Butler Parker ist ein Detektiv mit Witz, Charme und Stil. Er wird von Verbrechern gerne unterschätzt und das hat meist unangenehme Folgen. Der Regenschirm ist sein Markenzeichen, mit dem auch seine Gegner öfters mal Bekanntschaft machen. Diese Krimis haben eine besondere Art ihre Leser zu unterhalten. Butler Parker ist seinen Gegnern, den übelsten Ganoven, auch geistig meilenweit überlegen. In seiner auffallend unscheinbaren Tarnung löst er jeden Fall. Bravourös, brillant, effektiv – spannendere und zugleich humorvollere Krimis gibt es nicht! E-Book 71: Kleopatra E-Book 72: Cats + Dogs E-Book 73: Giftgas + Kanonen E-Book 74: Sperrt den Vampir ein E-Book 75: Girl-Quartett E-Book 76: Shark, Sharp Girls E-Book 77: Hexenwochenende E-Book 78: Lady in Red E-Book 79: Ausgetrickst E-Book 80: No Deal E-Book 1: Kleopatra E-Book 2: Cats and Dogs E-Book 3: Giftgas und Kanonen E-Book 4: Sperrt den Vampir ein E-Book 5: Girl-Quartett E-Book 6: Shark, Sharp Girls E-Book 7: Hexenwochenende E-Book 8: Lady in Red E-Book 9: Ausgetrickst E-Book 10: No Deal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1228
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Kleopatra
Cats and Dogs
Giftgas und Kanonen
Sperrt den Vampir ein
Girl-Quartett
Shark, Sharp Girls
Hexenwochenende
Lady in Red
Ausgetrickst
No Deal
Butler Parker – Staffel 8 –E-Book 71 - 80
Günter Dönges
Kleopatra
Josuah Parker war mehr als nur leicht verwirrt.
Er stand nämlich plötzlich einer Dame gegenüber, die ihn fatal an jene Kleopatra erinnerte, die seinerzeit in Ägypten Geschichte gemacht hatte.
Sie trug ein enganliegendes Kleid, das bis zu ihren Knöcheln reichte. Die nackten Füße mit den rot gelackten Zehennägeln steckten in leichten Sandalen, und auf den schlanken Oberarmen befanden sich goldschwere Spangen in Form von sich windenden Schlangen.
Ihre dunklen Augen blitzten erfreut, als sie Parker vor sich sah. Sie strich sich das rabenschwarze Haar ihrer Ponyfrisur glatt und schaute einen Moment selbstzufrieden auf ihr verwegen anmutendes Dekolleté. Sie schien bemerkt zu haben, daß auch Parker beeindruckt war.
»Wo kommt Ihr her, Fremder?« erkundigte sie sich mit einer reizenden Kinderstimme, in der aber bereits Verruchtheit zu erkennen war.
»Parker – Josuah Parker«, stellte der Butler sich formvollendet vor und lüftete höflich seine schwarze Melone.
»Kommt Ihr aus Mesopotamien?« wollte Kleopatra wissen.
»Eigentlich nicht direkt«, erwiderte Parker höflich, »mehr aus Chikago, falls Ihnen das ein Begriff ist, Königin!«
Sie nickte geistesabwesend und griff nach ihrem Metallspiegel, in dem sie sich bewunderte. Sie schien plötzlich jedes Interesse an Parker verloren zu haben und entschwebte.
Parker sah ihr verdutzt nach. Mit solch einer Begegnung hatte er nicht gerechnet. Er war gespannt, was sonst noch alles auf ihn zukommen würde. Er machte sich auf Überraschungen gefaßt.
Die nicht lange auf sich warten ließen, wie sich sehr schnell zeigen sollte.
Madame Pompadour kreuzte seinen Weg.
Parker konnte durchaus verstehen, warum und wieso ein gewisser französischer König ihr sein intimes Vertrauen geschenkt hatte. Madame war vielleicht noch attraktiver als Kleopatra. Was mit ihrer ausgeprägten fraulichen Reife Zusammenhängen mußte.
Sie zwinkerte Parker zu und winkte ihm mit dem Zeigefinger vertraulich. Dieser Wink war eine mehr als eindeutige Einladung und Herausforderung, ihr ins Nebenzimmer zu folgen.
Parker befand sich in einem echten Zwiespalt der Gefühle. Sollte er Madame folgen? Oder sollte er sich diskret zurückziehen? Nun, bevor er zu einem Entschluß kam, erschien Ludwig XV. auf der Bildfläche und benahm sich wenig königlich.
Was sich in einer saftigen Ohrfeige ausdrückte, die er Madame verabreichte.
Die Pompadour kreischte auf wie eine beleidigte Marktfrau und trat ihrem Liebhaber und König kurz und knapp gegen das Schienbein.
Worauf der königliche Ludwig das Gesicht schmerzvoll verzog und zu einer zweiten Ohrfeige ausholte. Die aber nicht mehr ihr Ziel erreichte, da Madame es vorgezogen hatte, das Weite zu suchen.
»Ich fordere Genugtuung«, schnarrte Ludwig den Butler an und zog seinen Zierdegen.
Parker, der das bisher für einen schlechten Scherz gehalten hatte, wurde augenblicklich und zielsicher von diesem Stoßdegen bedroht.
Er sah sich daher gezwungen, seinen Universal-Regenschirm einzusetzen. Und Parker erwies sich schon nach dem ersten Durchgang als ein wahrer Meister der Fechtkunst.
Ludwig XV. starrte verblüfft seinem Degen nach, den Parker ihm geschickt aus der Hand geschlagen hatte.
»Ich werde meine Wachen alarmieren«, schnarrte der königliche Ludwig und maß den Butler mit ausgesprochen zornigen Blicken, »die Bastille wird ihn zur Vernunft bringen!«
»Echauffieren Sie sich nur nicht«, bat Parker höflich und machte den Kratzfuß nach, den Ludwig gerade getan hatte. Dann wandte der König sich um und ging mit wallender Perücke davon. Er hinterließ eine süßliche Parfümwolke.
Josuah Parker räusperte sich leicht, als er endlich allein war. Er hatte längst erkannt und eingesehen, daß dieser Besuch seine Nerven zu strapazieren begann. Er hoffte dringend, in die Jetztzeit zurückkehren zu können. Diese hastigen Sprünge in die Geschichte und Vergangenheit verwirrten ihn nur unnötig.
»Ganz schön verrückt, was?« Parker drehte sich zu der ironisch klingenden Stimme um, die hinter ihm ertönte. Er sah sich einem jungen und sportlichen Mann gegenüber, die ihn sehr eindeutig an Robin Hood erinnerte. Das hing schon mit der Kleidung dieses edlen Räubers zusammen, der eine enganliegende Hose trug und darüber ein rotes Wams. In den Händen hielt der Retter der Enterbten und Erniedrigten Pfeil und Bogen.
»Zumindest etwas ungewöhnlich«, erwiderte Parker in seiner höflichen Art und Weise.
»Die hier sind doch alle bekloppt«, behauptete Robin Hood verächtlich, »wundert mich, daß man die frei herumlaufen läßt.«
»Sie – Sie sind einer der Pfleger?« erkundigte sich Parker aufatmend.
»Pfleger? Daß ich nicht lache! Eingesperrt hat man mich hier. Lebendig begraben. Und was die Pfleger betrifft, so will ich Ihnen ein Geheimnis verraten.«
»Ich lasse mich gern überraschen«, versprach Parker. Er sah Robin Hood erwartungsvoll an.
»Die Pfleger«, sagte der Räuber mit leiser Stimme und sah sich dabei mißtrauisch um, »die Pfleger, Sir, die sind doch alle verrückt. Haben Sie das noch nicht mitbekommen?«
*
»Na, endlich, Parker«, sagte Mike Rander und strebte schnell auf seinen Butler zu, »ich habe Sie schon überall gesucht. Ich brauche einen harten Schluck.«
»Wenn Sie gestatten, Sir, würde ich mich solch einem Verlangen nur zu gern anschließen«, erwiderte Parker.
»Unheimlich, dieses Maskenfest«, redete Rander weiter und wischte sich dicke Schweißtropfen von der Stirn, »wissen Sie, wer mir da eben einen fast unsittlichen Antrag gemacht hat?«
»Ich bin auf alles gefaßt, Sir.«
»Die Zarin Katharina!«
»Was zu ihr passen würde, Sir, falls man der Historie glauben darf.«
»Mein Bedarf ist auf jeden Fall reichlich gedeckt, Parker. Wir werden uns absetzen. Kommen Sie, suchen wir die Bar und Doc Waterson.«
Zu Randers Enttäuschung stießen sie zuerst auf den Chef des Hauses. Dr. Waterson war etwa 55 Jahre alt, groß und massig wie ein Turm. Er glich irgendwie Laughton, dem gewichtigen Filmschauspieler.
»Ein gelungener Abend, wie?« fragte er strahlend.
»Wahrscheinlich«, gab Rander zurück, »Sie werden das besser beurteilen können als ich.«
»Alles Therapie, mein Bester«, redete Waterson weiter. Er trug übrigens Zivilkleidung, einen Smoking, dessen Jackett sich über seinem Bauch strammte. »Das hier gehört mit zur allgemeinen Entkrampfung meiner Gäste. Und Sie werden gesehen haben, wie begeistert sie mitspielen.«
»Wobei sich die Frage erhebt, Sir, woher Sie diese originellen Kostüme haben«, schaltete Josuah Parker sich ein.
»Woher wohl? Eigener Fundus. Alles aus Spenden.« Waterson knipste ein noch strahlenderes Lächeln an und winkte Cäsar, der mit einem seiner Legionäre durch den Korridor hinüber in den großen Festsaal stampfte.
»Sie müssen erstklassige und zahlungsfähige Gönner haben«, stellte der junge Anwalt fest.
»Hab’ ich! Hab’ ich!« Waterson nickte freudig, »dafür biete ich aber auch echte Heilungen. Hypnose, Gruppentherapie. Individualbehandlung und das Freimachen verschütteter Persönlichkeit. Man weiß mich zu schätzen!«
»Wie schön für Sie«, sagte Rander trocken.
»Wer schätzt Sie, Sir, wenn man höflichst fragen darf?« Parker wollte es wieder mal genau wissen.
»Die Angehörigen meiner Patienten«, präzisierte Waterson prompt, »ich könnte die Kapazität des Hauses verdoppeln. Und vielleicht werde ich wirklich noch mal anbauen. Das ist kaum noch eine Geldfrage.«
»Vorher möchten wir uns aber verabschieden«, sagte Rander ohne jedes Bedauern, »es war nett, daß Sie uns eingeladen haben, Doc. Wir haben … Moment, was ist denn los!? Parker!«
Er sah seinem Butler nach, der die Bar gefunden oder zumindest gewittert zu haben schien, denn sein Butler schritt zwar gemessen, aber doch unverkennbar schnell aus dem kleinen Empfangsraum und verschwand im Korridor.
»Entschuldigen Sie mich!« sagte nun auch Waterson und hatte es sehr eilig.
Erst jetzt hörte Rander einige spitze und grelle Schreie. Und erst jetzt wurde ihm bewußt, daß der allgemeine Geräuschpegel erheblich zugenommen hatte.
Er kam zu dem treffenden Schluß, daß irgend etwas passiert war. Er konnte sich vorstellen, daß vielleicht eine handfeste Prügelei zwischen Buffalo Bill und Kolumbus stattfand.
In diesem Haus war eben alles möglich.
*
Parker blieb betroffen stehen.
Er hatte sich in der Tür zu einem kleinen rechteckigen Saal aufgebaut und schaute auf die Guillotine, die man darin versteckt hielt.
Dieses mechanische Gerät zum schnellen Ablösen eines diversen Kopfes vom Rumpf sah ungemein echt aus. Das Schrägmesser war hochgezogen und sollte von einem Mann bedient werden, dessen Kleidung an die der Sansculotten aus der Französischen Revolution erinnerte. Der Henker machte einen fast heiteren und gelösten Eindruck und sah interessiert auf den jungen Adeligen, dessen Kopf man bereits samt Körper auf die Wippe geschnallt hatte.
Irgendwie spürte Parker, daß dies alles kein Spaß mehr war! Er fühlte, daß sich etwas zusammenbraute, das schreckliche Folgen nach sich zog.
Parker boxte sich einen Weg durch die Masse der neugierigen Zuschauer. Es handelte sich um etwa zwanzig Frauen und Männer, die alle Kostüme trugen. Aber das störte sie nicht. Sie fühlten sich der Französischen Revolution verhaftet, und sie wollten einen Kopf rollen sehen.
Parker schaffte es nicht mehr.
Es wurde plötzlich totenstill. Der Geräuschpegel war völlig in sich zusammengerutscht.
Der junge Adelige auf der Wippe der Guillotine schien sich in sein schreckliches Schicksal ergeben zu haben. Er wehrte sich nicht mehr gegen die Griffe der beiden Henkersknechte, deren Gesichter hinter Masken verborgen waren.
Die Wippe wurde herumgelegt.
Der Körper des Opfers befand sich jetzt waagerecht unter dem Fallbeil. Der Kopf wartete nur noch darauf, vom Rumpf getrennt zu werden.
»Halt!« Parker rief mit einer an sich leisen Stimme. Da es aber totenstill geworden war, wirkte sein Einwand wie der Stoß einer Fanfare.
Doch seine Stimme wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Sie verhallte ungehört.
Dann legte der Sansculotte einen Sperrhebel um, und das Fallbeil zischte nach unten, direkt auf den Nacken des Opfers zu.
Parker schloß ungewollt die Augen. Er wollte das Schreckliche nicht sehen. So hilflos wie im Moment hatte er sich bisher selten gefühlt.
Dann, als der Geräuschpegel wieder anstieg, schaute er hinauf auf das Gerüst der Guillotine.
Das Opfer erhob sich gerade und grinste mit törichtem Gesichtsausdruck in die Menge, die sich an den Händen faßte und das Blutgerüst umtanzte. Übrigens zu den Klängen einer Rumba, was eigentlich nicht paßte und eine Art Anachronismus war.
»Sie dachten doch nicht etwa, die Guillotine sei echt, Mister Parker?«
Der Butler wandte sich zu Dr. Waterson um, der hinter ihm aufgetaucht war.
»Der Wahrheit die Ehre«, bekannte Parker, »ich glaubte in der Tat an die Schärfe des Fallbeils!«
»Sehr echt, nicht wahr?« Waterson schien stolz zu sein.
»Ungewöhnlich echt«, bekannte der Butler weiter, »gehören diese Spiele auch zu Ihrer Beschäftigungstherapie?«
»Selbstverständlich!« Waterson nickte begeistert und sah zufrieden auf seine Patienten, die den kleinen Saal verließen. Wahrscheinlich strömten sie in den nächsten Raum, um etwas für ihre Gesundheit zu tun.
»Werden damit nicht Energien freigesetzt, die man später kaum noch hemmen kann?« wollte Parker wissen.
»Sicher nicht.« Waterson sagte es mit Nachdruck. »Darauf achte ich schon, Sie sehen etwas mitgenommen aus, Mister Parker.«
»Darf ich Sie etwas fragen?« erkundigte sich der Butler.
»Aber sicher.« Waterson beugte sich neugierig zu Parker hinunter.
»Wo finde ich die Hausbar?« stellte der Butler kurz und knapp seine Frage, »mir scheint, Sir, daß ich das brauche, was man einen herzhaften Schluck zu nennen pflegt!«
*
»Und dann?« wollte Sue Weston eine knappe Stunde später wissen. Sie hielt sich zusammen mit Rander und Parker im Studio des Penthouse auf und hatte sich bis zu diesem Punkt die ungewöhnliche Geschichte angehört, und zwar in einer Mischung aus Amüsiertheit und Grauen.
»Wir gewannen den Parkplatz«, berichtete Rander weiter, »reden wir nicht mehr davon, Miß Weston, daß ein Häuptling der Sioux uns noch kurz vor dem Einsteigen skalpieren wollte!«
»Zu schweigen von Hannibal, Sir, der Ihnen sein Kurzschwert in die unteren Rippenpartien zu jagen beabsichtigte!«
»Tatsächlich!« Rander schüttelte den Kopf, »ein Alpdruck, was wir erlebt haben, Sue. Sagenhaft. Von solchen Dingen träumt man normalerweise nur.«
»Und das alles spielte sich in einem Privatsanatorium ab?« erkundigte sich die Sekretärin.
»Richtig.« Rander nickte. »Ein Bungalow- und Gebäudekomplex in der Nähe von Stratford. Eine sehr reizvolle Gegend nördlich von Rock Falls.«
»Muß man Stratford kennen?« fragte Sue lächelnd.
»Sie sollten es vergessen«, gab Rander zurück, »Sie sollten vor allen Dingen dieses Nervensanatorium vergessen. Und diesen Dr. Waterson!«
»Wird Ihnen das gelingen?« Sue musterte Rander und Parker nacheinander sehr betont.
»Ich werde mich bemühen«, erwiderte Rander.
»Und ich werde es erst gar nicht versuchen, Miß Weston«, räumte der Butler ein, »dieses Szenarium werde ich wohl niemals wieder vergessen.«
»Wie sind Sie eigentlich dorthin geraten?« Sue hatte einen echten Nachholbedarf an Informationen, denn sie war ein paar Tage unterwegs gewesen und hatte in New York eine Freundin besucht.
»Wir fuhren im Auftrag eines Klienten, dessen Sohn bei Waterson untergebracht ist«, informierte Rander also, »dieser Junge, übrigens ein Rauschgiftsüchtiger, der privat behandelt werden soll, schrieb schreckliche Briefe an seine Eltern. Daraufhin setzten wir uns in Bewegung.«
»Konnten Sie den Rauschgiftjüngling sprechen?« wollte Sue Weston wissen.
»Nur sehr kurz. Und er wußte plötzlich nicht mehr, was er geschrieben hatte. Er redete sich auf Mißverständnisse heraus.«
»Er log, Sir, falls mir diese Offenheit gestattet ist.« Parker hatte sich korrigierend eingemischt.
»Möglich«, sagte Rander zurückhaltend, »wir haben den Eltern des Jungen geraten, sich an die Behörden zu wenden.«
»Stand der junge Mann vielleicht unter irgendeinem Druck?« wollte Sue Weston wissen. Sie wußte, daß sie mit dieser Frage dem Butler einen echten Gefallen erwies.
»Offensichtlich«, sagte Parker prompt und schnell, »meiner bescheidenen Ansicht nach war er entsprechend präpariert worden.«
»Und welche schrecklichen Dinge schrieb er an seine Eltern?« Sue Westens Neugier steigerte sich.
»Lassen wir das«, wollte Rander ausweichen und das Thema beenden, »für mich ist die Sache erledigt.«
»Nun, die Berichte des jungen Mannes, die sich in drei Briefen befanden, die aus dem Sanatorium hinausgeschmuggelt wurden, diese Berichte sprachen von Mord!« Parker hatte sich nicht beeindrucken lassen.
»Mord?!« Sue staunte nicht schlecht.
»Von Mordversuchen«, schwächte Mister Rander sofort ab, »die Phantasien eines Rauschgiftsüchtigen, wenn Sie mich fragen, Sue … Hier alles in Ordnung? Wie war der Rückflug? Warum sind Sie nicht noch ein paar Tage in New York geblieben?«
Bevor Sue antworten konnte, meldete sich der Türsummer.
Parker verließ gemessen und würdevoll das Studio seines jungen Herrn und begab sich hinüber in die große Wohndiele. Hier öffnete er einen Wandschrank und schaltete das hauseigene Fernsehgerät ein, das in Sekundenschnelle sofort Bild und Ton lieferte.
Vor dem Eingang zum Lift, der von der Straße aus direkt hinauf zum Penthouse reichte, stand ein schlanker Mann von vielleicht 55 Jahren.
Er machte einen aufgeregten und nervösen Eindruck. Er klingelte gerade ungeduldig und erneut.
Parker betätigte auf elektrischem Weg den Türöffner und wartete, bis der Besucher den Privat- und Direktlift betreten hatte. Als der Lift sich dann nach oben bewegte, begab Parker sich zurück zu seinem jungen Herrn, der ihm bereits mit Sue Weston entgegenkam.
»Nun?« fragte Rander.
»Mister Moberly«, meldete Parker gemessen, »er scheint das zu sein, was man ungewöhnlich erregt nennt.«
»Mister Moberly?« fragte Sue Western und sah Rander neugierig an.
»Der Vater des bewußten Rauschgiftjünglings«, erklärte Mike Rander und verzog sein Gesicht, »jetzt fehlt nur noch, daß etwas passiert ist.«
*
»Vor einer Stunde kam der Anruf«, sagte Moberly und wischte sich den Schweiß von der hohen Stirn, »und ich weigere mich einfach, das zu glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Michael tot sein soll. Ich weigere mich entschieden.«
Rander schwieg betroffen, und Sue senkte den Blick. Fast verlegen griff sie nach einem Stenoblock und ließ sich an ihrem Schreibtischchen in Randers Studio nieder.
Josuah Parker stand wie eine Statue aus Bronze an der Tür und verzog keine Miene.
»Mikes Herz soll versagt haben«, redete Paul Moberly weiter, »das wenigstens sagte Dr. Waterson. Aber das glaube ich einfach nicht, Rander! Sie wissen doch, Mike schrieb von den Mordversuchen im Sanatorium. Wissen Sie, was ich glaube? Er ist umgebracht worden. Man hat ihn ermordet!«
»Haben Sie sich schon mit der Polizei in Verbindung gesetzt?« fragte Rander.
»Das werde ich, darauf können Sie sich verlassen! Ich fahre gleich los nach Stratford. Und, bitte, Sie werden mitkommen. Sie müssen mitkommen! Ich will mich nicht abspeisen lassen. Ich will wissen, wer meinem Jungen umgebracht hat. Und warum man es getan hat. Ich will die Wahrheit herausfinden. Und wehe dem, der für diese Tat verantwortlich ist. Mit meinen eigenen Händen werde ich dieses Schwein erwürgen. Mit meinen eigenen Händen!«
»Darf ich fragen, ob Sie sich möglicherweise noch im Besitz der bewußten drei Briefe Ihres Sohnes befinden, Sir?« schaltete der Butler sich ein.
»Natürlich. Und für mich sind sie ein wichtiges Beweismittel! Ich habe sie unten im Wagen. In meinem Aktenkoffer.«
»Ist der Wagen unbewacht?« erkundigte Parker sich weiter.
»Meine Frau ist im Wagen. Sie will unbedingt mit nach Stratford. Aber versuchen Sie ihr das auszureden, Mister Rander. Sie bricht mir doch glatt zusammen, wenn sie Mike sieht.«
Bevor Rander antworten konnte, ging erneut der Türsummer des Privatlifts.
Parker öffnete in der Wohnhalle den Wandschrank und schaltete das hauseigene Fernsehgerät ein.
Er wußte sofort, was passiert war, als er die vor Angst bebende schmale Frau sah, die verzweifelt klingelte, um dann in sich zusammenzusinken.
Parker eilte nach unten auf die Straße, um der Frau zu helfen, die übrigens Mistreß Moberly hieß.
*
Sie bat um ein Glas Milch, das Parker ihr selbstverständlich bieten konnte. Er schätzte es, seinem jungen Herrn Milch zu servieren. In seinen Augen befand Rander sich immer noch im Stadium des Wachsens, er brauchte laut Parker die wertvollen Mineralstoffe, Spurenelemente und hochwertigen Eiweiß- und Milchfettstoffe, die Parker manchmal raffiniert mit hochprozentigen Beigaben auffrischte.
Mistreß Moberly merkte überhaupt nicht, daß ihr Milchgetränk ebenfalls etwas hochgejubelt worden war. Gierig trank sie das Glas leer, bevor sie überhaupt in der Lage war, ihre Geschichte zu erzählen.
Sie war im Grunde knapp genug.
Sie hatte im Wagen gesessen, dessen Tür plötzlich von einem jungen Mann aufgerissen worden war. Dieser junge Mann hatte kommentarlos die Wagentür geöffnet und den Aktenkoffer an sich genommen. Dann war er in Sekundenschnelle verschwunden und hatte eine völlig entnervte Frau zurückgelassen.
»Darf ich noch etwas Milch nachservieren?« erkundigte sich Parker höflich bei ihr.
»Haben Sie keine anderen Sorgen?« bellte Mister Moberly den Butler an, »rufen Sie die Polizei! Verständigen Sie einen Streifenwagen! Klarer Fall, daß das ein gezielter und geplanter Überfall gewesen ist.«
»Darin haben Sie recht«, pflichtete Rander dem Mann bei, »es ging wohl um die bewußten drei Briefe.«
»Wobei sich automatisch die Frage erhebt, Sir, woher dieser junge Mann von den drei Briefen wußte, die immerhin aus dem Sanatorium geschmuggelt wurden.« Parker hatte wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen.
»Haben Sie mit irgendeiner Person über die Briefe gesprochen?« erkundigte sich Rander bei Moberly.
»Nein. Das heißt – warten Sie. Ja, richtig. Mit Ihnen habe ich drüber gesprochen. Aber sonst …? Nicht, daß ich wüßte.«
»Und Sie, Mistreß Moberly?«
»Ich habe mit keinem Menschen darüber gesprochen.« Sie schüttelte langsam den Kopf und stierte wieder zu Boden. Sie befand sich hart am Rande eines Nervenzusammenbruchs, wie deutlich zu sehen war. Der Tod ihres Jungen und der Überfall, den sie gerade über sich hatte ergehen lassen, das alles war einfach zuviel für sie.«
»Wollen Sie Ihre Frau etwa mit nach Stratford nehmen?« fragte Rander leise Mister Moberly.
»Sie will mit. Um jeden Preis.«
»Versuchen Sie, es ihr auszureden, Mister Moberly.«
»Ich möchte sie bei mir haben«, sagte Moberly, »allein würde sie bestimmt durchdrehen. Wann fahren wir?«
»Wir?«
»Sie werden doch mitkommen, oder?«
»Was versprechen Sie sich davon, Mister Moberly. Die Polizei wird Ihnen besser helfen können.«
»Bitte, Sir. Bitte, kommen Sie mit! Paul, äh, mein Mann, braucht jetzt Ihre Hilfe. Wir kennen uns in Stratford nicht aus. Und dann der Umgang mit den Behörden. Sie wissen doch, daß er von Mord spricht.«
»Für wieviel Tage wünschen Sie gepackt zu sehen, Sir?« fragte Parker staubtrocken von der Tür her. »Wenn ich vorschlagen darf, so würde ich zu dem Wochen-Set raten.«
»Moment mal! Parker … Wir … Wir …« Rander war wirklich noch nicht bereit, sich in dieses neue Abenteuer zu stürzen. Gewiß, Moberly war ihm bekannt. Er hatte ihn schon verschiedentlich als Anwalt vertreten, aber er fühlte sich nicht verpflichtet, in diese privaten Dinge einzugreifen.
»Vergessen Sie mich nicht«, rief Sue Weston Parker zu, »ich nehme den kleinen Lederkoffer und die Reisetasche.«
»Sie wollen mitkommen, Sue?« Rander sah Sue Weston fast strafend an.
»Eine Sekretärin gehört in allen Lagen an die Seite ihres Chefs«, übertrieb Sue ernst, »ich werde selbstverständlich auch die Reiseschreibmaschine und das Diktiergerät mitnehmen?«
Mike Rander nickte ergeben.
Er ahnte wieder mal, was da auf ihn zukam. Erfreulich konnte es sicher nicht sein.
*
Von einem Maskenball im Sanatorium war keine Rede mehr, als Rander und Parker sich bei Dr. Waterson melden ließen. Genau das Gegenteil war der Fall. Es herrschte eine spürbar gedrückte Stimmung. Von den Patienten bekamen Rander und Parker nichts zu sehen. Man schien sie absichtlich in den Einzelhäusern und Bungalows zurückgehalten zu haben.
Waterson sah ernst, aber würdevoll aus, als er in das Besuchszimmer trat.
»Ich freue mich, daß Sie das Ehepaar Moberly begleitet haben«, sagte er, »aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Es war schrecklich, als ich den Moberlys ihren Sohn zeigte. Mistreß Moberly erlitt einen Nervenzusammenbruch.«
»Ich weiß«, erwiderte Rander, »hat Mister Moberly mit Ihnen gesprochen!«
»Wegen dieser Briefe? Ja, wir diskutierten darüber. Ich schließe Mord selbstverständlich aus. Wer sollte Mike schon umgebracht haben?! Er war ein netter Junge, vielleicht ein wenig aufbrausend, aber sonst anpassungsfähig.«
»Mister Moberly verlangt eine Autopsie, ist Ihnen das bekannt, Doktor?«
»Auch ich bestehe darauf, um jeden Verdacht aus dem Weg zu räumen«, erklärte Waterson, »ich habe mich deswegen bereits mit dem Sheriff dieses Bezirks in Verbindung gesetzt. Und selbstverständlich kann und soll Mister Moberly noch einen Arzt oder Coroner seiner Wahl hinzuziehen.«
»Sie schließen Mord also aus?« Rander sah Dr. Waterson aufmerksam ah.
»Selbstverständlich«, erklärte der Arzt kategorisch. »Mike starb an akutem Herzversagen. Wenn Sie mich fragen, so muß der Junge es verstanden haben, sich Rauschgift zu verschaffen. Er starb mit größter Wahrscheinlichkeit an einer Überdosis.«
»Hatte er bestimmte Freunde hier im Haus?«
»Clive Muscat.«
»Was ist das für ein Patient?« wollte Rander wissen. Er hatte die Fragen übernommen, während Josuah Parker sich absichtlich zurückhielt. Er wollte den Arzt aus der Distanz studieren, wie er es immer gern tat. Es galt, die Persönlichkeit dieses Mannes auf sich wirken zu lassen.
»Clive Muscat ist Alkoholiker«, erläuterte Dr. Waterson gelassen, »ein schwieriger junge Mann, der noch unter Entziehungserscheinungen leidet.«
»Könnte man diesen Clive Muscat sprechen?«
»Natürlich, aber was versprechen Sie sich davon?«
»Vielleicht gewisse Informationen«, schaltete Josuah Parker sich jetzt höflich und gemessen ein, »grundlos dürfte Michael Moberly diese Briefe nicht geschrieben haben.«
»Wann bekomme ich diese Briefe endlich zu sehen?« fragte Waterson etwas aggressiv, »was steht in ihnen? Was hat Mike konkret behauptet?«
»Er schrieb von Mordversuchen in Ihrem Sanatorium!«
»Von Mordversuchen an ihm?«
»In etwa«, gab Parker ausweichend zurück.
»Dann war sein Geist bereits verwirrter als ich annahm«, entgegnete Waterson kopfschüttelnd, »ich kann nur immer wieder fragen, wer ihn denn ermorden wollte? Glauben Sie mir, meine Patienten habe ich unter Kontrolle! Ich habe erstklassige Mitarbeiter.«
Bevor Mike Rander auf diesen Punkt näher eingehen konnte, war draußen auf dem Korridor plötzlich ein erstickter Aufschrei zu hören, dem ein dumpfer Fall folgte.
Parker war ungemein schnell an der Tür, die er noch schneller öffnete.
Er sah, daß zwei stämmige Pfleger damit beschäftigt waren, einen etwa 30jährigen schlanken Mann wegzuschaffen. Sie bedienten sich dabei brutaler Mittel. Sie hatten dem Mann die Arme auf den Rücken gedreht und schleiften ihn hastig in einen Raum, dessen Tür sie mit einem kräftigen Fußtritt geöffnet hatten.
»In der Tat, Sir«, wandte Parker sich an Doc Waterson, der neben ihm erschienen war, »Ihre Mitarbeiter dürften das sein, was man erstklassig nennt. Mir imponiert zum Beispiel die diskrete Wahl ihrer Behandlungsmittel. Es muß eine wahre Freude sein, in Ihrem Haus leben zu dürfen.«
*
»Mir scheint, daß ich bereits das Vergnügen hatte«, sagte Parker zu dem jungen Mann, der ins Sprechzimmer gekommen war. Er hatte sich auf keinen Fall getäuscht, denn er stand Robin Hood gegenüber, der auf dem Maskenfest der Patienten behauptet hatte, alle Pfleger seien total verrückt.
»Clive Muscat«, stellte Hood sich vor. Er trug jetzt eine Art Einheitskleidung, die aus Hose und Hemd bestand und an die Ausgehkleidung der Armee erinnerte.
»Mein Name ist Parker – Josuah Parker«, gab sich nun auch Parker zu erkennen, »ich erfuhr, daß Sie mit dem inzwischen verstorbenen Mike Moberly eng befreundet waren.«
»Wer hat Ihnen denn das erzählt?« Muscat machte einen völlig normalen Eindruck. Was wohl auch damit zusammenhing, daß er auf Pfeil und Bogen verzichtet hatte.
»Dr. Waterson.«
»Dann muß es ja stimmen«, gab Muscat spöttisch zurück, »was erwarten Sie jetzt von mir?«
»Die ehrliche Antwort auf einige bescheidene Fragen«, erwiderte der Butler. »Entspricht es den Tatsachen, Mister Muscat, daß es hier im Sanatorium zu gewissen Mordversuchen gekommen ist?«
»Wie war das? Mordversuche!?« Muscat grinste und schüttelte dazu den Kopf. »Davon habe ich noch nie gehört. Wer hat denn das behauptet?«
»Ihr Freund Moberly.«
»Mein Freund? Hören Sie, ich habe Moberly nur flüchtig gekannt.«
Es war erstaunlich, wie Muscat seine Antwort verkaufte. Er grinste und deutete dabei auf eine Tischlampe, die auf der Fensterbank stand. Sie sah völlig unverdächtig aus und lieferte sicher auch ein gutes Licht, aber dennoch schien sie mehr zu sein als nur eine Lampe.
Als Muscat schließlich in einer Art Kurzpantomime die Bewegungen eines Telefonierenden machte, da wußte der Butler Bescheid. In der Lampe mußte sich ein Mikrofon befinden. Muscat wußte das und hütete sich aus irgendwelchen Gründen, jetzt und hier die Wahrheit zu sagen.
»Sie haben Mike Moberly also nur flüchtig gekannt«, wiederholte Parker und bediente sich einer anderen Taktik, »welchen Eindruck hatten Sie von ihm?«
»Total durchgedreht, das war er. Das Rauschgift hatte ihn schon fertig gemacht, bevor er hierher kam. Er litt an Halluzinationen, und an ’nem Verfolgungswahn. Ja, das war es! Verfolgungswahn! Er fühlte sich am laufenden Band gejagt und verkroch sich am liebsten unter seiner Bettdecke. Das war der Grund, warum ich die Bekanntschaft zu ihm nicht ausgebaut habe. Selbst in mir sah er irgendeinen Menschen, der ihm ans Leder wollte.«
»Können Sie sich vor stellen, Mister Muscat, daß er ermordet wurde?«
»Ermordet? Lächerlich! Wenn überhaupt, dann hat er sich selbst umgebracht, das ist meine Meinung.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Hinweise«, sagte Parker und nickte Muscat zu.
»Gern geschehen«, erwiderte Muscat, der überhaupt nicht mehr an den edlen Robin Hood erinnerte. Er schien unter irgendeinem Druck zu stehen und Angst zu haben. Auf seiner Stirn hatten sich Schweißtropfen gebildet. Er schielte immer wieder hinüber zur Tischlampe.
»Eine letzte Frage vielleicht noch«, rief Parker dem jungen Mann zu, der auf eine zweite Tür im Besucherzimmer zugehen wollte. Muscat blieb stehen und drehte sich um.
»Sind Sie freiwillig hier?« erkundigte sich Parker.
»Wie man’s nimmt«, gab Muscat zurück, »ich bin Trinker, falls Sie das noch nicht wissen sollten. Ich habe im Suff eine Frau überfahren und säße jetzt wohl schon im Gefängnis, wenn die ärztlichen Gutachten nicht gewesen wären. Statt Gefängnis bin ich jetzt hier bei Doc Waterson. Und ich bin verdammt froh, daß die Sache so geschaukelt werden konnte. Freiwillig bekommen Sie mich hier vorerst nicht raus.«
Er deutete, während er redete, wieder hinüber auf die Tischlampe. Dann öffnete er die Verbindungstür und verließ das Besucherzimmer. Parker wartete, bis die Tür sich hinter Muscat geschlossen hatte. Dann ging er sehr leise auf die bewußte Tischlampe zu und untersuchte sie.
Als geschulter Bastler brauchte der Butler nicht lange zu suchen. Er fand den Miniatursender im und am Haltegestänge des Lampenschirms. Muscat hatte also nicht gelogen. Das Gespräch war abgehört worden. Parker fragte sich, warum Dr. Waterson das tat. Hatte er etwas zu verbergen? Wollte er wissen, was man über ihn und sein Sanatorium sagte?
Parker nutzte die Gelegenheit, das Besuchszimmer auf einem anderen Weg zu verlassen. Er folgte Muscat und wollte die Tür öffnen. Es überraschte ihn kaum, daß diese Verbindungstür inzwischen versperrt war. Man wollte die Patienten unter Verschluß halten und ihnen keine Möglichkeit geben, das Gelände zu verlassen.
Dennoch öffnete Parker ungeniert die Tür.
Dazu benutzte er sein kleines Spezialbesteck, mit dem er das Türschloß bewegte, damit es sich ihm willig öffne. Er sah in einen langen Korridor, der ihn an einen Hotelflur erinnerte. Etwa zehn Türen zu beiden Seiten führten in diverse Zimmer.
Der Gang war leer.
Parker lustwandelte langsam über den dicken Teppich und versuchte sein Glück bei jeder Tür, die er passierte. Alle Türen waren fest verschlossen.
Er hatte schon fast das Fenster erreicht, das den Korridor nach hinten begrenzte, als er hinter der vorletzten Tür rechts einen leisen und erstickten Aufschrei hörte, was ihn stutzig werden ließ.
Bevor er diese Tür öffnen konnte, hörte er hinter sich das Geräusch schneller Schritte.
Parker wandte sich um.
Er sah sich zwei stämmigen Pflegern gegenüber, die weiße Kittel trugen und einen sehr entschlossenen Eindruck machten. Sie bauten sich vor ihm auf und schüttelten fast gleichzeitig und vorwurfsvoll die Köpfe.
»Schon wieder angehauen, Limers?« fragte der Pfleger, der einen kleinen Schnurrbart trug.
»Warum immer dieses Theater?« erkundigte sich der zweite Pfleger, der einen etwas unrasierten Eindruck machte.
»Ich fürchte, Sie sind das Opfer einer Verwechslung«, sagte der Butler, »mein Name ist Parker – Josuah Parker.«
»Komm schon, Limers«, sagte der Schnurrbartträger und griff herzhaft zu.
Was er aber besser nicht gemacht hätte, denn Parker klopfte ihm mit dem bleigefütterten Griff seines Universal-Regenschirms nachdrücklich auf die Finger, worauf der Schnurrbärtige erstickt jaulte.
Der Unrasierte wollte klüger sein und nach Parker treten. Er hatte sich einen besonders gemeinen Tritt ausgedacht, aber Parker hatte mit solch einer Absicht bereits gerechnet.
Er trat, geschickt wie ein Torero, einen halben Schritt zurück und benutzte erneut den Bambusgriff seines Regenschirms. Diesmal hakte er damit unter und hinter den Fuß des Tretenden, der daraufhin das Gleichgewicht verlor und krachend auf dem Boden landete. Er blieb einen kurzen Moment benommen liegen.
Der Mann mit dem Schnurrbart steckte selbstverständlich nicht auf. Er warf sich vor und wollte den Butler mit einem Klammergriff an sich reißen.
Er hätte es besser sein lassen.
Parker, nicht unflott und sehr phantasievoll, wenn es darum ging, sich Muskelmännern zu erwehren, stellte seinen Regenschirm auf den Boden und kippte den Griff schräg nach vorn.
Auf dieses Hindernis krachte der Schnurrbart mit voller Wucht. Er fiel mit seinem Brustbein auf den Bambusgriff und hatte anschließend unter Luftschwierigkeiten zu leiden, die sich derart steigerten, daß er sich freiwillig auf dem Teppichboden niederließ und japste.
»Ich bedaure unendlich, falls ich Sie inkommodiert haben sollte«, entschuldigte sich Parker, »aber Sie sollten Ihren Eifer in Zukunft vielleicht etwas dämpfen. Blinder Eifer schadet nur, wie der Volksmund es so treffend ausdrückt.«
Parker stieg über die beiden Pfleger, die jetzt selbst der Pflege bedurften und begab sich zurück zum Besuchszimmer.
Es war leer.
Parker wollte diesen Raum gerade auf reguläre Art und Weise verlassen, als die Tür aufgerissen wurde. Doc Waterson und ein Pfleger kamen schnell herein, stutzten und sahen sich dann etwas unsicher an.
»Limers«, fragte Waterson vorsichtig.
»Parker«, stellte der Butler richtig.
»Aufpassen, Chef, das ist ein Trick!« sagte der Pfleger und blockierte die Tür.
»Mein Name ist Parker«, wiederholte der Butler noch mal, »ich unterhielt mich gerade, wenn Sie sich erinnern, Doc, mit einem gewissen Clive Muscat.«
»Wie – wie heißt Ihr Arbeitgeber?« fragte Waterson mißtrauisch.
»Mister Mike Rander, der zusammen mit dem Ehepaar Moberly hierher nach Stratford gekommen ist.«
»Okay«, meinte Waterson erleichtert und knipste sein Lächeln an, »das geht in Ordnung, Mister Parker.«
»Mir scheint, daß ich verwechselt worden bin!«
»Genau. Und zwar mit John Limers, der Ihnen zum Verwechseln ähnlich sieht. Hoffentlich hatten Sie deswegen keinen Ärger, Mister Parker.«
»Auf keinen Fall«, gab der Butler gemessen zurück, »und was den Ärger anbetrifft, Mister Waterson, so sollten Sie diese spezielle Frage an zwei Pfleger richten, die inzwischen aus ihrer Benommenheit erwacht sein müßten.«
*
»Haben Sie diesen Limers gesehen?« fragte Rander. Der junge Anwalt war gerade zurück ins Hotel gekommen, nachdem er das Ehepaar Moberly zum Sheriff begleitet hatte.
»Mitnichten, Sir. Dieser Herr und Doppelgänger wurde mir leider unterschlagen.«
»Ob es ihn überhaupt gibt?« warf Sue Weston skeptisch ein.
»Dies, Miß Weston, wird die Zukunft lehren.«
»Die es in diesem Fall wohl nicht geben wird«, meinte Anwalt Rander und winkte mit einer entsprechenden Handbewegung ab, »wir waren bei Sheriff Denver. Er konnte den Moberlys den Autopsiebefund vorlegen. Mike Moberly starb einwandfrei an Herzversagen. Sheriff Denver lehnte daraufhin jede weitere Verfolgung dieses Falles ab, was juristisch einwandfrei ist.«
»Darf man fragen, Sir, wie das Ehepaar Moberly daraufhin reagiert hat?«
»Moberly wies auf den Raub seines Aktenkoffers hin.«
»Und?« Sue Weston sah Rander erwartungsvoll an.
»Nun, Denver sieht dann keinen Zusammenhang. Er ist der Ansicht, daß der Aktenkoffer in Chikago regulär gestohlen wurde. Mit anderen Worten, er unterstellt einen Vorgang, der in keinem Zusammenhang mit dem Tod Mikes und dessen Briefen zu sehen ist.«
»Werden die Moberlys jetzt zurück nach Chikago fahren?« wollte Sue Weston wissen.
»Ich habe sie dazu überredet, Sue. Hier können sie doch nichts erreichen. Sie würden mit ihrem Verdacht nur gegen Windmühlenflügel ankämpfen.«
»Eine sehr gute Detailentwicklung«, ließ Parker sich vernehmen, »ich muß gestehen, Sir, daß mich die Anwesenheit des Ehepaares Moberly auf die Dauer irritiert hätte.«
»Wollen Sie etwa bleiben?« Rander sah seinen Butler erstaunt an. »Was versprechen Sie sich davon, Parker? Machen Sie sich doch endlich mit dem Gedanken vertraut, daß hier kein Kriminalfall auf Sie wartet!«
»Möglicherweise, Sir, gelingt es meiner bescheidenen Wenigkeit, Sie ein wenig umzustimmen«, antwortete Parker würdevoll, »ich vergaß, Ihnen und Miß Weston von einer Abhöranlage im Besuchszimmer des Sanatoriums zu erzählen.«
»Na und?«
»Und von der offensichtlichen Angst eines gewissen Clive Muscat, der sich verständlicherweise nicht traute, die Wahrheit zu sagen.«
»Das sind doch Dinge, die Sie übertrieben darstellen«, gab Rander leicht gereizt zurück, »geben Sie schon zu, daß Sie hier einen Fall finden wollen … Um jeden Preis, Sie haben ihn sich nun mal in den Kopf gesetzt und jetzt suchen Sie nach Details.«
»Darf ich mir die Freiheit nehmen, Sir, Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten?«
»Na schön …«
»Gestatten Sie mir, dem Sanatorium einen nächtlichen Besuch abzustatten, der nicht unbedingt angemeldet zu sein braucht!«
»Was versprechen Sie sich davon Parker?«
»Eine Besichtigung ohne Führung, Sir.«
»Sie wollen mit verschiedenen Patienten sprechen?«
»Auch dies, Sir, schwebt mir in der Tat vor.«
»Und wann soll der Spaziergang stattfinden?«
»In den Morgenstunden, Sir, etwa gegen 2.30 Uhr. Ich werde mir die Freiheit nehmen, die südliche Grundstücksmauer zu übersteigen. Dort scheint mir der Zugang möglich zu sein.«
*
Josuah Parker war bereits nach Einbruch der Dunkelheit aktiv.
Gegen 22.00 Uhr verabschiedete er sich von seinem jungen Herrn und von Sue Weston. Er wollte, wie er behauptete, etwas auf Vorrat schlafen, da er ein alter, müder und relativ verbrauchter Mann sei. Parker zog sich auf sein Zimmer zurück, das sich in einer netten, sauberen Pension befand.
Dieses Zimmer entsprach genau seinen Wünschen und Vorstellungen. Nach dem Hochschieben des Fensters war er in der Lage, hinunter auf das angrenzende Flachdach einer Remise zu steigen. Von diesem Flachdach aus war es ein Katzensprung bis auf den Erdboden.
Als Parker diesen erreichte, war er entsprechend ausgerüstet. Er beabsichtigte einen gewissen Test vorzunehmen. Er wollte, falls es so etwas wie eine Gegenseite gab, diese zu Aktionen herausfordern. Er wußte im vorhinein, daß er sich auf ein gefährliches Abenteuer einließ.
Nach einem Spaziergang von fast vierzig Minuten Dauer erreichte er jenes Mauerstück, von dem er im Hotelzimmer seines jungen Herrn gesprochen hatte.
Am Fuß dieser Mauer, die gut und gern zwei Meter hoch war und deren Krone mit Glasscherben gesichert war, nahm er im Schutz von hohen Sträuchern einige Manipulationen vor. Dazu gehörte vor allen Dingen das Anbringen einer Zeituhr eigener Bauart. Nach Ablauf einer vorher eingestellten Frist gab der Stundenzeiger eine Sperre frei. Diese Sperre wiederum war dann so freundlich, gewisse Reaktionen auszulösen.
Parker nahm sich sehr viel Zeit, zumal er noch ungestört arbeiten konnte. Dann stellte er sorgfältig die Zeituhr und begab sich zurück in die kleine Pension. Mit einer Geschmeidigkeit und sportlichem Eifer, den man Parker niemals zugetraut hätte, stieg er über die Remise zurück in sein Zimmer, ohne sich bei seinem jungen Herrn oder Sue Weston zurückgemeldet zu haben. Er hoffte sehr, daß sein Bluff zu einem Zugzwang der Gegenseite führen würde.
Parker war nämlich fest davon überzeugt, daß es längst eine Gegenseite gab. Für solche Dinge hatte er nämlich eine sehr feine Antenne.
*
Mitternacht war lange vorüber, die Uhren gingen langsam auf 2.30 Uhr zu.
Ein leichter Wind war aufgekommen, der dunkle Regenwolken vor den Mond trieb. Die Sichtverhältnisse waren schlecht geworden. Die bewußte Mauer des Sanatoriums war nur als vager Schatten auszumachen.
2.30 Uhr!
Am Fuß der Mauer tat sich einiges.
Eine Gestalt richtete sich plötzlich auf und stieg behend wie eine Eidechse an der Mauer hoch und erreichte die Krone.
Hier verhielt die nur vage zu erkennende Gestalt. Sie schien auf das Gelände des Sanatoriums zu spähen und dabei sehr vorsichtig und mißtrauisch zu sein.
Sekunden später, als die Gestalt sich anschickte, noch höher zu steigen, Sekunden später passierte es.
Zwei Schüsse, die offensichtlich aus einer Schrotflinte stammten, peitschten auf. Sie waren ungedämpft und zerrissen die Stille der Nacht. Selbst der Wind schien für einen Moment den Atem anzuhalten.
Die nur vage zu erkennende Gestalt wurde voll getroffen.
Sie hielt sich für einen Augenblick. Dann rutschte sie haltlos ab und landete am Fuß der Mauer in dichtem Gesträuch.
Hinter der Mauer waren schnelle Schritte zu hören, dann leise Stimmen. Von weither bellte ein aufgeschreckter Hund.
Jenseits der Mauer folgte ein feines Scharren, das lauter und intensiver wurde.
Davon hörte die immer noch nur vage erkennbare Gestalt am Fuß der Mauer nichts.
Halb verdeckt von den Zweigen des Gesträuchs, lag sie ruhig auf dem Boden und rührte sich nicht mehr. Wie gesagt, die beiden Schrotschüsse waren Volltreffer gewesen.
*
Es ging auf 3.00 Uhr zu, als auf dem Flachdach der Hotelremise sich jemand an Parkers Zimmerfenster heranpirschte.
Diese Gestalt, die allerdings recht gut zu erkennen war, bewegte sich mit einer erstaunlichen Unbekümmertheit. Sie schien genau zu wissen, daß ihr keine Gefahr drohte. Sie hatte inzwischen das Fenster von Parkers Zimmer erreicht und benutzte einen ordinären Glasschneider, um das Fensterglas in einem kleinen Halbbogen zu durchtrennen. Dann griff die behandschuhte Hand ins Zimmer hinein und entriegelte das Fenster.
Leise wurde das Fenster hochgeschoben. Anschließend stieg der Unbekannte in Parkers Zimmer.
Eine kleine Taschenlampe flammte auf und suchte die Ecken ab. Dann bewegte sich die Gestalt in die Mitte des Zimmers, stieg auf einen Stuhl, den sie neben den Tisch gestellt hatte, kletterte darauf und fingerte nach der Deckenfassung der Lampe.
Dabei irrte der Schein der Taschenlampe kurzfristig durch den einfachen, aber sauberen Raum. Da war der solide Schrank mit der Doppeltür, das einfache Holzbett, der Waschtisch und schließlich ein uraltes Kanapee, das aber sehr gemütlich und einladend aussah.
Doch das alles interessierte die Gestalt nicht, die übrigens einen bulligen und kräftigen Eindruck machte. Sie fingerte noch immer an der Deckenfassung der Lampe herum und fand endlich, wonach sie gesucht hatte.
In der behandschuhten Hand dieser Gestalt lag eine flache Metallkapsel, die fatal an einen gängigen Minisender erinnerte.
Der Mann stieg vom Stuhl, stellte die Sitzgelegenheit weg und wandte dabei automatisch dem Schrank den Rücken zu, was sich nicht sonderlich auszahlte.
Dadurch entging dem Unbekannten nämlich eine erstaunliche Tatsache, wie sich zeigen sollte.
Die rechte Schranktür wurde leise aufgedrückt.
Ein gewisser Josuah Parker, vollständig und korrekt gekleidet, stieg leise ins Zimmer. Dann nahm Parker seinen Universal-Regenschirm hoch und legte den bleigefütterten Bambusgriff nachdrücklich auf den Hinterkopf des nächtlichen Besuchers.
Der Mann gab daraufhin einen leisen Seufzer der Müdigkeit von sich und beeilte sich, auf dem Boden ein kleines Nickerchen zu absolvieren.
*
Dieser nächtliche Eindringling kam schlagartig und ohne jeden Übergang wieder zu sich.
Sein Kurzschlaf hatte genau dreieinhalb Minuten gedauert.
»Ein gewisser Kopfschmerz wird mit Sicherheit in den kommenden Stunden vergangen sein«, tröstete Parker seinen nächtlichen Gast, der sich aufgesetzt hatte und den Butler völlig überrascht musterte.
»S… S… Sie!?« stammelte er dann leicht verwirrt.
»In der Tat«, erklärte Parker, »ich kann Ihre Enttäuschung verstehen. Sie waren sicher der Meinung, meine bescheidene Wenigkeit sei mittels zweier Schrotladungen ins Jenseits befördert worden, nicht wahr?«
Der nächtliche Gast nickte unwillkürlich, bis er merkte, daß er sich gehenließ. Augenblicklich stoppte er seine Bewegungen und rieb sich dann vorsichtig den Hinterkopf.
»Ich war so frei, mich durch ein Double vertreten zu lassen«, führte der Butler höflich weiter aus, »eine von mir angekleidete Gummipuppe mit entsprechender Gasfüllung, die durch einen Zeitschalter zur Mauerbesteigung freigelassen wurde …«
»Ich – ich weiß überhaupt nicht, wovon …«
»Natürlich sind Sie ahnungslos«, bestätigte Parker milde, »natürlich wissen Sie nicht, wovon ich im Augenblick rede. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden bald alles begreifen! Und was den Minisender in Ihrer Hand betrifft, so fanden Sie ihn selbstverständlich rein zufällig.«
Der Mann sah verblüfft in seine Hand, die natürlich leer war. Parker hatte diesen Minisender längst an sich genommen und zu seinem Beutegut erklärt.
Der nächtliche Gast war für den Butler übrigens kein Unbekannter. Es handelte sich um den Unrasierten, dessen Bartstoppeln noch gewachsen waren. Dieser Pfleger erinnerte sich ebenfalls und hatte das Gefühl, etwas für seine Freiheit tun zu müssen.
Er sprang unvermittelt auf, was ihm trotz seiner Stämmigkeit sehr schnell gelang. Doch er hatte die Rechnung ohne einen gewissen Josuah Parker gemacht, der sich stets einiges einfallen ließ.
Der Mann stand noch nicht ganz auf seinen Beinen, als er auch schon wieder auf dem Hosenboden saß. Der Pfleger aus dem Nervensanatorium hatte im Eifer völlig übersehen, daß sein rechtes Fußgelenk mit einem soliden Strick am Bettpfosten befestigt worden war. Und dieser Strick erwies sich jetzt als ausgesprochen hinderlich.
»Sie sollten sich wie ein erwachsener Mensch benehmen«, sagte Parker mißbilligend.
»Lassen Sie mich gehen«, reagierte der Pfleger gereizt und knotete den Strick von seinem Fußgelenk los.
»Aber selbstverständlich«, meinte Parker entgegenkommend, »versäumen Sie auf keinen Fall, Dr. Waterson die herzlichsten Grüße auszurichten.«
»Waterson?«
»Ihr Hörvermögen ist erstaunlich gut entwickelt«, gab der Butler würdevoll zurück.
»Was hat Waterson mit dem hier zu tun?« fragte der Mann und richtete sich vorsichtig auf. Er hatte den Strick endlich losgeknüpft.
»Fragen Sie mich das bitte nicht«, erwiderte Parker gemessen. »Mir scheint, daß Sie dafür kompetenter sind.«
»Sie – Sie wollen mich tatsächlich gehenlassen?« Der Pfleger konnte es nicht glauben.
»Der Rückweg über die Remise steht Ihnen frei. Nachträglich meinen Dank für Ihr Erscheinen. Ich hoffte, daß sich irgendeine offizielle Person aus dem Sanatorium zeigen würde.«
»Wieso?«
»Weil ich von der Annahme ausging, daß man möglicherweise einen Minisender installiert hatte. Was stimmte, wie sich erfreulicherweise zeigte.«
»Und – und was wollen Sie jetzt tun?«
»Über diesen speziellen Punkt werde ich ausgiebig nachdenken müssen«, gestand Parker, »nach der Sprechweise des Volkes soll man bekanntlich niemals etwas überstürzen. Auch Ihnen empfehle ich diese Weisheit, falls Sie auf dem schnellsten Weg zurück in das Sanatorium zu gehen beabsichtigen!«
Der Pfleger mit dem Stoppelbart sah den Butler zweifelnd und unsicher an.
»Ich könnte mir nämlich vorstellen, daß Sie unter Umständen nicht mehr sonderlich lange leben werden«, schloß Parker seine Ermahnungen, »ein Herzversagen wird Ihnen ja wohl bekannt sein. Wie im Fall Michael Moberly!«
*
»Sie ließen ihn tatsächlich gehen?« fragte Rander eine Viertelstunde später, nachdem der Butler ihn aus dem Schlaf geweckt hatte. Auch Sue, die den Butler oft schneller verstand als Mike Rander, wirkte irritiert. Die Sekretärin trug einen leichten Morgenmantel, der ihre ausgeprägten und sympathischen Formen wirkungsvoll unterstrich.
»Gewiß, Sir. Er wäre hier in der Pension nur lästig gewesen, wie ich bemerken möchte. Zudem wollte ich dem Herrn die Zeit und Möglichkeit einräumen, sich seine speziellen Gedanken zu machen, was seine Rückkehr in das Sanatorium betrifft.«
»Muß der Mann sich erschreckt haben, als Sie plötzlich hinter ihm standen«, sagte Sue und schmunzelte.
»Das Leben ist voller Überraschungen«, stellte der Butler fest.
»Woher wußten Sie eigentlich von den beiden Schrotschüssen?« erkundigte sich Rander, »normalerweise hätten Sie die doch gar nicht hören können. Das Sanatorium ist doch viel zu weit entfernt von hier!«
»Auch ich war so frei, mich eines Minisenders zu bedienen«, gestand Parker offen, »als die beiden Schüsse fielen, nachdem laut meiner Uhr das Double an der Mauer hochgestiegen war, rechnete ich mit dem nächtlichen Besuch. Ich ging von der Voraussetzung aus, daß man das Corpus delicti aus meinem Zimmer bergen wollte.«
»Und woher wußten Sie wieder von diesem Minisender?« schaltete Sue Weston sich lächelnd ein.
»Durch die beiden Schüsse, die mir sagten, daß man unser Gespräch belauscht hatte. In diesem Gespräch hatte ich absichtlich eine genaue Zeit genannt, um die Bewegungen der Gegenseite besser kontrollieren zu können.«
»Sie sind ganz schön abgefeimt«, sagte Rander lachend, »aber es hat sich wieder mal gelohnt!«
»Darf ich Ihre Bemerkung dahingehend interpretieren, Sir, daß Sie jetzt an einen Mord glauben, was den Tod des Michael Moberly betrifft?«
»Also schön«, meinte Rander und war plötzlich sehr ernst, »lassen Sie die Puppen tanzen, Parker! Sie haben freie Hand. Dieser Waterson scheint jede Menge Dreck am Stecken zu haben.«
Sue Weston kam nicht mehr dazu, ihrerseits etwas zu sagen. Das hing mit einer Eierhandgranate zusammen, die durch das Fenster geflogen kam, nachdem sie das Glas durchschlagen hatte.
*
»Oh …!« sagte Josuah Parker nur und sah hinunter auf den eiförmigen Sprengkörper, der offensichtlich echt war.
Sue Weston hatte sich an die Brust von Rander geflüchtet.
Rander handelte sofort und warf sich zusammen mit Sue hinter einen der beiden leichten Sessel.
Es war eine Frage von Sekundenbruchteilen, bis der Sprengkörper explodierte.
Josuah Parker löste das anstehende Problem auf seine Art und Weise, also souverän.
Fast gelassen griff er nach seinem Universal-Regenschirm und senkte den bleigefütterten Bambusgriff nach unten. Dann benutzte er seinen Schirm als Golfschläger, nahm erst mal genau Maß und produzierte dann einen Treibschlag, der selbst einen Vollprofi in Erstaunen versetzt hätte.
Die Eierhandgranate wurde voll erwischt und begab sich auf ihre Flugbahn.
Sie zischte durch die zerbrochene Fensterscheibe hinaus in die frische Nachtluft und war nicht mehr zu sehen.
Dafür hingegen war sie gut zu hören.
Noch mitten in der Flugbahn platzte sie auseinander, worauf der Scherbenrest aus dem Fensterrahmen flog und sich ins Zimmer ergoß.
»Donnerwetter«, sagte Rander, der bleich um die Nase geworden war und sich jetzt erhob. Er half Sue auf die Beine, die sich nach wie vor gegen seine Brust lehnte.
»Ein Attentat, Sir!«
»Sie hätten diesen Pfleger nicht gehenlassen dürfen«, meinte Rander vorwurfsvoll.
»Ich glaube kaum, Sir, daß der Stoppelbärtige für diesen Anschlag verantwortlich zeichnet«, gab der Butler gemessen zurück, »hier dürften bereits andere Kräfte am Werk sein, wie ich unterstellen möchte.«
*
Sheriff Denver sah verschlafen und leicht verkatert aus, als er auf der Bildfläche erschien. Seine Stimmung war dementsprechend gereizt.
»Eierhandgranate!?« fragte er skeptisch, »sind Sie sicher, daß es eine war?«
»Bei Tageslicht besehen werden Sie die Spuren der Explosion leicht feststellen können«, erwiderte Parker.
»So was gibt es doch gar nicht«, wunderte sich Denver, »so was hat’s hier noch nie gegeben.«
»Wir haben sie sehr genau gesehen«, schaltete Mike Rander sich ein, »und drüben das Fenster, Sheriff. Aus einer Laune heraus haben wir’s bestimmt nicht zertrümmert.«
»Wie lange werden Sie hier in Stratford bleiben?« erkundigte sich Denver mißmutig.
»Was hat das mit der Eierhandgranate zu tun, Sheriff?« Rander wunderte sich.
»Seitdem Sie hier aufgekreuzt sind, gibt es nichts als Ärger. Zuerst die Autopsie, dann diese wirren Mordanklagen und jetzt die angebliche Eierhandgranate.«
»Das alles paßt Ihnen nicht, wie?« Rander konnte nur noch ironisch sein.
»Wir wollen hier unsere Ruhe haben«, meinte Sheriff Denver, »und was den angeblichen Mord betrifft, so sind das Hirngespinste, wenn sie mich fragen.«
»Sie können sich nicht vorstellen, daß so etwas im Sanatorium passiert, oder?«
»Hören Sie, Mister Parker, ich kenne Doc Waterson seit ein paar Jahren. Ein erstklassiger Arzt und Bürger unserer Stadt. Bisher hat es noch nie Ärger mit ihm gegeben. Lächerlich, daß in seinem Sanatorium ein Mord passiert sein soll!«
»Ausgesprochen lächerlich, daß eine Eierhandgranate ins Zimmer geworfen wurde!« Rander lächelte mokant.
»Sehen Sie da etwa einen Zusammenhang?« Sheriff Denver fauchte den jungen Anwalt wütend an.
»Parker, jetzt sind Sie an der Reihe.« Rander wandte sich an seinen Butler, »ich denke, auch Sie haben noch etwas zu erzählen.«
Parker faßte sich kurz, was seine Erlebnisse mit dem Pfleger angingen. Er berichtete sehr konzentriert von der Mauerbesteigung seines Doubles und der beiden Schrotschüsse.
»Hoffentlich können Sie all diesen Unsinn auch beweisen«, sagte Sheriff Denver, als Parker geendet hatte, »falls nicht, sollten Sie sich um ’nen Freiplatz im Sanatorium bemühen. Dann hätten Sie’s nämlich dringend nötig.«
*
»Na, wo haben wir denn die Puppe, die an der Mauer hochgestiegen ist?«
In Denvers Stimme schwangen Hohn und auch so etwas wie eine gewisse Erleichterung mit.
Es war hell geworden, und Denver, Parker und Rander hatten sich hinaus zur Mauer begeben. Zu Parkers Enttäuschung war von der Puppe nichts mehr zu sehen. Auch die Zeituhr war verschwunden. Von dem Minisender mal ganz zu schweigen, den er immerhin gut versteckt hatte.
Die Gegner hatten ganze Arbeit geleistet und alle Spuren hervorragend verwischt. Irgendwie hatte Parker ja damit gerechnet, doch diese Präzision beeindruckte ihn. Selbst das Gras stand hoch und fest. Es schien niemals niedergetreten worden zu sein. Bis auf die Stellen natürlich, wo Parker sich in der Nacht bewegt hatte.
»Gehen wir also zu Waterson«, redete Denver weiter, »unterhalten wir uns mit dem Pfleger, den Sie angeblich in Ihrem Pensionszimmer überrascht haben.«
Eine Viertelstunde später standen sie im Besuchszimmer des Sanatoriums diesem Pfleger gegenüber. Der Mann hatte sich zwar frisch rasiert, aber sah dennoch etwas ungepflegt aus.
Er wußte selbstverständlich von nichts.
»Ich bestreite ganz entschieden, bei Ihnen im Zimmer gewesen zu sein«, sagte er aufgebracht, »und ich habe Zeugen dafür, daß ich die ganze Nacht über hier im Haus gewesen bin. Ich hatte zusammen mit Steve Nachtdienst auf der geschlossenen Station. Und auch mit Mistreß Colbert. Soll ich sie holen?«
»Was er sagt, stimmt!« Dr. Waterson, der sich ebenfalls im Zimmer aufhielt, nickte bestätigend, um sich dann an Josuah Parker zu wenden, »sind Sie sicher, nicht das Opfer eines vielleicht außergewöhnlichen Alptraums gewesen zu sein?«
»Wenn Sie gestatten, Sir«, erwiderte Parker, »werde ich mir die Freiheit nehmen, Sie in den nächsten Tagen zu konsultieren. Mir scheint, daß ich tatsächlich etwas überreizt bin.«
*
Auch die nächste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten, wie sich schnell herausstellte.
Der Besuch an der Mauer des Sanatoriums war vorgezogen worden. Jetzt auf der Rückfahrt und wieder in Stratford, wollte Sheriff Denver sich die Wirkung der Handgranate aus der Nähe ansehen.
Nun, er sah zwar etwas, aber nicht das, wovon Parker gesprochen hatte. Denver sah einen brennenden Holzschuppen, dessen Dach gerade in sich zusammenrutschte.
Dieser Schuppen befand sich genau unterhalb der Flugbahn, die die Eierhandgranate genommen haben mußte. Wahrscheinlich war sie von der Gewalt der Explosion durchgeschüttelt worden, und das Holz hatte die herumwirbelnden Granatsplitter aufgenommen.
Von diesen Dingen aber war nichts mehr zu sehen. Der bewußte Holzschuppen war nur noch eine kleine Feuerhöhle. Das trockene Holz brannte wie Zunder, den man zusätzlich noch mit Benzin behandelt haben mußte.
Nach Treibstoff roch es nämlich penetrant.
»Natürlich reiner Zufall«, sagte Rander und grinste Denver ironisch an. Dann wies er hinüber auf die Rückseite der Pension, in der sie abgestiegen waren, »von dort bis hierher hätte man ja auch niemals eine Eierhandgranate werfen können!«
»Sie sagen es«, meinte Denver und nickte zufrieden, »um den Schuppen ist es nicht schade …«
»Schade aber um die Beweismittel«, meinte Rander.
»Hirngespinste! Was versprechen Sie sich von diesen Märchen, Mister Rander? Ich weiß, Sie sind Anwalt. Warum ziehen Sie dann solch eine Show ab? Warum wollen Sie Waterson unbedingt etwas am Zeug flicken?«
»Vielleicht meine sehr private Form der Freizeitbeschäftigung«, gab Rander ärgerlich zurück, »seit wann sind Sie eigentlich als Sheriff dieses Bezirks tätig?«
»Seit fast zehn Jahren!«
»Es geschehen immer wieder Zeichen und Wunder«, spöttelte der junge Anwalt, »die Bewohner des Bezirks scheinen nicht gerade hohe Ansprüche zu stellen!«
Dieser Wortwechsel wurde nicht unter vier Augen geführt. Es gab eine Menge neugieriger Zuschauer, die sich kein Wort entgehen ließen. Und wie beliebt Denver war oder sein mußte, zeigte sich an den Reaktionen auf ihren Gesichtern. Von offenem Spott bis hin zur Verlegenheit spiegelten diese Gesichter alles wider. Denver schien in ihren Augen ein zwar skurriler, aber dennoch ausgeprägter Trottel zu sein.
Rander hielt eine weitere Unterhaltung für sinnlos. Er nickte seinem Butler zu und ging dann zusammen mit ihm hinüber zur nahen Hotelpension.
Denver sah ihnen nach. Sein Mund war zu einem schmalen Strich geworden, wie es in einschlägigen Romanen immer wieder so treffend heißt. Seine Gedanken schienen nicht gerade rosa gefärbt zu sein.
»Nun sagen Sie schon, daß ich ihn nicht auf die Palme hätte bringen sollen«, wandte Rander sich an seinen Butler.
»Sheriff Denver dürfte das sein, Sir, was man gemeinhin verstimmt nennt.«
»Das ist mir gleichgültig. Soviel Ignoranz reizt mich einfach.«
»Mister Denver ist vielleicht, was diesen Fall betrifft, einfach überfordert.«
»Auf keinen Fall! Dumm ist er nicht, nur befangen. Wissen Sie, mir kommt da gerade ein Gedanke. Ob er nicht von Waterson gekauft sein könnte?«
»Sir, es handelt sich immerhin um einen Vertreter des Gesetzes.«
»Na, und … wäre er der erste Vertreter unseres Gesetzes, der Schmiergelder annimmt? Auch Sheriffs sind nur Menschen. Sie sind doch keine Ausnahmenaturen. Nein, nein, Parker, Denver spielt ein falsches Spiel, wenn Sie mich fragen! Und was die Autopsie angeht, ich werde sie wiederholen lassen, falls die Moberlys einverstanden sind, und zwar von neutralen Sachverständigen. Jetzt will ich es genau wissen!«
Sie hatten inzwischen die Vorderfront der Hotelpension erreicht und betraten die kleine Empfangshalle.
Der Tagesportier winkte ihnen zu, kam um die Theke der kleinen Rezeption herum und überreichte Rander einen Brief.
Der Anwalt studierte den Absender.
»Von den Moberlys«, sagte er dann zu Parker, während er den Umschlag neugierig öffnete. Rander überflog die wenigen handschriftlichen Zeilen.
»Das ist aber eigenartig«, sagte er dann, Parker den Brief reichend, »die Moberlys sind abgefahren. Das geht in Ordnung. Aber sie entbinden uns von der Weiterverfolgung dieses Falls. Sie schreiben, daß sie sich durch die Autopsie haben überzeugen lassen, daß jeder Verdacht auf Mord unbegründet ist. Wie finden wir denn das, Parker?«
»Ich erlaube mir, Sir, dazu das Prädikat ausgezeichnet zu wählen. Inzwischen scheint man auch das Ehepaar Moberly unter Druck gesetzt zu haben!«
*
Parker benahm sich wirklich mehr als auffällig.
Er stand auf dem Dach seines hochbeinigen Monstrums und benutzte ein schweres und leistungsstarkes Fernglas, um das Gelände des Sanatoriums zu beobachten.
Er mußte mit Sicherheit von den Gebäuden dieses Sanatoriums aus gesehen werden. Aber das schien ihn nicht zu stören. Genau das Gegenteil war sogar der Fall. Er sorgte immer wieder dafür, daß das Sonnenlicht sich in der Optik des Fernglases derart spiegelte, daß die Lichtreflexe unbedingt bemerkt wurden.
Parker trieb dieses Spiel vielleicht zehn Minuten lang, als sich etwas Sichtbares tat.
Im Obergeschoß des Haupt- und Verwaltungsgebäudes bewegte sich eine Gardine. Dann erkannte Parker durch sein Fernglas, daß er nun endlich seinerseits beobachtet wurde. Hinter der Gardine stand eine Gestalt, die ebenfalls ein Fernglas benutzte.
Parker genierte sich nicht.
Genau diese Reaktion hatte er herausfordern wollen. Er war gespannt, wie man jetzt reagieren würde. Er konnte sich lebhaft vorstellen, daß gewisse Leute im Sanatorium nervös wurden.
Sie benutzten einen Landrover und preschten in schneller Fahrt an die Mauer heran. Sie hielten so, daß sie vom Wagen aus gerade noch den Butler auf dem Dach seines Monstrums sehen konnten.
Parker senkte sein Fernglas, regulierte die Schärfe und erkannte zwei liebe alte Bekannte. Es handelte sich um die beiden Pfleger Hank und Steve, wie er inzwischen wußte. Hank, der Mann mit den Bartstoppeln, wirkte irgendwie gehemmt und verlegen. Und jetzt, es war deutlich zu sehen, zwinkerte er dem Butler zu. Da er wußte, daß er durch das Fernglas beobachtet wurde, konnte er sicher sein, daß dieses Zwinkern auch bemerkt wurde.
Parker nahm dieses Zwinkern zur Kenntnis, ohne es im Moment zu werten. Er nahm das Fernglas wieder etwas höher und übersah dann im wahrsten Sinn des Wortes die beiden Pfleger des Sanatoriums.
»Was – was soll denn das?« rief Steve ihm schließlich zu. Der Schnurrbartträger hatte sich im offenen Landrover hochgestellt und winkte, um sich zusätzlich bemerkbar zu machen.
Parker dachte nicht im Traum daran, auf diese Frage zu antworten. Er ignorierte die beiden Männer, die jetzt leise miteinander beratschlagten, um dann sehr schnell zu wenden und zurück zum Hauptgebäude zu fahren.
Nun stieg auch der Butler vom Dach seines hochbeinigen Monstrums und setzte sich ans Steuer. Er fuhr ein gutes Stück an der Mauer entlang, bis er einen neuen, günstigen Beobachtungspunkt erreicht hatte.
Dann begann sein Spiel von vorn.
Er begab sich hinauf auf das Dach seines Wagens und betätigte sich wieder als Beobachter, sehr ungeniert und betont auffällig. Er wußte inzwischen, wie stark er gewisse Nerven strapazierte. Ein Mann wie Doc Waterson zum Beispiel litt mit Sicherheit bereits unter erhöhtem Blutdruck.
Es dauerte etwa zehn Minuten, bis der Landrover wieder erschien.
Diesmal saß auch Waterson mit im Wagen. Er stieg aus und kam schnell auf die Mauer zu, hinter der Parker sich auf dem Wagendach aufgebaut hatte.
»Mister Parker! Mister Parker?!«
Der Butler lüftete höflich seine schwarze Melone.
»Was bezwecken Sie eigentlich damit?« rief Waterson gereizt, »soll ich Ihnen den Sheriff an den Hals schicken? Ich verbitte mir diese Spioniererei. Meine Patienten werden unruhig.«
»Erfreulich, daß dies im Gegensatz zu Ihnen geschieht«, gab der Butler höflich zurück, »aber wenn Sie darauf bestehen, werde ich selbstverständlich das räumen, was man gemeinhin das Feld nennt.«
Ohne sich weiter um Waterson zu kümmern, stieg Parker vom Wagendach und fuhr davon, um nach einer Viertelstunde und an anderer Stelle sich erneut aufzubauen. Gewiß nicht aus dem Grund, die Patienten des Sanatoriums zu beunruhigen. Dem Butler ging es um ganz andere Personen.
*
Es ging auf Mittag zu, als Josuah Parker seine Rundreise um die Sanatoriumsmauer beendete.
Er hatte den Landrover noch in zwei weiteren Fällen zum Herumkurven gezwungen. Und er hatte zur Kenntnis genommen, daß die beiden Pfleger Hank und Steve sich darauf beschränkt hatten, ihn nur schweigend zu beobachten.
Parker hatte aber auch eine zusätzliche Kleinigkeit registriert.
Beim Beobachten der Gebäude war ihm ein Handtuch aufgefallen, das aus dem Oberlicht eines der Bungalows hervorgestreckt und bewegt worden war. Dieses Handtuch schien ihm ein bestimmtes Signal mitzuteilen, doch was dieses Signal bedeutete, vermochte der Butler natürlich nicht zu sagen.
Im Zusammenhang mit dem Handtuch dachte er spontan an Clive Muscat, mit dem Michael Moberly befreundet gewesen war. Dieser junge Mann, der als Robin Hood aufgetreten war, hatte ihn schließlich schon mal gewarnt, als er auf das Abhörgerät im Besuchszimmer hingewiesen hatte. Wollte Muscat – wenn er es gewesen war – ihm mitteilen, daß er festgehalten wurde, daß er eingesperrt worden war? Oder bedeutete das Winken mit dem Handtuch eine intensive Warnung?
Parker steuerte seinen hochbeinigen Wagen gerade hinauf auf die Landstraße, die, nach Stratford führte, als ihm plötzlich der Weg versperrt wurde.
Der bewußte Landrover schoß förmlich hinter einem dichten Gesträuch hervor und stelle sich quer zur Straße. Am Steuer erkannte Parker den Schnurrbärtigen. Neben ihm saß Doc Waterson.
Parker mußte sich blitzschnell entscheiden, was zu tun war. Sollte er sich auf eine Unterhaltung einlassen, die Waterson mit Sicherheit von ihm fordern wollte? Oder sollte er Waterson einfach aus dem Weg gehen und ihn leerlaufen lassen?
Dr. Waterson richtete sich auf und hielt sich an der Windschutzscheibe fest. Er winkte Parker zu und schien ihm auch etwas zuzurufen. Was der Butler übrigens nicht verstand, denn aus gewissen Gründen der Sicherheit hatte er sämtliche Fenster seines Wagens geschlossen. Das Panzerglas hatte sich bereits in der Vergangenheit schon als günstig erwiesen, wenn man auf Parker geschossen hatte. Offen, oder nur aus dem Hinterhalt heraus.
Josuah Parker kam zu einem Entschluß.
Seiner Ansicht nach war es noch zu früh, sich mit dem Chef des Sanatoriums zu unterhalten. Waterson sollte und mußte noch etwas im eigenen Saft braten.
Ohne sich also um das Winken des Arztes zu kümmern, kurvte der Butler mit seinem hochbeinigen Monstrum geschickt um den quergestellten Landrover herum. Ihm kam zustatten, daß sein Wagen eben derart hochbeinig war, daß er unebenes Gelände noch leichter nehmen konnte als ein Rover.
Im Rückspiegel beobachtete Parker, daß Waterson ihm verblüfft nachschaute. Mit dieser Reaktion hatte der Arzt sicher nicht gerechnet. Er ließ sich gerade zurück auf seinen Sitz fallen, während der Schnurrbärtige sich mühte, den Landrover wieder auf die Straße zu bekommen.
Die erwartete Verfolgung blieb aus, wie sich herausstellte.
Der Landrover kurvte zurück in das unübersichtliche Gelände und war bald verschwunden. Parker steigerte das Tempo seines Wagens und ließ dabei seine schwarz behandschuhte Hand mit den Kipphebeln und Tasten des Armaturenbretts spielen, worauf sich erstaunliche Dinge taten.
Unter dem Wagen, etwa in Höhe des Auspufftopfes, rasselte eine normale Eisenkette hinunter auf den Boden. Diese Eisengliederkette war etwa 30–40 Zentimeter lang und mündete in einer Art Glockenklöppel.
Dieser Glockenklöppel schlug und hämmerte auf den unbefestigten Feldweg und wirbelte hohe Staubwolken hoch. Es dauerte nur knapp hundert Meter, bis Parkers Wagen eine lange, dichte und gelbe Staubwolke hinter sich ließ, die jede Sicht versperrte.