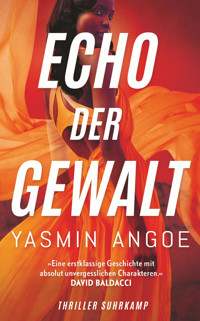
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nena Knight, die als Kind aus ihrem ghanaischen Dorf entführt wurde, hat viele Motive zu töten. Jetzt, da sie Elite-Attentäterin für das mächtige Geschäftssyndikat namens The Tribe ist, bekommt sie jede Menge Gelegenheiten dazu. Und Nena, Codename Echo, ist effektiv, loyal und absolut tödlich.
Doch als sie in Miami einen Bundesstaatsanwalt eliminieren soll, um einem neuen Mitglied von The Tribe einen Gefallen zu tun, widersetzt sie sich erstmals den Befehlen dieser Geheimorganisation. Denn sie erkennt, dass es sich bei diesem Gangster, der The Tribe beigetreten ist, um denselben Mann handelt, der ihr Dorf zerstören, die Bewohner massakrieren und sie in die Sexsklaverei verkaufen ließ. Nena kann der Versuchung der Rache nicht widerstehen ‒ und sie will es auch gar nicht. Sie muss nun alles einsetzen, was sie war und was sie ist, um ihn zur Strecke zu bringen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Yasmin Angoe
Echo der Gewalt
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Diemerling
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Her Name is Knight bei Thomas & Mercer, Seattle.Diese Ausgabe wurde durch eine Lizenzvereinbarung mit Amazon Publishing, www.apub.com, in Zusammenarbeit mit der Agence Hoffman ermöglicht.Bitte beachten Sie die »Anmerkung der Autorin« zu möglichen Triggern sowie die »Sprachliche Anmerkung« am Ende des Bandes.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5328. Korrigierte Fassung, 2023
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© 2021 by Yasmin AngoeAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach Entwürfen von Ray Lundgren und Anna Laytham
eISBN 978-3-518-77576-9
www.suhrkamp.de
Widmung
Für meinen Vater Herbert Nana Angoe, unser Stammesoberhaupt. Ruhe in Frieden, Dad.
Motto
Die Erinnerung ist Segen und Fluch zugleich.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
1 Danach
2 Danach
3 Danach
4 Davor
5 Danach
6 Davor
7 Danach
8 Davor
9 Danach
10 Davor
11 Danach
12 Davor
13 Danach
14 Davor
15 Danach
16 Davor
17 Danach
18 Davor
19 Danach
20 Davor
21 Danach
22 Davor
23 Danach
24 Davor
25 Danach
26 Davor
27 Danach
28 Davor
29 Danach
30 Davor
31 Danach
32 Davor
33 Danach
34 Davor
35 Danach
36 Davor
37 Danach
38 Davor
39 Danach
40 Davor
41 Danach
42 Davor
43 Danach
44 Davor
45 Danach
46 Davor
47 Danach
48 Davor
49 Danach
50 Davor
51 Danach
52 Davor
53 Danach
54 Davor
55 Danach
56 Davor
57 Danach
58 Davor
59 Danach
60 Davor
61 Danach
62 Davor
63 Danach
64 Davor
65 Danach
66 Davor
67 Danach
68 Davor
69 Danach
70 Davor
71 Danach
72 Danach
73 Danach
74 Danach
75 Danach
76 Danach
77 Danach
78 Danach
79 Danach
80 Danach
81 Danach
82 Jetzt
Danksagung
Anmerkung der Autorin
Sprachliche Anmerkung
Informationen zum Buch
Echo der Gewalt
1
Danach
Echo warf noch einen Blick in den Spiegel, um sich davon zu überzeugen, dass ihre Schwimmkappe richtig saß und der wasserdichte Ohrhörer gut hinter ihren Diamantsteckern verborgen war. Dann nahm sie das flauschige weiße Handtuch von der Bank und tastete prüfend nach der Waffe darin. Der nigerianische Unternehmer und Mittelsmann für illegale Geschäfte Adam Mofour ging gern frühmorgens schwimmen, bevor das öffentliche Bad sich mit Besuchern füllte, die sich auf ihre Kurse vorbereiteten oder für die Olympiaauswahl Nigerias trainierten.
Sie verließ den Umkleideraum und ging ins Hallenbad hinüber, hörte schon im Gang das Platschen der Zielperson, die ihre Bahnen zog, roch das Chlor, bevor ihr Blick auf das blaue Becken mit den schwarzen Linien auf dem Grund fiel. Am Eingang blieb sie kurz stehen und sah sich um für den Fall, dass noch jemand anders da war, den sie würde beseitigen müssen. Doch wie erwartet war die Halle leer.
Die Stimme in ihrem Ohr sagte: »Die Sicherheitscrew dreht ihre Runde. Die Luft ist rein.«
Sie legte das Handtuch auf den Fliesen am Beckenrand ab, als Mofour sich näherte, mit der Eleganz eines Athleten durchs Wasser pflügte. Aus dem Info-Dossier über ihn wusste Echo, dass Schwimmen seine Leidenschaft war. Daran hätte er sich mal lieber halten sollen, statt den Tribe zu hintergehen und Staatsgeheimnisse aus Gewinnsucht an dessen Feinde weiterzugeben. Es kümmerte sie nicht, ob er tatsächlich schuldig war oder nicht. Der Tribe hatte Mofour zur Liquidierung vorgesehen, und sie war hier, um den Auftrag auszuführen.
Seine muskulösen Arme arbeiteten sich im Bruststil voran. Sie glitt ins Wasser, machte sich bereit. Als er am Beckenrand anschlagen wollte, griff sie zu und klemmte ihm den Arm um den Hals. Riss seinen Kopf aus dem Wasser und stützte sich dabei mit der freien Hand am Rand ab, während er japsend um sich schlug. Seine Überraschung ausnutzend, zog sie ihn noch weiter heraus, während sie zugleich die Spritze aus dem Handtuch fischte und ihm die Nadel in den Hals stach. Dann verlagerte sie ihr Gewicht, beugte sich vor und drückte seinen Kopf unter Wasser. Er riss die Arme hoch in dem Versuch, sie abzuwehren, und sie hörte seine gurgelnden Schreie, sah ihn krampfhaft zucken. Mit eisernem Griff tauchte sie ihn unter, bis sein Umsichschlagen nachließ und keine Blasen mehr an die Oberfläche stiegen, bis das Aufputschmittel wirkte und sein Herz zum Stillstand brachte. Dann ließ sie ihn davontreiben.
Echo stieg aus dem Becken, wickelte die leere Spritze wieder in das Handtuch und ging zurück in den Umkleideraum, wo sie sich anzog und Handtuch, Spritze, ihren Schwimmanzug und die Kappe in eine Sporttasche warf. Das alles würde sie anderswo entsorgen. Mit gespitzten Ohren wartete sie, bis Mofours Sicherheitsleute an den Umkleideräumen vorbei waren und die Schwimmhalle ansteuerten, um nach ihrem Boss zu sehen. Als sie freie Bahn hatte, schlüpfte sie hinaus, stieg die Treppe am anderen Ende des Flurs hinauf und verließ das Bad durch den Haupteingang. Während sie auf das Auto zuging, das sie speziell für diesen Einsatz geknackt hatte, ließ sich Witt, der Leiter der Liquidierungsabteilung des Tribe, im Ohrhörer vernehmen.
»Gut gemacht. Wie üblich.«
»Danke.« Sie schnallte sich an.
Ihr Mund zuckte vor Freude über dieses seltene Kompliment ihres Mentors. Sie drehte den Zündschlüssel und fuhr unter dem Sirenengeheul der herbeirasenden Krankenwagen und Polizeifahrzeuge davon.
2
Danach
»Gibt es ein Problem, Dad?«, fragte Nena, während sie zusah, wie ihre ältere Schwester in ihrem gemütlichen kleinen Wohnzimmer auf und ab lief. Elin verirrte sich nur selten in diesen Teil von Miami. Sie musste ziemlich beunruhigt gewesen sein, um die Fahrt von Coconut Grove nach Citrus auf sich zu nehmen – die »Slumtour« machen, wie sie es gern nannte. Wobei ihre piekfeine Schwester im selben Atemzug bemerken konnte, dass Nenas Häuschen der ruhigste Ort war, den sie kannte. Er war friedlich, weil Nena ihn dazu gemacht hatte. Sobald sie durch die Tür trat, war sie nicht mehr Echo, sondern nur noch Nena.
Noble Knights wohltönende, wenn auch leicht gereizte Stimme erklang über eine sichere Leitung aus dem Lautsprecher, damit beide Töchter ihn hören konnten. »Sieht so aus. Das Problem ist, dass dieser Auftrag erledigt werden muss und du plötzlich Bedenken anmeldest«, sagte er. »Versteh doch – den Staatsanwalt jetzt auszuschalten, stellt einen Vertrauensbeweis gegenüber unserem neuen, zukünftigen Ratsmitglied dar. Das Handelsabkommen, das er uns vermittelt, muss ohne Komplikationen über die Bühne gehen.«
Elin sah Nena streng an, ohne etwas zu sagen. Aber die Zielperson ist ein Bundesanwalt, dachte Nena. Und was meinte Dad mit »Vertrauensbeweis«? Seit wann liquidierte der Tribe Leute als »Vertrauensbeweis«? Das Ganze gefiel ihr nicht, aber wer war sie, ihren Vater in Frage zu stellen? Er hatte ihr nie einen Grund dazu gegeben, seit er und ihre Mutter sie von der Straße aufgelesen und adoptiert hatten. Trotzdem machte die Sache ihr zu schaffen.
»Diese Zielperson ist aber wirklich außerhalb der Norm, oder?«, sagte sie zu ihrer Schwester, nachdem sie den Anruf beendet hatten. »Außerhalb der Norm für uns, meine ich. Wir sind doch kein Gangstersyndikat.«
»Warum die Zweifel?«, erwiderte Elin, die in ihrer Handtasche kramte. »Hast du vielleicht was Besseres zu tun als diesen Job? Draußen in deinem Gärtchen in der knallheißen Sonne sitzen? Oder mit deinem Kumpel mit dem peinlichen Namen abhängen?«
»Keigel«, half ihr Nena auf die Sprünge. Ihr Nachbar drei Häuser weiter und der Kopf einer großen Gang im Viertel. »Ich frage nur, weil dieser Mann eben nicht unser typisches Ziel ist.«
Elin schnaubte genervt. »Ich muss eine rauchen. Du machst mir vielleicht einen Stress hier.« Sie brachte ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug zum Vorschein. »Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Typ ein Perversling oder korrupt. Das scheint die Standardvoraussetzung zu sein, damit einer …« Sie beendete die Bemerkung, indem sie sich einen perfekt manikürten Finger quer über die Kehle zog.
Nena lehnte sich auf dem Sofa nach vorn, stemmte die Ellbogen auf die Knie. »Du bist manchmal ziemlich derb, weißt du das?«
»Ach, du willst mich doch gar nicht anders haben.« Elin sah sie mit einem so umwerfend charmanten Grinsen an, dass Nena sich kopfschüttelnd geschlagen gab.
»Aber hat dieser Mann wirklich mehr Dreck am Stecken als der, den er anklagt?«, hakte sie nach. Es war in allen Nachrichten gewesen. Der mutmaßliche Geldwäscher Dennis Smith sollte wegen Schutzgelderpressung und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung sowie Zeugenbedrohung vor Gericht gestellt werden.
»Du weißt doch, wie es läuft«, sagte Elin. »Der Rat erlässt die Anordnung und gibt die Namen heraus, ich recherchiere die Informationen bei Network, und ihr von der Liquidation führt den Befehl aus. Wir hinterfragen die Gründe des Rats nicht.« Einlenkend schüttelte sie den Kopf. »Es stimmt, Smiths Geschäfte sind bestenfalls fragwürdig, und normalerweise würde der Tribe sich nicht mit ihm abgeben, aber sie machen es, um das neue Ratsmitglied auf ihre Seite zu ziehen. Politik halt.«
»Politisches Geschacher sollte eigentlich nicht die Sache des Tribe sein«, murrte Nena.
»Tja, wie das Leben so spielt – dieses neue Mitglied ist zufällig der Vater des Mannes, mit dem ich bumse, was soll man machen.«
Nena schnaubte. »Bumsen, ach ja? Ist das so eine arrangierte Sache? Eine traditionelle Kuppelei wie zu Hause in Afrika? Hat der Vater dieses Typs unserem Dad Ziegen und Schnaps gebracht?«
Elin zeigte ihr den Mittelfinger. »Nee, er hat ein ganzes Land mitgebracht.« Sie seufzte, sah plötzlich müde aus. Vielleicht auch verärgert. »Der Rat will Lucien Douglas, und Douglas will aus irgendeinem Grund, dass Smith nicht ins Gefängnis kommt. Es ist am einfachsten, den Staatsanwalt zu beseitigen und dem Mann den Gefallen zu tun. Außerdem billiger und weniger zeitaufwendig, als eine ganze Jury zu bestechen.«
Das klang ungewohnt kalt und herzlos aus Elins Mund. Jemanden umzubringen, nur weil es die einfachste Möglichkeit war. Nicht gerade ein inspirierendes Bild des Tribe, dessen oberstes Ziel die Förderung und Entwicklung afrikanischer Länder einschließlich der afrikanischen Diaspora sein sollte. Es ließ die Organisation selbstsüchtig und gierig erscheinen, geradezu böse.
»Aber es wirkt schon ziemlich eigennützig, diesen Cortland Baxter, zu liquidieren, oder?«, wandte Nena vorsichtig ein.
Elin schielte sehnsüchtig auf ihre Zigaretten und zog einen Schmollmund in Richtung ihrer Schwester, aber Nena schüttelte den Kopf. Mit einem frustrierten Seufzer steckte Elin die Packung wieder in ihre Handtasche. »Dieser Douglas hat gute Verbindungen zu einem der Länder, die bislang nicht an Bord zu holen waren. Und wenn der African Tribal Council ihm nun einen Gefallen tut, um das Land für sich zu gewinnen, damit wir die Im- und Exporte über die Küsten ausweiten können, ja, dann handelt der Tribe eben eigennützig.«
Sie wickelte ihren Pferdeschwanz aus langen Box Braids um die Finger und sah Nena zum ersten Mal, seit sie gekommen war, wirklich an. »Geht es dir gut? Mal ehrlich jetzt.«
Nena zuckte die Achseln. Das war die einzige Antwort, die sie im Moment geben konnte, weil sie nicht richtig wusste, wie sie sich fühlte. Die Beseitigung dieses Bundesanwalts erschien ihr immer noch als eine Abweichung von den Grundsätzen des Tribe. Okay, es war nicht ihre Aufgabe, einen Auftrag gutzuheißen oder nicht. Ihre Aufgabe war es, ihn wie befohlen auszuführen, und es bedrückte sie, dass sie auf einmal Zweifel an der Organisation hegte, der loyal zu dienen sie gelobt hatte.
»Jedenfalls«, sagte Elin, »denk nicht zu viel darüber nach. Es ist ein Auftrag wie jeder andere. Konzentrier dich jetzt lieber auf die Erledigung des Kubaners in ein paar Tagen. Ich kann übrigens nicht zu diesem Empfang mit all den Würdenträgern am selben Abend kommen, also musst du für mich daran teilnehmen – als du selbst.«
»Elin.« Nena merkte, wie ihr Unbehagen wuchs bei dem Gedanken, als die jüngste Tochter der Knights an einer prätentiösen Party teilnehmen zu müssen. »Du weißt, dass ich mir aus solchen Events nichts mache. Der Empfang plus der Kubaner bedeutet doppelten Einsatz.« Sie seufzte, dachte nach. »Ich kann da doch allein hingehen, oder?«
Elin überhörte das. »Wir werden das Team hier vor Ort für den Einsatz hinzuziehen.« Sie zählte an den Fingern ab: »Du hast gerade den Nigerianer abgewickelt, der Kubaner ist als Nächstes dran und dann der Staatsanwalt. Danach, kleine Schwester, wirst du dich für ein paar Monate bedeckt halten müssen. Witt sieht das genauso. Es hat ihm nicht geschmeckt, dir diese dicht aufeinanderfolgenden Aufträge zuzuweisen, aber im Moment müssen verschiedene Interessengruppen gleichzeitig zufriedengestellt werden.«
»Und der Empfang? Ich würde lieber ohne Begleiter hingehen.«
Elin antwortete nicht darauf, aber ihre Miene sagte alles. Sie winkte ihr lässig zu, stampfte mit ihren Blockabsatz-Sandaletten zur Haustür und riss sie in dem Moment auf, als gerade jemand anklopfen wollte. Nenas Kumpel Keigel stand davor, der eine Schachtel gebratene Hähnchenflügel mit Zitronen-Pfeffer-Butter in der Hand hielt. Das war ihr gemeinsames Ding, sie liebten beide ihre Wings auf diese Art. Nena sah den Hundeblick, mit dem Keigel ihre Schwester anglotzte, in die er total verknallt war. Wahrscheinlich hatte er ihr Auto gesehen und das Essen als Vorwand besorgt, um rüberzukommen, statt wie sonst darauf zu warten, dass Nena zu ihm kam.
Sie brachte es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass er keine Chance bei Elin hatte.
»Ach, sieh an«, spottete Elin, »Rettung naht.«
Keigel sah gut aus, das musste Nena ihm lassen. Halblange Braids, ein tadellos gepflegter Bart und nussbraune Augen, die verrieten, was für ein Softie er im Grunde war. »Platz ich gerade in was rein?«, fragte er grinsend.
»Aber nein, Schätzchen«, flötete Elin und streichelte ihm mit ihren langen Nägeln über die Wange, worauf er sichtlich dahinschmolz. So etwas machte ihr Spaß.
Nena hörte ihnen nur mit halbem Ohr zu. Sie war mit ihren Gedanken noch bei den beiden bevorstehenden Jobs und der Party, zu der sie nicht gehen wollte. »Muss ich wirklich eine Begleitung mitbringen?«
Elin schob sich an dem verdatterten Keigel vorbei und bedachte ihn noch mit einem bezaubernden Lächeln. Über die Schulter hinweg rief sie: »Natürlich. Such dir besser selbst jemanden aus, bevor ich es mache.«
3
Danach
Bisher waren die Attentate für sie kaum etwas anderes gewesen als ein stinknormaler Job. Die Morde bereiteten ihr keine schlaflosen Nächte. An diesem Abend jedoch, als der Himmel über Miami dem Inneren einer afrikanischen Diamantmine glich, verließ sie bei der Vorstellung, einen weiteren Einsatz dieser Art leiten zu müssen, plötzlich alle Kraft. Für einen Moment hätte sie es lieber mit den Fallstricken einer Zusammenkunft von Miamis Elite aufgenommen, als zum zigsten Mal die anstehende Beseitigung des zweitobersten Bosses eines kubanischen Kartells durchzugehen.
Ein Gefühl der Leere beschlich sie, und sie fragte sich, woher diese seltsame Stimmung kam. Was war nur mit ihr los? Kopfschüttelnd rief sie sich zur Ordnung und verscheuchte diese jämmerliche Anwandlung so schnell, wie sie gekommen war. Der Liquidierungsabteilung beizutreten, hatte ihr eine Aufgabe gegeben und eine wohltuende Atempause von den bösen Erinnerungen verschafft, die sie jahrelang geplagt hatten. Trotzdem fragte sie sich jetzt, als sie auf das Gewehr in ihren Händen hinunterblickte, ob es nicht mehr gab im Leben, als anderen das Leben zu nehmen.
Auf ihrer Armbanduhr war es 23.00 Uhr.
»Es ist Zeit«, verkündete Witt durch das kaum sichtbare Ohrfunkgerät, das sie alle trugen. Er saß mit Network, der allsehenden Einsatzleitung, an irgendeinem geheimen Ort in Europa, von dem aus ihre sämtlichen Aktionen dirigiert wurden.
»Echo, hast du verstanden?«
»Verstanden«, sagte Nena, unterdrückte ihre Skrupel und streifte die eine Hälfte ihrer Persönlichkeit ab. Es war Zeit, wie Witt sagte, Zeit, nur noch die andere Hälfte zu sein, Echo zu sein. Noch ein Name in ihrer langen, elenden Geschichte von Namen.
»Was ist mit der Überwachungsanlage?«, fragte sie.
Gleich darauf beobachtete sie zusammen mit Alpha, dem stellvertretenden Leiter ihres aus fünf Personen bestehenden Teams, wie die roten Lämpchen auf Alphas Handsender zweimal kurz blinkten und dann einmal lang, ehe sie auf Grün wechselten, was bedeutete, dass das Überwachungssystem der Villa offline war und nun von Network kontrolliert wurde. Jeder, der die Kameras im Auge behielt, würde nur eine Endlosschleife des stillen Hauses und Grundstücks sehen.
Witts krächzende Stimme hatte immer eine beruhigende Wirkung auf Nena. »Bleibt sauber, Leute. Zügig rein und raus.«
Alpha, Charlie, Sierra und sie legten den Rest ihrer Ausrüstung an: Nachtsichtbrillen, schwarze Skimasken und dünne Handschuhe, um keine Spuren zu hinterlassen, die zu ihrer Identifizierung führen oder Hinweise auf ihre ethnische Zugehörigkeit geben konnten.
Das Team kletterte aus dem dunklen, unauffälligen Minibus und ließ nur X-Ray auf dem Fahrersitz zurück. Im Schutz der Dunkelheit warteten sie geduckt einen Augenblick, bevor sie auf das Hausportal zuhuschten. Hintereinander bewegten sie sich in Schlangenlinien um die pseudobarocken Statuen von nackten Frauen und Putten herum, die den Weg säumten, schwenkten dabei ihre Gewehre und hielten nach Wachen Ausschau.
Der Plan der Villa und der umgebenden Gartenanlage war in Nenas Gedächtnis verankert, als wäre sie dort aufgewachsen. Innerhalb von drei Minuten hatten sie das Grundstück durchquert, wobei sie die Sträucher und Palmen als Deckung nutzten. Kurz vor dem Haus entdeckte Nena zwei Wächter auf dem tiefgezogenen Schindeldach. Sie richtete ihr halbautomatisches Gewehr auf den einen und drückte ab. Noch ehe der Mann fiel, zielte und schoss sie erneut und schaltete auch seinen Partner aus. Sie machte das schon so lange, dass es kaum mehr Emotionen in ihr auslöste, als eine E-Mail abzuschicken. Nicht dass sie Gefallen am Töten fand, es musste einfach sein. Um Ordnung zu halten und die Sache des Tribe voranzubringen.
Der neueste Vorstoß des Kubaners – illegale Immigranten einzuschleusen und als billige Arbeitskräfte feilzubieten – gefährdete die geschäftliche Partnerschaft des Tribe mit dem Kartell. Der Rat ließ es nicht zu, dass mit seinem Kapital irgendeine Form von Menschenhandel betrieben wurde. Waren nicht aus ihren Heimatländern zahllose Afrikanerinnen und Afrikaner geraubt, verkauft und als Sklaven nach Amerika verschifft worden? Niemals würden sie es dulden, dass dieses dunkle Kapitel der Geschichte sich wiederholte. Doch nicht Juarez, der Boss der Kubaner, traf die Entscheidungen – Juarez war lediglich das Gesicht ihres Drogenimperiums. Das Gehirn hinter dem Gesicht war die Nummer zwei, Esteban Ruiz, weshalb man Ruiz zur Liquidierung vorgesehen hatte. War er erst einmal aus dem Weg geräumt, würde das Kartell vom Tribe kontrolliert und nach dessen Grundsätzen wieder auf den rechten Weg geführt werden.
Nena gab dem Team ein Zeichen, woraufhin die anderen drei auf ihre vorgesehenen Positionen eilten, während sie das Zielobjekt lokalisierte.
Ruiz war dort, wo er ihren Infos nach sein sollte, hinter dem massiven Eichenschreibtisch in seinem Arbeitszimmer. Seinen Chefsessel hatte er zu einer Wand aus Monitoren herumgedreht und den Kopf zurückgelegt, als wäre er eingeschlafen. Umso besser.
Sie schulterte das Gewehr, zog ihre Faustfeuerwaffe und zielte damit, während sie sich ihm näherte. Auf einmal gab er ein tiefes Stöhnen von sich, und sie stockte, nahm im selben Moment eine Bewegung unterhalb von ihm wahr. Eine Hand lag auf der Armlehne des Sessels, während die andere … Sie reckte den Hals, konnte aber nicht sehen, wo die Hand genau war, nur dass sie sich bewegte. Mehr wollte sie gar nicht wissen.
Schnell rückte sie noch näher an ihn heran, setzte die Waffe an seinen Hinterkopf und drückte ab. Er war so in sein Tun versunken, dass er sie nicht einmal bemerkte. Sein Kopf ruckte nach vorn und fiel auf seine Brust.
Sie wollte sich gerade über ihn beugen, um nachzusehen, ob er wirklich tot war, als ein dunkler Schopf von unten hervorschoss, wie ein Präriehund in einer Naturdoku von National Geographic. Sie kannte die Uniform, es war einer von den Sicherheitsleuten. Konnte nicht älter als zwanzig sein, wenn überhaupt. Blinzelnd überwand sie ihre Verblüffung. Diese Information hatte das Dossier nicht enthalten, und sie hasste Überraschungen.
Der junge Wachmann blickte zu ihr auf, doch bevor er die richtigen Schlüsse aus der herabhängenden Kinnlade seines Chefs, der Austrittswunde zwischen seinen Augen und den Blutrinnsalen zu beiden Seiten der Nase ziehen konnte, legte Echo wieder an und erschoss auch ihn. Sein Kopf fiel zurück in den Schoß, mit dem er so intim vertraut gewesen war.
Nena suchte das Zimmer mit den Augen ab, um sicherzugehen, dass nicht noch mehr Lustknaben von irgendwo auftauchten. Als sie den Blick auf die Reihen der Monitore richtete, fiel ihr einer auf, der sich von den anderen unterschied. Er zeigte eine Schwarzweiß-Videoaufnahme von Juarez in seinem Schlafzimmer, und sie erkannte, dass er nicht allein war. Schluckend stellte sie sich vor, wie leicht die Aktion hätte in die Hose gehen können. Warum Network diesen Feed übersehen hatte, war ihr schleierhaft. Sie hatten Glück gehabt.
»Liquidation abgeschlossen. Es gibt eine separate Videoübertragung«, murmelte sie in ihr Mikro. »Sieht aus, als hätte die Zielperson das Schlafzimmer von Nummer eins überwacht.«
»Sehen wir«, lautete die Antwort. Diesmal war es nicht Witt, sondern irgendein anderes Mitglied des Network-Teams, auf dessen Bekanntschaft sie keinen gesteigerten Wert legte. »Vergiss ihn. Nimm den USB-Stick und korrumpier ihr Überwachungssystem, dann geh zum Wagen.«
»Was ist, wenn sie es in der Cloud haben?«
Kurzes Zögern. »Haben sie nicht. Sie sind altmodisch.«
Diesen letzten Teil bekam sie kaum noch mit, weil sie wie gebannt auf den Bildschirm starrte. Sie biss sich auf die Lippen, als sie begriff, was sie da sah. Über die Muschel in ihrem Ohr hörte sie, wie ihr Team weitere Wachmänner ausschaltete und das Haus säuberte, sich bereit machte, zu dem Minibus zurückzukehren – hörte jedes leise Grunzen, jedes Pfft der Schalldämpfer, jedes Patta-patta pat-pat der halbautomatischen Waffen. Sie zwang sich, den neuen Befehl auszuführen, fand den Computer und schob einen USB-Stick hinein, mit dessen Hilfe Network das Sicherheitssystem zerstören würde.
Dann verließ sie hastig das Zimmer, um nach unten zu laufen. Oben an der mit Teppich ausgelegten Treppe blieb sie plötzlich stehen. Die Zeit drängte, aber was sie auf dem Bildschirm gesehen hatte, veranlasste sie, umzukehren und die Treppe hinaufzueilen statt hinunter. Sie musste noch etwas erledigen. Alle glaubten, die Sklaverei sei längst Geschichte, aber man musste sich nur die Aufnahmen aus dem Schlafgemach dieses Kubaners ansehen, um zu begreifen, dass es sie immer noch gab, hier, in diesem Moment, in diesem Haus.
Sie rief sich den Grundriss der Villa in Erinnerung und fand die Master-Suite rasch. Die Wortwechsel ihres Teams und die Mitteilungen von Network ignorierend, drehte sie lautlos den Türknauf. Die Tür knarrte ein wenig, so dass sie kurz innehielt und lauschte. Niemand schien etwas gehört zu haben.
»Echo, ich wechsele auf einen privaten Kanal«, sagte Witt auf einmal. Eine Sekunde später fragte er: »Was machst du da?« Sie zog eine Grimasse. Witt wich während eines Einsatzes nie vom vorgesehenen Ablauf ab. Genauso wenig wie sie normalerweise. Die Tatsache, dass sie sich nicht strikt an den Plan hielt, beunruhigte ihn offenbar genug, um gegen das Protokoll zu verstoßen. »Du bist nicht mehr auf Kurs. Geh zurück dorthin, wo du sein solltest.«
Doch sie war genau da, wo sie sein sollte. Sie schob die Tür weiter auf und betrat ein in Weinrot und Gold gehaltenes Schlafzimmer mit einem riesigen Himmelbett in der Mitte, in dem sechs ausgewachsene Männer Platz gehabt hätten. Der Raum wirkte größer als ihr gesamter Bungalow in Citrus Grove, größer als jedes Zimmer, das sie sich als junges Mädchen in Ghana hätte vorstellen können. Trotzdem war er hässlich und düster, erinnerte sie an Shades of Grey, und was sich darin abspielte, war ein Albtraum – mit Juarez als Schreckensgestalt.
Das Mädchen bei ihm war noch ein Kind, dünn, unterernährt. Schwer zu sagen, welcher Ethnie sie angehörte, denn ein Vorhang langer strähniger Haare verdeckte ihr Gesicht wie in einer Szene aus einem Horrorfilm. Die Träger eines Negligés für eine erwachsene Frau rutschten ihr von den schmalen Schultern, und sie zitterte so heftig, dass das schwere, mit Satinlaken bezogene Bett unter ihr bebte. Ihr Wimmern traf einen empfindlichen Nerv bei Nena. Erinnerungen an Stacheldraht, die Hölle der Hot Box und an Leichen – so viele Leichen – zuckten durch ihren Kopf und ließen sie beinahe in die Knie gehen.
Der Kubaner bemerkte sie noch immer nicht, als er mit lüsternem Grinsen aus einem offenen Schrank sorgfältig ein Halsband mit einer Leine daran auswählte. Als würde er einen Verlobungsring aussuchen. Schwankend ging er auf das Mädchen zu und warf dabei seinen Morgenmantel ab, unter dem er nackt war, wie Gott ihn geschaffen hatte.
Die Kleine, die jetzt auf dem Bett kniete, blickte mit aufgerissenen Augen hinter ihrem Haarvorhang hervor und flüsterte: »Por favor, Señor. No!«
Nena verstand selbst nicht, warum sie zögerte. Warum sie zusah, wie er das Halsband um den schmalen Hals des Mädchens befestigte und das Schloss zuklicken ließ. Die Kleine verzog schmerzhaft das Gesicht, weil er es zu eng schnallte. Bei jeder Berührung von ihm zuckte sie zusammen, als würde sie mit einem weißglühenden Eisen gebrandmarkt.
Nena steckte ihre Pistole ins Holster und zog das Messer aus der Scheide an ihrem Rücken.
»Höchste Zeit«, warnte Witt.
»Das wird dir gefallen, Schätzchen«, sagte der Kubaner. »Ich werd’s dir richtig besorgen.« Er schlug das Mädchen, schlug es so fest, dass Nena das Brennen auf ihrer eigenen Haut spürte. Dann holte er erneut aus, die Hand zur Faust geballt.
Es war der hohe Angstschrei des Kindes, der sie aus ihrer Starre riss. Sie bewegte sich flink, nahm flüchtig den dichten, drahtigen Haarteppich auf dem Rücken des Kubaners wahr und die Mischung aus Körperausdünstungen und Zigarrenrauch, die von ihm ausging.
Das Mädchen starrte jetzt nicht mehr ihn an, sondern Nena, die stumm den Finger vor den Mund hielt.
Ohne auf Witts neuerliches Drängen in ihrem Ohr zu achten, packte sie den Kubaner am Kopf und riss ihn an sich. Mit der anderen Hand zog sie ihm das Messer über den Hals, schnitt durch die weichen, schlaffen Hautfalten wie durch Butter.
Der Mann gurgelte, Blut sprudelte aus der klaffenden Wunde, und seine Hände flogen an seine Kehle in dem vergeblichen Versuch, den Schnitt zusammenzudrücken.
Als Nena ihn losließ, kippte er mit einem dumpfen Knall auf den Boden. Die beiden Frauen sahen zu, wie das Leben aus ihm herausfloss, sich als Lache um ihn herum ausbreitete.
»Verdammt nochmal, was ist da los?«, knurrte Witt und brachte sie wieder zu sich. Das Team wartete auf sie, sie war lange genug vom Einsatzplan abgewichen.
Ein Rascheln vom Bett zog ihren Blick auf das Mädchen. Was sollte sie mit ihr machen? Sie konnte sie nicht so hier zurücklassen. Aber sie konnte sie auch nicht mitnehmen.
Die Kleine nestelte mit ihren schmalen Fingern an dem Halsband herum, worauf Nena rasch zu dem Schrank voller Sex-Utensilien des Kubaners ging, in dem ein kleiner Schlüssel an einem Haken hing.
Über den Teamkanal hörte sie, wie die anderen zum Fahrzeug zurückkehrten, sich nacheinander bei Network meldeten. Sie würde den Einsatz gefährden, möglicherweise die Sicherheit des ganzen Teams aufs Spiel setzen, falls weitere Männer der Kubaner eintrafen. Sie musste hier weg. Schnell riss sie den Schlüssel vom Haken. Das Mädchen würde allein zusehen müssen, wie es überlebte – oder eben nicht.
Witt zischte: »Um Himmels willen, du musst sofort da raus.«
»Bin unterwegs.« Sie sah sich noch einmal kurz im Zimmer um, während das Mädchen auf den kleinen silbernen Schlüssel zu krabbelte, der zwischen den Satinkissen gelandet war. Als Nena die Treppe hinunterspurtete, weg von dem Mädchen und den Erinnerungen an eine Vergangenheit, die sie endlich vergessen wollte, hatte sie das Gefühl, direkt dorthin zurückzulaufen, wo alles begonnen hatte.
4
Davor
Bevor ich zu Echo, bevor ich zu Nena wurde, war ich Aninyeh. Das ist meine Geschichte, meine Erzählung.
Davon, wer ich war.
Davon, wer ich geworden bin.
Meine Reise beginnt in einem kleinen Dorf, eingebettet in die üppigen, leuchtend grünen Wälder an den Hängen des Aburi Mountain. Wenn man nach mir sucht, findet man mich oft weiter oben auf einem Felsen, von wo aus ich die Welt unter mir betrachte. Meine liebste Tageszeit ist der frühe Morgen, wenn alles noch vom Tau glänzt und der Nebel dicht über allem liegt, um sich dann mit der höher steigenden Sonne aufzulösen. Es ist heiß in Ghana, besonders im Spätsommer. Dieses Jahr ist ein gutes Erntejahr, es hat genug geregnet, so dass die Feldfrüchte und unsere Tiere gedeihen konnten und wir viel auf dem Markt verkauft haben. Es geht uns gut.
Hier oben auf dem Berg ist es kühler und sehr angenehm. An klaren Tagen kann ich von meinem Felsen aus durch den sich lichtenden Nebel Accra sehen, das nur vierzig Kilometer entfernt liegt, aber so viel weiter weg zu sein scheint von meinem Standpunkt aus. Die tiefen Täler unten führen mir immer wieder vor Augen, wie schön meine Heimat ist. Ich sehe ihren Reichtum und was für ein Glück ich habe, Afrikanerin, Ghanaerin, aus N’nkakuwe zu sein.
»Papa sagt, wir sollen uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern und nicht begehren …«
»… was unser Bruder oder unsere Schwester hat. Ja, ja, ich weiß, Aninyeh.« Mein Bruder Ofori verdreht die Augen. »Deswegen kann ich mir aber trotzdem Gedanken machen, was aus mir werden soll, wenn Wisdom unser Oberhaupt wird und Josiah sein Berater.«
Jedes Mal, wenn Ofori mit seiner Eifersucht auf unsere älteren Brüder anfängt, muss ich mich beherrschen, um ihn nicht grün und blau zu schlagen. Wisdom, der große, ernste, mutige Wisdom, der seinem Namen alle Ehre macht, wird als Erstgeborener einmal den Titel des Häuptlings übernehmen, wenn Papa zurücktritt. Josiah ist drei Minuten jünger als er und soll sein erster Berater werden.
»Du kannst froh sein, dass dich die Pflicht nicht an N’nkakuwe bindet so wie sie«, sage ich zu Ofori. Ich verstehe nicht, warum er sein Glück nicht einsehen will.
In der Küche unseres Hauses riecht es nach einer köstlichen Mischung aus Gewürzen und süßem Gebäck. Auntie, Mamas Lieblingscousine, die nach ihrem Tod ihre Stelle eingenommen hat, rührt schweißglänzend in einem gusseisernen Kessel voll brodelndem Bohneneintopf mit dicken Stücken von eingesalzenem Dorsch darin. Gleich wird sie Öl in einer Pfanne erhitzen, um reife, süße Kochbananen darin zu braten. Bohneneintopf mit gebratenen Bananen ist das Lieblingsgericht von Papa und mir.
Derweil mopst Ofori einen Bofrot, einen süßen, frittierten Hefeknödel, und Auntie schimpft, dass er sich den Appetit fürs Abendessen verdirbt. Ich zähle die Bofrots sorgfältig, teile sie durch uns sechs und ziehe einen Flunsch, weil Ofori jetzt schon mehr als seinen Anteil hatte.
»Ofori, du solltest bei deinem Vater und den Zwillingen sein und die Abendaufgaben erledigen.«
»Warum?«, fragt er und stopft sich den letzten geraubten Knödel in den Mund.
»Was soll das heißen, warum?« erwidert sie.
»Warum soll ich denen hinterherlaufen, wenn ich doch nie Häuptling werde? Sie brauchen mich nicht.«
»Du wirst Mitglied des Ältestenrats sein, Ofori. Das ist eine wichtige Aufgabe, weil ein Häuptling ohne seinen Rat nicht gut regieren kann«, erklärt Auntie und versetzt ihm einen Klaps. »Jetzt lass uns die Frauenarbeit tun und hilf deinem Vater auf dem Dorfplatz.«
Ich zucke zusammen, als hätte mich jemand mit einem spitzen Stock gepikst. Aunties Auffassung davon, wo der Platz von Frauen oder Männern zu sein hat, ist vorsintflutlich, und ich habe nicht vor, mich daran zu halten. In ein paar Tagen werde ich fünfzehn, und wenn ich achtzehn bin, gehe ich zum Studieren ins Ausland, bestimmt nicht in Ghana auf die Uni, wie Auntie glaubt. Ich werde die Welt bereisen wie Papa und noch mehr Sprachen lernen neben denen, die er mir schon beigebracht hat. Niemand wird mir vorschreiben, was eine Frau zu tun oder zu lassen hat. Das sage ich aber nicht laut, weil mein Kopf mir lieb und teuer ist und er keinen Schlag mit ihrer schweren Holzkelle abbekommen soll.
Mein Vater ist das Dorfoberhaupt, weshalb ich eigentlich eine Prinzessin bin, doch es gibt Grenzen, die selbst moderne Prinzessinnen nicht zu überschreiten wagen.
Ofori weicht gewandt meinem Griff aus, als ich ihn beim Mopsen eines weiteren Bofrots ertappe. »Hey!«, schreie ich und will ihm hinterherjagen, aber Auntie hält mich am Kragen meiner Schuluniform fest.
»Die zählen nicht!«, ruft Ofori und hüpft lachend davon.
»Pass auf wegen der Schlangen!«, ruft Auntie ihm nach. Das sagt sie jeden Morgen und jeden Abend, weil die vielen Schlangen, die diesen Berg mit uns teilen, dann am aktivsten sind. Es gibt noch andere gefährliche Tiere hier, zwar keine Löwen oder großen Räuber, doch genug, was uns schaden kann. Die Schlangen aber machen Auntie am meisten Angst.
»Auntie!«, protestiere ich. »Ofori hat schon viel zu viele genascht.«
»Still, Kind.« Sie fährt sich glättend über ihre gerunzelte Stirn. »Es gibt reichlich, alles ist gut.«
Ist es das? Wie mag es sein, den abendlichen Kontrollgang durchs Dorf zusammen mit meinem Vater und meinen Brüdern zu machen? Sie vergewissern sich bei den anderen Männern, dass alle wohlbehalten zurück sind und dass es keine ungeklärten Angelegenheiten zwischen den Dorfbewohnern gibt, die in Streit ausarten könnten. Mir wird eng um die Brust, und meine Augen verschwimmen von ungewollten Tränen, als ich daran denke, dass Ofori jetzt mit Papa und den Zwillingen unterwegs ist. Er beklagt sich noch über das Privileg, während ich hier in dieser heißen, stickigen Küche festsitze und »Frauenarbeit« tun muss. Vor lauter Groll passe ich nicht auf und hacke mir beinahe die Fingerkuppe mit dem Messer ab, mit dem ich die reifen Kochbananen in schräge Scheiben schneide.
Ofori denkt nie an andere, nicht so wie Papa, der gerecht und ehrenhaft ist und der fleißigste von allen. Nie verlangt er von anderen, etwas zu tun, das er nicht selbst erledigen kann. Er ist ein guter Anführer, ein großer Mann, von den meisten geliebt, und würde nie mehr als den ihm zustehenden Anteil an Bofrots nehmen …
Ein plötzlicher, stakkatoartiger Lärm unterbricht Aunties Geplapper.
Sie wedelt die Störung mit der Hand weg, als wolle sie einen Brummer verjagen. »Bestimmt Jungen, die trommeln üben oder Stockkampf spielen«, sagt sie und räuspert sich. »Oder eine Hyäne, die dem Dorf zu nahe gekommen ist.«
Ich nicke, obwohl ich es besser weiß. Und als laute Schreie zur Küche hereindringen, weiß auch Auntie Bescheid.
Ich lasse das Messer fallen, alle Gedanken an gebratene Bananen und brodelnden Bohneneintopf sind verflogen.
Auntie streckt ihre Hände – verarbeitet und ledrig von all den Jahren, die sie zum Formen von Banku-Klößen oder Auspressen von Maniokblättern in heißes Wasser getaucht wurden – nach mir aus. »Aninyeh, warte!«
Doch ich bin schon zur Tür hinaus, höre nicht auf ihre immer verzweifelteren Rufe. Ich laufe schneller, laufe durch das hohe schmiedeeiserne Tor hinaus ins Unbekannte, entferne mich rasch von unserem Hof, der unserer Abstammung wegen größer ist als die meisten anderen im Dorf.
N’nkakuwe liegt an der Schwelle zwischen der alten Welt und den boomenden Städten Accra und Kumasi. Das Land gehört nicht der Familie meines Vaters. Er stammt aus einem Dorf im Fantiland, tief gelegene Täler, fast vier Stunden von hier entfernt. Die Geschichte seines Stammes reicht Hunderte von Jahren zurück, bis in die Zeit, als die Völker der Ashanti und der Fanti sich bekriegten. Sie kämpften um die Vorherrschaft in der Region und die Übermacht beim Handel mit den Europäern, die auf afrikanische Güter aus waren – was vor allem Sklaven bedeutete.
Nach jahrelangen Kriegen aber schlossen die beiden Stämme Frieden und begannen, sich zu vermischen. Aus diesem Grund stammt mein Vater von beiden Völkern ab. Als junger Mann, gerade vom Studium in Übersee zurückgekehrt, lernte er meine Mutter auf einem Markt in Accra kennen. Aus Liebe zu ihr verließ er seine Heimat und heiratete sie. Mama war die einzige Tochter des Häuptlings, und wie es das Gesetz vorsieht, wurde mein Vater nach dem Tod meines Großvaters unser Stammesoberhaupt.
Meine Mutter war mütterlicherseits zu einem Viertel Yoruba, von ihrer nigerianischen Großmutter her, der Rest war Ewe. Folglich sind meine Brüder und ich eine Verschmelzung der drei großen Volksgruppen Ghanas: Ashanti, Fanti und Ewe.
Von allem, an was ich mich erinnern werde, sticht eines als unbedingt wahr heraus: Mein Vater ist ein ehrenwerter Mann.
Doch auch die ehrenwertesten Männer haben Feinde.
An diesem Abend sind die Feinde mit Gewehren gekommen. Mit Macheten. Und mit einem Blutdurst so gierig und zerstörerisch wie ein Lauffeuer, das uns alle verschlingen wird.
5
Danach
Als Nena den Minibus erreichte, versuchte sie, nicht auf die bohrenden Blicke ihrer Teammitglieder zu achten. Ja, sie hatte sich verspätet, aber es war alles glatt gegangen, oder? Hastig entledigte sie sich ihrer Montur, als könnte sie dadurch umso schneller ihr schlechtes Gewissen abstreifen, weil sie ihr Team allein gelassen und einem Risiko ausgesetzt hatte. Sie schlüpfte wieder in das fließende, melonenfarbene Abendkleid, das ihre Schwester für sie ausgesucht hatte. Immerhin hatte Elin diesmal einen guten Griff getan.
Der Transporter rollte im Leerlauf die lange, gewundene Auffahrt des Anwesens hinunter. Acht Kilometer weiter trank und tanzte Miamis Oberschicht und hatte sie wahrscheinlich kein bisschen vermisst.
Der Auftrag war ausgeführt, trotz ein paar kleiner Widrigkeiten, aber die Nacht war noch nicht zu Ende.
Charlie reichte ihr ihre goldfarbene Clutch. Sie wirkte geradezu komisch in seinen behaarten Pranken, die vor noch nicht einmal zwanzig Minuten Menschen erschossen hatten.
»Danke.« Nena holte eine Puderdose mit Spiegel heraus, um ihr Äußeres zu überprüfen. Froh, die Skimaske los zu sein, nahm sie ein paar Reinigungstücher aus der Sporttasche mit ihrer abgelegten Kleidung und tupfte sich den Schweiß vom Gesicht. Die kühle Luft der Klimaanlage war eine Wohltat auf der Haut.
Jetzt musste sie nur noch den Rest dieser Party überstehen. Musste sich zusammennehmen und wieder ihr normales Selbst sein, was auch immer das sein mochte. Oft fiel es ihr schwer zu unterscheiden, wer sie wirklich war, die Angehörige der feinen Gesellschaft oder die Wudini. Gleich jedenfalls würde sie wieder die Gesellschaftsdame geben und an dieser pompösen Soiree teilnehmen, weil Elin in Angelegenheiten des Tribe im Ausland war. Wenigstens gab die Party ein perfektes Alibi ab – sie repräsentierte ihre Familie und hatte am selben Abend den Kubaner eliminiert. So ein Glücksfall.
Alpha saß vorn neben X-Ray, der jetzt den Minibus auf die Hauptstraße lenkte und Gas gab, um sie alle schleunigst von der Kubaner-Villa wegzubringen. Nena fing seinen Blick im Rückspiegel auf, er zog die Augenbrauen hoch. »Vielleicht kannst du das nächste Mal dein Team vorwarnen, wenn du beschließt, auf Abwege zu gehen?«, sagte er.
Sie trug ein paar Spritzer einer Lotion auf und verteilte sie auf ihrem Gesicht. Jetzt noch den farbigen Lipgloss. »Du hast recht«, sagte sie. »Mein Fehler.« Zum Schluss wickelte sie ihre Haare zu einem opulenten Dutt auf, den sie mit einem goldenen Haarband befestigte und zurechtzupfte.
»Weißt du …«, schaltete sich Sierra neben Charlie ein. Die beiden waren gerade ebenfalls beim Umziehen, tauschten ihr Einsatz-Outfit, das sie später, nachdem sie sich getrennt hatten, entsorgen würden, gegen ihre Alltagskleidung. »Wir halten dir immer den Rücken frei, Kollegin – also sag uns einfach, was Sache ist.«
Nena nickte ihr über den Spiegel entschuldigend zu, während sie noch eine Schicht Deo auftrug, sich danach mit Parfüm bestäubte. Sie sah kurz zum Fenster hinaus, um festzustellen, wo sie waren. Zehn Meter weiter ragte ein Sicherheitstor auf, flankiert von hohen Palmen. »Setzt mich bitte hier ab.«
Als die Tür des Busses aufglitt, sagte Sierra: »Benimm dich da drin, Boss.«
Nena nickte erneut. »Klar doch.«
Sierra grinste anzüglich und sagte noch etwas, als die Tür schon wieder zuging. »Ich würd es nicht – mich benehmen, meine ich.«
Bis zum nächsten Auftrag würde das Team sich nicht wiedersehen. Jetzt fuhren sie erst einmal alle nach Hause, zu ihren über die Ostküste verstreuten Wohnsitzen. Sie kannten weder die richtigen Namen voneinander, noch wussten sie, wo die anderen wohnten, obwohl Nena vermutete, dass Sierra wie sie in Florida lebte.
Auf hohen Absätzen, die sie nicht ausstehen konnte, stakste sie die Auffahrt zu dem schlossartigen Gebäude hinauf, in dem die Feier stattfand. Das weiße Licht der Außenstrahler erhellte den Nachthimmel, als wäre es Silvester. Sie ließ den Blick über das hohe Eingangstor schweifen, die sich wiegenden Palmen, die perfekt beschnittenen Sträucher und die hell erleuchteten Fenster. Der top gepflegte Rasen, der sich vor ihr erstreckte, hatte die Ausmaße eines Fußballfelds.
Vorbei an den Bediensteten mit roten Westen, die geschäftig Luxuslimousinen in improvisierte Parkplätze quetschten, während immer neue Partygäste eintrafen. Ein Junge im Collegealter schien drauf und dran, der Bordsteinkante Gesellschaft zu leisten, bevor ein herannahender Bentley eine Vollbremsung machte.
»Ich bin drin«, murmelte sie in dem Wissen, dass die Hightech-Mikros in ihren sich um die Ohrmuschel schmiegenden Onyxohrringen auch die leisesten Töne auffingen. Network würde dafür sorgen, dass ihre Rückkehr zu der Party von den Überwachungskameras genauso wenig erfasst wurde wie ihr Weggang vorhin. Sie durchquerte die Vorhalle und ließ sich von dem Saxophon-Riff der Liveband in den Ballsaal leiten.
»Verstanden. Kanal wird geschlossen«, antwortete Network.
»Nena, da bist du ja! Ich suche dich schon die ganze Zeit«, empfing sie ihr gutaussehender Begleiter und fasste sie fürsorglich am Ellbogen. »Ist alles in Ordnung?«
Im Nu schlüpfte sie wieder in ihre brave, sittsame Rolle, auch wenn sie mit den Zähnen knirschte, als sie auf ihren walnussbraunen, goldschimmernden Arm starrte, an dem David sie für ihren Geschmack etwas zu besitzergreifend festhielt.
Doch sie blieb ihrem Part treu. »Ich habe mich verlaufen«, hauchte sie, wie erleichtert, dass ihr kleines unfreiwilliges Abenteuer ein gutes Ende genommen hatte, und blinzelte zu den meergrünen Augen dieses Blinddates auf, das ihre Schwester ihr aufgezwungen hatte.
»Um den Schein zu wahren. Das macht sich besser«, hatte Elin behauptet.
Eher, um sie zu quälen, dachte Nena. Sie hätte weiß Gott lieber solo an diesem Event teilgenommen.
»Ich brauchte frische Luft und dachte, ich spaziere ein bisschen durch den Garten, der allerdings ein Park ist. Dabei habe ich irgendwie die Orientierung verloren. Bin ich froh, dass du mich gefunden hast.«
David schwoll die Brust, der zufriedene Held. »Hättest du Lust auf ein Tänzchen? Oder möchtest du lieber gehen?«
Natürlich wollte sie lieber gehen. Doch sie wollte sich auch Elins Gezeter darüber ersparen, dass sie ihre familiären Pflichten vernachlässige, die bei solchen Anlässen darin bestanden, die Beziehungen zu möglichen Geschäftspartnern und politischen Verbündeten zu festigen. Reichtum und Macht für den Tribe zu mehren, war Noble Knights Ziel, jedoch nicht das einzige. Die Stellung seiner Familie auszubauen, dafür zu sorgen, dass sie innerhalb und außerhalb des Tribe mächtig blieb, war ihm genauso wichtig.
Also gab sie nach und ließ sich von David zwischen die tanzenden und lachenden Gäste unter der Glaskuppeldecke führen, durch die man den funkelnden Sternenhimmel sah.
»Könntest du den Typ vielleicht davon abhalten, dir sein Liebesgesülze ins Ohr zu flüstern? Es klingt höllisch laut durch die Ohrringe«, witzelte ihre ältere Schwester über den Hörer. »Du brauchst dich auch nicht mehr lange mit ihm abzugeben.«
Sie hätte wissen sollen, dass Elin nicht den Großmut besaß, sie für den Rest des Abends in Ruhe zu lassen. Nein, sie musste sich eines Kommunikationskanals bemächtigen, um ihr Spielchen mit ihr zu treiben, zumal sie wusste, dass sie nicht antworten oder sie abschalten konnte. Zwar könnte sie die Ohrringe herunterreißen und sie wegwerfen, aber dann hätte sie keine Absicherung für den Fall, dass etwas schiefging.
David drehte sie gemächlich herum und zog sie dabei enger an sich. Die merkliche Schwellung in seiner Hose und sein glasiger Blick sagten ihr, dass er sich Hoffnungen machte, sie noch heute Nacht ins Bett zu bekommen. Doch Hoffnungen waren dazu da, enttäuscht zu werden. Was würde er tun, wenn ich seinem Ständer mit meinem Dolch die Luft rausließe?
»Du bist wunderschön«, säuselte er lüstern.
Sie fand sein Verhalten amüsant und fragte sich, was er sah, wenn er die Augen auf ihren vollen Lippen und ihrem ovalen Gesicht ruhen ließ.
»Danke«, sagte sie höflich, nachdem sie sich ermahnt hatte, dass ihre Schicht als Echo vorbei war und sie wieder Nena Knight verkörperte. Doch auch Nena würde diesen Typ nicht küssen, da konnte er noch so sehr wie Tom Cruise aussehen.
Wieder fragte sie sich, welche Rolle ihrem wahren Ich entsprach – die der reichen jungen Oberschichtsdame in den Armen dieses ebenso reichen Adonis oder die der athletischen Auftragsmörderin, die gerade nicht weit von hier Menschenleben ausgelöscht hatte. Und was war aus ihrem Ich davor geworden, aus Aninyeh? Aus diesem vierzehnjährigen Mädchen? Ach ja, sie war gestorben. Oder nicht?
»Du könntest wenigstens so tun, als würdest du auf den Blödmann stehen«, riss Elin sie stichelnd aus ihren Gedanken. »Ich hab deine Werte hier auf dem Bildschirm, und sie sinken«, gackerte sie. »Der Wichser langweilt dich buchstäblich zu Tode. Hier, was sag ich, dein Blutdruck fällt ab!«
Nena verkniff sich eine Erwiderung und hoffte nur, dass Elin daran gedacht hatte, auf einen privaten Kanal zu schalten. Doch wie sie ihre Schwester kannte, ließ sie wahrscheinlich ganz Network zuhören. Sie hatte ihren Spaß daran, sie mit solchen kleinen Streichen zu piesacken. Viel zu viel Spaß.
»Tja, wir wissen beide, dass du ihn nicht bumsen wirst«, prustete Elin. »Vielleicht sollte ich für dich einspringen? Wenn Oliver nicht wäre, meine ich natürlich. Weißt du, wem David ähnlich sieht? Tom Cruise! Deshalb hab ich ihn für dich ausgesucht, weil du immer so Rehaugen machst, wenn Mission Impossible läuft.«
Das stimmte nicht, Elin log wie gedruckt.
»Also, ich würde auf der Stelle mit ihm vögeln, wenn ich könnte.«
Sie blendete die Stimme ihrer Schwester aus, bis sie nur noch ein Hintergrundrauschen war, und dachte wieder an das Mädchen im Schlafzimmer des kubanischen Bosses. Ob sie entkommen war? War sie clever genug gewesen, die herumliegenden protzigen Klunker mitgehen zu lassen, um damit ein neues Leben anzufangen? Hoffentlich wurde sie nicht wieder eingefangen.
»Womit habe ich dieses Glück nur verdient?«, murmelte David und schnüffelte an ihr, hinterließ zweifellos eine nasenförmige Delle in ihrer dichten, fest gewickelten Haarpracht. Sie legte nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten, aber ihre Haare waren ihr ganzer Stolz, sie hegte und pflegte sie, wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte, bevor sie gestorben war.
Die drei Teile ihrer Persönlichkeit befanden sich in einem ständigen Kriegszustand miteinander, jeder kämpfte ums Überleben, und sie war nicht sicher, wen sie als Sieger sehen wollte. Nena oder Echo, Echo oder Aninyeh. Sie hatte keine Ahnung, wer sie sein würde, wenn der Krieg irgendwann endlich vorbei war.
Widerstrebend lehnte sie ihren Kopf an Davids Brust und ließ sich vom Rhythmus seines Herzschlags zu einem weit entfernten Ort tragen, weg von der Folterkammer des Kubaners, über einen Ozean hinweg in ein anderes Leben.
David hielt es für ein Glück, mit ihr zusammen zu sein. Würde er das immer noch so sehen, wenn er wüsste, dass die Frau in seinen Armen eine Berufskillerin war und dass ihre Geschichte auf einem anderen Kontinent mit dem Verrat und der Zerstörung ihrer einfachen kleinen Welt begonnen hatte?
6
Davor
Das Rattern der Gewehre zieht mich immer weiter weg vom Hof meiner Familie, als wäre ich ein Fisch an der Angel. Ich höre die Dorfbewohner, ihre furchtbaren Schreie jagen Stromstöße der Angst durch meinen Körper. Das sind meine Freunde und Verwandten, die da vor Qual schreien. Es gibt kaum eine Pause zwischen den Schüssen. Ich gehe weiter, zwinge mich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, obwohl ich nur davonlaufen möchte.
Fremde Männer in Tarnanzügen rasen in Lastwagen vorbei, ziehen Dieselgestank hinter sich her. Die LKWs verlangsamen, und einige der Männer springen heraus. Sie laufen in die Häuser, neue Schreie folgen. Ich halte mir die Ohren zu und kneife die Augen zusammen, um nicht sehen zu müssen, wie sie die Menschen herauszerren. Dann drücke ich mich schnell in die Schatten der Hauswände in der Hoffnung, unentdeckt zu bleiben, während diese Fremden nach Opfern suchen, die ihren Hunger nach Chaos stillen.
Weiter vorn treiben sie Leute auf dem Dorfplatz zusammen. Sie bedrohen sie mit einem ganzen Arsenal an Waffen – Gewehre, Messer, Macheten –, mit denen sie sie auf dem kleinen offenen Platz, wo sie sich nicht verteidigen können, in Schach halten.
Die Männer beginnen, Häuser anzuzünden, ich hielt sie für leer, bis ich Menschen herauslaufen sehe, die in Flammen stehen, grell-orangene Flammen, die niemand löschen darf. Sie schreien in solcher Pein, dass meine Beine meinem Gehirn nicht mehr gehorchen, weil mein Gehirn nicht mehr richtig arbeitet. Ich kann nur dastehen und auf diese Gestalten in ihrem grotesken, grausamen Tanz starren. Als die erste zusammenbricht, bewegen sich meine Füße von allein, die Schreie der Verbrennenden treiben mich auf den Platz zu. Es dreht mir den Magen um bei dem beißenden Geruch versengten Fleisches, und ich erbreche mich in den Abwassergraben entlang unserer Hauptstraße.
Mit dem Handrücken, dann mit dem Saum meines Kleids wische ich mir den Mund ab. Wo sind Wisdom und Josiah? Ofori und Papa? Mein Herz rast, meine Angst nimmt mit jeder Minute zu. Obwohl ich es nicht will, suche ich unter den Toten nach Familienangehörigen, suche die schreiende, heulende Menge meines Volks ab. Einer Tante wird ihr weinendes Kind aus den Armen gerissen. Sie rennt ihm hinterher, wird aber von einem Eindringling mit einem Stock niedergeschlagen, während zwei andere das um sich tretende, brüllende Kind zu einer Reihe von Lastwagen mit offener Ladefläche zerren. Einem Onkel ziehen sie krachend den Gewehrschaft über den Kopf, als er darum fleht, seine Frau zu verschonen, die diese Welt aber schon verlassen hat. Ich habe ihre Leiche auf dem Weg hierher aus dem Augenwinkel gesehen.
»Aninyeh«, ruft jemand aus der dunklen Menschenmasse.
Grobe Hände packen mich und zwingen mich zu Boden inmitten eines Gewirrs aus Armen, Beinen und schwitzenden Körpern, von denen der Gestank der Angst ausgeht. Automatisch wehre ich mich, schlage um mich, aber dann tritt Wisdom in mein Gesichtsfeld, und mein Kampfeswille kommt zum Erliegen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mich an ihn zu schmiegen und von ihm zu hören, dass das alles nur ein böser Traum ist.
»Schsch«, macht er und beschwört mich mit den Augen, ausnahmsweise einmal auf ihn zu hören.
Josiah, der neben ihm steht, verfolgt jede unserer Bewegungen mit wildem Blick. Sein Ausdruck spiegelt meine Gefühle wider – Todesfurcht, Verwirrung und mittendrin die Frage: Warum?
»Wo ist Papa?«, frage ich keuchend. »Ist er …?«
»Dort.« Wisdom deutet auf eine Stelle irgendwo vor uns. Sein Gesicht glänzt vor Schweiß in der erstickenden Hitze. Diese Hitze, das ist nicht normal. So heiß dürfte es nicht sein. Nichts von dem hier ist normal. Deshalb muss das Ganze ein furchtbarer Traum sein. Entweder das oder wir sind in der Hölle gelandet.
Josiahs Blicke schnellen in alle Richtungen, registrieren alles um uns herum. Er hört uns zu, sagt aber nichts, was ungewöhnlich für ihn ist. Schließlich folge ich Wisdoms zeigender Hand und blicke über die zusammengedrängte Menge hinweg.
»Wo ist euer Oberhaupt?«, verlangt einer der Eindringlinge zu wissen. Er steht mitten unter den kauernden Dorfbewohnern. Die Ärmel seines Uniformhemds sind bis über die Ellbogen aufgekrempelt, auf dem Kopf trägt er einen schwarzweiß karierten Turban. So eine Kopfbedeckung habe ich schon einmal gesehen. Diese Männer wollen wie Armeeangehörige erscheinen, wie echte ghanaische Soldaten, doch das sind sie nicht. Aber wenn sie keine Regierungstruppen sind, wer sind sie dann? Und warum tun sie uns so etwas an?
Der Fremde hält einen unserer Dorfältesten am Arm gepackt, der stark aus einer Platzwunde über der Augenbraue blutet, und hebt mit der anderen Hand einen Knüppel an. »Zeig dich, oder der Onkel hier wird die Folgen deiner Schwäche ausbaden.«
Vor Wut und Empörung springe ich beinahe auf, aber Josiah hält mich zurück, warnt mich, zu bleiben, wo ich bin. Genau aus dem Grund wäre er der perfekte Ratgeber für Wisdom – er lässt sich nie von Impulsivität leiten, wie es mir oft passiert. Meistens zu meinem Nachteil.
»Ich bin hier«, antwortet mein Vater und steht auf. Seine volltönende Stimme trägt über die geduckten Köpfe und zitternden Leiber hinweg. Seine Kleider sind über und über mit Schweiß, Schmutz und Blut befleckt. Zum ersten Mal sehe ich ihn so unordentlich vor seinen Leuten, sonst präsentiert er sich immer tadellos gepflegt. Doch selbst in diesem Zustand und mit seinen zerzausten Haaren steht er würdevoll und furchtlos da.
»Und jetzt«, befiehlt er klar und ruhig, »lasst diesen Mann los.«
Die Hitze der Brände macht die Nacht unerträglich und saugt alle Luft ab, während die Eindringlinge dämonenhafte Schatten im flackernden Licht werfen. Papas Gesicht aber drückt nichts als ein Gebot der Ruhe aus, an das wir uns alle halten sollen. Der Söldner mit dem Knüppel starrt ihn an und löst langsam seine Finger vom Kragen des alten Mannes, beugt sich wie gebannt Papas Willen.
»Warum seid ihr hergekommen?«, fragt mein Vater streng, während der alte Mann schwer wie ein Sack Steine zu Boden sinkt und sich in Tränen auflöst.
Ein großer, kräftiger Kerl, so massig, dass die Ladefläche des Pritschenwagens befreit wippt, als er von ihr herunterspringt, kommt auf uns zu. Er bewegt sich langsam und bedächtig, als hätte er vor, vernünftig mit Papa zu reden. Vielleicht ist das alles nur ein Missverständnis.
Dann aber hebt er sein Gewehr und rammt den Schaft so brutal gegen Papas Kopf, dass das ganze Dorf entsetzt nach Luft schnappt. Wieder will ich aufspringen und ihm zu Hilfe eilen, aber Wisdom und Josiah packen mich mit vereinten Kräften, bis ich nicht mehr gegen sie ankämpfe. Das ist mein Vater, den dieser Kerl geschlagen hat. Das ist mein Papa, der unter dem Hieb taumelt, seinen Kopf schüttelt, um die Benommenheit zu vertreiben und wieder klar zu sehen. Eine Hand schließt sich um meinen Mund, drei andere Hände halten mich fest, und Josiah murmelt beschwörend:
»Sei still. Sei still.«
Ich höre auf ihn und sitze still, denn was bleibt mir anderes übrig.
7
Danach
Nena verließ das Haus und schloss die Tür ab. Die Kubaner und die Party lagen fast zwei Wochen hinter ihr, und sie hatte seitdem wie eine Einsiedlerin gelebt, Filme geguckt und die kleine Gartenoase genossen, die sie in jahrelanger Arbeit angelegt hatte. Zum Glück gab es nur noch einen Auftrag zu erledigen, bevor sie endlich richtig Urlaub machen konnte. Es waren ein paar letzte Vorbereitungen für den Baxter-Job zu treffen, aber im Moment dachte sie nur daran, in ihren bevorzugten Burgerladen einzufallen.
Als sie bei Jake’s Burger Spot ankam, der in einer weniger gut beleumundeten Gegend der Stadt lag, waren die meisten Geschäfte schon geschlossen und die Straßen relativ leer. Nur Jake’s hatte länger auf für die Leute, die Spätschicht arbeiteten. Sie bemerkte einen smaragdgrünen Cadillac am Straßenrand, nicht weit von der Bushaltestelle. Auf die Motorhaube waren fünf Spielkarten aufgesprüht: König, Dame, Bube, Ass und die Zehn.
Die Royal Flushes, eine örtliche Gang.
Sie las »Alle Trümpfe in der Hand« in schwungvoller Schnörkelschrift unter dem Siegerblatt und runzelte die Stirn. Keigels Angelegenheiten gingen sie zwar nichts an, aber sie wusste, dass die Flushes sich hier auf seinem Gebiet befanden. Was auch der Grund sein mochte, es verhieß nichts Gutes, und Keigel würde nicht begeistert sein, wenn er davon erfuhr.
Sie hegte insgeheim die Hoffnung, dass er den African Tribal Council eines Tages genauso als seine Familie betrachten würde wie jetzt seine Gang. Vielleicht würde er irgendwann doch für den Tribe arbeiten und geloben, sich für die Einigung aller afrikanischen Länder einzusetzen – und zugleich aller Schwarzen in der Diaspora –, damit sie zu einer starken, anerkannten Macht wurden, auf Augenhöhe mit den anderen Weltmächten.
Dieses Gespräch würde jedoch irgendwann anders stattfinden müssen, denn sie hatte Hunger, und Jake’s winkte.
Es waren nur zwei andere Gäste in dem Diner, ein Hispano und ein Weißer, die gerade ihre Mahlzeit beendeten, als sie sich in ihre gewohnte Nische ganz hinten setzte. Sie mochte diesen Platz, weil sie von dort aus im Blick hatte, wer kam und wer ging. Die beiden Männer bezahlten bei Cheryl, der Kellnerin, und machten dabei ein paar Scherze, die ihr ein Lachen abnötigten. Die Art von Lachen, wenn der Witz nicht besonders lustig war. Die zwei trugen Overalls der Stadtreinigung von Miami-Dade County und besprachen beim Rausgehen geschäftig ihre Arbeitszeitblätter. Die Türglocke verabschiedete sie, während die dralle Cheryl sich daranmachte, den Tisch abzuwischen, an dem sie gesessen hatten.
Als sie fertig war, kam sie lächelnd herbei. Nena schob die Speisekarte weg und sah zu ihr auf.
»Was geht?«, fragte Cheryl und wartete darauf, dass sie das Übliche bestellte.
»Hallo«, sagte Nena. »Kann ich bitte einen Bacon-Cheeseburger mit Zwiebelringen und eine Cola haben?«
»Und einen Schoko-Milchshake zum Mitnehmen?«, sagte Cheryl grinsend.
Nena nickte. »Ja, gern«, fügte sie höflich hinzu. »Danke.«
»Alles klar.« Cheryl zwinkerte ihr zu, wobei der Diamantstecker in ihrer Nase funkelte, und kehrte mit einem Schwenk ihres ausladenden Hinterteils zum Tresen zurück.
Ihre Bestellung kam schnell, weil sie der einzige Gast war, und sie verschlang sie genauso schnell. Als sie an dem letzten Zwiebelring arbeitete, brachte Cheryl ihr den Milchshake und schenkte ihr Cola nach. Im selben Moment ertönte die Türglocke. Ein junges Mädchen mit einer üppigen natürlichen Haarpracht kam herein, das eine Ausstrahlung von »Schwarze Girls rocken« um sich verbreitete und so tat, als würde sie hierher gehören.
Nena wartete darauf, dass der Rest ihrer Posse hereinspazierte, aber es tauchte niemand weiter auf. Das Mädchen konnte nicht aus der Gegend sein, sonst wüsste sie, dass Jake’s gleich schließen würde. Sie musterte sie genauer, die zierliche Figur, nicht größer als eins fünfundsechzig, wie sie sich neugierig mit ihren weit auseinanderstehenden Augen in dem milchkaffeebraunen Gesicht im Diner umsah, sie über die in Rot und Weiß gehaltene Einrichtung und den Schachbrettmusterboden wandern ließ. Ihr Alter schätzte sie auf dreizehn, vierzehn.
Während die Kleine überlegte, wo sie sich hinsetzen sollte, kreuzten sich ihre Blicke, und Nena legte den Kopf schräg zu einer stummen Frage: Warum bist du hier, und wo ist dein Anhang? Das Mädchen sah weg und nahm sich einen Hocker am Tresen.
Nena wandte sich wieder ihrem iPhone zu. Eine leise Ahnung sagte ihr, dass es vielleicht besser war, noch zu bleiben, aber eigentlich wollte sie nach Hause. Sie dachte an den Cadillac draußen. Bestimmt würde es keine Probleme geben. Das Mädchen war ohne Zwischenfall an ihm vorbeigekommen, sonst hätten Cheryl und sie etwas gehört.
Das Essen der Kleinen kam genauso schnell wie ihres, zweifellos wollten Cheryl und Jake, der in der Küche stand, für heute Feierabend machen und nach Hause. Nena sah ihre Textnachrichten durch. Eine war von Elin, die sich darüber beklagte, dass ihre Mutter die Nase zu sehr in ihr Liebesleben steckte. Ganz was Neues. Eine andere von Mum, die wissen wollte, warum Elin so eigensinnig war, und sie bat, ihre Schwester zur Vernunft zu bringen. Vermutlich keine gute Idee, den beiden zu antworten, dass sie sich ähnlicher waren, als sie zugeben wollten. Nena seufzte über die Ironie des Ganzen. Die Killerin in der Familie war diejenige, die für Ausgleich und Frieden sorgte – während ihr mächtiger Dad sich so weit wie möglich aus der Schusslinie hielt.
Sie las gerade die Schimpftirade eines bekannten Autors auf Twitter, als wieder die Türglocke klingelte. Ein Windstoß fuhr herein wie in einem B-Movie, und Nena sah auf, rechnete damit, dass das Mädchen ging, doch stattdessen kam ein junger Mann hereingeschlendert, offensichtlich ein Mitglied der Royal Flushes.
Betont lässig ging er zum Tresen, ohne in ihre Richtung zu sehen. Ein kleiner Wichtigtuer, sicher ein Fußsoldat der Gang, kein Anführer. Gespannt nahm sie einen langen Zug von ihrem Milchshake.
»Zwei Cheeseburger zum Mitnehmen«, verlangte der Typ und schlug mit der Faust auf die Theke, als stünde Cheryl nicht direkt vor ihm.
Cheryl zeigte auf die rotweiße Coca-Cola-Uhr an der Wand, auf der es fünf nach zehn war. »Wir haben geschlossen«, sagte sie knapp.
»Leck mich, sitzen doch noch zwei Schnallen hier drin, also habt ihr auf«, sagte er. »Jetzt hol mir meine verdammte Bestellung, wenn du weißt, was gut für dich ist.«
Nena schätzte, dass sie mit einer der Schnallen gemeint war. Die Beleidigung kratzte sie nicht, aber es ging ihr gegen den Strich, dass er das junge Mädchen so abfällig bezeichnete, das merklich vor ihm zurückwich. Der Junge war schnell auf der Palme, und das war nicht gut. Sie steckte ihr Handy in den Rucksack.
Cheryl verschwand in der Küche, vermutlich um Jake zu holen. Derweil beglotzte der Flush das Mädchen und schob sich auf den Hocker neben ihr. Sie ignorierte ihn und konzentrierte sich auf ihre Cherry Coke, aber es nützte nichts.
Seine Stimme hallte laut durch das Lokal. »Scheiße, weißt du eigentlich, wer ich bin? Mit wem du’s hier zu tun hast, he?«, fragte er. »Weißt du, von was für ’ner Crew ich bin?«





























