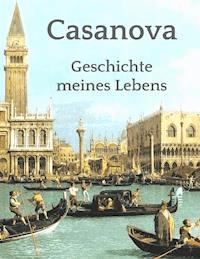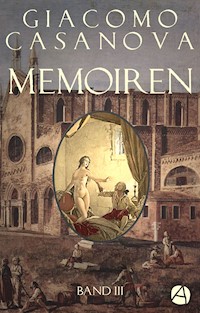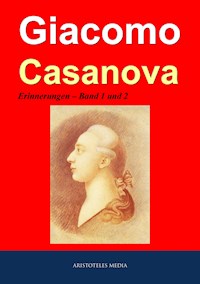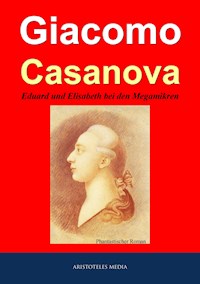Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wenn Casanovas Werk nichts anderes wäre, als eine von den vielen Utopien, die nach der Utopia des Thomas Morus entstanden oder eine der vielen Liliputiaden nach Swift, so brauchte man sich nicht darum zu mühen, es der Vergessenheit zu entreißen. Aber es ist mehr: es ist das Werk eines tiefen und vor allem auch freien Denkers und es ist vor allem eine sehr unterhaltsame Abenteuergeschichte, die zwar einen Leser verlangt, der gerne denkt, die aber auch ganz abgesehen von ihrem Gedankengehalt durch die bewusste Fülle der Ereignisse interessiert. Eduard und Elisabeth sind ein junges englisches Geschwisterpaar, das im Maelstrom Schiffbruch leidet, aber auf eine sehr merkwürdige Art gerettet wird, indem es in einer Bleikiste durch die Rinde unseres Erdballs hinabsaust und so in den hohlen Innenraum der Erde gelangt, dessen Grundfläche von dem nach Milliarden zählenden Volk der Megamikren (das heißt: Großkleinen) bewohnt wird. Ein phantastischer Roman um eine Reise in die Mitte der Erdkugel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 932
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giacomo Casanova
Eduard und Elisabeth bei den
Megamikren
Eduard und Elisabeth bei den
Megamikren
Giacomo Casanova
Ein phantastischer Roman
Impressum
Texte: © Copyright by Giovanni G. CasanovaUmschlag:© Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Heinrich Conrad
Illustrationen: © Copyright by Franz von Bayros
Verlag:Das historische Buch, 2024
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. Band.
2. Band
Geschichte des Erblehnsfürsten der Republik.
Vorwort
Casanovas Icosameron ist bekanntlich eines der seltensten Bücher, die es gibt. Ich persönlich hatte mich seit fünfzehn Jahren vergeblich bemüht, es zu erhalten. Da führte ein (wenn auch von mir etwas beeinflußter, doch immerhin) glücklicher Zufall zur Entdeckung eines Exemplars in einem kleinen österreichischen Städtchen.
Schon nach den wenigen Andeutungen Victor Ottmanns hatte ich stets angenommen, daß es sich um eine bedeutende geistige Schöpfung handeln müsse. Diese Erwartung fand ich nicht nur bestätigt, sondern sogar weit übertroffen, als ich diesen Icosameron nun endlich lesen konnte.
Wenn Casanovas Werk nichts anderes wäre, als eine von den vielen Utopien, die nach der Utopia des Thomas Morus entstanden oder eine der vielen Liliputiaden nach Swift, so brauchte man sich nicht darum zu mühen, es der Vergessenheit zu entreißen. Aber es ist mehr: es ist das Werk eines tiefen und vor allem auch freien Denkers und es ist vor allem eine sehr unterhaltsame Abenteuergeschichte, die zwar einen Leser verlangt, der gerne denkt, die aber auch ganz abgesehen von ihrem Gedankengehalt durch die bewußte Fülle der Ereignisse interessiert.
Eduard und Elisabeth sind ein junges englisches Geschwisterpaar, das im Maelstrom Schiffbruch leidet, aber auf eine sehr merkwürdige Art gerettet wird, indem es in einer Bleikiste durch die Rinde unseres Erdballs hinabsaust und so in den hohlen Innenraum der Erde gelangt, dessen Grundfläche von dem nach Milliarden zählenden Volk der Megamikren (das heißt: Großkleinen) bewohnt wird.
Eduard ist vierzehn, Elisabeth zwölf Jahre alt. Der Trieb der Natur führt sie zusammen: die Geschwister werden Mann und Frau, sie werden die Eltern von vierzig Zwillingspaaren, die stets aus einem Knaben und einem Mädchen bestehen. Im Laufe ihres Aufenthalts, der 324 Megamikrenjahre oder 81 Jahre unserer Zeitrechnung währt, vermehrt diese Nachkommenschaft sich auf mehr als 600000 Menschen, die sich zu Herren der Megamikrenwelt machen. Eduard und Elisabeth, die sich während dieser ganzen Zeit im Paradies (denn das Paradies unserer Bibel ist nach Casanovas Annahme eben die Megamikrenwelt) in ihrer Jugendblüte erhalten haben, gelangen auf eine höchst merkwürdige Weise wieder an die Oberfläche der Erde empor und begeben sich zu ihren noch lebenden Eltern in England. Dort erzählt nun Eduard, ab und zu von Elisabeth ergänzt, einer Gesellschaft von Lords und Ladies die ganze Geschichte ihrer erstaunlichen Abenteuer und gibt eine genaue Beschreibung aller Einrichtungen und Gebräuche des nicht minder erstaunlichen Megamikrenlandes. Sein Bericht wird in Kurzschrift aufgenommen und so entsteht ein englischer »Roman«, den Casanova ins Französische übersetzt. Diese Übersetzung ist natürlich eine Fiktion; jede Seite des Werkes ist aus Casanovas klugem und kühnem Kopf hervorgegangen.
Das Werk ist mit Feuereifer in einem Zuge geschrieben; in sechzehn Monaten hat Casanova die fünf Bände (ungefähr 1800 Druckseiten) vollendet. Eine ganz erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, daß zwar die Phantasie, und zwar eine sehr schwungvolle Phantasie, den Plan des Werkes eingegeben hat, daß aber die Ausführung auf den genauesten mathematischen Berechnungen beruht. Nachdem die Voraussetzung gegeben war, ist nichts mehr der Willkür überlassen; jede einzelne Zahl stimmt ganz genau. Die außerordentlichen Kenntnisse auf allen Gebieten, die schon für den jungen Casanova bei seinen ersten Ausflügen in die Welt so charakteristisch sind, treten in einer Fülle hervor, über die man staunen muß. Zugleich wird auch Casanovas Charakterbild in einer Weise ergänzt und vervollständigt, die seine zahlreichen Freunde erfreuen wird. In diesem Werk ist keine Spur von dem frivolen Abenteurer, Weibverführer, Spieler und Schwindler der Memoiren. Es ist die reife Frucht eines in allem Schlamm doch rein und im Kern gesund gebliebenen Geistes, der allerdings in einem sehr sinnlichen Körper haust. Eines Geistes aber, den Männer wie der Fürst von Ligne bewunderten, dem sie zugleich auch tiefe menschliche Teilnahme zollten. Eines Geistes, der allerdings sich über menschliche Vorurteile und Satzungen weit emporhebt; der in dem Eheverhältnis des Geschwisterpaares nicht den Incest sieht, sondern die Naturnotwendigkeit (wie übrigens auch unsere Bibel in der Fortpflanzung der ersten Menschensippe); der dieses Verhältnis zu einer moralischen Reinheit emporhebt, die man großartig nennen darf.
Es braucht für diejenigen, die den Casanova der Memoiren wegen seiner von Manchem wohl überschlagenen philosophierenden und kritisierenden Abschweifungen erst recht lieben – und nur solche sollten eigentlich die Memoiren lesen dürfen! – es braucht für diese wahren Freunde Casanovas nicht gesagt zu werden, daß die Wissenschaftlichkeit dieses Werkes in frevelnder Weise verarbeitet ist. Der Leser braucht nicht zu befürchten, mit dunkler Gelehrsamkeit gelangweilt zu werden.
Casanova hatte gewiß große Hoffnungen auf seinen Icosameron gesetzt, als er das Werk zu schreiben begann, sobald er in Dux beim Grafen Waldstein den sicheren Hafen gefunden hatte. Er hatte mit früheren Werken gute pekuniäre Erfolge gehabt. Er hatte in den sieben Jahren nach seiner Begnadigung in Venedig (es kann leider nicht verschwiegen werden) als Spion und Schmarotzer gelebt und seine fleißige Schriftstellerei hatte ihn aus dieser traurigen Sphäre nicht befreien können. Jetzt trat er wieder in glänzende Kreise ein: Waldstein und Ligne, Clarys und andere vom Hochadel ehrten seinen Geistesadel und verstatteten ihm Zutritt in ihren vertrauten Kreis. In diesem Kreise und unter seinen früheren Freunden und Gönnern mußte er unschwer auch die Subskribenten für sein Werk finden.
Er fand sie auch in einer Anzahl, die jedenfalls einen Verlust für ihn vollkommen ausschließen mußte. Trotzdem wurde die Herausgabe für Casanova zum Unglück, das ihm seinen Lebensabend verbitterte. Die Gründe sind nicht ganz klar. Er scheint von seinem Leipziger Verleger betrogen worden zu sein. Da er nun das Werk auf seine Kosten in Prag hatte drucken lassen, so geriet er in Schulden, in Wuchererhände und in die bekannten bedrängten Umstände, die ihm die Demütigungen von dem Feldkircher, dem Wiederholt und der übrigen Duxer Crapule einbrachten.
Es ist aber angebracht, zu untersuchen, ob nicht auch Eigenschaften des Werkes selber zu dem Mißerfolg beigetragen haben mögen. Die Frage muß ich bejahen. Das Werk hätte zweifellos einen Erfolg verdient, wenn auch nicht bei der großen Menge (an der natürlich Casanova gar nichts lag); daß es diesen Erfolg nicht fand, liegt meines Erachtens an der unglücklichen Form, die er seinem so inhalts- und abwechselungsreichen Buch gab. Die Nachahmung des Decameron lag einem Italiener nahe; auch ist die Einleitung durchaus nicht ungeschickt, denn sie erweckt Teilnahme und Spannung. Leider aber ist das Zwischenwerk, das bei Boccaccio so anmutig ist, dem Venetianer ganz mißglückt. Die Glossen der zuhörenden Engländer sind ganz überflüssig und können nur langweilen; sie werden sicherlich auch die freundlich gesinnten Gönner beim Lesen abgeschreckt haben, noch mehr vielleicht die Exegese der ersten Genesiskapitel, mit der Casanova sein Buch beginnt. Für diese theologischen Exkurse hatten die Fürsten und Fürstinnen, Grafen und Gräfinnen, die ihn mit ihrer Subskription beehrten, gewiß kein Interesse. Casanova hat allerdings den Plan seines Buches der biblischen Schöpfungsgeschichte entnommen: der Garten Eden ist das Reich der Megamikren. Hierfür brauchte aber nicht mühsam versucht zu werden, auf hundert Druckseiten einen Beweis zu führen, der doch nur Hypothese bleiben konnte. Diese Untersuchung war für Casanova eine Spielerei, die ihn interessierte, seine Leser aber und Leserinnen bekamen dabei wohl vor Gähnen Kinnbackenkrämpfe. Nicht jeder ist so klug, ein fünfbändiges Werk beim letzten Bande anzufangen, wenn er sieht, daß er nicht über den Anfang hinwegkommt.
So bedauerlich es nun ist, daß Casanovas Hoffnungen so schnöde enttäuscht wurden und daß er um den wohlverdienten Lohn kam, so ist seine Mühe darum nicht verloren gewesen. Ich habe den guten, blanken Kern herausgeschält und biete nun die Abenteurergeschichte von Eduard und Elisabeth bei den Megamikren als das was sie ist: einen phantastischen Roman in zwei starken Bänden.
Heinrich Conrad.
Dem Grafen von Waldstein
Herrn auf Dux und anderen Gutsherrschaften,
Kämmerer S. k. u. k. M.
Herr Graf!
Kein Mensch auf der Welt, nicht einmal jener, der dieses Wert erfunden haben könnte, vermag zu entscheiden, ob es eine wahre Geschichte oder ein Roman ist, denn es ist nicht ausgeschlossen, daß eine rechtschaffene Feder eine wahre Begebenheit niederschreibt, in der Meinung, sie zu erfinden, sowie sie Unwahres berichten kann, obgleich sie nur die Wahrheit zu sagen glaubt. Aus dieser Voraussetzung kann folgende Schlußfolgerung gezogen werden: Ohne genügende Beweise wird man weder etwas leugnen noch glauben können. Der Leser muß unbekümmert alles, was ihm wahrscheinlich erscheint, für Wahrheit halten, und als falsch alles bezeichnen, was seiner Vernunft anstößig ist. Wenn Sie also, Herr Graf, finden, daß der Inhalt dieses Buches nicht möglich ist, so glauben Sie es ganz ruhig, schaden wird es Ihnen nicht, umsoweniger, weil alles Gute darin mit der Weltgeschichte nichts zu tun hat. Da ist zum Beispiel ein englisches Buch »Robinson Crusoe«: man hält es nur darum für einen Roman, weil man keine Beweise für die geschichtliche Wahrheit hat, aber als Roman wird es um so höher geschätzt. Vor fünfunddreißig Jahren sagte mir der französische Geschichtsschreiber Herr Duclos, die von Abbé de S. Real geschriebene Geschichte der venezianischen Verschwörung könne nur als eine Fabel angesehen werden, woher er sie haben könne. Ich antwortete ihm: dieser Leitsatz könne richtig sein, nichtsdestoweniger aber sei diese Verschwörung eine geschichtliche Tatsache und, was mehr bedeute, der Bericht sei sehr genau.
Wenn der Icosameron, den ich Ihnen, Herr Graf, vorlege, eine wahre Geschichte ist, so werden Sie daraus entnehmen, daß die Welt im Innern der Erde das irdische Paradies jenes Garten Eden ist, dessen tatsächliches Vorhandensein wir nicht bezweifeln können, obwohl es uns unbekannt ist, wo er sich befindet. Einige Gelehrte haben schon behauptet, er könne wohl im Innern der Erde sein, doch ist niemand danach suchen gegangen; Juden sowohl wie Christen scheuten sich natürlich vor dem Versuch, ihn zu entdecken, weil sie wußten und wissen, daß Gott Cherubim mit Feuerschwertern aufstellte, um einem jeden den Eintritt zu verwehren (Genesis Kap. III. V. 24). Die Neugierde hätte wohl darauf kommen können, das Paradies in der Mitte des Erdballes zu suchen; vielleicht aber fürchtete man, anstatt des Paradieses die Hölle zu finden. Viele behaupten nämlich, daß dort ihr Platz sei: Tertullian zweifelt nicht daran, der heil. Augustin ist derselben Meinung und sagt: das Feuer in der Erdmitte entsteht durch ein Wunder Gottes. Dadurch fällt die Behauptung von Swinden, es sei unmöglich, daß im Innern der Erde die nötige Menge Salpeter sich befinde, um dieses Feuer ewig zu erhalten: mit tiefer Sachkenntnis meint er, daß die Hölle sich nur im großen Hohlgewölbe der Sonne befinden könne, obgleich König David das Gegenteil gesagt hat.
Wie dem auch sein mag, wir können an der Hand dieser Geschichte darüber disputieren und dürfen offen, ohne unsere Religion zu verletzen, sagen, was reine Vernunft und klarer Sinn uns eingeben. Die Scharfsichtigen werden uns nicht auslachen, dafür steh' ich Ihnen, und das Brummen jener, die Petrarca gente cui si fa notte avanti sera nennt, wird nicht imstande sein, unsern Disput zu unterbrechen. Wir werden nicht albern stolz behaupten, daß wir zur Gewißheit gelangen werden; wir werden aber zum Zweifeln gelangen; und Sie wissen wohl, daß die allergelehrtesten Menschen jene sind, die viel zweifeln. Wer zweifelt, weiß nicht, dafür irrt er aber sich nie: ein denkendes Wesen, das von der Materie umgeben ist, kann nie behaupten, etwas sicher zu wissen. Wir dürfen aber von unserer Vernunft Gebrauch machen. Glücklich, wem die Vernunft zur Unterhaltung dienen kann.
Wenn Gott unsere Erde zu dem Zwecke erschaffen hat, damit sie bewohnt werde, ist es dann wahrscheinlich, daß er gewollt habe, nur ihre äußere Fläche solle bewohnt werden und nicht auch die innere Höhlung? Nein. Der Bienenkorb ist nicht dazu gemacht, damit die Bienen dessen Außenwand bewohnen; die Muschel birgt das Weichtier in ihrem Innern; und die Seele, der Geist, der Sitz der Leidenschaften und der Tugenden wurden durch den Schöpfer nicht am, sondern im Menschen untergebracht; ausgenommen sind nur die Sarmaten, deren Tugend nach Tacitus veluti extra ipsos war. Der berühmte Kern der Erde, über den so viele Philosophen tastende Vermutungen aufgestellt haben, ist eine Notwendigkeit und kann nur ihr bewohnbarer Teil sein, von Gott dazu erschaffen, damit wir ihn ewig bewohnen; er ist der Garten Eden, aus dem uns der Ungehorsam gegen den Allmächtigen vertrieben hat. Wenn es heißt, daß Er uns herausjagte, so waren wir eben drinnen, und das Äußere des Inneren können nur dessen Wände sein, die Rinde, der äußere Umkreis. Als wir nun uns unwürdig machten dort im Innern zu hausen, als wir verdächtig waren, vom Baume des Lebens gekostet zu haben, um unsterblich zu werden (Genesis Kap. III. V. 22), da wurde unser rebellisches Geschlecht von Gott dazu verdammt, außerhalb der Mauern des schönen Gartens sich niederzulassen. Und da sind wir nun. Dabei wundert mich besonders, daß wir uns stets Bewohner dieser Welt nannten, während in Wirklichkeit dieser Ausdruck uns gar nicht zukommt: er kann nicht auf Vertriebene passen, wir sind rechtmäßige und eigentliche Ansiedler nur auf der Oberfläche des Erdballs, auf der wir, da er selbstverständlich hohl ist, herumkriechen – gestatten Sie den Ausdruck. Es ist wahr, mir haben uns vielfach ausgezeichnet, wir haben aus allem Nutzen zu ziehen gewußt, haben ziemlich schöne Dinge vollbracht auf dieser undankbaren Erde, die eher dazu geeignet erscheint, überschwemmt und von Fischen bewohnt zu werden, als Menschen zu beherbergen. Wir haben uns durch herrliche Werke hervorgetan: wir haben unfruchtbare Erdflächen beackert, einigen Flüssen ihre Grenzen angewiesen, Meeren Dämme entgegengebaut, Sümpfe getrocknet, Berge durchbohrt und abgetragen, Straßen und Städte gebaut, überhaupt die Baukunst zu Ehren und zu großer Würde gebracht, tief in der Erde gewühlt, um ihr Metalle zu entnehmen, wir haben ihr sozusagen den Bauch aufgeschlitzt. Wir haben die Chemie, die Künste und sogar die Wissenschaften erfunden, wir haben Gesetze gemacht, Verbrechen verabscheuen und die Tugend triumphiren lassen, ja, wir haben es soweit gebracht, uns von der Göttlichkeit des menschlichen Geistes zu überzeugen und dadurch auf den kürzesten und gradesten Weg zur Betrachtung der Allmacht und unbegreiflichen Größe des Schöpfers zu gelangen. Gott muß sich also sozusagen gefreut haben, als er sah, welch nützlichen Gebrauch wir von dem ungefügen Geschenk gemacht haben, das er uns zur Strafe gegeben hatte. Wenn wir unsere Erde ansehen und sie schön finden, – müssen wir da nicht sofort bedenken, daß es nur durch das ist, was wir aus ihr gemacht haben. Ja, wir. Dieser Gedanke aber soll uns nicht stolz machen, sondern uns dazu anregen, Jenem zu danken, der uns die Gelegenheit gab, uns in all diesem Elend auszuzeichnen.
Und indem wir uns mit diesem Allem abfanden, gewöhnten wir uns an all den Jammer unseres Lebens in dieser Wohnstätte, die doch nur ein Verbannungsort ist; gewöhnten uns so sehr, daß die meisten von uns nichts mehr als störend betrachten, was unser Glück beeinträchtigt; wir ertragen die Krankheiten, denen wir unterworfen sind, ertragen Pest, Kriege, Hungersnot, Überschwemmungen, Erdbeben, wir ertragen den Gestank der Nebel, die Blitze des Himmels, das Toben der Winde, den verpestenden Einfluß des Hundssternes. Wir ertragen übermäßige Hitze, die starken Fröste, die wilden Tiere, die stets bereit sind, uns zu verschlingen, die Insekten, deren die Luft voll ist, und die (wenn es wahr ist, daß sie aus uns entstehen, wie die Flöhe, die Läuse, die Wanzen), nicht unrecht haben, uns zu stechen, um uns die Nahrung zu entnehmen, die wir ihnen schulden. Man muß zugeben, daß wir sehr gutmütige und leichtblütige Menschen sind, da fast alle ungern sterben und viele sich willig verpflichten würden, unter denselben Verhältnissen wieder auf die Welt zu kommen.
Alle diese Armseligkeiten, Herr Graf, sind bei den Megamikren nicht vorhanden. Nun werden Sie mich fragen: wie konnten, wenn dieses Land das irdische Paradies sei, Eduard und seine Schwester trotz der Wache haltenden Cherubim (Engel, die nach der Namensbezeichnung den Ochsen gleichen sollen) und dem göttlichen Bannspruch dorthin gelangen?
Ich kann Ihnen hierauf als philosophischer Theologe antworten. Erstens kann Gott kein unwiderrufliches Urteil aussprechen; und zweitens kann der Schöpfer zu seiner größten Ehre einem unserer sterblichen Menschenpaare erlaubt haben, dorthin zu gelangen und wiederzukehren, um uns davon zu berichten und dadurch unseren Glauben zu stärken, der nur gar zu schwach und wankelmütig ist. Bedenken Sie auch, daß das göttliche Erlösungswerk jeden bösen Einfluß der ersten Sünde vernichtet haben muß und daß die Ledigsprechung von einer Schuld mit der Aufhebung der für sie bestimmten Strafe verbunden sein muß. Eduard ließ dort fünf Millionen Kinder zurück, die er während der achtzig Jahre niemals krank werden noch altern sah. Vielleicht wollte Gott ihnen die Unsterblichkeit wiedergeben. Was wissen denn wir?
Kommen wir nun auf die Megamikren zurück, die Eduard als Herren jener Welt fand. Was ist das für ein neues Menschengeschlecht, von dem wir nie etwas gehört haben, deren Vorhandensein niemand geahnt hat, das nicht von Adam abstammen, mit der Erbsünde nichts Gemeines haben kann und somit mit der Menschwerdung Gottes nichts zu tun hat? Dürfen wir vermuten, daß es das vom ersten Menschenpaare abstammende Geschlecht sein könnte, von dem der 26. Vers des ersten Kapitels der unfehlbaren Genesis spricht? Der heilige Geist nennt uns deren Namen nicht, er läßt uns nur im folgenden Verse 27 wissen, daß dieser Mensch zwei Wesen bildete, dessen jedes Männchen und Weibchen war, marem et feminam fecit deus. In Vers 28 sagt er ihnen: füllet die Erde, implete; meinen Sie, daß das Wort füllen gleichbedeutend mit decken sein könnte? Würden Sie von einem grün angestrichenen Ei sagen, es sei mit grüner Farbe gefüllt? Sie würden sagen: mit grün bedeckt. Gott hat die Megamikren und uns nicht erschaffen, damit wir die Erde bedecken, sondern damit wir sie füllen. Die Erstgeborenen sind dortgeblieben und wir wurden hinausgejagt. Gott schuf unsern Ältervater Adam, nachdem die erste Woche schon verstrichen war. Doch bevor ich meine Gedanken weiter ausführe, beschwöre ich Sie, Herr Graf, gütigst beachten zu wollen, daß ich trotz meiner zuversichtlichen Sprache Ihnen nur Vermutungen vortragen will. Ich versichere Ihnen gleichzeitig, daß, wenn auch meine Reden die Wahrheit streifen würden, die strengste Kritik darin nie das Geringste finden wird, was den von den Mysterien abhängenden Glauben unserer Religion irgendwie verletzen könnte. Gott gab Adam den Befehl, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu kosten; hierauf schläferte er ihn ein und schuf durch eine für uns unbegreifliche Zauberei Eva, der, wie wir annehmen müssen, Adam das Verbot Gottes mitteilte. Diese Schöpfung, die wir im 7. Vers des zweiten Kapitels finden, hat nichts mit jener ersten zu tun, die uns im 26. Vers des ersten Kapitels so ganz nebenbei berichtet wird und wovon in der ganzen heiligen Schrift nie wieder die Rede ist; die Geschichte der Erbsünde bilde den Inhalt des ganzen dritten Kapitels. Man sollte sich aber nicht wundern, daß die Bibel nirgends mehr des zuerst geschaffenen Menschenpaares erwähnt; denn sie ist das Buch unserer Religion, dessen Vollkommenheit nicht im geringsten davon abhängt, daß wir irgend etwas über das erste Menschengeschlecht erfahren: denn wir haben mit diesem nichts gemein. Außerdem kommt es mir weder schicklich noch wahrscheinlich vor, daß es Gottes Absicht gewesen sein könnte, das Innere dieser Welt leer zu lassen, wir können es daher ohne jegliches Bedenken für bewohnt halten.
Seien Sie aber darauf vorbereitet, in der Welt der Megamikren verschiedene gewöhnliche Irrtümer anzutreffen, denn sie sind eben auch Menschen; dafür werden Sie bei ihnen überall Erhabenes finden, wo es sich um ihre Lehren handelt: um Gott, das Geistige, die Schöpfung, die Unsterblichkeit der Seele, denen ihre Natur widerspricht, die Seelenwanderung, um die so viele Philosophen sich mühten. Sie werden bei ihnen unsere Glaubenssätze von der Ewigkeit finden, Belohnungen und sehr vernünftig abgestufte Strafen; der Gerechte ist stets sein Lebenlang und auch nachher glücklich, der Ungerechte immer unglücklich. Sie werden vom herrlichen süßen Tode der Megamikriten hören, dem achtzehn Monate ununterbrochener Freuden vorausgehen. Die Dauer ihres Lebens ist für alle gleich bemessen, daher jedem bekannt. Sie werden dort Herrschaft und Abhängigkeit finden, und Gesetze sind nur in beschränkter Zahl vorhanden, da es nur solche gibt, die zum Glück des Menschen notwendig sind; alle sind ohne Erläuterungen im Gegensatz zu den unseren, die dadurch nur noch unverständlicher werden. Sie werden dort fast dreihundert Herrscher bewundern können, die alle glücklich sind dank ihrer Erziehung, die sie belehrt, daß sie nur dann glücklich sein können, wenn sie von ihren Untertanen geliebt werden; und Sie werden mit Terenz sagen! »et errat longe – qui imperium credat esse gravius, aut stabilius vi quodsit quam illud quod amicitia adjungitur«. Sie werden dort ein Menschengeschlecht finden, das, um vollkommen und beneidenswert zu sein, nicht erst in zwei Geschlechter geteilt werden muß; das, um seine Kräfte wieder zu stärken, nicht erst zu schlafen braucht; das sich von der eigenen Milch ernährt; und das, um essen zu können, nicht erst warten muß, bis die Natur es mit Zähnen versorgt, diesen unhaltbaren, oft ungleichen Knochen, die auf unserer Erdoberfläche zwei Drittel der Lebenden verlassen, ehe sie das elende Greisenalter erreicht haben. Sie werden dort einen ewigen Tag, einen ununterbrochenen Frühling vorfinden.
Die Liebe kann bei den Megamikren nicht eigentlich Leidenschaft genannt werden, denn es ist ein Gefühl, das keinem Wechsel unterliegt, weder verringert noch verändert wird, und man kann sie als die wirkliche Substanz ihres Lebens bezeichnen, denn ihr ganzes Leben ist nur eine Liebe, die gleich feurig fünfundvierzig Jahre fortbesteht, nachdem drei Jahre vergangen sind, um sie zu entfachen. Die zwei Wesen, die ein unzertrennbares Paar bilden, kommen auf die Welt, um zu lieben und sterben in der Liebe, denn sie geben einander die lebhaftesten Liebesbeweise bis zum letzten Augenblick ihres Lebens. Ihr sanftes Erlöschen kann man nicht Sterben nennen, sondern nur einen leichten Übergang, denn dieselbe Liebe wird in der Ewigkeit unsterblich fortleben. Wir sollen nach dem Wortlaut der heiligen Schrift selbzweit einen Körper bilden, die Megamikren aber sind eins in zwei Körpern.
Sie werden dort mit Staunen Bäume sehen, auf denen unzählige Schlangen sich befinden, die unser Held mit Hilfe seiner vielen Kinder vernichtete, dem Aberglauben zum Trotz, obzwar nichts ihm bewiesen hatte, daß dieses Schlangen vom Geschlecht jener seien, die die Eva verführte; denn sie sprachen nicht.
Wenn Sie, Herr Graf, auf die Sprache der Megamikren achtgeben, so werden Sie bemerken, wie weit sie alle Ihnen bekannten übertrifft, denn sie ist eine wahre Musik in Prosa, deren weiche Harmonie durch keine Konsonanten gestört wird: es ist ein ununterbrochenes Tönen mit Zwischenräumen zwischen jedem Klang, jedoch mit einer so zarten Abstimmung, daß nur ein sehr empfindliches Ohr es merken kann. Die höhere Musik des Kontrapunktes ist ihre Poesie, die keiner Worte bedarf wie die unsrige: der Megamikre braucht sie nicht erst durch die Ohren zu empfangen, sie findet ihren graden Weg zur Seele durch einen sechsten Sinn, den wir nicht haben und den Gott in ihre äußere Haut legte. Diese Musik kann nur durch wirkliche Dichter erzeugt werden, die dort ebenso selten sind wie bei uns: sie bildet für die Megamikren ganze Erzählungen, die man durch Worte nicht wiedergeben kann Unser Held Eduard, seine Schwester und Gattin Elisabeth und ihre Nachkommen empfanden beim Zuhören nur die Empfindung, die sie ausdrückte: Freude, Schmerz, Staunen, Empörung, Mitleid und Rührung, ohne begreifen zu können, um was es sich handelte. Man sagt, die Sprache der Griechen habe Mut eingeflößt oder zur Liebe entzündet und den Zorn besänftigt; und dies glaube ich wohl, denn die unsere erlustigt, rührt und stimmt zum Weinen, wie sie auch einschläfernd wirkt, wenn sie schlecht ist, und das ist sie oft, weil unsere Herren Musiker keine Poeten sind und weil unsere Dichter elende Reimschmiede sind, die nicht einmal wissen, was der schöne Name bedeutet, den sie sich geben.
Der Tanz ist bei den Megamikren im höchsten Grade ausgebildet: man grüßt nur mit Tanzschritten und drückt dadurch seinen Gedanken aus, und dies ist ein einfaches Mittel, wodurch man sich vor Schmeichelei, Lüge und jener verfluchten Verstellung schützt, die wir für lobenswert halten und sogar zu den Tugenden rechnen, während sie sich bei genauer Beobachtung als reine Hinterlist herausstellt. Cicero sagt uns »quo quis versatior et callidior est, hoc invisior et suspectior detracta opinione probitatis«. Die Megamikren pflegen sehr sorgfältig die schönen Künste und ganz besonders betreiben diese glücklichen Sterblichen das Studium der Physik, Geometrie, Mechanik und Jurisprudenz; alle sind sie Geographen und Musiker: außerdem verschafft ein gründliches Studium denen, die es wünschen, die nötigen Kenntnisse im Handelswesen, das alle geselligen Völker beglückt und die Quelle der Industrie ist, die nur durch Gedeihen des Handels befördert werden kann.
Da es nicht möglich ist, Herr Graf, daß ein Menschengeschlecht leben kann ohne sich zu ergötzen, so besteht das Vergnügen der Megamikren darin, daß sie jagen, ohne das Wild zu töten, daß sie fischen, ohne den Fischen ihre Freiheit zu rauben. Dem Schwimmen ergeben sie sich mit einer von uns ungeahnten Begabung, da die Natur sie mit besonderen inneren Organen ausgestattet hat, die ihnen erlauben, wie Fische im Wasser zu atmen. Die Reichen haben Lauben in den Flüssen, die in meinem englischen Original »Fischotterbauten« genannt werden. Dort unterhalten sie einander durch sehr beredte Gebärden und mit einer ungemeinen Geläufigkeit.
Pferderennen gehören zu ihren beliebtesten Vergnügungen und der edelste Sport der Begüterten ist, in ihrer freien Zeit Pferde zu zähmen und abzurichten. Sie besitzen hundert verschiedene Arten von Pferden, darunter auch fliegende, die Ihnen jedoch kaum besser als die anderen gefallen werden, denn sie haben nur die ihnen von der Natur angeborene Intelligenz. Diese unschuldigen Unterhaltungen der Megamikren werden Sie sicherlich begeistern und Ihnen die Worte entlocken: »o miseri quorum gaudia crimen habent!«
Sie werden finden, daß die gelehrtesten Naturwissenschaftler Chemiker sind; alle Chemiker sind Apotheker und alle Apotheker sind gute Köche. Sie werden von einer unbeweglichen Sonne hören, der die ganze dortige Natur ihr Leben verdankt und von einem stets gleichen System, das erzeugend und wohltuend wirkt, als kleinste seiner Wohltaten den roten Regen bringt, der in seiner Farbe den Gewässern ihrer Flüsse gleicht und viermal im megamikrischen Jahr, nachdem ein Wind vorausgegangen ist, die Atmosphäre erfrischt, indem er nicht wie bei uns vom Himmel herabkommt, sondern in der Art von Springbrunnenstrahlen aus der Erde herausquillt.
Sie würden dort keine verpestete oder von zu starken Winden bewegte Luft zu atmen haben und hätten nicht auf einem Boden zu wandern, der Überschwemmungen unterliegt, die die Gaben der Ceres und Flora zerstören und die hübsche Ordnung zunichte machen, die uns lächelnde, fruchtbare Felder, zartgefärbte Bäume, Blumen und Gräser in unseren Gärten zukommen lassen.
Man streitet auch in jener Welt, Herr Graf, denn die Menschen sind auch dort verschiedener Meinung und wollen stets recht behalten, aber es gibt dort keine Kriege oder doch nur ganz zufällige, denen man das Widernatürliche wohl anmerkt; es ist nicht wie bei uns, wo die Kriegsvorbereitungen zu den ersten Pflichten eines Herrschers gehören, wo man einen Krieg auf eine den Megamikren ganz unbekannte freundschaftliche Weise anzuspinnen versteht, während man zum Morden bereits entschlossen ist. Eduard hat allerdings den Krieg bei den Megamikren eingeführt, aber er mußte dies tun, sonst wäre er der Gewalt zum Opfer gefallen, und ein Engländer stirbt eher, als daß er sich ergibt. Sie werden gerade daran sehen, was wirklicher, unbestrittener Edelsinn ist, dem jeder Streit fern liegt und der der Natur entsprossen ist. Sie werden sehen, wie die Bestrafung der Lüge der Triumph der Wahrheit ist, die Bestrafung der Nacktheit der Triumph der Schamhaftigkeit. So triumphiert auch die Wissenschaft über die indiskrete Neugierde, die durch freche Fragen entfacht wird. Die Schönheit jener Welt wird Ihnen erst beweisen, daß dies schöne Europa, das Sie besichtigt haben, nur ein buntes Allerlei ist, ein unfertiges, aus verschiedenartigen, wenn noch so prachtvollen, doch zueinander nicht passenden Stoffen zusammengeflicktes Kleid.
Diese glücklichen Megamikren, die Ihnen nach meiner Beschreibung wohl genügend imponiert haben, sind recht kleiner Gestalt: sie sind nicht größer als eines Ihrer Beine, deshalb werden sie Megamikren oder Großkleine genannt; sie werden jedoch vor Ihren Augen an Größe gewinnen, Sie werden sich an ihre Kleinheit so sehr gewöhnen, daß Sie schließlich zu der Ansicht kommen werden, sie seien eigentlich größer als wir, und ihre Könige seien majestätischer als die unseren, obgleich die letzteren vier Ellen hoch zu sein geruhen; wenn dies wahr ist, denn ich weiß es nicht bestimmt und will niemandem zu nahe treten. Die eigentliche Majestät eines Herrschers beruht ja auf seinen Tugenden, seiner Großmut und Gerechtigkeit, denen sich die Milde paart: Qui piger ad poenas princeps, ad praemia velox, quique dolet quoties cogitur esse ferox.
Die kleine Gestalt der Megamikren könnte Sie zum Nachdenken über die Größe von Adam und Eva anregen, die nach der Ansicht einiger alter Rabbiner Riesen gewesen sind; dies waren sie nun jedenfalls im Vergleich zum erst geschaffenen Menschenpaar. Sie werden auch an Hand der Heiligen Schrift über eine zur Seele sprechende Musiksprache Ihre Schlüsse ziehen können. Wir lesen (Genesis Kap. II V. 19), daß Adam allen Tieren die ihnen entsprechenden Namen gab, d. h. also nur solche, die sie richtig bezeichneten. Jene Namen und jene Ursprache sind vergangen, selbst dem Noah waren sie schon unbekannt; sonst hätte er sie den Menschen nach der Sintflut mitgeteilt. Diese schöne Sprache konnte nur eine Musiksprache sein, da wir nicht begreifen können, daß Worte, wie wir sie auszusprechen gewohnt sind, die Macht haben könnten, uns einen Begriff der Form einer uns unbekannten Sache beizubringen; ich meine aber, ein Gesang kann diese Macht haben und zwar durch die Vermittlung des sechsten Sinnes, den Adam vielleicht besaß, den er aber nach dem Willen Gottes seinen Nachkommen nicht vererbte.
Die Megamikren, Herr Graf, haben Laster, die durch Mißbrauch der Leidenschaft entstehen; Sie werden aber sehen, daß dies kein Makel, sondern nur Staub ist. Alle Leidenschaften der Megamikren sind nur vorhanden, um sie glücklich zu machen: sie gleichen unseren giftigen Pflanzen, aus denen man Arzneien verfertigt; alles hängt ja nur von der guten Erziehung ab, und der Mensch versteht aus allem seinen Vorteil zu ziehen: nisi parent, imperant. Einige reiche Megamikren lassen sich vom Ehrgeiz beherrschen; sie werden aber dafür nicht verdammt, sich auf ihre alten Tage langweilen zu müssen, wie wir dies in Venedig, Rom, Neapel und Wien sehen. Auch die unrechtmäßige Liebe macht einige von ihnen unglücklich, sie trachten aber, sich von ihr zu befreien, da sie deswegen ausgelacht werden. Bei den Megamikren gibt es nur ein Geschlecht: da alle Männchen und zugleich Weibchen sind, so sind sie eben weder Männchen noch Weibchen, und wir begreifen daher, daß die Fortpflanzung nicht mehr von dem einen der beiden Individuen als vom andern abhängig ist. Sie sind alle gleich und so sind auch bei ihnen die Triebe gleich. Sie dürfen sie aber nicht als Zwitter bezeichnen, denn damit würden Sie einen sehr schmutzigen Begriff verbinden und ihnen unrecht tun; denn sie sind es in Wirklichkeit nicht, und obwohl Sie es nicht sehen werden, können Sie sich dies leicht vorstellen; denn obzwar Eduard in seinem Stil sehr züchtig ist und auf jede Weise die Schamhaftigkeit des Lesers zu schonen weiß, verhindert er doch einen klugen Menschen nicht, zu verstehen, was er zu wissen braucht.
Der Körperbau eines Megamikren bietet einen Anblick, den wir schön nennen, und der die zärtlichste Liebe zu erwecken imstande ist; die Fortpflanzung ihrer Rasse ist eine angenehme Folge dieser Schönheit, obgleich sie mit dem, was ihren Reiz bildet, nichts zu tun hat.
Sie werden dort drinnen auch die Armut treffen, aber sie ist nicht schmutzig, und Sie werden sie ruhig hinnehmen, da Sie merken werden, daß sie sich überall vorfinden muß, wo Reichtum herrscht, und Sie werden den Reichtum nicht verdammen, wenn Sie sehen, daß er die Belohnung für wirkliche Tugend und wirkliche Verdienste ist. Die Megamikren haben eine Seele und eine Vernunft wie wir Menschen, und sie sind wie wir mit Fleisch umhüllt; aber ihre Natur macht sie uns überlegen und ihre Sitten, die ihrer Erziehung entsprechen.
Ich mache Sie noch darauf aufmerksam, daß die übermäßig zahlreiche Familie unseres Helden Sie nicht abschrecken möge; Sie werden weder etwas Unerhörtes noch Abgeschmacktes darin finden, wenn Sie ruhig lesen und Ihrem Geist jede Voreingenommenheit fernhalten, denn Voreingenommenheit täuscht die Vernunft.
Und nun muß ich Ihnen, Herr Graf, noch von den Eigenschaften der Gabe sprechen, die ich Ihnen und gleichzeitig dem Publikum übergebe. Es ist die Übersetzung eines englischen Manuskriptes; verlangen Sie aber nicht von mir, Ihnen das Original vorzuzeigen, denn ich bin nicht sehr stark im Englischen und fürchte strenge Kritik. Ich schenke Ihnen dies Werk, nicht indem ich es Ihnen widme, sondern indem ich es Ihnen als einen Wertgegenstand übergebe, auf den Sie ein Recht haben; denn um dies Werk zu schreiben, habe ich eine Zeit benützt, die nach dem mir von Ihnen verliehenen ehrenvollen Titel hätte anders benützt werden können. Die feste Überzeugung, daß das Lesen dieses Werkes Ihnen eine angenehme Zerstreuung bieten werde, gab mir den Ansporn, es binnen sechszehn Monaten fertigzumachen.
Als ich beschloß, Ihnen ein Geschenk dieser Art zu machen, sah ich klar, daß ich nicht verhindern konnte, es auch der allgemeinen Kritik zu unterwerfen; somit überliefere ich es der Gnade oder Ungnade, den Launen oder Vorurteilen, dem feinen oder barocken Geschmacke des Weltalls, denn, ob das, was ich Ihnen biete, auch der Mühe wert ist, das kann ich nicht wissen, ohne zu hören, was man darüber sagen wird pro captu lectoris habent sua fata libelli. Ein Curio wird mit dem alten Terenz sagen: Ne iste magno conatu magnus nugas dixirit; ein anderer wird behaupten, ich hätte dies Werk nur deshalb für eine Übersetzung ausgegeben, um mir einen Schlupfweg zu sichern, einen Ausweg gegenüber der Kritik der Aristarchen, die ich gerne verdienen möchte: mögen sie aber, wenn nur nicht Sie, Herr Graf, mir das sagen, was der Kardinal Hippolyte von Este dem Ariosto sagte, so will ich mich mit allem zufrieden erklären. Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der anfangs September des Jahres 1785 daran gedacht hat, meiner Wanderschaft Einhalt zu tun, indem Sie mir Ihre schöne Bibliothek anvertraut haben. Ich hatte es mein Lebenlang als einen Spaß angesehen, niemals den Ort zu bestimmen, wo meine Gebeine zu Staub werden sollen; denn dieser Gedanke hat mich stets empört. Dank Ihnen aber sehe ich jetzt meiner angenehmen Auflösung im böhmischen Chantilly in Ihrem Schlosse zu Dux entgegen.
Ich wollte nicht, Herr Graf, Ihnen mein Buch mit einer faden Widmung anbieten, die Sie verachtet hätten; denn was ist eine Widmung. Widmungen mißfallen mir alle sogar mehr noch als Grabreden, denn diese haben wenigstens das Gute, daß sie ihre Helden nicht mehr langweilen können. Hätte ich Sie denn durch eine formelle Widmung mehr geehrt? Hätte ich dadurch meinem Buche einen größeren Ruf gemacht, mehr Absatz verschafft? Weder das eine noch das andere. Die Menschen lesen lieber Satiren als Lobreden und haben damit auch vollkommen recht: die besten Bücher sind jene, die am wenigsten gelesen, am schwersten verkauft werden: was aber nicht sagen will, daß ich damit ein Urteil über die Vorzüge des meinen abgeben möchte. In einer nach dem üblichen Brauch gemachten Zueignung hätte ich alle Ihre erlauchten Ahnen aufzählen müssen; ich hätte, ohne mich von der Wahrheit zu entfernen, ganz besonders über den berühmten Herzog von Friedland sprechen müssen. Es wäre mir nicht schwergefallen, an Hand sehr wichtiger Dokumente sein Verhalten zu verteidigen, und an seinem tragischen Ende den Heroismus seiner Tugenden zu beweisen. Was hätte ich aber damit erreicht? Ich hätte nichts Neues berichtet, wenn ich geschrieben hätte, daß sein Blut in Ihren Adern fließt, und daß sein Bildnis das einzige ist, das Ihren Augen lieb ist, das einzige Gemälde, das alle, die Ihnen nahestehen, in Ihrem Schlafzimmer sehen können. Ich hätte Ihnen vielleicht durch die Erinnerung an die traurigen Folgen seines Mutes mißfallen; denn ohne die heldenhafte Größe seiner Seele hätten Sie eine halbe Million Renten mehr gehabt, die das Recht des Stärkeren Ihrer Familie entrissen hat, die auch ohne jenen Großen ruhmvoll genug ist.
Hätte ich in meiner Widmung von Ihnen gesprochen? Selbstverständlich. Wie könnte es auch anders sein? Ich hätte sagen müssen, daß Sie alle Tugenden besitzen, und Sie hätten mir dafür ins Gesicht gelacht; denn obwohl Sie den Keim alles Guten in Ihrer Seele und in Ihrem Blut haben, so wissen Sie doch selbst am besten, daß Ihnen gar nicht daran gelegen ist, vor der Welt als Muster der Keuschheit, der Bescheidenheit oder der Demut und Geduld zu gelten. Sie sind nicht dazu berufen, Ihre Güter den Armen zu schenken, noch haben Sie Neigung, als Märtyrer für die Religion zu sterben, oder den Heldentod für Ihr Vaterland zu finden. Hätte ich aber Ihre wirklichen Tugenden gepriesen, so würden Sie meinen Weihrauch verschmäht haben; denn ich hätte nur sagen können, daß Ihre Gefühle stets der Ehre entsprechen, der Sie vor allem andern huldigen und von der Sie durchdrungen sind; daß Ihr Haus mehr Ihren Freunden als Ihnen gehört; daß Fröhlichkeit überall dort herrscht, wo Sie sich befinden; daß Ihr Geist sich zu den höchsten Werken der Literatur zu erheben weiß; daß die schwersten Autoren viele von Ihren Mußestunden ausfüllen und daß Ihre Vergnügungen jene sind, die von den größten Geistern des Altertums gepriesen worden sind. Ich hätte Ihrer edlen Liebhaberei für die Pferde erwähnen müssen, und ich hätte Ihrer Kenntnisse von der Natur dieses redlichen Freundes des Menschen, dieses Beschützers der berühmtesten Kriegshelden gedacht. Es stand in meinem Belieben, vom Kastor und seinem Bruder Pollux zu sprechen, die vergöttert wurden und durch die Freundschaft mehr noch als durch Blutbande vereint waren: Castor gaudet equis, ovo prognatus eodempugnis. Ich hätte sagen können, daß das Altertum keine höhere Tugend Castors hervorzuheben wußte, jene, die ihn als unerreichbaren Pferdezähmer preist und das ihn deshalb zu den Göttern zählte mit Pollux, der das Glück hatte, der erste aller Athleten zu sein: palmaque mobilis terrarum dominos ehavit ad Deos.
So sah, Herr Graf, die Tugend vor dreitausend Jahren aus; sie bestand im Mut, in der Stärke und in der kriegerischen Tapferkeit. Was Männer heutzutage emporhebt, beruht auf ganz anderen Dingen und Sie beneiden sicherlich nicht die Dioskuren um ihr Los. Sie lieben die Kinder Apollos um der Literatur willen, wie Sie andererseits die verlockende Harmonie der Lobgesänge vermeiden; aber Sie verdienen doch Lobredner, weil Sie Ihre Freunde lieben wie Augustus und Mäcenas den Horaz liebten. Ich achte und ehre Sie, Herr Graf, wie ich es muß und ich bitte Sie, nicht zu glauben, daß ich gemeint hätte, durch diesen Brief Ihr Ansehen vermehren zu können; ich wollte dadurch nur die Gefühle aussprechen, die Sie in mir erweckt haben. Ein Name, der in ganz Europa so bekannt ist wie der Ihrige, würde vollkommen genügen, um mein Buch in der Gegenwart zu ehren; was ihm einen Platz in der Zukunft sichern kann, das hängt ja nicht von Ihnen ab; sollte ihm dies nicht gelingen, so werde ich mir selber Gerechtigkeit widerfahren lassen, ohne um feige Ausreden zu betteln.
Seien Sie glücklich, und um es vollkommen zu sein, folgen Sie der strengsten und ernstesten aller Schulen, den Lehren Epikurs, der der weiseste und tugendhafteste aller Meister des Altertums war. Er wird Sie lehren, daß Sie nur dadurch glücklich werden können, daß sie sich Freuden verschaffen, dabei aber jene meiden, die es nur dem Schein nach sind, oder auch solche, die lästige Folgen veranlassen: nocet empta dolore voluptas. Wirkliche Lust darf nie schädlich werden; doch werden Sie vor kleineren Plackereien nicht zurückschrecken, wenn Sie merken, daß sie die Quellen eines wirklichen Glückes werden können; denn wir genießen die Gegenwart, indem wir dabei die Zukunft stets vor Augen behalten, selbst wenn wir rückwärts gehen. Dies war die Moral des großen Philosophen, der bis zum non plus ultra der Weisheit gelangt wäre, wenn er begriffen hätte, daß die Freuden der Götter unabhängig von der Materie sein können. Er konnte sich die geistige Substanz nicht vorstellen, weil er es nicht für möglich hielt, daß sie für Freuden empfänglich sein könnte; er konnte sich nur die von den Sinnen abhängigen Freuden vorstellen, und deshalb stellte er Gott als ein sinnliches Wesen dar. Obgleich dieser Fehler ein wesentlicher ist, ist darum doch seine Moral rein und nur darauf bedacht, den Menschen glücklich zu machen.
Die besonderen Mittel nun, die Sie anwenden müssen, um die ganze Glückseligkeit zu erlernen, die das Leben des Sterblichen geben kann, die vermag niemand Ihnen anzugeben; Sie müssen sich darin an sich selbst halten, denn niemand kann besser als Sie selbst ermessen, was Sie dazu nötig haben. Bereiten Sie sich nur stets das Glück, weislich zu prüfen. Denn dies ist ein Glück und zwar ein großes. Die Ihnen angeborene Fröhlichkeit ist etwas so Wichtiges, daß Sie mit allen Mitteln trachten sollten, sie in ihrer ganzen Kraft zu erhalten; denn ich glaube sogar, daß Ihre Gesundheit davon abhängt. Wer sagen würde, daß Sie stets fröhlich sind, weil Sie gesund sind, würde sich irren; man muß Ihre Gesundheit nicht als Ursache, sondern als Folge Ihres Frohsinns betrachten; denn Heiterkeit ist eine Geistesgabe, die viel mehr Einfluß auf den Körper hat, als der Körper auf sie ausüben könnte. Ihr ganzes Wohlergehen hängt somit nur von Ihnen selbst ab, Herr Graf; Sie sind freier Herr, das höchste Glück zu erreichen und sich im Stande zu erhalten, es zu genießen und alle jene auszulachen, die das Vorhandensein dieses Glückes bezweifeln möchten.
Ich habe die Ehre mit der tiefsten Ergebenheit und den innigsten Empfindungen und der hochachtungsvollsten Zuneigung mich zu zeichnen Herr Graf
Dux, den 29. September 1787
als Ihr untertänigster und gehorsamster Diener
Jaques Casanova de Seingalt.
Einleitung
Unweit des St. Georg-Kanals, in der Richtung von Monmouth saßen eine Stunde nach Sonnenuntergang beim Kamin im schönen Hause des Grafen von Bridgend zwei gute Alte, Jakob Alfred und seine Frau Wilhelmine, als sie einen schönen jungen Mann ins Zimmer eintreten sahen, der eine sehr hübsche junge Frau am Arme führte: dies geschah am 15. Februar (alten Stils) des Jahres 1615. Sobald die beiden Unbekannten einen Blick auf die Greise geworfen hatten, blieben sie stehen, aber eine Minute später riefen sie gleichzeitig aus: »Sie sind es, daran ist kein Zweifel!« Mit diesen Worten warfen sie sich den alten Leuten zu Füßen, überschütteten sie mit den zärtlichsten Liebkosungen, küßten sie und benetzten sie mit Freudentränen. Jakob und Wilhelmine waren ganz erstaunt über diesen Gefühlsausbruch ihnen ganz unbekannter Personen und entzogen sich ihm, indem sie sich erhoben. Nachdem sie mit der größten Aufmerksamkeit das schöne Paar betrachtet hatten, redete sie der ehrwürdige Greis mit folgenden Worten an: »Aber wer sind Sie denn? Wie kommen Sie dazu, uns mit so ungewohnter Zärtlichkeit zu überschütten und eigenmächtig und unbekannt unser Haus zu betreten? Woher kommen Sie? Was wollen Sie? Sagen Sie uns das rasch und befriedigen Sie unsere begreifliche Neugierde, oder entfernen Sie sich, denn wir haben bereits genug Sorgen und werden unwillkürlich mißtrauisch in diesen Zeiten, wo man die letzte Verschwörung den Katholiken in die Schuhe schiebt und unter diesem Vorwand die armen Jesuiten ausweist.«
»Ich bin«, antwortete der junge Mann (und sein Gesicht drückte ehrliche Aufrichtigkeit aus) »Euer Sohn Eduard.«
»Und ich«, fügte die schöne Unbekannte hinzu, »bin Eure Tochter Elisabeth.«
Und wiederum eilten sie auf die alten Leute zu, um ihre zärtlichen Liebkosungen zu erneuern; doch der weise Jakob schob sie zurück und sprach zu ihnen voller Entrüstung und mit gebieterischer Stimme: »Wie traust du dich, Unverschämter, uns Unwahrscheinliches glauben machen zu wollen? Und du, Dirne, die mit ihm unter einer Decke steckt, um diesen dummen Schwindel zu bekräftigen, sag, wie willst du diese Behauptung aufrechterhalten?«
Elisabeth: »Ihnen, lieber Vater, will ich nur die Wahrheit sagen; und Sie, teure Mutter, will ich bitten, uns etwas aufmerksamer betrachten zu wollen.«
Wilhelmine: »Lieber Mann, ich bin wirklich außer mir. Diese zwei Menschen sind ja zwei Ebenbilder, lebende Porträts unserer beiden Kinder, die wir vor einundachtzig Jahren beweint haben, als sie mit dem Schiff Bolsey untergingen, das in Norwegen durch den Malstrom verschlungen wurde, durch diesen schrecklichen grausamen Meeresstrudel, der alle Schiffe, die sich ihm nähern, in seine Tiefen herabzieht.«
Eduard: »Ganz richtig.«
Jakob: »Was? Ganz richtig? Du bist entweder ein Narr ober du hältst uns für blödsinnig. Du Haft dich natürlich als geschickter Betrüger, der du bist, sehr genau über alles unterrichten lassen; denn allerdings hatten wir einen Sohn und eine Tochter, die dieselben Namen führten, die ihr euch gebt: aber selbst wenn wir nicht sicher wären, daß sie damals verunglückt sind, – wie erkühnt ihr euch, ihr frechen Menschen, euch für jene auszugeben, da ihr doch augenscheinlich nicht das Alter habt, das unsere Kinder heute hätten, wenn sie noch lebten? Du würdest fünfundneunzig und deine Schwester dreiundneunzig Jahre alt sein; nicht wahr, meine gute Frau? Und wie alt seid ihr denn? Man sieht ja, daß keines von euch älter als fünfundzwanzig ist.«
Elisabeth: »Aber abgesehen von unserem Alter, erkennt Ihr, lieber Vater, unser ganzes Wesen nicht wieder?«
Jakob: »Ich gebe wohl zu, daß eine überraschende Ähnlichkeit mich ganz stutzig macht und ich vor Staunen gar nicht zu mir komme; aber selbst wenn du mir das Zeichen, den Biß des Hundes, der meine arme Elisabeth am linken Ellbogen verletzt hat, vorweisen würdest, so hätte ich auch dann noch nicht die Kraft, an das zu glauben, was mein Verstand als wahnwitzig und falsch annehmen muß.«
Wilhelmine: »Und mein armer Eduard hatte oben am rechten Schenkel ein großes Muttermal in Gestalt einer Ananas.«
Elisabeth: »Hier, lieber Vater, ist das Zeichen, dessen Ihr Euch so gut erinnert.« Jakob: »Ich sehe es, es ist wirklich stark.«
Eduard: »Und Sie, liebe, gute Mutter, schauen Sie her und sagen Sie mir, ob es nicht das Muttermal ist, von dem Sie soeben sprachen.«
Wilhelmine: »Ja, ich sehe es. Oh, lieber Mann, es kann doch kein Traum sein! Wir schlafen doch nicht!«
Eduard: »Ihr werdet Euch nun wohl daran erinnern, daß wir uns in Plymouth eingeschifft haben, als ganz England wegen der Abtrünnigkeit Heinrichs des Achten in Aufruhr war. Unser Oheim soll mit allen, die an Bord des Volsey waren, untergegangen sein.« Elisabeth: »Wir glauben, wir sind die einzigen, die durch einen Zufall, der an ein Wunder grenzt, dem Tode entgangen sind. Wir wissen, daß wir so alt sind, wie Sie sagen, obgleich Gott uns in eine Welt gelangen ließ, wo man die Zeit auf eine ganz andere Art berechnet; als wir aber trachteten, dies festzustellen, kamen wir bis auf einige Monate auf dieselbe Zahl.«
Jakob: »Das klingt ja wie der Anfang eines Märchens. Nun wollt Ihr uns weismachen, daß Ihr einundachtzig Jahre in einer anderen Welt zugebracht habt! Das müßte allerdings so sein, denn nur in einer anderen Welt könnte es geschehen, daß die Zeit nicht die Macht besäße, Sterbliche alt zu machen.«
Eduard: »Regen Sie sich nicht so sehr auf, lieber Vater, und bereiten Sie sich vor, aus unserem Munde viele Wunder zu hören, an die Ihr niemals glauben würdet, wenn nicht gerade unser junges Aussehen Euch schon darauf vorbereitete. Die Frische unserer Wangen soll Bürgschaft dafür sein, daß alles, was wir Euch erzählen werden, reine Wahrheit ist.«
Wilhelmine: »Er hat recht; alles, was wir sehen, ist ja gar zu merkwürdig. Ich fühle mich schon bereit alles zu glauben, was unsere lieben Kinder uns erzählen werden, laß uns nun, mein lieber Mann, hören, was sie alles erlebt haben.«
Jakob: »Frau, du faselst. Ich zähle hundertundneun Jahre und du bist hundertundsieben Jahre alt; und nachdem wir diese lange Zeit als vernünftige Menschen gelebt haben, sollen wir nun zu Narren gehalten werden und an etwas Unwahrscheinliches glauben?«
Wilhelmine: »Aber, was wir sehen, das ist wahrhaft vorhanden.«
Jakob: »Ich beschwöre dich, laß mich daran wenigstens bis morgen zweifeln, denn mir ist ganz wirr im Kopfe von dieser seltsamen Begebenheit.«
Eduard: »Gut, Vater, bis morgen; dieser Aufschub ist ganz vernünftig; aber versprechen Sie uns, uns morgen anzuhören.«
Elisabeth: »Sie werden Unglaubliches hören. Tatsachen, auf die niemals ein Bewohner der äußeren Erdfläche gekommen ist.«
Voller Staunen stand der gute alte Jakob lange da und warf nur wortlos seiner Frau und den beiden Eindringlingen Blicke zu. Endlich gab er sich dem ihn überwältigenden Gefühl hin. Das Nachdenken weckte in ihm die natürlichen Empfindungen wieder und rührte ihn; er mußte weinen; seine Frau weinte mit ihm; die Unbekannten folgten ebenfalls ihrem Beispiel, und nun hätte nichts mehr ihren Gefühlsaufwallungen Einhalt tun können. Den Tränen folgte eine unendliche Herzensfreude, und ihre gegenseitigen Gefühle äußerten sich in Liebkosungen, die schließlich den braven Alten zwangen, seiner Fröhlichkeit in ungewohnter Weise Luft zu machen; er lachte aus vollem Halse. Das alte Mütterchen zog zwei Sessel ans Feuer heran und hieß an ihrer Seite die beiden merkwürdigen Wesen Platz nehmen, die sie vom Paradies herabgestiegen wähnte, denn nur dort konnte sie sich diesen Zustand von ewiger Jugend vorstellen.
Ein Bauer und eine alte Frau waren Zeugen dieser Szene; die Alte war in ihrer Kindheit eine unzertrennliche Freundin der Elisabeth gewesen und mußte ungefähr deren Alter haben. Sie konnte sich nicht entschließen zu glauben, was doch ihre Augen sahen: als sie sie jung sah, obwohl sie doch alt sein mußte, erwachte in ihr ein Unwillen, der ihre Seele zerfraß; sie glaubte fest an Teufelswerk, und so ging sie, von diesem Gedanken beherrscht, hinaus, einen katholischen Priester zu benachrichtigen, der sich heimlich im Dorfe aufhielt. Unterwegs erzählte sie das Vorgefallene allen Nachbarn, denen sie begegnete; alle lachten sie aus, aber nichtsdestoweniger liefen sie alle, von Neugierde getrieben, zu Jakob Alfred.
Bald überfüllten sie die ganze Wohnung.
Mylord, Graf Bridgend, über diesen ungewöhnlichen Lärm erstaunt, kam mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter herunter, und traf gerade in dem Augenblick ein, als der Priester erschien. Nachdem dieser erfahren hatte, um was es sich handelte, gebot er Ruhe und sagte, diese beiden Menschenwesen könnten wohl geschickte Hexenmeister sein, denen er jedoch bald jede Teufelei austreiben werde, sobald er in Stola und Meßgewand und mit den heiligen Reliquien, die er besitze, wiederkehre; man möge sie nur bis dahin aufhalten und gut bewachen. Zwei eifrige und unerschrockene Katholiken, die sich dort befanden, versicherten ihm, sie würden sie, falls sie nicht etwa Geister wären, nicht entschlüpfen lassen. Sie stellten sich bei der Tür auf, während er zurücklief, um die Waffen zu holen, die seine Religion ihm zu gebrauchen gebot. Lord Bridgend, der weder an Engel noch an Teufel glaubte, lachte; die Mylady hatte Angst, ihr Sohn Lord Tarnton, der nicht wußte, was Teufelaustreiben bedeutete, und der von Elisabeths Schönheit entzückt war, wollte auf den frommen Pater losgehen und ihn durchprügeln, und Lady Stanhope, seine fünfzehnjährige Schwester, der Eduard besonders gefiel, war ganz betrübt zu erfahren, daß er so alt und möglicherweise nur ein schwarzes Gespenst sein könne.
Die beiden Gegenstände des allgemeinen Staunens bemühten sich durch ihre bescheidene Haltung den Mut ihrer Eltern aufrechtzuerhalten und durch eine edle Unerschrockenheit deren Sorgen zu verscheuchen. Bald war der Priester mit allen seinen Geräten zur Stelle; er gab sich redliche Mühe, die vermeintlichen Schwarzkünstler zu entlarven. Da er aber kein Zeichen sah, das seine Vermutungen bestätigte, meinte er endlich, die Unmöglichkeit, ihre teuflische Abstammung festzustellen, sei im Glaubensmangel einiger anwesender Ketzer zu suchen, die ihn durch ihre Heiterkeitsausbrüche störten. Er ersuchte nun alle jene, die nicht an den Vorrang der römischen Kirche glaubten, sich zu entfernen, und man tat ihm diesen Gefallen. Er verdoppelte seine Beschwörungen und Belehrungen: als er aber sah, daß diese jungen Alten allen seinen Anstrengungen widerstanden und weder heulten noch sich auf die Erde warfen, noch auch nur ein Wort auf hebräisch sagten, da verlangte er Schreibzeug und stellte ihnen eine Bescheinigung über ihre ganz natürliche, von jedem Drucke freie Menschlichkeit aus. Er entschuldigte sich und ging seiner Wege, Eduard aber und Elisabeth empfingen die Glückwünsche der ganzen Gesellschaft, die sie auf die freundlichste Weise entgegennahmen.
Graf Bridgend, der von Natur sehr neugierig war, begann die Neuankömmlinge mit allen möglichen Fragen zu überschütten, auf die beide abwechselnd antworteten; je mehr die Antworten den Fragen entsprachen, wuchs aber die Neugierde des Fragenden, da ihm alle möglichen Voraussetzungen in den Sinn kamen, die er nicht sofort aussprechen konnte. Mylord war nun der Ansicht, daß der Saal, in dem sie sich befanden, obgleich geräumig, doch nicht imstande war, die Menge zu fassen, die immer größer wurde; er entschloß sich rasch und lud die ganze Familie ein, in seiner Wohnung zu Abend zu essen. Er war um so freundlicher, als er in seiner Gier, alles zu erfahren, fürchtete, daß die übergroße Zahl der Zuhörer den Herrn Eduard veranlassen würde, nur eine den Umständen angemessene Erzählung vorbringen. Er aber wollte alles erfahren, wo sie diese vielen Jahre zugebracht hätten, als der Volsey vom Malstrom verschlungen wurde, und noch mehr interessierte ihn, wie sie sich so jung erhalten hatten.
Seine Einladung wurde angenommen. Mylord beeilte sich nun, Elisabeth seinen Arm zu reichen. Eduard bot den seinen der Lady und ihnen folgten die zwei Alterchen (so nannte man nämlich Jakob und Wilhelmine), die sehr langsam gingen und zum ersten Stock stiegen. Die übrigen Leute, die im Saale gewesen waren, gingen nach Hause.
Sehr gelegen kam dem Grafen Bridgend in diesem Momente Lord Karl Burgleigh, Neffe des verstorbenen Großschatzmeisters und Verwandter von Robert Cecil, Grafen von Salisbury. Dieser Edelmann liebte Lady Caroline, die man auch geneigt war ihm zur Frau zu geben. Er wohnte fast ständig auf einem seiner Güter bei Chester. Eine Viertelstunde später wurde die Gesellschaft durch die Ankunft des Admirals Howard von Nottingham erfreut, der aus Spanien kam, wo er Botschafter gewesen war. Es war derselbe, der im Jahre 1588 mit dem Vizeadmiral Drake die Flotte Philipps des Zweiten vernichtete, die dieser König so unrichtig die unüberwindliche Armada nannte. Sie bestand aus hundertfünfzig Schiffen, war mit zwanzigtausend Soldaten, achttausend Matrosen, zweitausend Ruderern bemannt und führte zweitausendsechshundert schwere Geschütze. Hocherfreut über diesen Sieg feierte die Königin ihn nach Art der Römer, indem sie eine große Zahl Medaillen zur ewigen Erinnerung an diese glorreiche Tat prägen ließ.
Als man dem Admiral Eduard und Elisabeth als zwei Menschen vorstellte, die dem Schiffbruch des Volsey im Malstrom vor einundachtzig Jahren glücklich entgangen wären, empfing er sie mit Lachsalven. Er erinnerte sich, von diesem Unglück einigemale in seiner Familie reden gehört zu haben. Der Kommandant des Volsey, der ebenfalls dabei verunglückte, war sein Großonkel, der Graf von Surrey gewesen; wie sollte er da nicht lachen, als er so junge Leute vor sich sah! Sein Staunen hatte aber keine Grenzen, als man ihm sagte, es handle sich um keinen Scherz. Da war seine Neugierde der der anderen gleich. Lord Bridgend aber sprach nun zu Eduard:
Mr. Bridgend: »Wir hoffen, Herr Eduard, daß Sie unsere Neugier wohl entschuldigen und befriedigen werden, ohne auch nur die kleinsten Einzelheiten auszulassen, denn bei solch einem Abenteuer muß uns doch alles interessieren. Falls eine Stunde dazu genügt, so könnten Sie schon vor dem Abendessen uns damit erfreuen.«
Eduard: »Wenn Sie, Mylord, aus unserem Munde alles zu erfahren wünschen, was uns seit einundachtzig Jahren widerfahren ist, seitdem wir unsere Heimatsinsel verlassen haben, so glaube ich wohl, daß wir Sie binnen drei Wochen zufrieden stellen können, wenn Sie uns täglich drei Stunden lang anhören wollen. Einstweilen kann ich, wenn Sie wünschen, sogleich damit beginnen; ich bin natürlich stets bereit, meine Erzählung zu unterbrechen, sobald deren Weitschweifigkeit Sie ermüden sollte, oder wenn etwa Ihre Geschäfte Sie abrufen.«
Mr. Bridgend: »Ich werde alle andere Beschäftigung hintenansetzen, um Ihnen zuzuhören, und Sie werden mir durch Ihre Erzählungen ein großes Vergnügen bereiten.«
Lady Bridgend: »Ihre hier anwesende Schwester wird Sie an dies oder jenes erinnern können, das Sie vielleicht vergessen.«
Elisabeth: »Ich werde ganz darauf bedacht sein, Mylady; wir werden nichts auslassen.«
Burgleigh: »Ich vermute, Sie sind bereits ganz im Einverständnis über den uns zu erzählenden Roman; nichtsdestoweniger versichere ich Ihnen, daß ich ebenso aufmerksam zuhören werde, als ob es sich um eine wahre Geschichte handelte.« Eduard: »Alles, was ich erzählen werde, Mylord, wird nur gar zu wahr sein: Betrogen werden nur jene sein, die es nicht glauben werden.«
Howard: »Genau dieselbe Antwort gebe ich allen denen, die an den Begebenheiten zweifeln, deren Zeuge ich auf meinen langen Reisen war. Aber wenn alles richtig ist, so glaube ich, daß der Mann, der diese neue Welt, von der Sie uns erzählen wollen, für England erobern könnte, mit dem höchsten Ruhm bedeckt zur Ewigkeit eingehen würde. Ich will dem König berichten. Wenn ein Geschwader von Nutzen sein könnte, würde ich sofort bereit sein, allen Gefahren zu trotzen, um die Ehre zu haben, es befehligen zu dürfen. Ich würde es aber nicht wagen, dieses Unternehmen ohne Ihre Führung, Herr Eduard, in Angriff zu nehmen; ich wäre gern bereit, mit Ihnen die Ehre des Sieges zu teilen.«
Eduard: »Ihr Anerbieten, Mylord, ehrt mich ungemein; Ihr Wunsch ist edel und stolz; aber dies Unternehmen ist nicht ausführbar. Die Welt, aus der wir kommen, ist sicher, der unsrigen niemals zum Opfer zu fallen. Sie werden dies einsehen, wenn Sie meine Beschreibung hören. Erlauben Sie mir nur noch in bezug auf die Möglichkeit einer Eroberung dieser neuen Welt Ihnen offen meine Meinung zu sagen. Sie besteht aus achtzig Monarchien, zehn Republiken und aus zweihundertsechs Lehensstaaten, von denen einige so groß sind wie ganz England. Ich liebe die Freiheit dieser Welt, sei es, daß sie in ihrem Zustand erhalten bleibt, sei es, daß sie dereinst meinen Nachkommen zur Beute fällt. Ich bin den Menschen dort zu Dank verpflichtet, denn sie retteten mir vor einundachtzig Jahren das Leben und ich bin nicht der Mann, ihnen das mit solchem schnöden Undank zu vergelten. Ich wünsche ihnen alles Gute und Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich wünsche, daß meine Kinder stets mit ihnen in Frieden leben. Sagen Sie mir, ehrenwerter Lord, was haben denn die braven Megamikren Böses getan, was an England verbrochen, daß mein Vaterland sich für berechtigt halten sollte, sie zu unterwerfen, kaum daß es von ihrer Existenz gehört hat? Sie brauchen uns nicht. Wie kann aber irgend jemand das Recht haben, sich eines Staates zu bemächtigen, über den er niemals zu verfügen hatte? Ich sehe wohl ein, daß Ihnen, Mylord, dieser Gedanke von Ihrem unerschrockenen Mut, Ihrer Vaterlandsliebe, Ihrer Begierde nach dem höchsten Sieg und größtem Mut eingegeben wird. Ich sehe dies ein, doch beschwöre ich Sie, Mylord, mich zu entschuldigen, wenn ich nicht Ihrer Ansicht zu sein vermag! Ich bin in jener Welt auferzogen, wo man nicht versteht, wie es einem Menschen zum Ruhme gereichen kann, andere Menschen unglücklich zu machen.
Übrigens ist die innere Welt schon deshalb nicht zu erobern, weil sie von Natur keine Grenzen und Küsten hat; man kann nur durch die Erdrinde zu ihr gelangen, und da ist sie verteidigt durch Abgründe, die Schwerkraft, durch Gewässer, Luft und Feuer. Aber selbst wenn nicht die Natur das Eindringen hindern würde, welche Macht könnte es jetzt unterjochen, da sechshunderttausend Engländer in ihr leben, die verpflichtet sind, sie zu verteidigen? Sie würden dort eine ungeheuer starke Artillerie antreffen, Sie würden dem ganzen Mut unserer Nation und einem vom Sophismus nicht angekränkelten Geist begegnen, dem Sie niemals den Gedanken klar machen könnten, daß es zu ihrem Vorteil gereichen würde, sich unterjochen zu lassen und einen anderen Herrn anzuerkennen als ihre eigenen Gesetze und Herrscher.«
Burgleigh: »Ich bin wirklich betrübt, Mylord, daß diese Erklärung des Herrn Eduard Ihren Wünschen und Ansichten nicht entspricht. Sie klingt etwas wild. Es ist die Rede eines Menschen, der von unterhalb der Erde kommt. Aber trösten Sie sich: es gibt noch unbekannte Länder in unserer Welt, die sich nicht vom Fleck rühren; die können Sie entdecken gehen, sobald Sie Lust haben und können sie als guter Engländer der britischen Krone einverleiben. Diese armen Länder! Welch Unglück für sie, unbekannt zu sein! Wie können sie überhaupt existieren, ohne englisch, spanisch oder französisch zu sein! Man muß sie der Barbarei entreißen, in die sie sicherlich versunken sind. Gehen Sie nur hin, sie dem Nichts zu entreißen, und wenn Sie mich mitnehmen wollen, will ich gerne sterben oder mit Ihnen siegen.«
Howard: »Ich danke Ihnen; Sie werden mich begleiten; ich nehme Ihr Ehrenwort an. Nichtsdestoweniger muß ich Ihnen sagen, daß die aufrichtige und freie Rede des Herrn Eduard mir sehr gefallen hat; er sprach zu mir als Gentleman und als Philosoph; Ihre Glosse aber hat mich eher gelangweilt. Aber sagen Sie mir, mein lieber Herr Eduard, wieso sechshunderttausend waffenfähige Engländer in jener Welt vorhanden sein können?«