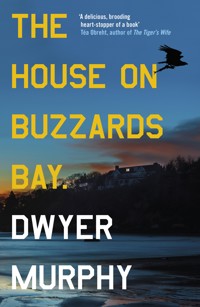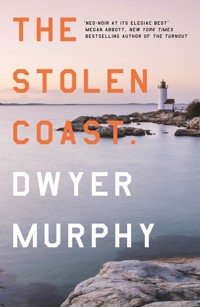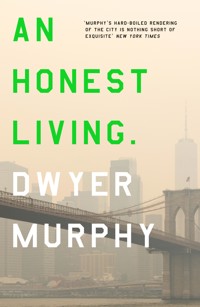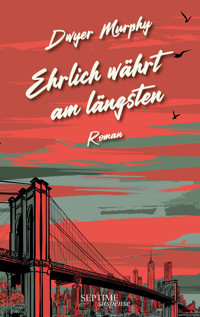
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als eine mysteriöse Frau namens Anna Reddick mit zehntausend Dollar in bar an die Tür eines aufstrebenden jungen Anwalts klopft und ihn bittet, den Beweis dafür zu liefern, dass ihr Ehemann Newton, ein Antiquar, ihre Sammlung seltener Prozessschriften gestohlen hat und verkaufen will, geht er davon aus, dass der Fall einfach und rasch erledigt sein wird. Und so ist es auch, Newton Reddick wird überführt. Doch als die echte Anna Reddick auftaucht und ihm klarmacht, dass er aufgrund seiner mangelnden Recherche Opfer einer Intrige geworden ist und den Ruf ihres Mannes zerstört hat, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln, um zu retten, was möglicherweise noch zu retten ist. Doch Newton Reddick ist spurlos verschwunden. Als Anna Reddick erneut bei ihm erscheint und ihm mitteilt, dass man ihren Mann tot aufgefunden hat und ihm den Auftrag erteilt, die Wahrheit über sein Ableben herauszufinden, überschlagen sich die Ereignisse und verwickeln ihn in eine fesselnde Geschichte, in der sich Wahrheit und Täuschung in einer stilvollen Hommage an das Noir-Genre zu einem dunklen Ritt durch Brooklyn und New York vereinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Erster Teil - Schöner wohnen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zweiter Teil - Leben auf dem Mississippi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dritter Teil - Eine reine Frau
20
21
22
23
24
25
26
Originaltitel: An Honest Living
Copyright © 2022 by Dwyer Murphy
© 2024, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Christie Jagenteufel
Cover: Jürgen Schütz
Coverbild: © i-stock
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-99120-053-6
Printversion: Hardcover
ISBN: 978-3-99120-047-5
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.instagram.com/septimeverlag
Dwyer Murphy
Dwyer Murphy ist der Autor von bisher zwei Romanen. Sein Debüt Ehrlich währt am längsten wurde von der New York Times als »Editors' Choice« ausgewählt. Er ist Chefredakteur von CrimeReads, dem Krimi-Portal von Literary Hub und der weltweit beliebtesten Anlaufstelle für Thriller-Leser. Bevor er in den Beruf des Schriftstellers wechselte, praktizierte er als Anwalt in New York City und war Redakteur der Columbia Law Review. Er lebt in Miami, Florida
Klappentext:
Als eine mysteriöse Frau namens Anna Reddick mit zehntausend Dollar in bar an die Tür eines aufstrebenden jungen Anwalts klopft und ihn bittet, den Beweis dafür zu liefern, dass ihr Ehemann Newton, ein Antiquar, ihre Sammlung seltener Prozessschriften gestohlen hat und verkaufen will, geht er davon aus, dass der Fall einfach und rasch erledigt sein wird. Und so ist es auch, Newton Reddick wird überführt.Doch als die echte Anna Reddick auftaucht und ihm klarmacht, dass er aufgrund seiner mangelnden Recherche Opfer einer Intrige geworden ist und den Ruf ihres Mannes zerstört hat, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln, um zu retten, was möglicherweise noch zu retten ist. Doch Newton Reddick ist spurlos verschwunden. Als Anna Reddick erneut bei ihm erscheint und ihm mitteilt, dass man ihren Mann tot aufgefunden hat und ihm den Auftrag erteilt, die Wahrheit über sein Ableben herauszufinden, überschlagen sich die Ereignisse und verwickeln ihn in eine fesselnde Geschichte, in der sich Wahrheit und Täuschung in einer stilvollen Hommage an das Noir-Genre zu einem dunklen Ritt durch Brooklyn und New York vereinen.
Dwyer Murphy
Ehrlich währt am längsten
Roman | Septime Verlag
Aus dem amerikanischen Englisch von Roland Freisitzer
Erster Teil
Schöner wohnen
1
Ich sah Newton Reddick zum ersten Mal vor dem Gebäude der Poquelin-Gesellschaft auf der East Forty-Seventh Street. Er war betrunken und lehnte an einem Einkaufswagen, der mit Ein-Dollar-Taschenbüchern gefüllt war. Er wirkte unbeschwert und schien sich an der Kälte nicht zu stören. Die Poquelin war eine Privatbibliothek, die im Vergoldeten Zeitalter von Bankkaufleuten gegründet wurde, die meinten, sich in Rockefellers und Carnegies zu verwandeln, wenn sie ihre Mittagspausen nur lesend verbrachten. Eine Privatbibliothek war sie 2005 noch immer, und zusätzlich dazu eine Gelehrtenvereinigung, die sich der Kunst, der Wissenschaft und der Erhaltung des Buches – was auch immer das bedeuten mochte – widmete. Auf ihrer Mitgliederliste fanden sich unzählige Akademiker, Antiquariatsbesitzer sowie einige unzeitgemäße Exzentriker des alten Geldes, die sich in der Hoffnung auf eine literarische Abendgestaltung von den East Seventies hierher verirrten. Newton Reddick war einer der Antiquariatsbesitzer, oder zumindest war er einer gewesen. Man sagte mir, dass er mittlerweile nur noch Sammler sei. »Sammler« schien mir ein übertrieben höflicher Ausdruck zu sein, doch er verdeutlichte immerhin die Tatsache, dass er damit kein Geld verdiente. Er lebte vom Geld seiner viel jüngeren Frau, die ihren Reichtum geerbt hatte und mit der er seit beinahe zehn Jahren verheiratet war. Offensichtlich verhalf ihm das zu einem Ehrenplatz unter den Mitgliedern der Bibliothek. An den mit Taschenbüchern gefüllten Wagen gelehnt, hielt er vor der Poquelin Hof und wedelte mit seiner Zigarette, die er in der freien Hand hielt, während ein Trio aus rotgesichtigen Alten wegen der Kälte eng aneinandergedrückt an seinen Lippen zu hängen schien. Seine schneidende Tenorstimme prallte von den Wolkenkratzern ab und drang auf die andere Straßenseite, wo ich mit einem Kaffee aus dem Gemischtwarenladen an der Ecke Fifth Avenue und Forty-Seventh Street stand.
Er ließ sich über jemanden namens Richardson aus. »Das Problem mit Richardson ist«, erklärte er den anderen, »dass der Mann keinen Sinn für Geschichte, kein Gefühl für irgendein höheres Anliegen hat. Er denkt, dass der Pulitzer den Wert eines Buches steigert.«
Die kleine vor der Poquelin versammelte Gesellschaft erkannte den Trugschluss dieser Denkweise nur allzu deutlich, und bevor sie ihre Zigaretten ausdämpften und wieder ins Gebäude gingen, hatten sie noch ein paar nette Worte für die ganzen Richardsons dieser Welt übrig, die den Wald vor lauter Bäumen nicht sahen, die wahre Größe nicht einmal dann erkennen würden, wenn diese an sie herantreten und ihnen einen Kinnhaken verpassen würde. Diese alten Büchermänner waren ein lebhafter Haufen. An einem anderen Abend, unter anderen Umständen, hätte ich ihrem Geschwätz möglicherweise gerne gelauscht. Es war ein Dienstag im November, kurz vor Thanksgiving. Überall in der Stadt besuchte man Freunde und schlug beim Trinken über die Stränge. Es war die Zeit der Partys und Paraden und der kleinen, bedeutungslosen Affären.
Üblicherweise hielt ich mich von Scheidungskram fern, aber der Fall war mir auf Empfehlung zugegangen. Eine Frau, die sich Anna Reddick nannte, hatte mich am Donnerstagabend der vorangegangenen Woche in meinem Apartment aufgesucht und erzählt, dass sie meinen Freund Ulises auf einer Party getroffen habe. Ulises war ein Lyriker aus Venezuela, der mir viel Arbeit zuschanzte. Er fand es furchtbar komisch, dass ich Rechtsanwalt und nicht Künstler oder Schriftsteller oder Lyriker wie alle anderen war. Noch amüsanter fand er die Tatsache, dass ich nicht mehr für eine der großen Midtown-Kanzleien arbeiten wollte und stattdessen versuchte, mich allein durchzuschlagen. Leichtsinnig und kaum profitabel. Er hatte mir bereits eine ganze Reihe potenzieller Mandanten zu Beratungsgesprächen geschickt. In seiner Welt fanden sich immer wieder Leute, die Hilfe benötigten und nicht wussten, wo sie diese finden konnten. Manche hatten Geld und andere versuchten, mich mit Mahlzeiten oder Gemälden zu bezahlen. Manchmal ließ ich mich darauf ein, obwohl ich eigentlich keine Ahnung von bildender Kunst hatte und deshalb jemanden um den Gefallen bitten musste – Ulises oder einen anderen Freund –, es für mich zu begutachten. Es war ein endloser Kreislauf ideeller Geschäfte und mickriger Erträge, von in Aussicht gestellten Gefallen, die letztendlich entweder spontan oder gar nicht eingelöst wurden. Solange ich die Miete bezahlen konnte, war das in Kauf zu nehmen. Anna Reddick erschien mit Bargeld – zehntausend Dollar. Sie hatte die Scheine fein säuberlich und alle gleich ausgerichtet gestapelt, so wie eine Kellnerin ihr Trinkgeld am Ende einer Schicht sortieren würde.
»Erwischen Sie ihn dabei«, sagte sie, »und Sie erhalten einen Bonus, in bar, per Scheck, Geldbrief oder Überweisung, wie auch immer, Sie haben die Wahl.« Ich hatte ein paar magere Monate hinter mir, also war ich nicht in der Lage, sie abzuweisen. Irgendetwas an diesem Fall beunruhigte mich von Beginn an. Was auch immer es war, ich konnte es erfolgreich verdrängen.
So wie ich es verstand, bestand der Job im Wesentlichen aus einem kontrollierten Ankauf, so wie ein verdeckter Ermittler ein wenig Gras auf der Straße oder einen von der Palette gefallenen Karton mit Motorolas oder Hunderte andere Dinge kaufen würde, deren Herkunft oder Bestimmung zweifelhaft war. Nur handelte es sich in diesem Fall nicht um Gras, sondern um Bücher. Ich hatte mir eine Liste von fünf Titeln auf einer Karteikarte notiert. Irgendeiner davon würde genügen, sagte sie, und ich müsse mir keine Sorgen darüber machen, sie tatsächlich zu kaufen, solange ich ein Kaufanbot ihres Mannes, von dem sie sich scheiden lassen wolle, erhielte und das auch in einer eidesstattlichen Erklärung beschwören würde. Sie glaubte, dass er ihre Bücher, bei denen es sich um Familienerbstücke handelte, verkaufen wolle. Ihre Anwälte hätten gesagt, dass sie irgendeinen Beweis für diese Annahme benötigen würde, und ihr dazu geraten, eigens zu diesem Zwecke einen weiteren Anwalt einzuschalten, da man die Sache durch die Arbeit eines Dritten zur Gänze in und unter Verschwiegenheitsklauseln verschleiern konnte. Ein typisches Konstrukt von Scheidungsanwälten. Sie trieben es mit der Geheimhaltung so weit, bis die Wahrheit beinahe bedeutungslos war, so gründlich und endgültig verdunkelt, dass man den Weg zurück ans Tageslicht kaum finden konnte. Die Bücher hatten recht ungewöhnliche Titel. Lang, verschnörkelt und grauenhaft. Die letzten Bekenntnisse von Tom Mansfield, der seinen Diener korrumpierte und ermordete. Anmerkungen zu den Ermittlungen gegen Charles Mandell und der letztendlichen Tötung von Luke M. Johnston. Es handelte sich offensichtlich um juristische Bände.
Oberflächlich betrachtet, hatte alles Hand und Fuß. Ein Anwalt auf der Suche nach Büchern. Soll immer wieder vorkommen.
Ich folgte Reddick und seinen Jüngern ins Gebäude und stieg eine schmale Treppe in den zweiten Stock hinauf, wo sich ein mit Kronleuchtern geschmückter Bankettsaal befand, auf dessen Hartholzboden abgenutzte Teppiche lagen. Es war der in der Poquelin öffentlich zugängliche Gesprächsabend, doch so wie es aussah, war ich der einzige Fremde, der dieses Angebot wahrnahm. Siebzehn alte Männer in bis zum Kinn zugeknöpften Hemden. Einige Gemälde an den Wänden und zur Schau gestellte Bücher. Die Reden waren bereits zu Ende und die Mitglieder hatten sich dem alkoholischen Teil des Abends zugewandt. Ich beobachtete Reddick von der anderen Seite des Raumes. Er war hochgewachsen, dünn und sehr bemüht, sich aufrecht zu halten, indem er sich mit den Händen den Rücken stützte, so wie eine schwangere Frau es tun würde. Er war dreiundsechzig Jahre alt. Seine Frau in ihren frühen Dreißigern. Vielleicht ging ich deshalb so hart mit ihm ins Gericht, weil ich der Meinung war, dass ein Mann seines Alters, dem das Leben eine junge und finanziell unabhängige, dazu auch noch auf ihre ganz eigene Art und Weise attraktive Frau beschert hatte – ganze zehn Jahre lang –, sich bescheiden und zivilisiert verhalten müsse, wenn sie am Ende doch noch zur Vernunft kam. Dass er nicht herumgehen und ihre Familienbücher verkaufen sollte. Es gibt nichts Schlimmeres als einen dreisten Hahnrei. Das waren jedenfalls die Gedanken, die ich wälzte, während ich mit einem Drink durch den Saal schlenderte und den alten Männern meine Geschichte erzählte, die Newton Reddick anlocken sollte und es schließlich auch tat. Die Geschichte war mehr oder weniger wahr: Ich erzählte ihnen, dass ich Anwalt sei, spezialisiert auf geistiges Eigentum. Dass ich mich für die Geschichte der Poquelin-Gesellschaft interessieren würde, aber unmittelbar darauf aus sei, ein paar Bücher zur Ausschmückung meines Büros zu kaufen, vorzugsweise Gesetzesbücher, historische Raritäten.
Reddick kam mit zwei Drinks auf mich zu und stellte sich vor.
»Ich sehe, dass Sie gerade dabei sind, loszulegen«, sagte er.
Er gab mir den Drink und wir stießen an. Sein Griff war unsicher und sein Lächeln das eines Mannes, der Fremden ebenso wie deren Absichten ganz selbstverständlich vertraut. Er strahlte eine gewisse Arglosigkeit aus, die vielleicht nicht nur dem Whiskey geschuldet war. Wir sprachen eine Weile über die Poquelin-Gesellschaft und die Stadt selbst. Er wollte mir erzählen, wie sich alles verändert hatte. In diesen Jahren fand man sich oft in derartigen Gesprächen wieder, und was die andere Person dabei wirklich sagen wollte, war immer, dass sie bereits länger in New York war als man selbst, viel länger natürlich, und dass das bedeutsam war. Bei Newton Reddick hatte ich dieses Gefühl nicht. Er erzählte mir von der Stadt, aber seine Erinnerungen wirkten irgendwie unschuldig, so wie man über das Haus seiner Kindheit erzählen würde, das längst verkauft worden war. Auf diesem Weg fanden wir zurück zum Thema Bücher und der Sammlung, die ich mir zulegen wollte.
»Das ist ein aufregender Moment«, sagte er. »Ich erinnere mich an meine Anfänge. An das Herumschnüffeln in der Book Row – die Läden sagen Ihnen bestimmt nichts, das war lange vor Ihrer Zeit. Ich arbeitete damals im Büro einer Versicherungsgesellschaft, doch nach Feierabend fand ich mich oft in der Innenstadt wieder, auf dem Weg Richtung Fourth Avenue, ohne genau zu wissen wieso. Natürlich besaß ich Bücher. Buchclubausgaben. Kartonweise Taschenbücher mit Eselsohren. Ich hatte nie daran gedacht, eine echte Sammlung anzulegen, eine eigene Bibliothek.«
Er hatte ein seltsames Funkeln in den Augen. Wäre ich boshaft, hätte ich gesagt, dass es Gier war, doch das Gespräch hatte mich milde gestimmt und ich fühlte, dass seine Erinnerung mehr war als das.
»Mit welchem Buch haben Sie angefangen?«, fragte ich.
»Schöner wohnen«, sagte er. »Edith Wharton und Ogden Codman, die Ausgabe von 1919.«
»War es sehr wertvoll?«
»Nicht besonders. Aber es hat dazu geführt, dass ich meine Richtung fand.« Er lächelte traurig und strich sich mit den Händen über den Rücken. »Man erinnert sich eher an die Bücher, die man verliert, als an die, die man behält. Sind Sie gewappnet?«
Ich nippte an dem Whiskey, den er mir gebracht hatte, und wappnete mich für eine lange, melancholische Zukunft des Sammelns und Verlierens von Büchern. So schlimm konnte es nicht sein. Seine Frau hatte die Bibliothek in den letzten Jahren finanziert, und jetzt, wo er sie verloren hatte oder sie demnächst an die Scheidungsanwälte verlieren würde, hatte er immerhin noch die Gesellschaft der Gelehrten, die hier seinen Geschichten lauschten. Überall in New York, auf der ganzen Welt, erlitten alte Männer viel schlimmere Schicksale. Armut, Krankheit oder Einsamkeit. Und sie hatten keine Büchergemeinschaften, bei denen sie sich ausweinen konnten.
Das sagte ich mir, obwohl ich ihn in Wahrheit mochte. Er hatte eine ungewohnt aufrechte Art.
»Interessieren Sie sich für Edith Wharton?«, fragte er.
»Ich mag ihre Romane. Sonst habe ich nichts von ihr gelesen.«
»Die meisten Menschen Ihres Alters kennen sie gar nicht mehr. Man sagt mir, dass sie heutzutage nicht mehr in Mode ist. Nicht modern genug. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das so sein soll. Das einzige ihrer Bücher, das noch irgendjemand in seiner Sammlung haben möchte, ist Zeit der Unschuld, aber sie wollen es auch nur, weil es den Pulitzer gewonnen hat. Sie sammeln Reihen. Pulitzer-, Booker- und Nobelpreisträger. Letzten Monat war ein Mann hier, der behauptete, jedes Pulitzer-Sachbuch mit einem blauen Schutzumschlag zu besitzen. Können Sie sich das vorstellen?«
Ich konnte es nicht. Ich versuchte es erst gar nicht. Nach einer Weile erwähnte ich beiläufig das Haus der Freude. Es war ein Buch, das ich in einer anderen Phase meines Lebens oft gelesen hatte. Als ich erstmals nach New York kam und in der Nähe des Brooklyn Museums wohnte, über einem Laden, der jamaikanisches Grillhähnchen mit Besteck und Teller an der Fenstertheke verkaufte. Wenn man mehr davon wollte, brachte man das Geschirr am nächsten Tag sauber zurück. Es war eine lange U-Bahn-Fahrt bis zur juristischen Fakultät an der 116th Street und ich las damals alle möglichen Bücher immer wieder. Edith Whartons waren da am besten. Da konnte man schon mal die Verbindung zur Lokallinie verpassen, wenn man solche Bücher las, und dann musste man zurückfahren oder den ganzen Weg von Harlem laufen.
Aus irgendeinem Grund wollte ich Newton Reddick davon erzählen, aber ich entschied mich dagegen.
»Lily Bart«, sagte er, »ist eine bewundernswerte Figur. So stark. Also suchen Sie nach einer literarischen Sammlung?«
»Natürlich, wieso nicht.«
»Solange sie sich nicht an Preisen orientiert. Nichts Gewöhnliches.«
»Nein, nichts Gewöhnliches.«
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Es war fast Mitternacht.
»Ich interessiere mich auch für juristische Bücher«, sagte ich.
Er blickte tief in sein Glas, möglicherweise immer noch in Gedanken an Edith Wharton oder an die ganzen jungen Leute, die es ablehnten, sie zu lesen, und alle, die ihre Meinung über schöneres Wohnen nie kennen würden. Er brauchte eine Weile, um sich wieder zu sammeln. Ich fragte mich, wie viele Verkäufe ihm in all den Jahren entgangen waren, weil er sich auf diese Weise in seinen Träumen und persönlichen Enttäuschungen verloren hatte.
»Juristische Bücher«, sagte er. »Natürlich. Da kann ich Ihnen behilflich sein.«
»Was würden Sie mir empfehlen?«
»Da gibt es eine ganz fabelhafte Tradition im Bereich der juristischen Schriften. Anwälte sind immer schon großartige Buchsammler gewesen. Da gab es Pforzheimer in Yale, Walter Jr., nicht Carl. Allyn Peck und der Rest von ihnen in Harvard. Es kommt darauf an, welcher Bereich des Rechts Sie interessiert.«
»Ich denke da an etwas Spezielleres als ein paar Bücher von Blackstone.«
»Etwas Spezielleres?«
»Etwas Ausgefallenes. Wäre schön, wenn es etwas Lesenswertes wäre.«
Er brauchte einen Moment, aber als es bei ihm ankam, lächelte er, freundlich und ein wenig abwesend. Er vermittelte mir den Eindruck, dass er viel Zeit darauf verwendet hatte, ausgefallene Dinge zu sammeln, und dabei oft genug schmerzhafte Erfahrungen gemacht hatte. Zusammengerechnet hatte er wahrscheinlich einen Großteil seines Lebens vornübergebeugt in Buchhandlungen verbracht.
»Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen«, sagte er. »Kommen Sie mit mir?«
Zu diesem Zeitpunkt war er schon völlig betrunken. Seine Augen waren glasig, wie ein See am frühen Morgen.
Ich folgte ihm einen Flur entlang und durch eine Reihe Lesesäle, die alle mit Lehnstühlen und mit Büchern gefüllten Einbauregalen ausgestattet waren. Keiner der Räume war besetzt, und da beschlich mich das Gefühl, ein seltsames Gefühl, das ich nicht richtig zu artikulieren oder zu deuten wusste, nämlich dass die Räume, durch die wir gingen, den Büchern gehörten, wie alles in dem Gebäude, und dass es keine Rolle spielte, wessen Name auf einer Besitzurkunde stand oder wer der Gesellschaft beitrat oder auch nicht, dass die Bücher immer da sein würden, genauso wie die alten Männer, die durch die Räume schlurften und sich um sie kümmerten.
Schließlich kamen wir zu dem Ort, den Reddick mir zeigen wollte. Es war ein Raum wie alle anderen, an denen wir bereits vorbeigekommen waren, klein und diskret, im hübschen Stil von Edith Whartons New York eingerichtet. Reddick öffnete die Arme. Er schien zu glauben, dass die Herrlichkeit offensichtlich war.
»Die Sammlung der Prozessschriften«, sagte er.
Es roch nach Herbstfäule. Der Raum hatte kein Fenster und war schummrig beleuchtet.
Er nahm ein Buch aus einem der Regale und reichte es mir. Es war minderwertig gebunden, minderwertig gemacht, geradezu schäbig, nichts, das ich zu sammeln gedächte und in den Regalen meines Büros auszustellen, des imaginären Büros, dessen Einrichtung mich in die Poquelin-Gesellschaft geführt hatte. Der Titel des Buches lautete Das Leben und die Verbrechen des Mordechai Hewitt, dem Mörder von New York. Es war ein Buch zum Prozess. Das ganze obere Regal war damit gefüllt. Von dort trug auch der faulige Geruch zu uns.
Ich gab vor, das Buch durchzublättern, es zu bewundern.
»Das trifft es genau«, sagte ich. »Es ist perfekt.«
»Nicht wahr?«, sagte er. »Es ist wie … wie das Festhalten der Zeit selbst.«
Seit wir den Raum betreten hatten, ging etwas in ihm vor. Wie eine Beschleunigung des Blutstromes. Er wirkte zwanzig Jahre jünger, was mich an die Frau denken ließ, die er im Begriff war zu verlieren. Selbst wenn er diese paar Jahrzehnte hätte abwerfen können, verband ihn nichts mit ihr. Das war die unumstößliche Wahrheit.
»Könnten Sie mir so etwas wie das hier verkaufen?«
»Ja«, sagte er feierlich. »Nicht diese, aber es gibt andere. Eine ganze Menge andere.«
»So viele, wie Sie entbehren können.«
»Es freut mich, dass Sie das zu schätzen wissen. Ehrlich.«
Ohne erneut gefragt werden zu müssen, fand er einen Notizblock und einen Kugelschreiber auf dem Lesepult in der Ecke des Raumes und begann zu schreiben. Als er fertig war, riss er das Blatt aus dem Block und überreichte es mir. Er hatte zehn Titel aufgeschrieben und neben jeden eine Anmerkung mit dem Verlag und einer Jahreszahl, vermutlich das Jahr, in dem das Buch gedruckt worden war, und schließlich eine Spalte mit den jeweiligen Preisen. Er hatte die Zahlen nur schwach gestrichen, als ob es ihn in Verlegenheit gebracht hätte, es überhaupt erst tun zu müssen, als ob wir uns beide dafür schämen müssten, so profan zu sein. Es waren unglaublich teure Hefte.
»Diese Bücher wären ein ausgezeichneter Auftakt zu einer spezialisierten Sammlung«, sagte er. »Nehmen Sie das mit nach Hause. Sehen Sie sich die Bände an, denken Sie über die Summen nach. Überlegen Sie. Dann rufen Sie mich an. Wir werden das schon hinkriegen.«
»Was hinkriegen?«, fragte ich ein wenig dümmlich.
»Ihre Bibliothek«, sagte er. »Das ist erst der Anfang.«
Ich fragte, ob es ihm etwas ausmachen würde, den Zettel mit seinem Namen zu unterschreiben. Als Andenken.
Er tat es mit Freude, ohne es zu hinterfragen oder Verdacht zu schöpfen. Wir waren an der Schwelle zu einem großen Abenteuer, er und ich. Natürlich sammelten wir Souvenirs.
Ich bedankte mich und steckte den Zettel in meine Hosentasche. Er war nun Beweismaterial.
Bevor ich ging, wollte er mir die Hand schütteln, doch ich fand einen Weg, es zu vermeiden, ohne dabei unhöflich zu sein.
2
Damals dachte ich, dass man kaum leichter Geld verdienen konnte. Am darauffolgenden Tag tippte ich meine Aussage und die eidesstattliche Erklärung, fügte Reddicks handgeschriebenen und signierten Zettel mit dem Angebot als Beweisstück A hinzu und mailte die Dokumente an Shannon Rebholz von Rebholz und Kahn, Anna Reddicks Scheidungsanwältin. Eine Woche später tauchte ein Kurier mit einem versiegelten Manila-Umschlag an meiner Tür auf. Er beinhaltete feines Briefpapier und eine Rolle mit Hundertdollarscheinen, fünfzig Stück davon. Zusammen mit dem Vorschuss machte das also fünfzehntausend Dollar. Keine schlechte Ausbeute für ein paar Stunden Arbeit. Ich steckte das meiste davon unter die Matratze und nahm mir vor, den Anleihenmarkt so bald wie möglich unter die Lupe zu nehmen. Mit dem, was übrig blieb, lud ich Ulises Lima zu Steaks im Peter Luger’s ein. Auf diesem Weg wollte ich mich bei ihm dafür bedanken, mir einen so unkomplizierten, aber lukrativen Fall vermittelt zu haben. Er bestellte ein Porterhouse mit Ofenkartoffeln, und gegen Ende des Abends, nachdem wir beide eine ganze Menge getrunken hatten, bestand er darauf, einen Toast auszusprechen. Er begann als Trinkspruch über Loyalität und Freundschaft und endete damit, dass er über Jorge Luis Borges und seine frühe Lyrik sprach, wie furchtbar sie war, so schrecklich, dass sie Teil eines großen Streiches sein musste, den der große Mann den Argentiniern gespielt hatte. Den Rest des Abendessens verbrachten wir damit, zu überlegen, ob es einen Sinn hinter diesem Streich geben könnte und ob eine erfundene Enzyklopädie wie der Codex Seraphinianus oder gar ein Haufen Gauchos involviert gewesen war. Es war einer dieser Abende, an denen wir glücklich und satt waren. Die Arbeit hatte sich einfach so ergeben, ohne dass einer von uns beiden sie hätte suchen müssen.
Zu dem Zeitpunkt war Ulises wahrscheinlich mein engster Freund in der Stadt, aber wenn man mich gefragt hätte, wie wir uns kennengelernt hatten, hätte ich es nicht vermocht, mich daran zu erinnern. Er behauptete, dass es in einer Buchhandlung auf der Lower East Side war, die Taschenbuchkrimis und anarchistische Literatur verkaufte, aber er konnte sich nicht an den Namen erinnern. Er verwechselte mich dabei mit jemand anderem. New York war damals gespickt mit kleinen, sterbenden Läden und es hätte genauso gut ein Schallplattenladen, eine Imbissbude oder ein Zeitungskiosk gewesen sein können. Ulises hatte einen scharfen Verstand, der sich ständig falsch an etwas erinnerte. Das war es, was ihn zum Poeten mache, wie er gerne sagte. Würde er sich in der richtigen Reihenfolge an Geschehnisse erinnern, wäre er Detektiv oder Laborassistent geworden. Erinnerungen seien spekulativ. So lautete jedenfalls seine Theorie, die auf Umwegen mit der Poesie von Borges und einigen der unbekannteren Werke von Roberto Bolaño, einem anderen von Ulises bewunderten Schriftsteller zusammenhing. Bolaño war zwei Jahre zuvor gestorben, irgendwo in Barcelona, vermeintlich an Leberversagen. Seither war er ziemlich populär geworden und manchmal sah man Leute in der U-Bahn, die versuchten, seine Bücher im spanischen Original zu lesen, insbesondere 2666, den Roman, den er zu der Zeit schrieb, als er auf die neue Leber wartete, die ihn allerdings nie erreichte. Für Ulises, der sich nach einer Figur Bolaños nannte, war das äußerst unangenehm. Er hatte sich den Namen verpasst, als er zum ersten Mal nach New York kam, und darauf gebaut, dass der Literaturhinweis für lange Zeit, vielleicht für immer, im Dunkeln bleiben würde. Sein wirklicher Name war Juan Andres Henriquez Houry. Alle nannten ihn aber Ulises. Er hatte überall in der Stadt Freunde, einen ganzen Haufen außergewöhnlicher Leute.
Nach den Steaks gingen wir ins Fortaleza Café und sprachen weiter über die Arbeit. Es war hauptsächlich Stammpublikum da. Manche von ihnen kannte er. Andere wiederum waren Leute, für die ich in der Vergangenheit Jobs erledigt hatte, Bekannte, Nachbarn und die Frau, die die Bäckerei auf der Graham Avenue führte und die im Sommer zuvor eine Zeichnung des blauen Ofens, den ihr ihre Großmutter vererbt hatte, als Markenzeichen hatte anmelden wollen. Ein einfacher Fall, der nur die Einreichung beim Patentamt erforderte und mir eine Zeit lang eine Menge kostenloser Muffins einbrachte. Warme, üppige Muffins, die vor Beeren nur so überquollen. Sie trug einen weiten Pullover und tanzte mit einer anderen Frau, die mir bekannt vorkam. Möglicherweise arbeitete sie auch in der Bäckerei. Rund um die Handgelenke waren ihre Ärmelenden mit Puderzucker bestäubt. Es war kurz nach dreiundzwanzig Uhr und im Fortaleza gab es unter der Woche Live-Musik. Sie verlangten dafür keinen Eintritt, ließen nur einen Hut herumgehen. Wenn man wollte, konnte man ihn ignorieren, doch Miss Daniela, die Besitzerin und Managerin des Cafés, die aus Fortaleza stammte oder auch nicht – ich habe das nie überprüft –, saß an der Bar und beobachtete ganz genau, wer spendete und wer nicht. Viele taten es nicht, aber die habe ich nie wiedergesehen.
»Ihr zwei seid immer am Arbeiten«, sagte Miss Daniela, als Ulises und ich an der Bar hockten. Sie saß drei Stühle weiter und beobachtete die Band, die aus einer Gitarre, Drums und einer Sängerin bestand und Samba zum Besten gab. Immer wenn ein Zug über die Williamsburg Bridge fuhr, beschleunigte die Band das Tempo und spielte lauter, kämpfte wacker gegen das Rattern der Gleise und des Brückenunterbaus an, das bemüht war, sie zu übertönen, was aber nie gelang. Es geschah immer sehr natürlich. Sie spielten jeden Donnerstagabend, von ungefähr einundzwanzig Uhr bis Mitternacht.
Miss Daniela setzte sich um, um uns näher zu sein. Näher zu Ulises und zur Band.
Ulises erzählte ihr, worüber wir diskutierten. Den Newton-Reddick-Fall. Borges. Scheidung. Sie hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir arbeiteten – es war nur ein Witz gewesen. Sie mochte es, Ulises aufzuziehen. Sie seien Nachbarn, wie sie gerne sagte, sie aus Brasilien und er aus Venezuela, sie würden schon eine Grenze teilen, wieso nicht auch hin und wieder das Bett; zum Lachen, zum Spaß, um in Übung zu bleiben? Sie trug ihr Haar zu einem großen, altmodischen Knoten, den sie mit Seidentüchern umwickelte. Im Vorjahr war sie zweimal wegen Verstößen gegen das Revue-Gesetz zu Geldstrafen verurteilt worden. Das Revue-Gesetz in New York war so wie sonst nirgendwo im Land, vielleicht wie nirgendwo auf der Welt. Man durfte nur in wenigen, über die Stadt verteilten Lokalen tanzen, in Clubs und in alten Discos, von denen einige nur noch aufgrund der Tanzgenehmigung über die Runden kamen. Die Strafen waren nicht allzu hoch, doch sie summierten sich für ein kleines Lokal wie das Fortaleza, das nur zehn Tische, die Barhocker und eine Küche mit vier Herdplatten hatte. Die Stadtverwaltung schickte unter der Woche gerne Polizisten in Zivil vorbei, um die Zuwiderhandelnden zu erwischen. Das Revue-Gesetz war verabschiedet worden, um die schwarzen und lateinamerikanischen Stadtteile besser unter Kontrolle zu haben. Es war genug, um eine Geschäftsfrau in den Wahnsinn zu treiben, besonders eine, die Musik anbot, speziell Samba. Aber Miss Daniela ertrug die Vorstellung nicht, ihr Lokal verändern zu müssen. Ich sagte ihr, dass ich es, wenn sie die nächste Strafe erhielt, für sie ausfechten würde, pro bono. Sie fragte, ob sich Ulises diesem Kampf anschließen würde, pro bono, und er sagte, er würde es versuchen, es wäre sogar eine Ehre, es zu tun, doch dass man die Stadtverwaltung nicht bekämpfen könne. Das hatte er irgendwo aufgeschnappt.
»Wisst ihr, ich habe mich bereits von fünf Männern scheiden lassen«, sagte Miss Daniela. »Zwei in Brasilien, drei hier. Jeder von ihnen ein klasse Typ. Keiner nahm mir etwas weg. Keiner nahm sich einen Anwalt. Unterschrieben einfach die Papiere, wenn ich sie vorbeibrachte. Wenn ich sie an den Sonntagen dann in der Kirche sah, zogen sie alle den Hut.«
»Du hast gute Männer für Scheidungen gewählt«, sagte ich.
»Das muss man. Man muss darüber nachdenken, wie es enden wird.«
»Du hättest Prozessanwältin werden sollen. Genau das bringen sie uns nämlich bei.«
»Anwälte tanzen nicht«, sagte sie. »Keine Musik, kein Tanzen. Nur Strafen, Bußgelder, Scheidungen.«
Sie hatte uns zur Gänze durchschaut. Dennoch fragte sie, ob ich mit ihr tanzen wolle.
»Und wie ist das mit der Strafe?«, fragte ich.
»Ich habe hier meinen Rechtsanwalt«, sagte sie.
Sie klopfte Ulises flirtend auf die Schulter, obwohl er uns längst nicht mehr zuhörte. Er sprach mit einer Kellnerin, die er kannte und ein paar Jahrzehnte jünger als Miss Daniela war, aber was wusste sie schon davon, wie man eine Ehe begann oder sich scheiden ließ? Miss Daniela und ich gingen bis zum Ende der Bar, wo gerade noch genug Platz zum Tanzen war, zwischen dem Servicebereich und der Ecke, in der sich die Band postiert hatte. Der J-Zug fuhr über unsere Köpfe hinweg und der Rhythmus beschleunigte, ich hatte keine Chance mitzuhalten, obwohl ich mich bemühte und dabei ordentlich ins Schwitzen kam. Miss Daniela bewegte sich anmutig. Der Duft der Käsebällchen, die sie immer brieten und den gesüßten Getränken beilegten, lag in der Luft. Hinterher ließ ich einen Zwanziger in den Hut gleiten. Es war viel mehr, als ich sonst spendete, aber wir feierten den Abschluss eines erfolgreichen Falls. Das war mein Argument, als ich den Schein einwarf und dem Hut dabei zusah, wie er verschwand.
»Zwanzig Mücken«, sagte Miss Daniela. »Denkst du, dass ich mir heute eine Strafe einfange?«
Ich erwiderte, dass ich das nicht wisse. Niemand wusste so etwas.
»Sind irgendwelche Polizisten hier?«, fragte sie. »Was siehst du?«
»Nein«, sagte ich. »Die sind alle auf dem Polizeiball.«
»Was soll das sein?«
»Der Weihnachtsball der Wohltätigen Brüder. Sie halten den immer im Dezember ab.«
»Und keiner von ihnen tanzt? Das klingt nach einer Party.«
Vielleicht tanzten sie ja. Ich wusste nichts darüber. Ich kannte kaum Polizisten. Als Anwalt sollte man eigentlich Freunde bei der Polizei haben, aber ich konnte mich nie dazu durchringen, mich mit ihnen anzufreunden. Ich kannte ein paar Leute vom FBI, Anwälte gewisser Spezialeinheiten, doch von denen tanzte niemand, nicht dass ich es je gesehen hätte. Ich war dabei, mir den Polizeiball auszudenken, ich erfand ihn, obwohl es sich wie etwas anhörte, das sie tun würden, nämlich in Fahrgemeinschaften von Staten und Long Island mit ihren Gattinnen in die Stadt zu kommen, dann stockbesoffen nach Hause zu fahren, dabei Rehe zu überfahren und am nächsten Morgen Blut auf dem Kotflügel oder auf dem Rand der Windschutzscheibe zu entdecken und sich zu fragen, was sie getan hatten, ihre Frauen zu fragen, die es auch nicht wussten, ihre Gewerkschaftsvertreter anzurufen, um sicherzustellen, dass es geheim gehalten werden konnte und dass keine Unfälle gemeldet worden waren. Und nein, ich hatte nie einen Sinn darin gesehen, auf Polizeidienststellen herumzulungern und dabei neue Freunde zu finden.
»Keine Scheidungen mehr für dich«, sagte Miss Daniela. »Dafür bist du nicht gemacht, in Ordnung?«
Ich pflichtete ihr bei, obwohl wir wahrscheinlich unterschiedliche Gründe hatten, es so zu sehen.
Ulises und ich blieben bis zur Sperrstunde und begleiteten die Kellnerin dann zu Fuß nach Hause, die Frau, von der er wusste, dass sie alle zehn Tische allein im Griff hatte, die Schwerstarbeit leistete, die die Drinks und die Käsebällchen herumtrug, die auch pão de queijo genannt wurden. Ihr Name war Gloria Almeida und sie lebte auf der North Eleventh, in der Nähe der Brauerei, fast eine halbe Meile Umweg, aber es machte uns nichts aus, wir wollten sie einfach nach Hause begleiten. Für die Nacht war Schnee vorhergesagt, aber er ließ noch auf sich warten.
3
Es war eine andere Woche, ein ruhiger Mittwoch und ich wollte hinausgehen und mir die weihnachtlich dekorierte Stadt ansehen, also lief ich über die Brücke und dann nördlich in Richtung des Sotheby’s Auktionshauses auf der York Avenue an der Upper East Side, nur einen Steinwurf vom Fluss entfernt. Sotheby’s war der perfekte Ort, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie hatten immer wieder neue Kunst ausgestellt und doch gab es eine übersichtliche Ordnung, die sich nie wirklich zu verändern schien. Im Erdgeschoss und im ersten Stock befanden sich die Impressionisten, die Modernisten und die pazifischen Skulpturen. Darüber dann die zeitgenössischen Gemälde und wenn man weiter aufwärtsging, konnte man Abbildungen und eine Auswahl der verschiedenen Privatangebote sehen, und irgendwo in einem Raum, den ich nie entdeckte, die Edelsteine. Wenn man es den ganzen Weg hinauf in den neunten Stock schaffte, gelangte man in ein Café, in dem es einen ausgezeichneten, bitteren Espresso gab. Gratis. Es war also definitiv kein schlechter Ort, um den Nachmittag zu verbringen, und hin und wieder ergatterte ich dort auch einen Job. Ich kannte eine Frau in der Uhrenabteilung. Tatsächlich leitete sie die Uhrenabteilung und hatte mir im vergangenen Jahr einen interessanten Fall zugeschanzt: Eine Lieferung Uhren musste vom Zoll abgefertigt werden, aber niemand wusste, wer der Besitzer der Uhren war, man kannte nur den Empfänger – Sotheby’s New York – und wusste, woher sie kamen – Marokko via Lausanne. Ich überlegte, sie zum Mittagessen einzuladen, doch ich ließ mir Zeit, in den sechsten Stock zu gelangen, um sie zu fragen. In der Abteilung für Privatverkäufe waren einige Schiffszeichnungen ausgestellt. Nicht der heldenhafte, britische Pomp, sondern Schiffszeichnungen aus Nordindien oder der zentralasiatischen Tiefebene, Gebiete also, in denen es weit und breit kein Wasser gab, weshalb die Zeichnungen also Träume von Menschen darstellten, die das Meer in ferner Vergangenheit ein- oder zweimal gesehen hatten. Als ich endlich im sechsten Stock ankam, war es kurz vor vierzehn Uhr.
Katya, die Frau, die ich in der Uhrenabteilung kannte, sagte, dass sie nicht wegkönne. Sie hatte vier oder fünf Geräte auf ihrem Schreibtisch stehen, die für mich undurchschaubare Aufgaben erledigten. Im ganzen Büro herrschte ein reges Treiben.
»Das ist schon in Ordnung«, sagte ich. »Nächstes Mal rufe ich vorher an oder komme zum Bieten.«
Sie muss etwas an meiner Stimme bemerkt haben. Einen Unterton. Sie war es gewohnt, Uhren zuzuhören, mit all ihren komplizierten Mechanismen und winzig kleinen Störungen, die einem verrieten, was man wissen musste. Sie fragte, wie es Xiomara ginge. Sie hatte sie bereits eine Zeit lang nicht mehr gesehen.
»Es geht ihr gut«, sagte ich. »Sie hat demnächst eine Show in Paris.«
»Welche Show?«
Ich erzählte ihr von der Ausstellung. In Englisch hatte man sie als »Young Voices of Latin America« bezeichnet – auf Französisch und Spanisch hatte man sie unterschiedlich betitelt. Ein hochkarätiges Ereignis, worüber man in den Kunstzeitschriften und vielleicht darüber hinaus in den Feuilletons in Frankreich und anderswo berichten würde. Einige Künstler könnten sich so einen guten Ruf machen, darunter auch Xiomara. Das Event wurde im Centre Pompidou abgehalten. Als ich mit Katya sprach und ihr schilderte, was ich über die Ausstellung wusste, täuschte ich aus irgendeinem Grund vor, eine Meinung über das Gebäude, das Centre Pompidou, zu haben, welches ich noch nie besucht oder gar gesehen hatte. Das war so eine Sache, über die Xiomara gelacht hätte. Sie war der Meinung, dass dies das Herzstück der Arbeit eines Anwalts sei, eine Meinung über Ereignisse und Menschen, die er noch nie gesehen hat, vorzutäuschen; und in dieser Hinsicht passten wir gar nicht so schlecht zusammen, sie und ich. Unsere Tätigkeiten waren sich sehr ähnlich.
»Sie muss begeistert sein«, sagte Katya.
Ich pflichtete ihr bei. Sie musste es sein. Sie war es. Ich freute mich für sie. Anders konnte es nicht sein. Überall, wo ich in diesem Winter hinkam, fragten mich die Leute nach Xiomara. Sie war etwas, worüber sie reden konnten, wie das Wetter oder die Verspätungen der U-Bahn. Sie war bereits über einen Monat weg, und zu Hause, in der Wohnung, fand ich ihre Skulpturen immer noch manchmal an merkwürdigen Plätzen, nackte Miniaturbüsten in klassischen Posen, ihr Ausdruck einer der Verzückung oder Folter oder irgendwo dazwischen, alle aus den raffiniertesten Materialien, die sie auftreiben konnte, gehauen, einschließlich eines Walknochens, den sie von einem pensionierten Galeerenkoch bezogen hatte, der im Seemannstrakt des Prospect Park YMCA wohnte. Vom Hals abwärts waren sie schlicht und klassisch dargestellt, doch sie trugen Totenmasken. Bunte und furchterregende Masken. Früher fand ich sie immer wieder zwischen Sofakissen oder in der Küche, hinter einer Schublade eingeklemmt, die sich nicht schließen ließ, egal wie fest man drückte.
»Sag mal«, sagte ich zu Katya, »gibt es unter den Uhren in eurer Sammlung nicht auch gestohlene?«
»Ich hoffe nicht.«
»Aber was, wenn sie es sind.«
»Dann ist deine Nummer die, die ich als zweite wähle«, sagte sie. »Spätestens als dritte.«
Die Aussicht auf einen langen, feuchten Nachmittag breitete sich vor mir aus. Zu Hause hatte ich nichts zu tun. Und da Weihnachten vor der Tür stand, wollte niemand einen Rechtsstreit beginnen. Am Wochenende würden alle in Vorfreude auf die Feiertage trinken und einige von ihnen dabei verhaftet werden, und das würde dann Arbeit bringen, doch an einem gewöhnlichen Mittwoch im Dezember liegt weniger Hoffnung in der Luft, und weniger Verzweiflung. Zur Aufmunterung blieb nur Sotheby’s und die Auslagen der Kaufhäuser.
Katya erzählte mir, dass im Haus gerade nicht viel los sei. Alle bereiteten sich auf die saisonalen Veranstaltungen vor. Doch wenn ich wirklich scharf auf Ablenkung sei, so gebe es irgendwo im Haus die Vorbesichtigung einer Bücherausstellung. Sie sagte es so, als wäre es die langweiligste Sache, die sie sich hätte vorstellen können. Im Vergleich zu Uhren schien ihr das offenbar eine ziemlich trostlose Angelegenheit zu sein.
»Schau in ein paar Wochen bei mir vorbei«, sagte sie. »Dann gehen wir so oft zu Mittag essen, wie du bezahlen kannst.«
Ich sagte, dass ich das tun würde. »Ich rufe dich nach Neujahr an.«
»Im Januar bin ich in Miami«, erwiderte sie.
»Um was zu tun?«
»Die sind dort verrückt nach Uhren. Und ich hasse Jänner in New York. Und dort schneit es nie.«
Sie ließ einen gerne mit derart kryptischen Bemerkungen zurück, sodass man sich eingehend fragen musste, was sie gemeint hatte. Sie war eine interessante Frau und ich war enttäuscht, nicht mit ihr zu Mittag essen zu können, obwohl ich in Wahrheit keinen Hunger hatte. Der Espresso im neunten Stock hatte ihn gestillt.
Die Vorbesichtigung der Bücherausstellung war im Untergeschoss. Sie hatten ganze Arbeit geleistet und den Raum mit altmodischen Details dekoriert, die mich an Newton Reddick und Edith Whartons Buch denken ließen, das er mir beschrieben hatte, das Buch, das sie über schöneres Wohnen und Inneneinrichtung geschrieben hatte, das Buch, das ihn fürs Sammeln begeistert hatte. Wahrscheinlich musste ich auch deshalb an ihn denken, weil es eine Buchauktion war und es so aussah, als ob so ziemlich jeder New Yorker Buchhändler bei der Vorbesichtigung anwesend war, und alle trugen sie Tweed in der einen oder anderen Ausführung. Tweed-Jacken, Tweed-Hosen, es gab sogar einige Tweed-Westen. Es war alles sehr festlich gehalten und man konnte sehen, dass die Auktion in ihrer Welt eine große Sache war und sie alle glücklich waren, da zu sein. Mir kam in den Sinn, dass Reddick anwesend sein könnte und er wahrscheinlich nicht sehr erfreut darüber wäre, mich zu sehen, nicht wenn seine Anwälte den endgültigen Scheidungsantrag bereits erhalten hatten, was höchstwahrscheinlich der Fall war. Es waren schon einige Wochen vergangen und Scheidungsanwälte waren nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt. Ich blickte mich um, konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Die meisten Anwesenden waren offensichtlich Raritätenhändler und Buchverkäufer. Anwälte waren nicht darunter, zumindest keine, die ich kannte, und so verteilte ich meine Visitenkarte im Hinblick darauf, dass sich hier die Gelegenheit ergeben könnte, in einer neuen Sparte Fuß zu fassen: als Finder von Büchern und von Betrunkenen oder Geschiedenen, die sie gelegentlich mitgehen ließen. Ich mochte Bücher. Ulises pflegte zu sagen, dass Balzac noch nie einen Menschen so viel Geld gekostet habe wie mich. Wie wahr: Ich las derartige Bücher äußerst gern, nicht nur Balzac, sondern eine ganze Reihe von Autoren mit überdimensionierten, unausgegorenen und etwas irrwitzigen Ambitionen. Vermutlich hatten mich diese Bücher zu einer ganzen Menge seltsamer Ideen inspiriert, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, was ich tun und was ich besser lassen sollte. Auf diese Weise war eine Stange Geld flöten gegangen – in Form von Gehalt, das damals in den Wirtschaftskanzleien noch immer recht üppig war, und anderen Bezügen, aber das machte mir nichts aus. Ich war zufrieden mit meiner Solo-Kanzlei. Man durfte lesen, was man wollte, und wenn es nichts anderes zu tun gab, konnte man einfach zu Sotheby’s gehen und dort neue Welten entdecken. Offenbar war es eine weihnachtliche Tradition. Die Sotheby’s-Auktion für schöne Bücher, Drucke und Americana.
Ausgestellt waren einige wunderbare Bücher und einige, von denen ich noch nie gehört hatte, obwohl ihr Rufpreis hoch, beinahe absurd hoch war. Nur war es eben Sotheby’s, kurz vor Weihnachten, und was die Leute von der Upper East Side kaufen würden, wusste man sowieso nie. Mein Favorit war eine Erstausgabe von Mark Twains Der berühmte Springfrosch von Calaveras. Es war eine besondere Ausgabe mit einem hübschen grünen Leineneinband, in dessen linker unterer Ecke ein zum Sprung ansetzender Frosch in Gold geprägt war, der wie ein in die Höhe schießendes Wappentier aussah. Es war offensichtlich Mark Twains erstes Buch, obwohl er zu dem Zeitpunkt bereits berühmt war, weil die Erzählung zuvor in einer Zeitung, in der New York Saturday Press, unter dem Titel »Jim Smiley und sein Springfrosch« abgedruckt worden war und sich die Leute darum rissen, es in einem langlebigeren Format zu kaufen. Die Frau, die für die Bücher Twains zuständig war, erzählte mir all das und erklärte auch, dass es ungewöhnlich war, Erstausgaben einer Ära, in der so viel Sorgfalt auf den Buchdruck gelegt worden war, zu finden, da man den historischen Wert der Autoren typischerweise erst lange nach deren Tod erkannte.
»Nehmen Sie Melville«, sagte sie. »Obwohl er eine Zeit lang recht populär war, hat das niemanden wirklich interessiert.«
Ich sagte, dass das für die meisten von uns gelten könne, und sie lächelte und fragte mich, ob es etwas anderes gebe, das ich gerne sehen würde, doch ich lehnte ab, ich hatte bereits zu viel ihrer Zeit in Anspruch genommen. Es gab ernsthafte Interessenten, die darauf warteten, über Twain und dessen außergewöhnliches Vermächtnis zu reden. Ich wollte sie ihnen nicht vorenthalten. Auf dem Weg nach draußen hielt mich einer der Händler auf. Er trug Tweed, wie alle anderen auch. Eine Sportjacke. Abgesehen davon wirkte er zu jung für dieses Umfeld. Vierzig oder fünfundvierzig vielleicht.
»Das sind Sie«, sagte er. Er hielt eine meiner Visitenkarten in der Hand.
Ich bot ihm meine Hand an, doch er schien es nicht zu bemerken. Es sah so aus, als würde er mit sich kämpfen. Einen Moment lang dachte ich, er würde gleich ein Geständnis ablegen. Er hatte diesen glasigen, abwesenden Blick, der oft einer entlastenden Aussage vorangeht. In Filmen und sogar in Büchern werden die Leute von Anwälten immer wieder davor gewarnt, ein Geständnis abzulegen, aber im wirklichen Leben sieht die Sache anders aus. Im wirklichen Leben will man alles hören, was es zu hören gibt, und danach muss man dann entweder Kompromisse eingehen oder eben nicht. Das ist das Wesentliche an diesem Job: eine schnelle Entscheidung treffen und mit den Konsequenzen leben. Ich war neugierig und wollte ihn anhören.
»Sie haben die Twain-Bücher bewundert«, sagte er.
Ich erzählte ihm, dass mich Der berühmte Springfrosch besonders beeindruckt hatte, den ich allerdings als Der unglaubliche Springfrosch oder irgendwie anders, ähnlich, aber nicht ganz korrekt wiedergab. Es machte keinen Unterschied. Er hörte mir nicht genau zu. Er kämpfte immer noch mit sich.
»Na ja, ich war jedenfalls hier drüben«, sagte er. »Und da habe ich mich einfach gefragt, wie Sie nachts schlafen. Ich dachte, heftiger Beruf, den Sie da ausüben. Eine besondere Art, sein Geld zu verdienen.«
Er betrachtete meine Visitenkarte, als ob das bedruckte Papier für mein Einkommen verantwortlich wäre.
»Es muss sich um ein Missverständnis handeln«, sagte ich.
»Sie sind einer der Anwälte. Ein Winkeladvokat. Ich weiß, wer Sie sind.«
Ich dachte, er würde mir gleich einen Schlag verpassen. Seine Hände zitterten heftig.