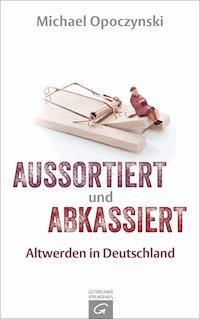15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Sprache: Deutsch
Schauplatz Berlin: voller Einsatz gegen Mietwucher und Immobilienhaie Die Szymanskis waren jahrzehntelang rechtschaffene Mieter. Doch nun wurde ihre Wohnung an einen Investor verkauft, der die beiden zu vertreiben versucht – mit perfiden Mitteln. Kein Einzelfall auf dem Immobilienmarkt in Berlin: Mieter werden terrorisiert und aus ihren Wohnungen vertrieben, um Luxussanierungen Platz zu machen. In diesem packenden Wirtschaftskrimi greift Michael Opoczynski ein topaktuelles Thema auf, das viele Menschen in Deutschlands Städten betrifft: Das Geschäft mit Mietterror und Immobilien-Spekulation boomt. Kann die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen für Gerechtigkeit sorgen? - Nicht immer legal, aber effektiv: die Methoden des Ermittler-Teams bringen die Immobilien-Kartelle in Bedrängnis - Miet-Terror in Berlin: fundierte Insider-Kenntnisse machen diese Kriminalgeschichte zum Politthriller - Band 3 der Krimireihe: der dritte Fall für die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen Spannender Krimi mit einer Portion Gesellschaftskritik Michael Opoczynski war mehr als zwanzig Jahre lang Leiter und Moderator der ZDF-Sendung WISO. Hier erlebte er wahre Betrugsfälle, Wirtschaftskriminalität und himmelschreiende Ungerechtigkeit aus erster Hand. Auch in seinen aktuellen Berlin-Krimi fließen seine Kenntnisse aus dem investigativen Journalismus mit ein. Im Kampf David gegen Goliath sorgt Opoczynskis unkonventionelle Einsatztruppe für Waffengleichheit. Um sich für die Wehrlosen und Unschuldigen einzusetzen, ist ihnen jedes Mittel recht – unblutig, aber mit Nachdruck Fesselnd, unterhaltsam und gleichzeitig aufrüttelnd – eine Leseempfehlung für alle Krimi-Fans!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Opoczynski
Eigenbedarf
Der dritte Fall für die Gesellschaftfür unkonventionelle Maßnahmen
Kriminalroman
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2021 Benevento Verlag bei Benevento Publishing München - Salzburg,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagmotiv: © Getty Images
ISBN 978-3-7109-0066-2
eISBN 978-3-7109-5076-6
Sämtliche Personen und Handlungen in diesem Buchsind frei erfunden. Sollten sich Ähnlichkeiten zulebenden Personen oder realen Ereignissen ergeben,so sind diese rein zufällig.
Inhalt
Eigenbedarf
»Na, Alter?«
Vural Tabak stand vor dem Laden seines Vaters in Neukölln. Teepause an einem kühlen und sonnigen Oktobertag. Tabak trug einen weißen Kittel, seine Arbeitskleidung. So stand er an der Fleischtheke des Supermarkts Istanbul, verkaufte Lammfleisch und Hammel, auch Kalbfleisch, scharf gewürzte Knoblauchwürste. Aber kein Schwein! Es war ein türkischer Supermarkt, darauf legte sein Vater Wert. Er wurde von den in diesem Ortsteil wohnenden türkischen und arabischen Kunden gut besucht, aber auch Deutsche kamen, weil es vieles gab, was sie für den Alltag brauchten, und vor allem, weil sie freundlich bedient und beraten wurden. Der Laden gehörte seinem Vater Mehmet Tabak, er hatte ihn in den Achtzigern gegründet. Es gab acht Angestellte. Er, Vural Tabak, war der Juniorchef.
»Hörst du mich?«
Er hielt einen halb vollen dampfenden Pappbecher in der Hand und ließ seine Gedanken schweifen, zum Beispiel was er ändern müsste an dem Laden, vor allem am Sortiment – und das alles ziemlich bald. Wenn sein Vater ihn nur ließe. Aber der Alte wehrte immer ab und vertröstete ihn. Lange geht es nicht so weiter, dachte Tabak gerade, da sprach ihn der Typ von der Straße schon wieder an.
»Alter! Was’n los? Ich rede mit dir!«
Tabak drehte sich weg. Es gab in Berlin mehr als in anderen Städten eine große Zahl von Sonderlingen und Spinnern, die friedlich vor sich hin lebten und die anderen in Ruhe ließen. Aber es gab auch welche, die lästig oder sogar aggressiv waren. Dann war es am besten auszuweichen. Widerworte hätten Eskalation bedeutet, Geschrei, vielleicht sogar Kampf. Nicht dass Tabak hätte Angst haben müssen. Er war Kampfsportler, durchtrainiert, groß und muskulös, leitete in seinem Sportverein einen Übungskursus für Jugendliche. Im Gegenteil: Er musste aufpassen, es bei einer tätlichen Auseinandersetzung nicht zu übertreiben. Tabak war gewissermaßen überqualifiziert.
Das Wegdrehen nützte nichts.
»Ich kann dir helfen«, sagte der Fremde.
Es nützt nichts, dachte Tabak. Der verschwindet nicht von allein. Er wandte sich dem Typ zu. »Was willst du?«
»Dir helfen!«
»Fuck!«, sagte Tabak. Er stand vor dem Supermarkt seines Vaters. Und sagte es einfach so vor sich hin: »Fuck!« Er sprach in die Luft, ohne den lästigen Typ, der sich an ihn rangemacht hatte, direkt anzusprechen oder ihn eines Blickes zu würdigen. »Fuck« benutzte er selten, eigentlich nur in dringenden Fällen.
»Bruder, ich weiß, wo’s brennt.«
Tabak blickte die Straße auf und ab. Es war viel los in der Karl-Marx-Straße. Schließlich war sie eine der Hauptadern von Neukölln. Viele Autos auf der Fahrbahn, viele Menschen zu Fuß, manche mit Fahrrädern, mit Tüten und Taschen. Versteckten sich in der Menge noch andere? Hatte der Typ vielleicht Komplizen? War das eine Anmache? Oder eine Verwechslung? Was sollte er tun?
Der Fremde stand einfach nur da, sah ihn an und schwieg. Nein, das war ganz sicher keine Verwechslung. Der andere schaute ihn an.
Er war ein arabisch aussehender mittelalter Mann, schwarze Haare, Undercut, gepflegter Bart, in schwarzen Jeans, schwarzem T-Shirt mit der Aufschrift »Converse« und mit weißen Sneakers. Sehr weißen Sneakers. Die nur so weiß sein konnten, weil sie entweder ganz neu waren oder weil sie vielleicht gerade frisch gewaschen worden waren. In der linken Hand schlenkerte er einen Autoschlüssel an einer längeren Kette. Einmal nach links geschlenkert, dann nach rechts. Wie eine Gebetskette. Die Automarke konnte Tabak nicht erkennen, aber es war ein ziemlich fetter Schlüssel mit eingebauter Elektronik, wie das heute bei den dicken Autos üblich war. Teuer, dachte Tabak und entschied sich für Kontaktaufnahme. Er sagte betont lässig: »Ja?«
Schweigen.
Also versuchte er es weiter: »Ja? Wo brennt’s denn?«
Der Typ kam näher, zu nah, Gesicht vor Gesicht, so nah sollten sich Fremde eigentlich nicht kommen, und sagte sehr leise: »Weißt du doch am besten!«
Das war frech.
»Lass gut sein«, sagte Tabak, rückte ein Stück von ihm ab und blickte scheinbar interessiert in seinen Becher. Er sah einen Rest Tee. Dann sagte er: »Ich weiß genug. Ich brauche keine Hilfe.«
Nur eine kurze Arbeitspause hatte er machen wollen, mit dem Becher in der Hand. So machte er das immer: kurz rausgehen aus dem Laden, Tee trinken, ganz selten eine rauchen (diesmal aber nicht) und dann zurück in den Supermarkt. Hinter die Fleischtheke.
Die Situation wurde ihm unheimlich. Der Typ war hartnäckig, stand ihm gegenüber, sie behinderten die vorbeiflutenden Menschen, er war scheinbar freundlich, aber irgendwie nervig. Andererseits: Was konnte der ihm wollen? Tabak war durchtrainiert, in Bestform, und dann auch noch Mitglied in der Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen. Also, was sollte passieren? Er sagte: »Stimmt was nicht mit dir?«
Der andere lachte. Legte Tabak die Hand auf die Schulter. Tabak zuckte zusammen. »Es läuft nicht gut. Das weiß ich. Ich kann dir helfen, und dann läuft’s wieder«, sprach der Fremde leise.
Die Hand auf der Schulter war irritierend, genauso wie das, was der Typ gesagt hatte – weil: Da war was dran! Tabak entwand sich dem Zugriff und schaute sich den anderen genauer an. Zu korpulent, dachte Tabak. Kein Sport. Zu viel Essen. Vielleicht Alkohol. Den könnte ich locker schaffen, dachte er. Dann schaute er ihm in die Augen. Harte Augen. Lieber nicht …, dachte Tabak. Also nahm er Kontakt auf.
»Wer bist du?«
»Ist doch egal!«
»Bist du vom Clan?
»Clan?«
»Kommst du von der Partei?«
»Welche Partei?«
Tabak wurde es zu bunt. Er schüttelte den Kopf, goss den Rest Tee in den Rinnstein und ging auf den Eingang des Supermarkts zu. Die Glastüren schoben sich auf. Er ging hinein.
»Ich kann helfen!« Das hörte er noch, bevor die Türen sich schlossen. Er knöpfte sich nachdrücklich den weißen Kittel zu, warf seinem Vater, der neben einer der Kassen stand, einen Blick zu und ging zur Fleischtheke. »Wer war das? Ein Freund?«, fragte sein Vater. Tabak schüttelte den Kopf und ging weiter.
Vural Tabak, der Juniorchef des türkischen Supermarkts in der Karl-Marx-Straße in Neukölln, hatte Sorgen. Aber reden wollte er nicht. Und einen Fremden an sich ranlassen? Schon gar nicht.
Sie: »Wir wohnen da seit mehr als vierzig Jahren.«
Er: »In einem alten Haus. So eins aus den Gründerjahren. Wir haben eine Wohnung im ersten Stock. Das war mal richtig hochherrschaftlich, viele Zimmer, ein Salon mit Doppeltüren und dann noch eine große Diele.«
Sie (seufzend): »Bestimmt gab’s da früher Stuck an der Decke.«
Er: »Lang her.«
Sie: »Das Haus hatte einen Bombentreffer, beim Luftangriff der Amerikaner, kurz vor dem Ende.«
Van de Loo blickte fragend.
Sie: »Kriegsende!«
Er: »Nein, nein, das haben wir nicht erlebt. Ich war noch Kind und lebte damals in Birkenwerder.«
Sie: »Ich in Königsberg! Bis ’45!«
Die beiden Alten saßen in dem Laden in der Wollankstraße, Ortsteil Gesundbrunnen. Das war die Adresse der Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen. Ein unscheinbares Ladengeschäft in einem Haus, das Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts erbaut und ebenfalls im Krieg schwer beschädigt worden war. In den Fünfzigerjahren mit einfachsten Mitteln wiederaufgebaut. Dabei wurden die Wohnungen aufgeteilt und modernisiert, bis es pro Stockwerk mehrere Drei- oder Zweizimmerwohnungen gab, mit kleinen Bädern ohne Fenster.
Im Erdgeschoss zog damals ein kleines Gemüse- und Kolonialwarengeschäft ein, wo sich die Kinder ihre Bonbons einzeln kaufen konnten. Fünf Pfennig für fünf Stück. Der Händler betrieb den Laden bis in die Achtziger. Er wurde von den Supermärkten und Discountern verdrängt, gab den Laden auf, verdingte sich bei der Supermarktkette Bolle und wurde dort Abteilungsleiter.
Ein Schuster übernahm die Räume und reparierte jahrelang die Schuhe der einfachen Leute aus der Nachbarschaft. Es gab im Flur hinter dem Ladengeschäft eine Treppe in das Obergeschoss, dort wohnte die Schusterfamilie in zwei Zimmern, Küche und Bad. Als die Leute dazu übergingen, Billigschuhe zu kaufen, die nicht geputzt, nicht gepflegt und schon gar nicht repariert wurden, sondern nach einem Jahr einfach weggeworfen wurden, gab der Schuster auf. Der Laden stand lange leer. Der Geruch nach Leim, Öl und Schuhcreme hielt sich hartnäckig, auch nachdem 2017 die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen eingezogen war.
Die Gesellschaft brauchte einen Standort, unauffällige Räume für den Empfang ihrer »Kunden« und ein Zimmer mit großem Tisch und Stühlen für die Arbeitsbesprechungen. »Verbraucherbüro« sagte das Schild über dem Laden. »Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen e.V.« stand auf dem kleinen Zettel, der hinter dem Glas der Eingangstür klebte. Das entsprach der Wahrheit und erklärte nichts. Die Scheiben des Schaufensters waren ungeputzt, die Auslage vollgestellt mit Pappdisplays mit sinnfreien Werbebildern, zum Beispiel glückliche junge Familien vor ihrem Eigenheim oder strahlende Autobesitzer vor ihrer glänzenden Neuerwerbung. Eine Spinne hatte sich ans Werk gemacht und an einem der Aufsteller ihren Arbeitsplatz eingerichtet. Manche Passanten dachten, hier habe sich eine Verbraucherzentrale eingerichtet. Anfangs, als die Tür des Ladens tagsüber geöffnet war, waren Menschen hereingekommen, um nach einem Beratungstermin zu fragen, da ging es dann um Kreditkonditionen, um Preisempfehlungen für Kühlschränke, um Mogelpackungen bei Lebensmitteln. Das war der Gesellschaft zu viel geworden. Also klebte irgendwann an der Eingangstür ein Zettel: »Termine nach Vereinbarung«, mit einer Telefonnummer und einer Mailadresse. Seitdem gab es keine Laufkundschaft mehr, und die Tür war meist verschlossen.
Aus dem ehemaligen Laden im Erdgeschoss waren der Tresen und die Schuhregale rausgeflogen. Stattdessen stand da ein alter einfacher Schreibtisch, dahinter ein Drehstuhl, davor mehrere alte Küchenstühle für die Hilfesuchenden. Die Möbel oben in den Wohnräumen stammten noch von der Schusterfamilie, manche sogar vom Sperrmüll. Wo der nicht genug hergegeben hatte, war Ikea eingesprungen. Repräsentative Räume, elegant eingerichtet, in guter Lage? Nein, niemand, nicht einmal ein fantasiebegabter Makler, hätte es gewagt, so zu texten.
Auf den alten Küchenstühlen saßen nun die beiden Alten vor Paul van de Loo, dem Vorsitzenden der Gesellschaft. Dank der Empfehlung einer Bekannten hatten sie hierhergefunden. Er gut achtzig Jahre alt, ziemlich kahl, mit Bauchansatz, gekleidet in eine Kombination aus cremefarbenen und beigen Sachen, die ihn noch älter aussehen ließen. Was ihm offensichtlich egal war. Sie war nicht viel jünger, wirkte aber so und sprach lebhafter. Schlank, weißes Haar, hinten hochgesteckt, blaues gemustertes Kleid, dunkelroter Mantel.
Die beiden hatten einen Termin vereinbart, jetzt saßen sie seit einer Viertelstunde vor dem alten Schreibtisch, ihnen gegenüber van de Loo, der dieses Gespräch persönlich führen wollte. Dass der schäbige Raum mit modernster Technik ausgestattet war, war ihnen nicht aufgefallen. Van de Loo hatte kurz vor Beginn Kameras und Mikrofone eingeschaltet, ohne seine Besucher ausdrücklich darauf hinzuweisen. Er hatte die Frau angeblickt, dann den Mann. »Wollen Sie etwas trinken?« Kopfschütteln. »Na, dann mal los!«
Er: »Also damals, nach dem Krieg, standen von unserem Haus nur noch die Mauern. Aber es wurde alles schnell wieder aufgebaut. Die Grundrisse blieben erhalten, die großen Wohnungen wurden aufgeteilt. Wir wohnen da jetzt seit mehr als vierzig Jahren.«
Sie, spitz: »Hab ich schon gesagt!«
Er, unbeirrt: »Ich war bei Reemtsma in Wilmersdorf, Betriebsleiter seit 1959. Peter Stuyvesant und West – kennen Sie, oder?«
Van de Loo hatte geraucht, vor vielen Jahren. Aber weder Stuyvesant noch West.
Sie: »Das interessiert den Herrn doch nicht!«
Van de Loo nickte.
Er: »Die Wohnung ist ja nicht groß, drei Räume, schmales Bad. Alles sehr hoch. Das ist teuer beim Heizen, auch wegen der alten Fenster. Und das mit der Treppe ist für uns nicht so einfach. Die Straße ist laut. Auch nachts.«
Sie: »Es wurde jahrelang nicht renoviert. Aber das war uns ganz recht: Die Miete wurde ja auch nie erhöht. Wir haben in der Wohnung vieles selber gemacht. Wir zahlen 550 kalt.«
Er: »Achtzig Quadratmeter.«
»Aber …«, sie holte Luft.
Er schaute sie an, sie schaute ihn an, dann schauten beide auf van de Loo und verkündeten laut und fast synchron: »Aber die hat einfach verkauft!«
Van de Loo schreckte hoch. »Wer ist die?«
Sie: »Die Frau Huth hat verkauft. Das Haus gehörte der Familie Huth. Seit den Dreißigern. Sie hatten es einer jüdischen Familie abgenommen. Wie das eben so war damals.«
»Arisiert nannte man das«, sagte er.
Sie: »Lass doch!«
Er: »Tja, war nicht schön damals.«
Sie: »Jetzt lass! Jedenfalls, die Tochter, die Frau Huth, hat es geerbt. Die ist heute auch nicht mehr jung. Und jetzt bekamen wir einen Brief von einer Firma, von deren Rechtsanwalt, die Frau Huth habe verkauft, genauso wie die Eigentümer der Häuser links und rechts. Er würde den neuen Eigentümer vertreten. Man würde bald renovieren. Man würde von ihm hören.«
Van de Loo nickte. Das war kein Einzelfall. In Berlin wurden zunehmend alte Mietshäuser aufgekauft, renoviert, in Eigentumswohnungen aufgeteilt und dann weiterverkauft. Auch das Virus und die Krise hatten die Investoren aus aller Welt nicht bremsen können. Berlin war im Vergleich zu anderen Metropolen noch billig, das zog Kapital an.
Er war vermögend und hätte auch gerne ein Haus mit Mietwohnungen erworben. Mit braven Mietern, mit ordentlicher Hausverwaltung und regelmäßiger Instandhaltung – ganz solide, um seine Altersversorgung abzusichern. Aber wo er auch nachfragte oder zur Besichtigung kam, waren schon junge Frauen oder Männer vor ihm da gewesen, die schneller waren und die mehr Geld boten. Manchmal sogar mehr Geld, als vom Verkäufer gefordert worden war. Van de Loo hatte jedes Mal das Nachsehen.
Sie war jetzt in Schwung und machte weiter: »Dieser Anwalt hat drei Häuser nebeneinander auf einmal gekauft, das muss man sich mal vorstellen. Drei Häuser! Dazu die Höfe und Hinterhäuser – alles gekauft! Die Leute reden, alle sind aufgeregt, es heißt, wir müssten bald alle raus. In unserem Alter!« Ihr Hände krampften sich um ihren Schirm, sie holte Luft.
Er: »Wir haben Angst!«
So war das mit dem Ehepaar Walter und Erna Szymanski. Fünfzig Jahre verheiratet. Seit mehr als vierzig Jahren Mieter in der Birkenstraße. Jetzt in Angst.
»›Wir haben Angst!‹, haben sie gesagt. Man sah es ihnen auch an«, berichtete van de Loo. Er zeigte auf den Monitor, auf dem das Ehepaar Szymanski im Büro zu sehen war.
Alle waren da. Sie saßen im ersten Stockwerk über dem Laden um den großen abgeschabten Küchentisch: Felicitas Hahmann, genannt Feli, schön, elegant gekleidet in ein Kostüm von Celine, ihren feinen Mantel über der Stuhllehne, da sie ihn nicht in der abgeschabten Garderobe auf einen verbogenen Drahtbügel hängen wollte. Dieser Shabby Chic (wie van de Loo schönfärberisch sagte) hier in der Wollankstraße war nicht so ihr Ding, aber die Ziele der Gesellschaft waren ihr wichtiger als das Umfeld. Sie hatte ihren Aktenkoffer dabei, denn sie war direkt aus ihrer Finanzberatungsagentur gekommen. Der Mini Cabrio parkte um die Ecke in der Steegerstraße.
Außerdem Eschweiler, Pfister, Tabak. Und Cromm, der nach van de Loo und vor den anderen gekommen war, seine Daunenjacke in die Garderobe gehängt und sich erst einmal vor den PC unten im Laden gesetzt hatte. Er wollte die jüngsten E-Mails lesen, bevor es losging. Außerdem alle Kameraaufzeichnungen kontrollieren, die den Laden und die Räume im Obergeschoss ununterbrochen überwachten. Sie waren sicherheitsbewusst, die Mitglieder der Gesellschaft. Sie hielten das für wichtig.
»Wir haben Angst«, zitierte van de Loo noch einmal die Szymanskis. Er hatte zu Beginn deutlich gemacht: Hier kam ein neuer Fall auf die Gesellschaft zu. Das sicherte ihm die Aufmerksamkeit. Jetzt machte er weiter: »Ich habe dann gedacht, das war’s. Die beiden sind halt schon wirklich alt, gebeugt und gebeutelt. Ich habe gedacht, die wollen direkte Hilfe von uns. Aber so einfach sind die nicht gestrickt. Ich habe mich geirrt.«
Hatte van de Loo soeben »geirrt« gesagt? Das sagte er eigentlich nie! Die anderen horchten auf.
»Es ging nämlich weiter.« Er drückte auf Play. Das Standbild mit den Szymanskis begann zu laufen.
»Ja, das stimmt«, sagte sie, »wir haben Angst. Aber wir sind auch entschlossen.«
Ihr Mann nickte.
»Wir wollen uns wehren«, sagte sie.
Und er: »Wenn Sie mit Ihren Leuten einsteigen – gut. Wenn Sie uns und den Nachbarn sagen, was wir tun sollen – noch besser!«
Wieder blickten die Eheleute Szymanski sich symbiotisch an. Sie nickten sich zu, als müssten sie sich in ihrem Entschluss bekräftigen. Dann wandte der Mann sich van de Loo zu und sagte mit fester Stimme: »Wissen Sie was? Wir sind alt. Wir haben nicht viel zu verlieren.«
»Genau!« Frau Szymanski pflichtete ihm bei und nickte.
Van de Loo drückte auf Stopp. Im Raum herrschte Stille. Ein paar Sekunden. Dann rührten sie sich. »Donnerwetter!«, murmelte Pfister. Tabak presste die Lippen zusammen und nickte zweimal. Felicitas lächelte.
Van de Loo sagte: »Das ist alles. Ihr wisst ja, was auf dem Wohnungsmarkt los ist.« Dann schob er noch ein »Oder?!« nach.
Silvio Cromm leckte sich die Lippen. Tabak hatte seinen rechten Arm auf den Tisch gelegt und spannte seinen Bizeps an, betrachtete ihn und entspannte ihn. Immer wieder, gedankenverloren. Feli sah interessiert zu, zog dann die Kostümjacke aus und hängte sie über ihren Mantel. Pfister starrte die Wand an, auf der nichts zu sehen war außer einem Tapetenmuster aus den Siebzigern. In dem Raum herrschte eine Atmosphäre wie im Klassenzimmer vor dem Läuten der Schulglocke. Überheizte, dicke Luft – Pausenstimmung.
Sie saßen jetzt eine halbe Stunde zusammen. Es war neunzehn Uhr, draußen fuhren die Busse der BVG und die Konvois großer Lastwagen auch nach dem Ende des Berufsverkehrs durch die Straße und brachten Lärm und Gestank. Die Wollankstraße hatte sich zur Durchgangsstraße entwickelt. Das tat ihr nicht gut und den Menschen, die hier lebten, auch nicht.
Eschweiler zog sein Päckchen f6 heraus, legte es demonstrativ auf den Tisch und guckte auffordernd in die Runde. Van de Loo bemerkte die Demonstration und seufzte. »Zehn Minuten Pause.«
Die meisten standen zügig auf und verließen das Büro, an der Spitze Eschweiler, der letzte aufrechte Raucher. Er ging durch den Flur, durch das Treppenhaus hinab bis nach vorn auf die Straße. Vor dem Haus lebte ein Obdachloser in einem Pappkarton. Alle kannte ihn und grüßten beim Kommen und Gehen. Eschweiler ging zu ihm, bot ihm eine Zigarette an, nahm sich selbst eine. Die beiden rauchten schweigend und einträchtig.
Die anderen waren hinuntergegangen in den Hinterhof, zum Frische-Luft-Schnappen. Da standen ein paar Autos. Und viele Fahrräder, verflochten zu einem Verhau aus Reifen und Stahlrohren. Etwas abseits das Mountainbike von Tabak, sorgfältig abgeschlossen. Ein paar Büsche und Stauden wehrten sich gegen Müll.
Cromm war sitzen geblieben, lehnte sich jetzt weit zurück, sodass er den alten Küchenstuhl zum Ächzen und Kippeln brachte. »Entspann dich«, sagte er zu van de Loo.
Der guckte grimmig zurück. »Hier geht es doch um eine größere Sache. Und ihr lümmelt hier wie die Pennäler.«
»Herr Lehrer, sei nicht so autoritär! Die meisten von uns kommen von der Arbeit. Sie sind müde.«
»Na und?« Van de Loo konnte trotz seiner zweiundsiebzig Jahre Anstrengungen gut aushalten, bei anderen legte er ebenso Wert auf Zähigkeit. Auch äußerlich demonstrierte er Sorgfalt und Stil. Er war wie immer korrekt und konservativ angezogen, mit olivfarbener Chino und langärmeligem weißem Hemd, das Jackett hing hinter ihm auf der Rückenlehne. Immerhin: keine Krawatte und das Hemd mit offenem Kragen. Dazu dunkelbraune glänzende Schnürschuhe – der verflossene Schuster hätte seine Freude gehabt.
Silvio Cromm, im Verein die Nummer zwei, ließ es zwar lockerer angehen, aber auf Stil legte er dennoch Wert. Rosa Polo, hellgrauer Pullover, klassische Jeans. Cromm war schwul. Schwul ohne Bekennerattitüde. Mit seiner Kleidung wollte er einfach gut aussehen und nichts signalisieren – weder ihr noch ihm.
»Ich hole mir was.« Cromm stand auf.
»Einen Wein? Mir auch!«
»Wenn noch welcher da ist …«
Cromm ging in die Küche, deren Möblierung aus der Zeit stammte, als die Familie des Schusters hier gelebt hatte. Er öffnete hoffnungsfroh den Kühlschrank. Ein angejahrter Privileg aus Quelle-Zeiten, aufgebockt auf einem Küchenhocker, angestoßen und dunkelweiß, aber das Ding arbeitete unverdrossen und kühlte alles, was man hineinstopfte. Müsste innen mal geputzt werden, dachte Cromm, aber der Gedanke ging nicht so weit, dass er selbst es sein würde, der den Lappen in die Hand nahm. Er nahm eine halb volle Flasche Weißwein heraus, holte zwei dicke Wassergläser aus dem Regal und füllte sie. Wein aus Wassergläsern fand er nicht in Ordnung. Aber er hatte Durst. Besser als Wasser aus Weingläsern dachte er, lachte laut über seinen Witz und trug die Gläser in den Konferenzraum.
»Da!« Er schob ein Glas über den Tisch.
»Du hast gelacht.«
»Ja. Über mich selbst.«
Van de Loo runzelte die Stirn und guckte fragend. Cromm erlöste ihn nicht und guckte unbewegt zurück. Dann setzte er sich, hob das Glas in Richtung van de Loo und nahm einen vorsichtigen Schluck. Er schmeckte dem Wein hinterher, war zufrieden und nahm einen zweiten und größeren Schluck.
Van de Loo schnupperte an dem Wein. »Italiener?«, fragte er.
»Rheinhessen. Sauvignon-Blanc von 2019.«
»Tatsächlich?« Van de Loo bezog seine Weinkenntnisse aus einer Zeit, als im Rheinhessischen noch Billigwein angebaut wurde. Da gab es doch mal diesen Skandal mit Glykol im Wein! Er nippte misstrauisch.
»Also«, sagte Cromm und schob das Glas von sich. »Du willst dich auf die Seite der Mieter schlagen?«
»Was heißt auf die Seite schlagen? Die Leute ahnen, dass sie bald unter Druck gesetzt werden. Es geht um ihre Wohnung. Sie wollen sich wehren. Es ist doch klar, dass wir auf deren Seite gehören!«
»Kann sein.«
»Na was denn sonst?«
»Objektiv bleiben!«
»Und das heißt?«
»Schau mal: dass eine Immobilie den Eigentümer wechselt, ist nichts Schlimmes!«
»Stimmt, aber …«
Cromm beugte sich vor: »Das ist nicht böse. Es ist auch kein Verbrechen, wenn einer alte Häuser renovieren will. Diese Stadt hat so viele alte und heruntergekommene Mietskasernen, da muss was passieren. Jedes Jahr ziehen Tausende junge Familien in die Stadt. Die wollen keine möblierten Zimmer mit Klo im Treppenhaus.«
»Darum geht’s doch hier nicht.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil die beiden Alten …«
Mein Gott, dachte Cromm, jetzt ist er unsachlich. Und sagte: »Ja, die beiden Alten! Aber die haben ihren Blickwinkel. Und bisher hat sich nichts getan. Was da wirklich ist, das müssen wir noch klären.«
Van de Loo hatte das Gefühl, dass Cromm ihn für unprofessionell hielt, und war beleidigt: »Natürlich müssen wir das klären. So machen wir das immer. Was denkst du denn?«
»Wir müssen die Fakten rauskriegen und unsere Meinung bilden. So ein Gespräch mit Betroffenen zeigt immer nur deren Sicht. Bis jetzt ist doch noch gar nicht klar, ob der neue Eigentümer ein Böser ist oder ein Guter.«
Van de Loo fühlte sich falsch verstanden. Er schwieg. Nahm das Wasserglas und trank es in einem Zug aus. Dann schüttelte er sich.
»Schade um den Wein«, sagte Cromm.
»Ach was«, sagte van de Loo.
Die anderen kamen zurück und setzten sich. Eschweiler roch nach Tabak. »Kann jemand mal das Fenster öffnen?«, rief Pfister. Eschweiler prüfte den Zustand seiner Fingernägel und schien nichts zu hören. Als auch sonst niemand reagierte, stand Pfister entrüstet auf, ging zum Fenster und öffnete beide Flügel. Der Straßenlärm flutete den Raum, und es wurde kalt. Pfister setzte sich mit demonstrativ hängenden Mundwinkeln.
Die anderen begannen zu frieren und sahen sich stumm an. Cromm schüttelte den Kopf. Eschweiler stand ungerührt auf, ging zum Fenster und mit herausforderndem Blick auf Pfister machte er es wieder zu. Niemand kommentierte, niemand protestierte. Es war nur eine weitere Episode in dem ewigen Kleinkrieg zwischen Eschweiler und Pfister.
»So!« Van de Loo musterte seine Leute und räusperte sich. »Ihr habt sie gesehen und gehört, die Szymanskis. Die müssen wirklich Angst haben. Sie wissen, dass es üblich geworden ist, Mieter unter Druck zu setzen. Die einfachen Leute sind die Opfer. Es werden rabiate Handwerker eingesetzt, es wird saniert und danach teuer verkauft. Das könnte in diesem Fall genauso laufen. Aber ihr habt gehört, wie sie reden. Die sind entschlossen, sich zu wehren. Wir könnten sie unterstützen.«
In das zustimmende Nicken hinein fragte Tabak: »Was heißt unterstützen?«
Cromm, wieder entspannt auf seinem knarzenden Küchenstuhl, beugte sich vor: »Genau! Bitte nicht voreilig! Vor dem Unterstützen kommt das Untersuchen.«
»Natürlich!« Van de Loo schoss einen Blick Richtung Cromm. »Macht mal Vorschläge! Wie gehen wir vor?«
»Wir brauchen die Fakten«, sagte Cromm. »Wer ist der neue Eigentümer? Hat er eine Vergangenheit als Investor und falls ja: Wie sieht die aus? Wie ist er bei vergleichbaren Projekten vorgegangen?«
»Und wer ist er überhaupt?« Feli fragte in die Runde, richtete die Frage aber vor allem an sich selbst. Sie wedelte elegant-lässig mit der linken Hand: »Krieg ich alles raus. Ich muss nur Name und Adresse haben. Den Rest mache ich.« Sie wedelte immer noch.
Ja, das glaubten die anderen ihr sofort. Sie hatte beste Kontakte in die Berliner Bankenszene, zu den Bauträgern und Investoren. Sogar zu manchen Politikern. Felicitas Hahmann war freie Finanzberaterin. Sie arbeitete als selbstständige Partnerin in einer Agentur für Versicherungen und Geldanlageberatung. Sie hatte ihre eigenen Kunden, manche hatten sich von ihren Bankberatern abgewandt und kamen ausschließlich zu ihr. Feli kannte die Fallen und Schliche der Finanzwelt, die versteckten Risiken der Finanzprodukte. Sie beriet sachlich und unabhängig, kassierte keinerlei Provisionen oder Kickbacks, dafür schrieb sie ihren Kunden ganz schöne Rechnungen für ihre Arbeit.
Wie sie vorgehen würde? Das wollten die anderen gar nicht so genau wissen. Van de Loo blickte auf seinen Notizblock und sagte: »Hier ist der Name des Anwalts: Dr. Mike Gress, Kanzlei in Pankow, Breite Straße. Das ist alles, was uns die beiden Alten sagen konnten. Der Gress schreibt die Briefe. Er ist der Ansprechpartner. An den musst du ran.«
Feli schrieb mit und nickte. »Er ist aber nicht der mit dem Geld?«, fragte sie.
Van de Loo schüttelte den Kopf. »Den kennen wir noch nicht.«
Pfister, normalerweise ein großer Schweiger, hob die Hand: »Dann müssen wir auch herausfinden: Wie sieht es da in der Birkenstraße aus? Welche Häuser sind betroffen? Was sagen die anderen Mieter? Wie viel Miete wurde bisher kassiert, und wie viel Miete will der Neue rausholen?«
Er war als Mitbewohner einer Männer-WG sehr engagiert, wenn es um das Mieten und Wohnen ging. Das ständige Drehen an der Preisschraube und den wachsenden Druck auf Mieter empfand er als persönliche Bedrohung, als Zerstörung der Berliner Lebensart. Da wurden Lebensentwürfe beschädigt, Kieze verloren ihre Besonderheit, Stadtteile wurden stromlinienförmig und langweilig. Dagegen musste man was tun, dachte er.
»Ich glaube, es geht um mehr«, sagte Cromm.
Pfister blickte verständnislos.
Cromm machte weiter: »Ich glaube, es geht um die Umwandlung in Eigentumswohnungen. Viele Investoren wollen den schnellen Gewinn und nicht über Jahre hinweg mit Hausverwaltung, Reparaturen und Mieterärger beschäftigt sein.«
»Mieterärger!«, knurrte Pfister. »So nennt man das nicht!«
»Ich krieg das raus«, sagte Feli.
»Mach das!«, sagte van de Loo. Er drehte sich zu seinem Gegenüber. »Eschweiler?«, fragte er.
Eschweiler, der Pfister betrachtet hatte und dessen Hand zufällig auf seinem Zigarettenpäckchen ruhte, blickte, ohne den Kopf zu bewegen, aus den Augenwinkeln zu ihm herüber.
»Dich und deine Technik brauchen wir«, sagte van de Loo. Eschweiler nickte.
»Besorg dir Kameras und Mikros und«, van de Loo suchte das richtige Wort, »na, du weißt schon, Bewegungszeug und Aufzeichnungsdinger oder so.«
Die anderen grinsten. Technikaffin konnte man van de Loo nicht nennen. »Du weißt am besten, was du brauchst. Die Szymanskis werden dir ihre Wohnung öffnen und auch Zugang verschaffen zum Treppenhaus, zum Hof, zum Dach. Ich werde dich bei ihnen anmelden.«
Eschweiler wusste, was sie von ihm erwarteten. »Und dann?«, fragte er.
»Irgendwann hast du alles installiert. Dann sagst du uns Bescheid. Und wenn wir uns einig sind, beginnst du mit dem Aufzeichnen. Kannst du die Bilder und Töne hierher senden?«
»Funkstrecke? Hm! Technisch geht das. Wird aber teuer. Ich muss das verschlüsseln, damit uns keiner zuhört.«
»Zu gefährlich«, sagte Cromm, der an die Möglichkeiten der Polizei dachte. »Lass doch einfach irgendwo in der Wohnung der Szymanskis die Aufzeichnung laufen. Das ist sicherer.«
Eschweiler zuckte mit den Schultern und nickte.
»Wir müssen«, sagte Cromm, »die Kontrolle über den Häuserblock haben. Damit wir sehen können, was der Investor vorbereitet.«
»Aber es kann Monate dauern, bevor es wirklich losgeht«, sagte Eschweiler.
»Wir wissen es nicht. Fang einfach an, wenn dein Job das zulässt!«
Sein Job? Das war Service und Reparatur von Geldautomaten in Berlin und Brandenburg. Er hatte in regelmäßigen Abständen die Automaten in Banken und Sparkassen zu kontrollieren, ihr Inneres zu reinigen, die Mechanik zur Einfärbung der Geldscheine scharfzustellen und manchmal neue Software aufzuspielen. Eschweilers Arbeit war sicherheitsrelevant, man hatte seine Vergangenheit überprüft und seinen Leumund. Er wohnte mit Ehefrau und zwei pubertierenden Töchtern in Köpenick, Nähe Müggelsee. Er hatte lange für einen Elektronikmarkt in Steglitz gearbeitet, war aber im Streit mit dem Chef ausgeschieden.
Sein jetziger Arbeitgeber saß in Paderborn und hatte ihn mit einem neutral aussehenden Dienstwagen mit den Anfangsbuchstaben PB auf dem Nummernschild ausgestattet. Er konnte das Fahrzeug auch privat nutzen, was er auch ausgiebig tat. Mit diesem PB-Kennzeichen konnte er sich ziemliche Frechheiten im Berliner Straßenverkehr erlauben. Meist wurde ihm verziehen, und falls er doch einmal beschimpft wurde, guckte er zurück und setzte dabei einen unschuldigen Provinzlerblick auf.
»Mein Job lässt vieles zu«, erklärte Eschweiler. Darum liebte er ihn auch. Viel Geld verdiente er nicht, aber er hatte Freiheiten, genug Zeit für die Gesellschaft, und abends war er meist zu Hause bei seiner Familie.
»Gut!« Van de Loo blickte in die Runde, sah allgemeine Zustimmung und schloss die Sache ab: »Beim nächsten Mal kommt alles auf den Tisch. Dann denken wir über eine Aktion nach. Wir werden bald viel zu tun haben!«
In den Augen der anderen sah er Erwartung und Neugier. »Einverstanden?«
Nicken und Stille.
»Habt ihr noch etwas?« Es war Cromm, der gefragt hatte. Er spürte Stimmungen eher als andere. Er blickte Tabak direkt an.
Vural Tabak, dem gerade ein Fremder »Ich weiß, wo’s brennt!« verkündet und ihn damit getroffen hatte, blickte zurück, zögerte und sagte dann entschlossen: »Nein. Was erwartest du?«
»Vural!«, sagte Cromm. »Wir sind nicht nur für andere da. Wir helfen auch uns untereinander. Wenn was ist.«
»Ich weiß. Aber es ist nichts«, sagte Tabak leicht aggressiv. Jetzt wusste Cromm: Da war etwas. Da war etwas, nur wusste er nicht, was.
Van de Loo, dem es grundsätzlich auf gute Stimmung ankam, sagte versöhnlich: »Na schön, da haben wir doch einen spannenden Auftrag vor uns. Ich danke euch für heute. Bis zum nächsten Mal. Ihr erfahrt den nächsten Termin per App.«
Eschweiler blickte finster, denn er hasste WhatsApp und traute Zuckerberg alles Böse zu. Sein Widerstand war erfolglos.
»Kommt gut nach Hause.«
Diese Gespräche! Diese langen und sinnfreien Telefongespräche! Kriminalhauptkommissar Werner Dreier konnte nicht anders. Er musste zuhören. Sein Kollege saß ihm gegenüber und sprach seit vielen Minuten lange sinnfreie Sätze in sein privates Handy. Zum Beispiel: »Aber wenn der schon hundertachtzigtausend draufhat, woher soll ich wissen, dass der Zahnriemen okay ist?«
Ja, dachte Dreier, woher sollst du das wissen?
»Und wenn der mir dann reißt, wie steh ich dann da?«
Dann, dachte Dreier, stehst du blöd da. Aber das bist du sowieso, mit oder ohne Zahnriemen. Sein Gegenüber, als hätte er etwas gemerkt, blickte plötzlich hoch und sah ihn scharf an. Dreier lächelte unschuldig zurück und hob den Daumen.
»Sie müssen mir da schon entgegenkommen, wegen dem Zahnriemen …!«
Des Zahnriemens, du Vollpfosten, dachte Dreier, griff verzweifelt nach einer Mappe mit Akten und versuchte zu lesen.
»Da ist nichts zu machen? Sagen Sie, da ist nichts zu machen? Echt?«
Bei dir ist auch nichts zu machen, dachte Dreier und las sich fest.
»Also dann … ich glaube, dann wird das nichts. So ein Zahnriemen, wissen Sie, der kann bald reißen und dann …! Sie haben meine Nummer? Ja? Wenn Sie es sich überlegen, rufen Sie an. Aber wenn, dann bald. Ich hab noch was anderes im petto. Genau! Tschüs!«
In petto, dachte Dreier und las mit Konzentrationsfurchen auf der Stirn in der Akte. Sein Kollege drückte auf seinem Handy herum, warf es dann auf den Schreibtisch und sprach drauflos: »Stell dir vor, so eine alte Karre, nie den Zahnriemen gewechselt, und da will der nicht mit sich reden lassen. Der hat sie doch nicht alle, oder?«
Dreier markierte mit dem Zeigefinger die Stelle, von der er glauben machen wollte, er läse sie, blickte hoch und sagte: »Was?«
»Hast du gehört?«
»Nee«, log Dreier. »Ich bin hier gerade …«, er stupste mit dem Zeigefinger auf eine Stelle in der Akte, »… mittendrin. Diese neue Verordnung über den Einsatz der Videokamera.«
»Betrifft dich das?«
Das ging den Pfosten nichts an. »Man kann nie wissen. Wer weiß, was auf uns zukommt. Kennst du doch noch vom Personalrat, oder?«
Treffer! Der andere schwieg.
Sein Kollege war jahrelang freigestellter Personalrat der Berliner Polizei gewesen. Bis er wegen erwiesener Faulheit von seiner Gewerkschaft nicht mehr aufgestellt wurde. Da hatte er entdeckt, dass er von der Gewerkschaft und deren Zielen eh nicht viel hielt, und war ausgetreten. Jetzt musste er wieder Dienst tun, was er nicht mehr konnte und auch nicht wollte. So saß er seine Zeit ab, machte alles Mögliche im Internet und telefonierte jedem Gebrauchtwagen und jedem Ebay-Angebot hinterher. Täglich. Dauernd.
Das waren noch schöne Zeiten, dachte Dreier, als dieser Kerl im Personalratsbüro saß und ich dieses Zweierbüro für mich allein hatte. In diese Gedanken hinein klingelte sein Telefon. Er nahm ab, und es meldete sich »The Voice«: »Der Präsident wünscht Sie zu sehen! Können Sie?«
»Was soll ich können?«
»The Voice« wurde unwirsch: »Herr Kriminalhauptkommissar Dreier! Bitte kommen Sie zum Präsidenten.«
»Zu Befehl, gnädige Frau«, sagte Dreier, aber da war die Leitung schon tot. Er legte ganz sanft den Hörer auf und sagte: »Ich bin dann mal weg.«
Sein Kollege unterbrach das Studium der Gebrauchtwagenangebote bei mobile.de, sah hoch und fragte: »Was?«
»Ich komme wieder«, versprach Dreier und war schon draußen. Er ging den breiten schäbigen Korridor im Präsidium entlang bis zum Treppenhaus, ignorierte das Angebot des altersschwachen Aufzugs und nahm zwei Stufen auf einmal, bis er das präsidentielle Geschoss erreicht hatte. Hier war der Korridor nicht mehr schäbig, die Wände leuchteten frisch gestrichen, und der Boden prunkte mit neuem Laminat. Er atmete dreimal kurz aus und dreimal kurz wieder ein, denn er wollte nicht atemlos das Herrschaftsgebiet des Chefs betreten. Dann klopfte er an die Tür zum Vorzimmer und trat im selben Moment ein.
Die Frau mit dem Namen Kathrin Stumm, Beamtin des gehobenen Dienstes, genannt »The Voice«, von manchen auch in einer Langfassung als »His Master’s Voice« bezeichnet, saß am Empfangstisch. Sie war schlank, jung, blond, kurzhaarig, modisch gekleidet und hatte eine erstaunlich tiefe Stimme. Wenn sie sich am Telefon meldete, sagte sie: »Büro des Polizeipräsidenten, Stumm«, was manchmal dazu führte, dass die Anrufer sie mit »Herr Stumm« ansprachen und sie dann mit einem nachdrücklichen »Frau Stumm!« korrigierte.
Wäre man ihr in einem der Berliner Start-ups begegnet, hätte man denken können, sie sei eine der Gründerinnen. Der Job in dieser Vorhölle hatte sie jedoch geprägt. Als Bewacherin des Zugangs zum Präsidenten hatte sie sich einen unduldsamen Stil zugelegt. Manche sagten, »The Voice« bewege sich außerdem auf mehreren Ebenen. Sie habe Zugang zu einem geschlossenen Zirkel, in dem über die Polizei grundsätzlich kritisch nachgedacht werde. Genaueres wusste die Gerüchteküche nicht. Umso wilder die Spekulationen. Es hieß, »The Voice« werde von manchen vor allem deshalb sehr geschätzt, weil sie Zugang habe zu wesentlichen Informationen. Sie kannte Interna, sie durfte Personalakten einsehen, sie war des Präsidenten rechte Hand.
Dreier hatte solches Gemunkel gehört, Geraune von Leuten, die gerne spekulierten. Er hielt das für Gequatsche, für Wichtigmacherei. Aber das Gerede hatte mit der Zeit zugenommen.
»The Voice« hatte sich mit der Zeit einen rauen Tonfall angeeignet und ein Gehabe …, so wie jetzt auch: Sie hob nicht den Kopf, um den eintretenden Dreier zu begrüßen. Stattdessen betrachtete sie intensiv ein vor ihr liegendes Heft, hob den rechten Arm mit abgewinkeltem ausgestrecktem Zeigefinger in halbe Höhe und zeigte nach rechts, auf die dunkle doppelflügelige Holztür. »Der Präsident wartet!«, sagte sie.