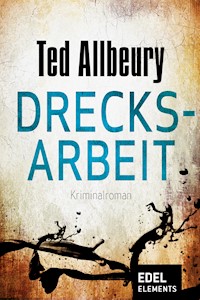4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein hochklassiger Spionagekrimi – spannendes Lesevergnügen für alle Fans von John Le Carré! Andrej Aarons ist zwanzig, als er zum Spion wird. In einem strengen Auswahlverfahren auf Herz und Nieren geprüft, wird er durch die Sowjets perfekt ausgebildet und 1938 in die USA eingeschleust. Er lebt in New York unauffällig als Buchhändler, baut ein Agentennetz auf und beliefert seine Auftraggeber mit äußerst wichtigen Informationen. Es braucht Jahrzehnte, bis Moskaus ranghöchster Geheimagent in den USA in seiner Überzeugung ins Wanken gerät...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ted Allbeury
Ein echter Amerikaner
Kriminalroman
Ins Deutsche übertragen von Georg Schmidt
Edel eBooks
Inhalt
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreissigstes Kapitel
Einunddreissigstes Kapitel
Zweiunddreissigstes Kapitel
Dreiunddreissigstes Kapitel
Vierunddreissigstes Kapitel
Fünfunddreissigstes Kapitel
Sechsunddreissigstes Kapitel
Siebenunddreissigstes Kapitel
Achtunddreissigstes Kapitel
Neununddreissigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Siebenundvierzigstes Kapitel
Achtundvierzigstes Kapitel
Neunundvierzigstes Kapitel
Fünfzigstes Kapitel
Einundfünfzigstes Kapitel
Zweiundfünfzigstes Kapitel
Dreiundfünfzigstes Kapitel
Vierundfünfzigstes Kapitel
Fünfundfünfzigstes Kapitel
Sechsundfünfzigstes Kapitel
Impressum
Zeigt mir einen Helden, und ich werde euch eine Tragödie schreiben.
F. Scott Fitzgerald, Der Zusammenbruch, 1945
Eitel die Hoffnung, man könne Menschen durch Politik glücklich machen!
Thomas Carlyle, 1831
Der Mensch ist ein religiöses Tier und muß an etwas glauben; wenn gute Gründe zum Glauben fehlen, wird er sich mit schlechten zufriedengeben.
Bertrand Russell, »An Outline of Intellectual Rubbish«, Unpopular Essays, 1950
ERSTES KAPITEL
Mary Taylor fragte sich, warum man keine Fernsehteams zugelassen und die Pressekonferenz nur auf die Vertreter der Printmedien und Radiosender beschränkt hatte. Sogar die Fotografen waren ausgeschlossen worden. Meistens waren bei den Pressekonferenzen in Camp David drei oder vier Kamerateams zugegen. Sicherheitsgründe konnten es nicht sein. Vielleicht wollte er nur den Zeitrahmen so knapp wie möglich halten. Fernsehleute machten sich immer wichtig und zogen alles in die Länge.
Die Techniker waren noch mit dem Überprüfen der Mikrofone und Aufnahmegeräte beschäftigt, als er zum Podium schritt. Blaues Hemd, keine Krawatte, graue Hose und Reebok-Turnschuhe, die so aussahen, als kämen sie tatsächlich zum Einsatz. Die feinen Haare hoben sich leicht im Wind, und um seinen Mund spielte bereits das gewinnende, etwas schiefe Lächeln, als ihm jemand das Hauptmikrofon hinschob. Sie hatte ihn immer gemocht, schon damals, bevor er Vizepräsident geworden war. Eigentlich hatte er nichts mit Reagan gemein, aber in mancher Hinsicht wirkten sie sehr ähnlich. Typisch liebenswerte amerikanische Jungs. Aber Bush war anders, weil er die Hebel in der Hand hatte und seine Hausaufgaben nicht nur machte, sondern sie auch verstand. Dafür hatte schon seine Arbeit als Chef der CIA gesorgt. Kaum wahrscheinlich, daß er Bolivien mit Brasilien verwechselte. Nicht daß Ronald Reagan wegen derartiger Schnitzer Wählerstimmen verloren hätte. Die Mehrzahl der Amerikaner war nicht in der Lage, anhand einer Weltkarte zu zeigen, wo die Tschechoslowakei lag. Reagan gab den Wählern das Gefühl, daß sie durchaus Präsident der Vereinigten Staaten werden könnten, wenn sie nur wollten.
Es gab die üblichen Fragen zu den Themen Abrüstung und »Star Wars«, wie die Presse das SDI-Programm getauft hatte, das den Aufbau eines im Weltraum stationierten Waffensystems zur Abwehr sowjetischer Interkontinentalraketen vorsah. Die Sonderberichterstatterin der Washington Post versuchte ihm eine Stellungnahme zum Thema Abtreibung zu entlocken, aber er bedachte sie mit einem Lächeln und deutete auf den Mann von der Londoner Times.
»Ja, Mister Long.«
»Mister President, manche Menschen in Europa und meines Wissens nach auch in den USA fragen sich, ob man im Weißen Haus nicht der Entwicklung hinterherhinkt, nun, da sich durch Glasnost und Perestroika das internationale politische Klima verändert hat. Haben sie recht, Mister President?«
»Nun – wir haben bei unseren Abrüstungsverhandlungen mit den Sowjets beträchtliche Fortschritte gemacht, zum Beispiel bei der Ächtung chemischer Waffen und beim Truppenabbau. Ich würde das nicht gerade als Hinterherhinken bezeichnen.«
»Mister President, ich habe dabei mehr an die psychologischen Aspekte von Glasnost gedacht. Für alle Welt sieht es so aus, als wollten uns die Sowjets die Hand zum Frieden reichen und die US-Regierung reagiere darauf eher zurückhaltend. Als sei sie nicht bereit, sich mit dem Ende des Kalten Krieges abzufinden.«
Der Präsident lächelte. »Freut mich sehr, daß die Presse zur Abwechslung einmal guten Nachrichten soviel Platz einräumt. Aber lassen Sie mich klarstellen, daß diese Regierung, wie alle anderen Regierungen auch, für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Bevölkerung verantwortlich ist. Wir hatten vierzig Jahre lang Kalten Krieg – und der ging, wie ich hinzufügen möchte, nicht von uns aus. Wir begrüßen die Veränderungen in den Ländern des Ostblocks und in der Sowjetunion von ganzem Herzen – und wir sind nur zu gern bereit, diese demokratischen Entwicklungen zu unterstützen. Aber man kann in diesen Ländern nicht über Nacht eine allmächtige Diktatur in eine Demokratie umwandeln – es gibt keinerlei organisierte politische Parteien, die in der Lage wären zu garantieren, daß sich demokratische Regierungsformen durchsetzen. Das dauert eine Zeitlang, und wir müssen ihnen diese Zeit lassen – wir dürfen in unserer Euphorie nichts überstürzen, sonst laufen wir Gefahr, daß man uns bewußte Destabilisierung vorwirft. Ja ...« Der Präsident nickte einem Mann in der hinteren Reihe zu. »Ja, Ted.«
»Mister President. Ist der Regierung bewußt, daß angesichts des veränderten Klimas zwischen den beiden Supermächten viele Amerikaner das Gefühl haben, es sei an der Zeit, unser militärisches Engagement in der NATO zu beenden?«
Der Präsident warf ihm das altbekannte Lächeln zu. »Wenn wir in den grundsätzlichen Fragen weitergekommen sind, wird zweifellos auch über die Streitkräfte der NATO und des Warschauer Paktes gesprochen werden. Wir müssen herausfinden, was die andere Seite im Sinn hat.«
Ein altgedienter Korrespondent von Reuters stand auf.
»Mister President, deutet die Verwendung des Begriffs ›die andere Seite‹ nicht darauf hin, daß die Regierung nur widerwillig dazu bereit ist, ihre ablehnende Haltung gegenüber der Sowjetunion aufzugeben?«
»Mister Olson – Sie sind doch Mister Olson? Richtig. Mister Olson, wenn zwei Anwälte vor Gericht auftreten, der eine als Verteidiger, der andere als Vertreter der Nebenklage, dann sprechen beide von der ›anderen Seite‹, und jeder trägt dem Gericht die Fakten vor, die seiner Sache am ehesten zupaß kommen. Und dennoch ist es nicht ungewöhnlich, daß alle zwei am Samstagnachmittag zusammen Golf spielen.« Er grinste. »Ich nehme an, die diplomatische Entsprechung dafür ist, daß man bei Abrüstungsgesprächen seinen jeweiligen Standpunkt vertritt und danach gemeinsam einen Waldspaziergang unternimmt.«
Es gab etliche Zwischenrufe, doch der Präsident sagte: »Tut mir leid, aber ich habe anderweitige Verpflichtungen. Ich danke für Ihr Kommen und Ihre Fragen.«
Sie sah, daß O’Brien auf sie zukam. Er war der Pressesekretär des Präsidenten, aber sie hatte ihn schon gekannt, als sie noch bei NBC gewesen war und O’Brien PR-Mann an der Madison Avenue.
Er zog sich einen freien Stuhl heran und setzte sich neben sie. »Freut mich, dich zu sehen, Mary. Lang, lang ist’s her.«
»Empfängt er mich?«
»Für wen ist deine Geschichte?«
»Bislang für niemand. Ich bin jetzt Freelancer, könnte aber sein, daß ich sie bei einer der Überregionalen unterbringe.«
»Politisch oder intellektuell?«
»Intellektuell.«
»Okay. Ich kann dich in etwa zehn Minuten reinbringen. Im Moment erledigt er ein paar Anrufe. Aber nur unter zwei Bedingungen.«
»Als da wären?«
»Nicht länger als eine Viertelstunde und keine unmittelbaren Zitate. Hintergrundinformationen für dich, aber kein – ich wiederhole: kein – Interview.«
»Ich fühle mich geschmeichelt.«
O’Brien wirkte überrascht. »Oh, ich dachte, du wärst verschnupft. Wieso fühlst du dich geschmeichelt?«
»Weil er bereit ist, vertraulich mit mir zu reden, und sich darauf verläßt, daß ich keinen Mißbrauch damit treibe.«
Er lächelte. »Du hast eben allerhand vorzuweisen, Schätzchen. Wie geht’s dem Kleinen?«
Sie lachte. »Der Kleine ist in Yale und studiert Jura.«
O’Brien schaute auf seine Uhr. »Ich glaube, wir können jetzt reinspazieren.«
Der Präsident lächelte, als er ihre Hand ergriff. »Schön, Sie zu sehen, Mary. Ich nehme an, Sean hat Ihnen die Spielregeln schon mitgeteilt. Sind Sie damit einverstanden?«
»Natürlich, Mister President. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet.«
»Setzen Sie sich doch, machen Sie es sich bequem.«
Als sie Platz genommen hatte, lehnte er sich zurück.
»Schießen Sie los.«
»Die sogenannten Ostblockländer und ihr Bemühen um Demokratie. Was wird letzten Endes dabei herauskommen?«
»In der DDR besteht die Chance, daß neue Parteien nach dem Vorbild der politischen Parteien in der Bundesrepublik entstehen. Helfen wird auch, daß man die BRD hinter sich hat und damit die Möglichkeit einer wirtschaftlichen und finanziellen Unterstützung aus Bonn. Aber die Kommunisten werden nicht kampflos aufgeben. Die melden sich zurück. Nicht sofort, aber vielleicht in ein, zwei Jahren. Euphorie ist kein Dauerzustand, und wenn die neuen politischen Führungskräfte den Lebensstandard nicht verbessern können, werden die Menschen enttäuscht sein. Und in der Tschechoslowakei und Ungarn muß wieder ganz von vorn angefangen werden. Und das wird nicht einfach werden.«
»Und die Wiedervereinigung?«
»In Bonn will man sie, und man wird alles daran setzen, daß sie kommt. Aber in Europa hat man ein gutes Gedächtnis. Den Franzosen wird das ganz und gar nicht gefallen, egal, was sie in der Öffentlichkeit dazu sagen, und den Polen und den Italienern auch nicht. Vielleicht in zehn Jahren, wenn die Ostdeutschen aus eigener Kraft soweit sind. Wenn man so etwas überstürzt, kann eine ganz vertrackte Situation herauskommen.«
»Was ist mit der NATO und dem Abzug unserer Streitkräfte aus Europa?«
»In Moskau rührt man bereits die Werbetrommel für einen Abbau der Kontingente auf beiden Seiten, aber es kommt darauf an, was die Sowjets darunter verstehen. Eine rein zahlenmäßig angeglichene Reduzierung kommt für uns nicht in Frage. Wenn, dann müssen schon die tatsächlich vorhandenen Truppen- und Waffenkontingente in die Rechnung aufgenommen werden. Im Augenblick sind sie in allen Belangen weitaus stärker als die NATO.
Und eins müssen Sie bedenken: Wenn etwas schiefgeht, brauchen sie bloß durch Polen oder Ostdeutschland vorzustoßen, und schon sind sie auf dem Marsch zum Rhein. Wir müßten erst Truppen aus den Vereinigten Staaten losschicken. Bis wir dort sind, könnte schon alles vorbei sein.«
»Glauben Sie, daß Gorbatschow es ehrlich meint?«
»Oh, selbstverständlich meint er es ehrlich. Er hat gar keine andere Wahl. Die sowjetische Wirtschaft bricht aufgrund allgemeiner Korruption und mangelnder Produktivität zusammen. Sie müssen bedenken, daß es Glasnost und Perestroika nicht erst seit Gorbi gibt. Schon Chruschtschow hat damit angefangen, als er beim Zwölften Parteitag Stalin verurteilte – neunzehnhundertsechsundfünfzig war das, wenn ich mich recht entsinne. Aber die Zeit war nicht reif dafür. Und Gorbatschow hat noch ganz andere Probleme als die Wirtschaft. Das Wiederaufflackern des Nationalismus ist ein ebenso großes Problem.«
»Wie steht es mit dem Vorwurf, wir würden bei der Beendigung des Kalten Krieges hinterherhinken?«
»Die haben den Kalten Krieg verursacht. Nicht wir. Und jetzt möchten sie, daß er aufhört. Das heißt nicht, daß sie erklärtermaßen davon Abstand nehmen, auch weiterhin auf Subversion und Expansion zu setzen, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Sie befinden sich in einer chaotischen Situation, und ich habe nicht die Absicht, etwas zu überstürzen und hinterher als Mitschuldiger dazustehen, wenn sie den Karren in den Dreck fahren – was wahrscheinlich der Fall sein wird.
Die Menschen im Westen haben sich von einer hervorragenden PR-Aktion des Generalsekretärs Gorbatschow einwickeln lassen. Aber die meisten sind sich nicht darüber im klaren, daß er in all seinen öffentlichen Stellungnahmen zum Thema Glasnost niemals, nicht einmal andeutungsweise, eine Reihe von Reformen angeregt hat, die die Sowjetunion in eine pluralistische Gesellschaft verwandeln würden, und auch die Allmacht der Kommunistischen Partei wurde nicht einmal annähernd in Frage gestellt. Er ist ein Kommunist, Mary. Vergessen Sie das nie. Und sorgen Sie dafür, daß es auch die Öffentlichkeit nie vergißt. Man sollte sich an Taten orientieren, nicht an Worten.«
»Und was ist mit Star Wars? Die scheinen ja ganz versessen darauf, daß wir das ganze Projekt aufgeben.«
Er blickte sie eine Zeitlang an, beugte sich dann vor und sagte: »Keinerlei Zitat, keinerlei Andeutung, nicht einmal einen vagen Verweis auf das, was ich Ihnen sage. Okay?«
»Natürlich, Mister President.«
»Die sind uns weit voraus, was SDI angeht. Das haben sie bereits. Genau das ist es doch, was mir durch den Kopf geht, wenn ich Glasnost und Perestroika höre, diese Scheinheiligkeit und Roßtäuscherei.« Er stand auf. »Ich muß los, Mary. War schön, Sie zu sehen. Bleiben Sie noch ein bißchen, und trinken Sie was mit Sean.«
An diesem Abend durfte außer den Marineinfanteristen vom Wachpersonal und den Agenten des Secret Service niemand in Camp David bleiben. Nicht einmal die Mitarbeiter des Weißen Hauses.
Der Präsident speiste mit seiner Frau und dem alten Mann zu Abend. Als sich der alte Mann zum Aufbruch anschickte, begleitete ihn der Präsident zur Tür. Er erinnerte sich, daß Malloy etwas von Arthritis gesagt hatte, und so gab er dem alten Mann ganz sanft die Hand zum Abschied. »Sie haben mir zu mehr Klarheit verholfen, und dafür bin ich Ihnen aufrichtig dankbar.« Dann lächelte er und sagte: »Do swedanja a spasibo.«
Der alte Mann lächelte ebenfalls. »Do swedanja.«
Bill Malloy fuhr mit dem Lincoln zum Dienstbotenbereich des Hauptgebäudes und half dem alten Mann auf den Beifahrersitz. Dann steuerte er den Wagen über den Versorgungsweg zur Hauptstraße und von dort zum Flugplatz.
Sie blieben im Wagen sitzen, während das Flugzeug durchgecheckt wurde. »Wollen Sie es sich nicht noch einmal anders überlegen?« sagte Malloy.
»Nein. Ich habe schon vor langer Zeit Schluß gemacht.« Er lächelte. »Ich hoffe, Sie lassen sich von Zeit zu Zeit mal sehen. Alle beide.«
»Bestimmt. Ich wünschte, wir könnten aller Welt mitteilen, wieviel wir Ihnen verdanken – dem Mann, der den Kalten Krieg gewonnen hat.«
Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Nicht gewonnen, mein Freund. Ich habe nur meinen bescheidenen Anteil dazu beigetragen, daß kein heißer Krieg daraus wurde. Und nur darauf kommt es an.« Er drehte sich zu Malloy um. »Ihre Leute haben allerhand zu tun, mein Freund. Wenn Sie sich die neuen Demokratien anschauen, müssen Sie immer daran denken, was Bertrand Russell gesagt hat.«
»Und zwar?«
»Wenn Ihnen jemand Demokratie bietet und jemand anders einen Sack Korn – wie ausgehungert müssen Sie sein, damit Sie das Korn freien Wahlen vorziehen?«
Dann gab man ihnen ein Zeichen, daß das Flugzeug startbereit war. Malloy begleitete den alten Mann zur Treppe und winkte ihm zu, als er unter der Tür stand.
Lange nachdem die Maschine abgehoben hatte, stand Malloy immer noch da. Wahrscheinlich hatte er den alten Mann zum letzten Mal gesehen, und er empfand Schuld und Trauer. Trotz aller Hilfe, die er ihnen geleistet hatte, war sein Leben leer. So einsam, selbst wenn er unter Menschen war. Blitzgescheit – und doch so unschuldig. Ein Humanist aus ganzem Herzen, und trotzdem fand er bei keinem Menschen Zuspruch. Ein Mann, den man achtete, aber nicht bewunderte. Er tröstete sich in der Gewißheit, daß man ihn zwar gebraucht, sein Engagement aber nicht mißbraucht hatte. »Wir werden jeden Preis bezahlen«, hatte Jack Kennedy gesagt, und der alte Mann war ein Teil dieses Preises gewesen. Aber das Herzblut hatte man ihm in Moskau abgezapft – für eine Sache, die auf der ganzen Welt im Zusammenbruch begriffen war.
Langsam ging Malloy zum Wagen zurück. Wenigstens hatte der alte Mann Tanja, die ihn als Heiligen betrachtete und genügend Liebe für sie beide besaß.
ZWEITES KAPITEL
Während der Zug durch das verschneite polnische Tiefland rollte, fragte er sich, ob er das Richtige getan hatte. Es war schon schlimm genug gewesen, als Rosa noch gelebt hatte: das Chaos in Moskau, der verrückte Mönch im Palast, die dritte Duma, die ebenso erfolglos war wie die vorigen, und dazu von allen Seiten Anzeichen, daß demnächst die Juden an die Reihe kamen. Man hatte ihm geraten, außer Landes zu gehen und seine Familie mitzunehmen. Die Armee werde die Juden genauso rücksichtslos umbringen, wie sie auf die Arbeiter geschossen hatte. Und dann die Mitteilung des Arztes, daß Rosa nur noch ein paar Wochen zu leben habe. Tatsächlich hatte sie noch beinahe sechs Monate weitergekämpft. Beim Verlassen der Synagoge hatte ihn die Polizei angehalten, seine Papiere kontrolliert und ihm lautstark Fragen über Fragen gestellt, bis Lensky eingeschritten war. Lensky war Anwalt, ein wohlhabender Mann, der überall seinen Einfluß geltend machen konnte. Aber es war der letzte Hinweis gewesen, daß sie weg mußten.
Er schaute zu den schlafenden Kindern auf der Sitzbank gegenüber. Andrej, der Fünfjährige, Anna, die gerade vier war, und Iwan, der erst ein Jahr alte Säugling. Er fragte sich, was aus ihnen werden würde. Jahrelang hatte er in seiner Freizeit für die Partei gearbeitet. Auf den Tag gewartet, da die Arbeiter sich erheben würden und die Partei die Macht übernehmen werde. Aufstände hatte es früher schon gegeben, aber die Soldaten des Zaren hatten sie allesamt niedergeworfen. Unglaublich, daß russische Soldaten russische Arbeiter zusammenschossen. Seufzend schüttelte er den Kopf. Eines Tages würde es geschehen, aber er würde es nicht miterleben. Nicht als Kommunist befand er sich auf der Flucht, sondern weil er Jude war. Kein gläubiger Jude, einfach ein Jude, aber das genügte. Als er mit Lensky darüber gesprochen hatte, ob er in den Untergrund gehen sollte, hatte dieser darauf hingewiesen, daß er für drei kleine Kinder sorgen müsse. Und irgendwie hatte er das Gefühl, Lensky wolle ihm mitteilen, daß er als Jude auch nach der Revolution keine Überlebenschance habe. Es gab große Männer in der Partei, die Juden waren. Er fragte sich, ob sie eine Überlebenschance hatten. Lensky war ebenfalls Jude, aber er war ein wohlhabender Mann, der einflußreiche Leute kannte, und zwar nicht nur in Moskau, sondern auf der ganzen Welt. Weiß Gott, was aus ihm und den Kindern geworden wäre, wenn sie Lensky nicht gehabt hätten. Aber die Partei hatte in Paris Arbeit für ihn. Vielleicht erlebte Andrej eines Tages, wie der Traum Wirklichkeit wurde. Er würde ihn schon lehren, worum es ging. Andrej war ein guter Junge mit einer raschen Auffassungsgabe. Lensky hatte ihm die Fahrkarten nach Paris gegeben und dazu genügend Geld für ihren Lebensunterhalt, bis er Arbeit gefunden haben würde. In Paris, so hatte er gehört, seien Handschuhe sehr gefragt, aber notfalls verfügte er auch noch über andere Fertigkeiten. Michail wollte in Moskau ihre wenigen Habseligkeiten verkaufen und ihm das Geld schicken, sobald er eine feste Anschrift in Paris hatte. Er hatte lediglich ihre Kleidung, seine Parteischriften und ein Buch mitgenommen – die vierte deutsche Ausgabe von Karl Marx’ Das Kapital mit einem Vorwort von Friedrich Engels. Bei den Schriften handelte es sich um russische Übersetzungen von Wert, Preis und Profit und Der Klassenkampf in Frankreich. Am 13. Februar 1913 hatten sie Moskau verlassen.
Eine aus Lettland geflüchtete Parteigenossin nahm sie am Bahnhof in Empfang und brachte sie zu einem alten Haus in Montmartre, wo man ihnen dank Lenskys Einfluß zwei Mansardenzimmer überließ. Die Frau entschuldigte sich für die bescheidene Unterkunft, was Grigor Aarons mit heimlicher Belustigung zur Kenntnis nahm. In Moskau hatten sie zu sechst in einem Raum gewohnt, so daß die beiden großen Zimmer, die man ihnen nun gab, vergleichsweise luxuriös waren. Zu seiner Erleichterung erfuhr er überdies, daß sich die Tochter der Frau um die Kinder kümmern wollte, wenn er zur Arbeit war, und daß man bei einer kleinen, aber eleganten Handschuhmacherei in den Hinterräumen eines Modegeschäftes an der Faubourg St-Honoré bereits eine Anstellung für ihn gefunden hatte. Er bemühte sich nach Kräften, nicht daran zu denken, wie glücklich Rosa unter diesen Umständen gewesen wäre. Jetzt mußte all sein Streben den Kindern gelten. Und der Partei. Irgendwann würde ihr Tag kommen. Es mochte noch Jahre dauern, aber es war unvermeidlich.
Die Kinder saßen um den zerschrammten Tisch, eine Art Klapptisch, wie er von reichen Leuten zum Kartenspielen verwendet wird. Er hatte ihnen Hühnersuppe mit Pumpernickel zubereitet, und während sie aßen und sich lachend über ihre armen Freunde in der Schule ausließen, die kein Russisch konnten, saß er auf einem Sessel am Fenster. Grigor hatte zwei Äpfel mitgebracht, und als er sie mitten durchschnitt und jedem ein Stück gab, wandte sich Anna an ihn und sagte: »Anne-Marie hat mich in der Schule gefragt, wieso wir hier sind, Papa. Wieso sind wir hier?«
»Weil wir Juden sind«, gab Andrej ihr zur Antwort.
»Wir sind keine Juden, wir sind Russen.« Anna schaute zu ihrem Vater. »Stimmt das nicht, Papa?«
»Wir sind beides, meine Kleine. Und jetzt iß deinen Apfel auf. Und du, Iwan, bist heute abend mit dem Abwasch und dem Bettenmachen dran.«
Da er drei kleine Kinder versorgen mußte, wurde Grigor nicht zur französischen Armee eingezogen, als der Krieg ausbrach, und weil es an fähigen Männern mangelte, übertrug man ihm die Leitung der Werkstatt, die jetzt Zelttuchgürtel und Gamaschen für Heer und Marine herstellte.
Schließlich ging der Krieg zu Ende. Andrej und Anna kamen in der Schule gut mit, und Grigor Aarons war nun Juniorchef der Handschuhmacherei. Als im Herbst 1917 die wunderbare Nachricht von der Oktoberrevolution eintraf, feierten sie in aller Stille. Die Kinder waren es zwar gewohnt, daß im Wohnzimmer noch lange gestritten und diskutiert wurde, während sie bereits im Bett lagen; und man hatte ihnen auch von den Vorgängen in Moskau erzählt, aber sie waren noch zu jung, um zu begreifen, weshalb die Erwachsenen soviel Aufhebens darum machten. Zu Hause sprachen sie sowohl Russisch als auch Französisch. Russisch während der Mahlzeiten und Französisch, wenn sie ihrem Vater von der Schule erzählten.
Als Andrej zwölf Jahre alt war, unterhielt sich sein Vater tagtäglich mit ihm über die Auseinandersetzungen in Rußland und nannte ihm die Namen der wichtigsten Beteiligten. Er erfuhr vom Kampf zwischen Bolschewiki und Menschewiki und von der Opposition um Männer wie Trotzkij, Sinowjew und Bucharin. Und er hörte von der Komintern, der Kommunistischen Internationale, die den Kommunismus zu allen Arbeitern auf der Welt bringen und ihnen beim Kampf gegen die Kapitalisten beistehen werde. Obwohl sein Vater ihn nie dazu anhielt, wußte Andrej, daß man über so etwas niemals mit Außenstehenden sprechen sollte.
Es waren angenehme Jahre. Frankreich erholte sich allmählich vom Krieg, und die Arbeit seines Vaters fand allgemeine Anerkennung. Manch vornehme Dame, darunter auch die Gattinnen amtierender Minister, bestand darauf, daß ihre Handschuhe von Grigor Aarons eigens für sie angefertigt wurden.
Als Andrej sechzehn war, arbeitete er bei seinem Vater, der mittlerweile gleichberechtigter Teilhaber der Handschuhmacherei war. Die Abende verbrachte er mit den jungen Kommunisten, die in billigen Cafés herumhockten, sich über eine gerechte Weltordnung ausließen und über den Ausgang der Revolution in Rußland spekulierten. Er sprach jetzt ganz gut Französisch, aber die meisten seiner Gefährten waren Flüchtlinge aus dem Baltikum – aus Litauen, Lettland und Estland. Dazu ein paar Studenten von der Sorbonne und einige Italiener, die in Restaurants und Cafés arbeiteten. Sein bester Freund aber war Igor Serow. Nicht daß sie nach außen hin viel Aufhebens von dieser Freundschaft machten, aber anscheinend war Serow von Andrejs Fähigkeit beeindruckt, wankelmütige Parteimitglieder davon zu überzeugen, daß der Kommunismus sowohl in der Theorie als auch in der Praxis funktionierte. Andrej hatte keine Ahnung, womit Serow seinen Lebensunterhalt verdiente, nahm aber an, daß er irgendeine Stelle in der Verwaltung hatte. In einer Gemeinschaft, in der falsche Papiere und neue Identitäten Mittel zum Überleben waren, bohrte man nicht zu tief nach. Aber es gab keinen Zweifel daran, daß Serow weit mehr über die Vorgänge in Moskau wußte, als er beim bloßen Zeitunglesen erfahren haben konnte.
Erschüttert nahm man 1928 beim Pariser Parteiableger die Nachricht zur Kenntnis, daß dreißig altgediente Parteimitglieder, darunter Trotzkij, Sinowjew und Kamenskij, aus der Sowjetunion verbannt worden waren und nun im Exil lebten. In der offiziellen Verlautbarung waren keine Namen genannt worden, aber Serow hatte es Andrej erzählt. Dessen Vater allerdings wollte es nicht glauben und sagte, es handle sich lediglich um revisionistische Propaganda.
Grigor Aarons starb 1929, eine Woche vor Andrejs zwanzigstem Geburtstag. Eine Grippeepidemie hatte Paris heimgesucht und zahlreiche Opfer gefordert. Andrej war nun das Oberhaupt der Familie, eine Aufgabe, der er sich gewissenhaft und voller Verantwortungsgefühl widmete. Inzwischen hatten auch die beiden anderen Geschwister Arbeit gefunden. Iwan als Page in einem der noblen Hotels und Anna als Verkäuferin in einem großen Warenhaus. Trotz ihres unterschiedlichen Temperaments kamen sie gut miteinander aus, und Andrej wurde von den beiden anderen geliebt und bewundert. Selbst Iwan, der mit zunehmendem Alter ziemlich ungebärdig und schnippisch wurde, tat, wie ihm geheißen. Andrej war fast einundzwanzig, als sich sein Leben von Grund auf änderte. Serow gab den Ausschlag dazu, aber allem Anschein nach war diese Veränderung von langer Hand geplant.
Sie saßen an einem Tisch in einem kleinen Café unweit von Andrejs Wohnung.
»Warum bestellst du dir immer heiße Schokolade, Andrej? Warum keinen Kaffee?«
»Kaffee ist was für Stümper. Das ist bloß ein Aufputschmittel. Heiße Schokolade dagegen ist nahrhaft. Ich brauche kein Aufputschmittel, aber ich brauche etwas Nahrhaftes.« Er lächelte. »Außerdem mag ich sie lieber als Kaffee.«
»Hast du immer noch diese langweilige Stelle in der Handschuhmacherei?«
»Wenn du es so ausdrücken willst – ja.«
»Man hat mich gebeten, mit dir über etwas Wichtigeres zu reden.«
»Oh. Worum geht es.«
»Die Partei möchte, daß du hauptberuflich für die tätig wirst.«
»Wer hat das gesagt?«
»Jemand in der Parteiführung. Der Name würde dir nichts sagen.«
»Woher wissen die über mich Bescheid?«
»Ich habe ihnen von dir berichtet.«
»Und was soll ich für sie tun?«
»Sie möchten, daß du ein paar Monate lang zur Schulung nach Moskau gehst.«
Andrej schüttelte den Kopf. »Ich kann die Familie nicht allein lassen. Die anderen brauchen mich.«
»Die Partei braucht dich ebenfalls.« Serow zündete sich eine Zigarette an. »Ich werde mich um die Familie kümmern, solange du weg bist.«
»Was für eine Schulung ist das?«
»Hast du schon mal was von der Komintern gehört?«
»Natürlich.«
»Das Politbüro leitet die Komintern, und dort findet gerade eine große Umbesetzung statt. Eine Art Neuaufbau. Man möchte, daß Parteimitglieder die kommunistischen Parteien im Ausland darin unterweisen, wie sich in ihren Ländern die Revolution organisieren läßt.« Er hielt inne. »Man hält dich für geeignet, eine ganze Reihe von Ländern zu übernehmen. Zumindest Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.«
»Aber ich bin doch viel zu jung, als daß jemand darauf achtet, was ich sage.«
Serow lächelte. »Ich habe dich hier bei der Arbeit erlebt, Andrej. Du hast eine wunderbare Art, mit Zweiflern umzugehen.« Er lachte. »Du hörst den Leuten wirklich zu, und genau das können die meisten Parteibonzen nicht. Und außerdem hast du so ein Selbstvertrauen, daß du sie von deinen Ansichten überzeugen kannst. Die jungen Leute sind es, die wir jetzt überzeugen müssen, Andrej. Die alten Parteihengste sind abgehalftert. Die haben immer nur die offizielle Parteilinie aus Moskau übernommen. Sie haben nie dagegengehalten – sie haben einfach alles hingenommen. Das reicht heutzutage nicht mehr.«
»Wie lange wäre ich weg?«
»Vier Monate – vielleicht auch sechs. Du würdest natürlich bezahlt werden, und das Geld würde an deine Familie überwiesen.«
»Sag mir, wer dieser Mann aus der Parteiführung ist, auch wenn mir sein Name vielleicht nichts sagt.«
»Wenn ich’s dir sage, gehst du dann zu der Schulung?«
»Sag’s mir.«
»Es ist ein alter Freund deines Vaters. Jakob Lensky. Er ist jetzt Mitglied des Politbüros.«
»Aber er ist doch Jude und ...«
»Das gilt für die Hälfte aller Intellektuellen, die jetzt die Partei führen. Jedenfalls wirst du Lenskys Protege sein.«
»Und du wirst die Familie jeden Tag besuchen?«
»Das kann ich dir nicht versprechen, aber ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn ich gebraucht werde. Die werden mir schon keine Schwierigkeiten machen, Andrej. Du hast sie gut erzogen.«
»Ich denke vor allem an den kleinen Iwan.«
Serow lachte. »Der kleine Iwan ist jetzt sechzehn oder siebzehn und durchaus in der Lage, selbst auf sich aufzupassen. Anna ebenso. Keine Sorge, ich werde ein Auge auf sie haben. Eine derartige Gelegenheit, der Partei zu dienen, wirst du nie wieder bekommen.«
Drei ganze Tage hatte die Zugfahrt nach Moskau gedauert. Die hohen Bögen des Belorussischen Bahnhofs waren mit Dampf- und Nebelwolken verhangen. Lensky wartete am Fahrkartenschalter auf ihn. Wie immer wirkte er stattlich und wohlhabend.
Lensky nahm ihn zu einer Wohnung an der Twerskaje-Straße mit, wo sie Blinij und Piroschkij speisten. Nach dem Essen winkte er Andrej zu einem Sessel und bot ihm Wodka an. Er lächelte, als Andrej statt dessen um Tee bat.
»Dein Freund Serow hat mir von deiner hervorragenden Arbeit in Paris berichtet. Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Ich wünschte, er könnte zurückkommen und die Aktivitäten der Partei miterleben.« Er machte eine weitausholende Handbewegung. »Unruhen, ja. Vielleicht sogar Fehlurteile. Aber vor allem Begeisterung und Hingabe an das, woran wir glauben. Aber wir wollen die Revolution exportieren. In alle Welt. Und junge Männer wie du, die talentiert und gut geschult sind, werden unseren Genossen in anderen Ländern zeigen, wie wir unsere Ziele erreichen können.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich so talentiert bin, wie Sie anscheinend glauben, Genosse Lensky.«
Lensky lächelte. »Dies zu beurteilen solltest du uns überlassen, mein Freund.«
»Wo soll ich geschult werden?«
»Die Zentrale in Moskau hat das alte Kuskowo-Anwesen übernommen. Es liegt etwa zehn Kilometer außerhalb der Stadt. Ziemlich primitive Bedingungen, aber die Schulung ist hervorragend. Nur die Vielversprechendsten werden dort hingeschickt. Du bist von mir vorgeschlagen worden, daher erwarte ich, daß du dein Bestes gibst.« Wieder lächelte er. »Aber davon bin ich überzeugt.«
Der Kuskowo-Palast mit seinem weitläufigen Park war einst die Sommerresidenz der Familie Scheremetjew gewesen, einer der ältesten russischen Adelsfamilien, die etliche Staatsmänner und große Soldaten hervorgebracht hatte. Jetzt aber war der Besitz von einem ein Meter achtzig hohen, mit Stacheldraht gekrönten Zaun umgeben. Ein uralter Wagen brachte Andrej zum Tor, wo zwei bewaffnete Posten standen. Der Mann im Pförtnerhäuschen fragte ihn nach seinem Namen.
»Aarons. Andrej Grigorowitsch.«
Der Mann schaute in einer Namensliste nach, griff dann hinter sich, wo eine Reihe von Blechmarken an der Wand hing, nahm eine herunter und reichte sie Andrej.
»Wir benutzen hier keine Namen. Deine Nummer ist drei-neun. Neununddreißig. Du bist im Hollandhaus untergebracht, Genosse.« Er deutete aus dem vergitterten Fenster. »Ist ein ganz schöner Fußmarsch. Das erste Haus ist die Eremitage, danach kommt das Grotto und dann deine Unterkunft.«
Als Andrej quer durch den Park auf die Gebäude zuging, dachte er daran, was der Taxifahrer gesagt hatte, als er vor dem Tor anhielt. »Weißt du, was das hier ist, Genosse? Hier bringen sie den verfluchten Negern bei, wie man eine Revolution macht. Die kriegen soviel Geld, wie sie wollen, aber für unsereinen gibt’s keine lumpige Kopeke.«
Der Mann am Podium wirkte wie ein Akademiker, und genau das war er auch. Strähnige Haare, blasses Gesicht, dicke Brillengläser. Er hielt einige Schriften empor und schaute die Schüler an.
»Das hier müßt ihr genauestens lesen und verinnerlichen.« Er deutete nacheinander auf die einzelnen Titel. Die Rolle der marxistisch-leninistischen Partei im revolutionären Prozeß, Der Kampf um die Einheit der kommunistischen Weltrevolution und Parteimitglieder und der Kampf um nationale und soziale Befreiung. Er ließ den Blick über sie hinwegschweifen. »Dies wird eure Aufgabe in euren Heimatländern sein, Genossen. Ihr dürft nie von den in Moskau festgelegten Prinzipien abweichen.
Ihr werdet darin unterwiesen werden, wie man die kommunistischen Parteien vor Ort motiviert, die Gewerkschaften, Studenten und Arbeiter, wie man sich Rundfunk und Zeitungen zunutze macht, um eine wohlmeinende Haltung zur Sowjetunion zu erzeugen. Es gibt viel zu tun, und ihr seid die Männer und Frauen, die dazu ausersehen sind.«
Zwei der dreißig Schüler, darunter auch Andrej, erhielten eine zusätzliche Ausbildung beim Nachrichtendienst in Moskau. Aber man hatte ihnen ebenso wie den anderen Schülern erklärt, daß Mitglieder der Komintern nie zu nachrichtendienstlicher Tätigkeit eingesetzt würden.
Lang und anstrengend waren die Tage während dieser Sonderausbildung. Bei Wind und Wetter, Regen und Schnee mußten sie durch die Moskau ziehen und lernen, wie man eventuelle Verfolger abschüttelte. Sie erfuhren, wie man Codes benutzte und feststellte, welche Orte zum Hinterlassen von Zeichen und Nachrichten geeignet waren. Wie man Zeichen verwendete, so daß sie nur von der jeweiligen Kontaktperson erkannt werden konnten, wie man Zwischenträger einbaute, damit nur der leitende Agent wußte, wer dem Netz angehörte und was er machte. Darüber hinaus gab es ein als Wunschkonzert kaschiertes Nachrichtensystem, das von Radio Moskau auf Langwelle ausgestrahlt wurde und bei dem bestimmte Wörter in den von Zuhörern aus dem Ausland eingesandten Briefen betont wurden.
Zu guter Letzt wies man sie darauf hin, daß sie sich über ein Kurzwellensende- und -empfangsgerät sogar aus Paris und Berlin mit Moskau in Verbindung setzen könnten, wenn dringende Nachrichten oder Mitteilungen anstünden. Jemand, der sich mit Morsezeichen auskenne und ein Funkgerät bedienen könne, werde immer zur Verfügung stehen, unabhängig davon, wo sie eingesetzt werden würden.
Eine weitere Woche brachte Andrej am Moskauer Filmzentrum zu, wo man ihn im Fotografieren von Dokumenten mit einer Miniaturkamera und der entsprechenden Beleuchtung unterrichtete. Er lernte, wie man einen Film entwickelte, bekam aber gesagt, daß belichtete Filme vor dem Losschicken normalerweise nicht entwickelt würden, es sei denn auf besonderen Befehl hin.
Ein Spezialist zeigte ihm, wie man einfache Schlösser knackte und Kraftfahrzeuge stillegte.
Andrej war dabei ebenso gewissenhaft wie bei allem anderen, was man ihm beibrachte. Die Partei wandte viel Zeit und Geld für ihn auf, und er mußte dafür Sorge tragen, daß beides nicht vergeudet würde. Zwar erkannte er im Augenblick nicht, welchen Nutzen er bei seiner Arbeit für die Komintern aus dieser Spionageschulung ziehen sollte, aber wenn hochstehende Leute sie für notwendig hielten, hatten sie vermutlich gute Gründe dafür.
Aus seiner Kindheit konnte er sich nur vage, fast wie im Traum, an Moskau erinnern, und so boten ihm die sechs Monate, die er dort verbrachte, eine wundervolle Gelegenheit, sich all die Orte anzusehen, von denen sein Vater erzählt hatte. Wenn die tägliche Schulung vorüber war, spazierte er in der Stadt herum, bewunderte die alten Häuser und redete mit Männern, die auf der Straße oder auf Baustellen arbeiteten. Aber er mußte feststellen, daß sie argwöhnisch und zurückhaltend reagierten, wenn er sie auf die Veränderungen ansprach, die seit der Revolution stattgefunden hatten. Als er es Lensky gegenüber erwähnte, warnte ihn dieser zu seiner Überraschung davor, mit Fremden zu reden. Über Politik, so ließ er durchklingen, sollte er nicht einmal mit den Leuten sprechen, die gemeinsam mit ihm ausgebildet wurden.
Bei seinen abendlichen Spaziergängen kam er immer wieder zum Roten Platz, wo er stehenblieb und die angestrahlte Flagge auf dem Kreml betrachtete. Die tiefrote, vor dem dunklen Himmel im Wind flatternde Fahne mit Hammer und der Sichel rührte ihn stets aufs neue. Sie kam ihm vor wie ein Leuchtfeuer für die Menschen dieser Welt.
Der andere Parteizögling, der ebenfalls eine Spezialausbildung erhielt, war ein Mädchen, eine Spanierin. Sie waren zusammen mit einem Ausbilder in einem alten Haus am Manege-Platz untergebracht. Sie war Anfang Zwanzig und sehr attraktiv, aber für seinen Geschmack zu wenig zurückhaltend. Zu risikobereit, so kam es ihm vor, wenn eher Vorsicht geboten war. Sie wiederum sagte ihm, er sei zu vorsichtig und zu reserviert. Aber offensichtlich mochte sie ihn, und er fand ihre Gesellschaft auf eine eigenartige Weise sehr angenehm. Ihr Optimismus wirkte wie ein Gegenpol zu seiner Vorsicht. Offenbar hielt man in Moskau große Stücke auf sie, und sie kannte einflußreiche Leute. Sie war es denn auch, die ihm von Lensky erzählte.
Sie saßen eines Abends in ihrer Wohnung beim Tee und lasen ihre Aufzeichnungen durch, als sie sich an ihn wandte und sagte: »Hast du vor, für die Komintern zu arbeiten oder für den Nachrichtendienst?«
»Für die Komintern.«
»Aber du wirst doch von Lensky gefördert.«
»Na und?«
»Lensky ist beim Geheimdienst.«
»Das glaube ich nicht. Er ist Anwalt.«
Sie lachte. »In mancher Hinsicht bist du wirklich ziemlich unbedarft, Andrej.«
»In welcher Hinsicht?«
»Hinsichtlich der Vorgänge in den oberen Etagen der Partei. Der Machtkämpfe. Lensky zum Beispiel. Die Tatsache, daß er Anwalt ist, hält ihn doch nicht davon ab, für den Geheimdienst zu arbeiten.«
»Und du? Wirst du für die Komintern arbeiten oder für den Nachrichtendienst?«
Sie lächelte und zuckte die Achseln. »Für mich gilt das gleiche wie für dich.«
»Was soll das heißen?«
»Bist du immer noch nicht draufgekommen?«
»Nein.«
»Die Geheimdienstler trauen nicht mal den Mitgliedern der Komintern. Vor allem, wenn sie keine Russen sind. Sie wollen, daß du ihnen Meldung machst, wenn du auf unsichere Kantonisten stößt. Dir trauen sie aus mehreren Gründen. Erstens, weil Lensky dir traut, und zweitens, weil du bei der Schulung der intelligenteste Verfechter der Parteilinie warst. Und sie trauen dir, weil du Russe bist.« Sie lachte. »Und mir trauen sie, weil sie unbedingt jemanden brauchen, der Spanisch spricht und bereit ist, gewisse Risiken für die gemeinsame Sache einzugehen.« Sie hielt inne. »Du solltest dir lieber darüber klarwerden, Andrej, daß die hohen Herren trotz der Revolution noch immer darum kämpfen, wer die Zügel in der Hand hält.«
»Damit habe ich nichts zu tun.«
»Eines Tages vielleicht schon, mein Lieber.« Wieder lachte sie. »Frag Lensky, wenn du mir nicht glaubst. Egal, wer gewinnt, Lensky wird immer obenauf sein.«
Lensky stand am Fenster und schaute hinaus auf die Lichter der Stadt, während der Schnee in dichten, weichen Flocken fiel. Ohne sich umzudrehen, sagte er: »Ich möchte, daß du vor deiner Abreise morgen noch jemanden kennenlernst. Seine Name ist Spasskij. Gene Spasskij. Er ist etwa fünf Jahre älter als du, aber er wird noch ein sehr bedeutender Mann werden. Er weiß über dich Bescheid. Später, wenn du dich in deine Arbeit eingefunden hast, wird er dein Vorgesetzter sein.«
»Ist er ein Spion?«
»Nein.« Lensky zögerte. »Nun ja, sagen wir mal, er hat Verbindungen zum Nachrichtendienst. Er ist ein führender Mann in der Partei, und zu seinem Aufgabenbereich gehören der Sicherheitsdienst und die Komintern. Du kannst ihm vertrauen. Falls du irgendwelche Schwierigkeiten haben solltest, kann er damit umgehen.« Er wedelte mit der Hand zu dem niedrigen Tischchen hin, an dem Andrej saß. »Die beiden Päckchen sind für Anna und Iwan. Bestell ihnen liebe Grüße.«
Der Mann namens Spasskij trug seine Segeltuchtasche, als sie zum Bahnhof gingen. Zusammen stapften sie durch den Schnee. Spasskij fragte ihn nach Anna und Iwan. Wären sie bereit, in Paris zusammen mit Andrej zu arbeiten? Würden sie sich auch einsetzen? Beherrschte Andrej den Code, den sie im Schriftverkehr mit ihm benutzen wollten? Wie gut kannte er Serow? Spasskij schien an seinen Antworten nicht besonders interessiert. Kurz vor Abfahrt des Zuges fragte er ihn schließlich, wie er das Gold in Francs einzutauschen gedenke. Offenbar stellte ihn die Antwort zufrieden. Als der Zug seine lange Fahrt aufnahm, blieb Spasskij grußlos und ohne zu winken zurück.
DRITTES KAPITEL
Serow holte ihn am Bahnhof ab und bestand darauf, daß sie auf dem Heimweg noch in ein Café gingen.
Beim Kaffee eröffnete ihm Serow, daß in den nächsten zwei Tagen in mindestens zwei französischen Zeitungen Berichte veröffentlicht würden, wonach fünf Millionen russische Bauern enteignet und in abgelegene Gegenden der Sowjetunion verbannt worden wären. Eine deutsche Zeitung werde sogar behaupten, daß wenigstens eine Million Bauern ermordet worden sei.
»Ist das wahr?« sagte Andrej.
Serow zuckte die Achseln. »Mehr oder minder. Ich habe sogar gehört, daß es keine fünf, sondern sieben Millionen waren. Was wiederum bedeutet, daß es in den nächsten zwei Jahren so gut wie keine Ernte geben wird.« Er lächelte. »Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, daß die Bürokraten in Moskau die Felder bestellen und das Korn einbringen. Und es steht kaum zu erwarten, daß sich die Landarbeiter, die beim Abmurksen der Bauern mitgeholfen haben, für ihre neuen Herren genauso abrackern, wer immer die auch sein mögen.«
»Wieso hat Lensky mich nicht vorgewarnt?«
»Von den Zeitungsartikeln dürfte er nichts wissen, und die Liquidierung der Kulaken war schon letztes Jahr.«
»Wie, zum Teufel, soll ich das den hiesigen Parteimitgliedern erklären?«
Wieder lächelte Serow. »Ich weiß es nicht. Aber ich bin gespannt, wie du es ihnen beibringst.«
»Wissen sie bereits Bescheid?«
»Heute war ein Artikel in der Zeitung. Bloß ein paar Absätze. Drohende Hungersnot in Rußland und dergleichen mehr.« Er stockte. »Ich habe für heute abend eine Parteiversammlung einberufen. Du solltest es den Leuten lieber erklären.«
»Wieso machst du das nicht?«
»Lensky möchte, daß du es übernimmst. Außerdem möchte er, daß du nach Marseille fährst. Die befehden sich dort untereinander. Er will, daß du für Ordnung sorgst.«
»Erst möchte ich ein, zwei Tage bei meiner Familie zubringen, bevor ich irgendwo hinfahre. Ich bin sechs Monate weggewesen.«
»Lensky sagte, du sollst dir eine größere Wohnung besorgen. Ich kann dir eine zeigen.«
»Wo liegt sie?«
»In den Batignolles. Rue Legrande. Anna und Iwan haben sie sich bereits angesehen. Sie gefällt ihnen.«
»Wieso möchte Lensky, daß wir umziehen?«
»Damit ihr genug Platz habt, falls von unseren Leuten mal jemand auf der Flucht ist und irgendwo unterkommen muß. Bloß für eine Nacht, bis wir etwas anderes gefunden haben.«
Tags darauf zogen sie zur Begeisterung der ganzen Familie in die neue Wohnung um. Aber irgendwie ärgerte sich Andrej darüber, daß Serow sich in seine Familienangelegenheiten einmischte. In Moskau hatte man mit keinem Wort erwähnt, daß Serow sein Vorgesetzter sei, doch da Serow anscheinend in ständigem Kontakt mit Lensky stand, fand er sich mit der Situation ab.
Die Parteimitglieder in Paris und Marseille akzeptierten seine Erklärungen zur Liquidierung der Kulaken. Jegliche Anstalten, die Partei zu spalten und ihre Ziele und Vorgehensweisen zu verändern, so hatte er ausgeführt, würden in jeder Hinsicht als illoyal betrachtet. Für die Kulaken müßten daher die gleichen strengen Strafmaßnahmen zur Anwendung gelangen wie für Verräter vom Schlage Trotzkijs oder Sinowjews.
Seine nächste Reise führte nach Berlin, wo die Partei an denselben Grundsätzen zu zerbrechen drohte wie in Moskau. Andrej war klargeworden, daß man Stalin als den Mann darstellen mußte, der als einziger den Willen und die Kraft hatte, das Programm des Politbüros durchzuziehen. Und wenn es dabei zu Widerstand und Störmanövern von seiten alter Genossen kam, dann mußten sie eben geopfert werden.
Als Andrej von einem kurzen Abstecher nach Spanien zurückkam, den er auf Anweisung Moskaus hin unternommen hatte, fand er den ersten unfreiwilligen Gast in ihrer Wohnung vor. Es handelte sich um eine junge Französin namens Chantal Lefevre. Sie wurde von der französischen Polizei wegen »subversiver Akte wider die Sicherheit des Staates« gesucht. Sie hatte nicht nur aktiv an der Gründung einer militanten Gewerkschaft für Textilarbeiter mitgewirkt, sondern auch eine wesentliche Rolle beim Herausgeben eines marxistisch-leninistischen Untergrundblattes gespielt, in dem ausführlich auf die Bestechung korrupter Politiker durch Waffenhersteller eingegangen wurde, die sie als »Händler des Todes« bezeichnet hatte.
Andrej verliebte sich auf der Stelle in sie. Mit ihren langen schwarzen Haaren und den großen braunen Augen hätte man sie für eine Jüdin halten können, doch das war sie nicht. Sie entstammte einer Hoteliersfamilie aus Lyon und war zu Toleranz, aber auch einer gewissen Skepsis gegenüber den Leuten erzogen worden, die Frankreich in dieser unsicheren, von gesellschaftlichen Spannungen geprägten Zeit regierten.
Ihre Eltern hatten die Aktivitäten ihres einzigen Kindes stets geduldet. Sie bewunderten ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit, auch wenn sie Zweifel hegten, ob die von ihr erwählte Sache eine derartige Hingabe und Opferbereitschaft verdiente.
Anna jedenfalls hatte bereits dafür gesorgt, daß sie sich als Mitglied der Familie fühlte.
Chantal war es, die Andrej dazu überredete, die Gegend zu erkunden, in der sie wohnten, und sich zur Abwechslung einmal mit etwas anderem zu beschäftigen als den ständigen Versammlungen und Streitgesprächen mit Flüchtlingen aus Osteuropa. Für ihn war es bedeutungslos, wo sie wohnten. Es war nur der Ausgangspunkt für seine Arbeit.
Sie nahm ihn mit in die Gegend um die Rue de Rome, wo sich die Läden befanden, in denen die Studenten am Pariser Konservatorium einkauften. Läden, in denen Violinen und Lauten gebaut wurden, wo man Noten kaufen konnte und allerlei Instrumente.
Die Batignolles, zwischen der anrüchigen Place de Clichy und dem Gare St-Lazare gelegen, waren eine ruhige Gegend.
Sie nahm ihn mit in ein kleines Café, wo man sie offenbar kannte und schätzte. Als sie an einem Tisch auf dem Bürgersteig Platz genommen hatten, sagte sie: »Wenn du nicht davon loskommst, wirst du genau wie die anderen.«
Er lächelte. »Was soll das heißen?«
»Sie werden zu Fanatikern. Sie haben kein Interesse mehr an den Menschen oder ihrem Alltagsleben. Menschen sind nur mehr Objekte. Für die ist es noch immer wie neunzehnhundertsiebzehn. Sie begreifen nicht, daß normale Menschen, sosehr sie der Partei auch ergeben sein mögen, ein Privatleben haben. Sie verlieben sich, sie machen Leid, Krankheit und Tod durch, haben Schwierigkeiten in der Arbeit, Schulden und so weiter.« Sie lächelte. »Du bist viel zu außergewöhnlich, als daß man zulassen dürfte, daß du ein Parteihengst wirst. Wir brauchen Leute wie dich, Menschen mit Phantasie, die uns führen können. Sonst haben wir für unsere Revolution am Ende nichts weiter vorzuweisen als Diskussionsgruppen und Agitatoren.«
»Wie kommst du darauf, daß ich außergewöhnlich bin?«
Sie wandte sich einen Moment lang ab und betrachtete die auf dem Bürgersteig vorbeigehenden Menschen. Dann schaute sie ihn wieder an.
»Sag mir eins. Wärst du bereit, zum Wohle der Partei Lügen zu erzählen, und zwar vorsätzlich und obwohl du weißt, daß die Leute jedes Wort glauben, weil es von dir kommt.« Sie lachte. »Keine besonders gute Erklärung. Aber du weißt schon, was ich meine.«
Er lächelte. »Die Antwort lautet: nein. Ich würde nicht wissentlich zum Wohle der Partei lügen. Weil ich nämlich davon überzeugt bin, daß die Leute in Moskau vermutlich gute Gründe für gewisse Verhaltensweisen haben, auch wenn diese anscheinend im Gegensatz zur allgemeinen Parteimeinung stehen.«
Sie lachte auf. »Du hättest Lehrer werden sollen, Andrej. Oder vielleicht auch Priester?«
Er zuckte die Achseln. »Vielleicht könnte ich als Lehrer oder Priester mehr für die Partei tun.«
»Serow sagt, daß du in der Partei bereits als kommender Spitzenmann giltst.«
»Apropos Serow. Wie gut kennst du ihn?«
»Er ist eine Art Beobachter für Moskau. Liefert Berichte über Leute. Spricht perfekt Französisch. Seine Mutter war Französin. Er ist sehr schlau. Opfert viel Zeit für die Gewerkschaften. Kümmert sich im Auftrag der Moskauer Zentrale um ganz Frankreich und Belgien.«
»Ist er bei der Komintern?«
»Das sagt er jedenfalls.«
»Und was denkst du?«
»Ich denke, er ist ein Spion.« Sie lächelte. »Du doch auch, oder etwa nicht?«
»Ich bin mir nicht sicher. Laut meinem Auftrag arbeite ich für die Komintern.«
»Aber du bist doch für nachrichtendienstliche Tätigkeit ausgebildet worden, oder etwa nicht?«
»Wer hat dir das gesagt?«
»Serow.«
»Der redet zuviel.«
Sie lachte. »Bei hübschen Mädchen wird er immer schwach. Möchte sie beeindrucken.«
»Hat er dich beeindruckt?«
»Nein. Er ist nicht mein Typ.«
»Wer ist dein Typ?«
Sie grinste. »Wie heißt es doch in den amerikanischen Filmen? Ich berufe mich auf den fünften Verfassungszusatz und verweigere die Aussage.«
Er öffnete den Mund und wollte zu einer Erwiderung ansetzen, überlegte es sich dann aber anders.
»Was wolltest du sagen?«
»Ist doch egal.«
»Sag’s mir.«
»Lassen wir’s lieber.«
»Ich weiß, was du sagen wolltest. Du kannst es mir also ruhig verraten.«
»Und was wollte ich sagen?«
»Du wolltest sagen, daß du mich magst.«
»Woher weißt du das?«
Sie lächelte. »Du bist wirklich ganz schön unbedarft, Andrej Aarons. Ich weiß eben, daß du mich magst. Und ich mag dich auch.«
»Wieso magst du mich?«
»Weil du ein netter Mensch bist. Und ein bescheidener obendrein. Du bist zu Großem fahig, aber das ist dir nicht bewußt. Bei dir fühle ich mich geborgen.«
»Ich mag dich nicht nur, Chantal. Ich liebe dich. Ich habe dich vom ersten Augenblick an geliebt. Und mit jedem weiteren Tag immer mehr. Ich fühle mich bei dir ebenfalls geborgen.«
Trotz Serows dringender Warnungen, daß dadurch seine Einsatzkraft als Funktionär der Komintern beeinträchtigt werde, heirateten sie zwei Monate später. Andrej war überrascht davon, wie viele Menschen sich in der Maîrie versammelten, um der Trauung beizuwohnen. Und noch mehr überraschte ihn das Glückwunschtelegramm, das Lensky aus Moskau sandte.
Im September 1937 erhielt er aus Moskau die Anweisung, zu einer Unterredung mit Lensky nach Berlin zu reisen.
Sie trafen sich in einem kleinen Hotel an der Kantstraße. Lensky überreichte Andrej einen silbernen Spiegel, den er für Anna mitgebracht hatte, und eine Uhr für Iwan. Dann nahm er auf einem Sessel Platz, lehnte sich zurück und schaute ihn an.
»Unsere Leute in Spanien wie auch hier in Berlin sagen, du hättest selbst die Wankelmütigsten resrlos davon überzeugt, daß es notwendig war, Trotzkij und die anderen in die Verbannung zu schicken. Wie lange hast du darüber nachgedacht, was du sagen willst?«
»In Paris mußte ich so was Ähnliches schon mal machen. An dem Tag, als ich aus Moskau zurückgekommen bin. Daher kannte ich die Fragen und die Einwände.«
»Ja gut, aber wie hast du dir deine Worte zurechtgelegt?«
Andrej zuckte die Achseln. »Ich mußte mir nichts zurechtlegen. Wenn sich ein Mann, egal wie wichtig er ist, seiner Verpflichtung gegenüber der Partei entziehen will, dann muß ihm Einhalt geboten werden. Wir haben weder die Zeit noch die Energie für Polemiken und dilettantische Diskussionen über mögliche Alternativen. Wir haben unsere Ziele, wir haben uns entschieden, wie wir sie erreichen wollen, und diejenigen, die davon abweichen, sind Volksfeinde.« Er hielt inne. »Meines Erachtens war die Verbannung das mindeste, was man tun konnte.«
»Hast du niemals Zweifel?«
»Nein. Niemals. Für Zweifler ist längst keine Zeit mehr. Wir möchten jetzt in Aktion treten, unseren Traum verwirklicht sehen. Nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Nur darauf kommt es an.«
»Ich wünschte, wir hätten Tausende, die so wie du sind, Andrej.«
»Die haben wir, Genosse Lensky. Sie müssen nur geschult werden. Lenin und Marx haben die Gesetzmäßigkeiten für die Weltrevolution vorgegeben. Der Genosse Stalin setzt sie in die Tat um.«
»Teilt Chantal deine Ansichten.«
»Natürlich. Die ganze Familie.«
Lensky schaute zum Fenster und wandte sich dann wieder Andrej zu. »Was ich dir jetzt sage, muß unter uns bleiben. Hast du verstanden?«
»Natürlich.«
»Wir möchten, daß du auswanderst. Du und die Familie. Wir möchten, daß ihr nach Amerika auswandert. In die Vereinigten Staaten. Und zwar in den nächsten zwei Monaten.« Er seufzte. »Uns liegen inzwischen klare Beweise dafür vor, daß die Nazis darauf aus sind, alle Juden zu vertreiben. Deswegen haben wir dir einen falschen Paß geschickt. Mancherorts haben die Schikanen bereits angefangen. Juden werden in aller Öffentlichkeit gedemütigt und manches Mal auch ermordet.«
»Aber ich lebe normalerweise in Paris. Hier in Deutschland bin ich immer nur für ein oder zwei Tage.«
»Ich weiß, ich weiß.«
Lensky stand auf, ging zum Fenster und schaute eine ganze Weile hinaus, bevor er sich wieder zu Andrej umdrehte.
»Was ich dir jetzt sage, mußt du vertraulich behandeln: Es gibt immer mehr unwiderlegbare Beweise dafür, daß Hitler auf Krieg aus ist. Er hat vor, ganz Europa zu unterwerfen. Nirgendwo in Europa werden Juden noch sicher sein. Wir können es uns nicht leisten, dich zu verlieren. Du hast Fähigkeiten und Eigenschaften, die selten und wertvoll sind. Wir haben bereits zwei wichtige Männer verloren, einen hier in Berlin und einen im Ruhrgebiet. Sie wurden mitten in der Nacht von der Gestapo festgenommen, und niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Die Polizei und die Gestapo behaupten, sie wüßten von nichts. Wir haben einen Informanten bei der Kripo. Er ließ uns wissen, daß sie als angebliche jüdische Agitatoren verhaftet wurden. Die SA macht auf offener Straße Jagd auf Juden und schlägt ihre Läden und Häuser kurz und klein. Die Nazis haben vor niemandem mehr Angst. Weder vor den Engländern noch vor den Franzosen. Der Spanische Bürgerkrieg dient ihnen nur zur Erprobung ihrer Luftwaffe. Die werden ihren Krieg anzetteln, glaube mir. Und alles deutet darauf hin, daß sie ihn auch gewinnen werden.« Er seufzte. »So sieht es aus. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern es deckt sich auch mit der Einschätzung der Lage von seiten Moskaus. Wann – das wissen wir nicht. Aber lange wird es nicht mehr dauern, fürchte ich. Wir müssen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir brauchen deine Hilfe.«
Andrej schwieg mehrere Minuten lang. »Was soll ich in Amerika tun?« fragte er schließlich.
»Einfluß auf die Menschen nehmen. Unsere Leute dort dahingehend organisieren, daß sie die Sowjetunion als Verbündeten betrachten. Als friedliebendes Volk. Für die meisten Amerikaner sind wir der Feind. Vermittle ihnen unsere guten Absichten. Sorge dafür, daß sie uns mögen, wenn wir am Zug sind.«
»Was meinen Sie damit – wenn wir am Zug sind?«
»Wenn Hitler ganz Europa erobert hat, wird er sich gegen uns wenden. Die Amerikaner werden sich unter allen Umständen aus einem Krieg in Europa heraushalten wollen. Sorge dafür, daß sie zumindest Verständnis für unsere Bemühungen haben, den Krieg zu verhindern.«
»Und die Leute beim Nachrichtendienst in Moskau?«
»Mit denen hast du nichts zu tun. Wenn die Nazis über Europa herfallen, darf es nicht den geringsten Verdacht geben, daß wir die Amerikaner ausspionieren. Wir werden unsere Leute anweisen, sämtliche nachrichtendienstlichen Tätigkeiten einzustellen.«
»Sie wissen, daß ich kein Englisch kann. Keiner von uns.«
»Dann solltet ihr es lernen. Überlaß Serow Frankreich. Er ist kein Jude. Er wird’s überstehen.«
»Es dürfte Schwierigkeiten bei der Einwanderung geben.«
»Nein. Wir werden uns um alles kümmern. Ihr werdet unter eurem richtigen Namen reisen, aber mit deutschen Pässen. In Amerika ist man jüdischen Flüchtlingen sehr wohlgesonnen. Wir haben Leute dort, die dafür sorgen, daß ihr bei der Einwanderung keinerlei Schwierigkeiten bekommt. Und im Laufe der Zeit nehmt ihr dann die amerikanische Staatsbürgerschaft an.«
»Heißt das, daß wir länger dort bleiben?«
»Auf Dauer, Andrej. Laßt euch nieder und werdet Amerikaner. Ihr werdet über alle erforderlichen Mittel verfügen.«
Im Februar 1938 wanderten sie nach Amerika aus. Andrej brach zuerst auf. Allein. Auf den Rat anderer russischer Juden hin beschloß er, sich in Breighton Beach niederzulassen, einer Gegend, in der so viele jüdische Einwanderer aus Rußland und Polen lebten, daß eine weitere Familie aus Osteuropa überhaupt nicht weiter auffallen würde.
Es war ein armer Bezirk, nur ein paar Hochbahnstationen vor Coney Island gelegen, aber die Lebensbedingungen waren weitaus besser als in Moskau. Die Geschäfte, die Restaurants, die gesamte Atmosphäre sorgten dafür, daß er sich wie zu Hause fühlte. Sogar Russisch konnte er sprechen, ohne daß deswegen irgend jemand auf die Idee gekommen wäre, er sei kein Amerikaner. Er war davon überzeugt, daß sich die Familie rasch einleben würde.
In den zwei Monaten, die bis zu ihrer Ankunft verstrichen, stellte er fest, daß ihm Chantal mehr fehlte, als er erwartet hatte. Er war ständig unterwegs, fand für sich und seine Angehörigen eine ziemlich geräumige Wohnung über einem leerstehenden Geschäft, sah sich in den Läden um und erkundete, welche Arbeitsmöglichkeiten es für sie gab. In der näheren Umgebung eine Stelle zu finden war offensichtlich nicht einfach, aber für nur zehn Cents kam man mit der Hochbahn nach Manhattan. Außerdem hörte er, daß es in Sheepshead Bay und weiter nördlich, in der Gegend um den Prospect Park, Arbeit für Frauen gab, so daß sie nicht in die Innenstadt fahren mußten.
Nach einem Monat hatte er Kontakt zu mehreren führenden Kommunisten vor Ort aufgenommen und bei diversen Zusammenkünften im privaten Kreis über die politische Linie Moskaus gesprochen. Man hörte ihm aufmerksam zu und nahm an, daß er ein Agent der Komintern sei, obwohl er nie ein Wort darüber verlor. Diese Leute waren daran gewöhnt, ihre politische Gesinnung geheimzuhalten, aber es gab auch zahlreiche gewöhnliche Parteimitglieder, die sich ganz offen für die Ziele des Kommunismus einsetzten. Er wurde von etlichen Familien eingeladen, die ihm beim Kauf von gebrauchten Möbeln und Küchengeräten für die Wohnung behilflich waren. Außerdem büffelte er mindestens zwei Stunden täglich Englisch.
Als Lensky ihn auf den Umzug nach New York vorbereitet hatte, hatte er geglaubt, es handle sich nur um eine Fortsetzung seiner üblichen Arbeit für Moskau. Doch nun, da er sich tatsächlich in New York befand, erfaßten ihn Zweifel. Ihm wurde klar, daß er wegen seiner schlechten Englischkenntnisse einen großen Bogen um Manhattan machte. Zweimal war er hingefahren, und beide Male war er von den Menschenmassen und dem geschäftigen Treiben überwältigt gewesen. Und von ihm erwartete man, daß er unter all diesen Menschen nicht nur zurecht kam, sondern auch noch Einfluß auf sie nahm. Es kam ihm grotesk vor.
Sprachbegabt war er seit jeher gewesen, aber die paar Brocken, die man beim Einkaufen oder im Gespräch mit den Nachbarn brauchte, reichten nicht für die Arbeit, die man von ihm erwartete. Doch wenn die Partei dies wollte, mußte er sich eben nach besten Kräften darum bemühen. Zum ersten Mal in seinem Leben zweifelte er daran, ob er ihren Wünschen gerecht werden konnte. Was kümmerte es diese vitalen, quicklebendigen Menschen schon, wie sie seiner Ansicht nach ihr Leben gestalten sollten? Mit einem Mal kam ihm das Dasein in Paris, das scheinbar so ausgefüllt gewesen war, viel zu beschaulich vor, allzu müßig. Und er wünschte, er könnte weitermachen wie gewohnt. Manchmal, wenn er sich einsam fühlte, war er fast soweit, daß er sich seine Angst eingestand. Die Angst vor der Aufgabe, die man ihm gestellt hatte. Die Ungewißheit, wie er sie anpacken sollte. Und die Angst, jämmerlich zu versagen.
Er aß alleine – eine Mahlzeit am Tag, immer abends – und ging dann den Boardwalk entlang nach Coney Island, lief wieder zurück und setzte sich an seine Bücher. Abends fehlte ihm Chantal ganz besonders. Es gab so vieles, was er ihr erzählen, so vieles, was er ihr zeigen wollte. Er kabelte ihr die Adresse durch, und mehrmals schrieb er ihr auch einen Brief, schickte ihn aber nie ab. Alles Schriftliche, so harmlos es auch sein mochte, konnte gefährlich werden.
Schließlich bekam er ein Telegramm von Serow, der ihm mitteilte, daß sie an Bord eines lettischen Schiffes von Le Havre aus in See gestochen waren und etwa drei Wochen unterwegs sein würden. Als die dritte Woche anbrach, rief er täglich bei der Hafenmeisterei an. Am Freitag erfuhr er, daß das Schiff tags darauf anlegen sollte.
Er stand am Kai, als die Besatzung den Schauerleuten die Leinen zuwarf. Und eine Stunde später sah er sie die schwankende Gangway heruntersteigen, bepackt mit allerlei Taschen und Bündeln, obwohl er ihnen aufgetragen hatte, nur das Allernötigste mitzunehmen. Als sie ihn entdeckten, winkten sie ihm lächelnd zu und begaben sich zur Baracke der Einwanderungsbehörde.
Es dauerte über eine Stunde, bis sie herauskamen. Mit wehenden Haaren stürmte Chantal auf ihn zu, und als sie einander endlich in den Armen lagen, hatte Andrej das Gefühl, daß alles gutgehen werde.
VIERTES KAPITEL
Allmählich hatten sie sich in Brighton Beach, das von seinen Bewohnern liebevoll »Odessa am Meer« genannt wurde, eingelebt, auch Chantal. Die anderen kamen sich ohnehin vor wie in Rußland. Wenn sie hörten, wie die Leute Jiddisch, Russisch und Polnisch miteinander sprachen, fühlten sie sich heimischer als in Paris.
In den ersten paar Wochen hatte er ihnen die Gegenden gezeigt, die sie bislang nur aus Illustrierten oder vom Kino her kannten. Den Central Park, den Times Square, die Fifth Avenue und die Park Avenue.
Er nahm sie mit ins Brooklyn Museum und zum Prospect Park. Der Prospect Park gefiel ihnen besser als der Central Park. Am Wochenende gingen sie nach Coney Island, wo sie sich wie Tausende anderer New Yorker Arbeiter an den Strand setzten und den Ausblick aufs Meer und die frische Luft genossen. Wie alle anderen amüsierten sie sich im Vergnügungspark und standen bei Nathans Würstchenbude an.
Sie gingen immer zu Fuß, und manchmal gönnten sie sich bei »Mrs Stahl’s Knisches« ein Knisch. Am liebsten aber aßen sie in einem der kleinen russischen Restaurants an der Brighton Beach Avenue, direkt unter der Hochbahn.
Doch dann traf ein in Mexico City abgestempelter Brief mit verschlüsselten Anweisungen ein, der ihr Leben nachhaltig verändern sollte. Und das galt nicht nur für Andrej, sondern auch für die anderen. Der ständige Moskauer Hickhack um Zuständigkeitsbereiche führte dazu, daß er nun sowohl für die Komintern als auch für den Nachrichtendienst tätig werden sollte. Nur er konnte die anspruchsvolle Arbeit für die Komintern leisten. Folglich mußte er den anderen gewisse Routineaufgaben übertragen, die die Leute vom Nachrichtendienst verlangten. Sie selbst sollten nicht zu nachrichtendienstlichen Tätigkeiten herangezogen werden, mußten aber in der Lage sein, ein Netz zu leiten, das Kurier- und Zwischenträgerdienste für sowjetische Agenten in New York übernehmen konnte, zumindest für die in Brooklyn ansässigen, aber auch für einige andere in Manhattan. Verlangt wurden neue »tote Briefkästen«, neue Verfahrensweisen und zumindest ein halbes Dutzend »sichere Häuser« für untergetauchte Agenten.
Mit einem Mal schien es so, als sei man in Moskau schlagartig vom strikten Neutralitätskurs gegenüber den Vereinigten Staaten abgekommen, als erwarte man aus irgendwelchen Gründen politische Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion. Er hatte in Moskau vorgefühlt und sich erkundigt, wie es zu diesem Meinungsumschwung kommen konnte, aber man war nicht auf seine Fragen eingegangen. Hider und Mussolini hatten gerade ein Abkommen geschlossen, das sie im Falle eines Krieges zu gegenseitiger politischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung verpflichtete. Aber Aarons Ansicht nach war dieser Pakt bedeutungslos. Mussolini würde wegen Adolf Hider und der Nazis nicht sein neugewonnenes afrikanisches Imperium aufs Spiel setzen. Die beiden waren Rivalen, keine Verbündeten, jeder darauf bedacht, sich als der wahre faschistische Führer darzustellen.