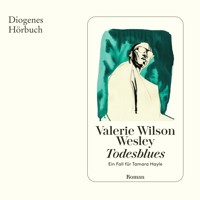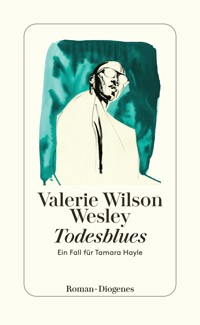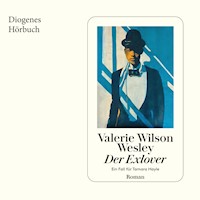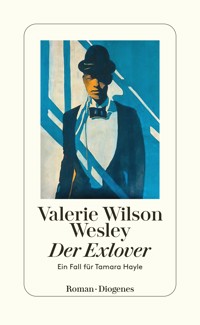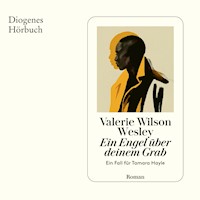13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tamara Hayle
- Sprache: Deutsch
Tamara Hayle hat ihren Job als Polizistin an den Nagel gehängt, ihrem Ehemann DeWayne den Laufpass gegeben und schlägt sich alleine als Privatdetektivin auf dem harten Pflaster von Newark, New Jersey, durch. Doch DeWayne, Vater ihres Teenagersohnes Jamal, meldet sich spätestens, wenn er in Schwierigkeiten ist. Terrence, sein Sohn aus einer anderen Beziehung, ist ums Leben gekommen. Nun fürchtet Tamara um ihr eigenes Kind: »Wenn wir abwarteten, bis die Polizei die Sache in die Hand nahm, würde Jamal sterben.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Valerie Wilson Wesley
Ein Engel über deinem Grab
Ein Fall für Tamara Hayle
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gertraude Krueger
Diogenes
Oh, what you goin to do
When Death comes stealing in your room?
O my Lord, O my Lord
What shall I do?
Traditional
1
»Bist du das, Tamara?«, fragte die Stimme am Telefon. Ich hatte ihn sofort erkannt, gab aber keine Antwort. DeWayne Curtis war der allerletzte Mensch, mit dem ich an diesem Sonntagmorgen reden wollte, zumal ich noch gar nicht aufgestanden war.
»Bist du das?«, fragte er noch einmal.
»Wer soll es denn sonst sein? Du hast doch meine Nummer gewählt, oder nicht?«, sagte ich schließlich.
»Ich muss mit dir reden, Tamara. Es ist dringend. Ich bin in einer Telefonzelle unten am Parkway.«
»Was?!«, schrie ich entsetzt in den Hörer und stützte mich im Kissen auf. Dass DeWayne Curtis nach wie vor meinte, ich hätte mich stets nach seinen Bedürfnissen zu richten, machte mich nach wie vor wütend. Als ich ihn vor fünfzehn Jahren kennengelernt und geheiratet hatte, war ich jung und dumm genug, seine überhebliche Selbstsucht für Charakterstärke zu halten. Inzwischen war ich klüger geworden. »Was willst du von mir?«, fragte ich, ohne Höflichkeit vorzutäuschen. Unser Sohn Jamal war in seinem Zimmer und schlief vermutlich noch, da brauchte ich meine wahren Gefühle nicht zu verbergen; ich konnte mit DeWayne reden, wie es mir passte. »Sag, was du von mir willst, und lass mich ansonsten in Ruhe.« Ich wollte mir ganz in Gedanken eine Zigarette aus der Nachttischschublade nehmen, wo sie früher immer lagen, dabei hatte ich doch vor einem halben Jahr aufgehört. Alles nur wegen DeWayne.
»Ich muss mit dir reden«, wiederholte er, diesmal noch dringlicher. »Es ist etwas passiert, und ich muss mit irgendwem darüber sprechen. Ich muss zu dir kommen, Tammy.«
Aha, jetzt bin ich wieder Tammy, dachte ich. Also ist es ernst. Er hatte mich nicht mehr Tammy genannt, seit ich ihn verlassen hatte. Eine Weile sagte ich gar nichts; ich wollte ihn warten lassen. Draußen regnete es; ich hatte noch nicht die Augen geöffnet, als ich schon hörte, wie die Tropfen gegen die Scheibe des Dachfensters schlugen, das ich letzten Sommer einbauen ließ. Irgendwie freute mich der Gedanke, dass DeWayne Curtis da draußen im Regen stand und wartete, bis ich zu einem Entschluss kam. Eigentlich hatte ich an diesem Morgen zu nichts richtig Lust gehabt, als – friedlich und ungestört – im Bett zu bleiben und mir höchstens den Kopf zu zerbrechen, ob ich eine Kanne von dem Blue-Mountain-Kaffee aufsetzen sollte, den ich von meinem alljährlichen großkotzigen Ausflug nach Negril mitgebracht hatte, oder ob ich mal von meiner Koffeinsucht lassen und mir eine Tasse Red-Zinger-Tee aufbrühen sollte.
»Tammy«, sagte DeWayne noch einmal. Ich stieß einen Seufzer aus. »Tammy, Terrence ist gestern gestorben. Terrence ist tot.«
»Grundgütiger Himmel.« Ich setzte mich auf. »Lass mir ein paar Minuten Zeit, damit ich mir was anziehen kann, DeWayne, und dann komm her.«
Ich legte auf, blieb noch einen Moment so sitzen und dachte darüber nach, was er mir da eben erzählt hatte. Bei dem Leben, das der Junge führte, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass er zu Tode kam, aber ich konnte mir auch vorstellen, wie DeWayne jetzt zumute war. Was Frauen anging, war er ja ein verdammtes Schwein, aber seine Söhne liebte er und sorgte auch für sie. Der einzige Zug an ihm, den ich wirklich achtete. Nichts hätte ihn schlimmer treffen können, das wusste ich.
DeWayne hatte vier Söhne von verschiedenen Frauen, darunter Jamal, den ich ihm geschenkt hatte. Der sechzehnjährige Hakim stand Jamal altersmäßig am nächsten, und ich hatte ihn in den fünf Jahren, die wir zusammen waren, mit großgezogen, aber die beiden anderen kannte ich im Grunde gar nicht. Gerard war ich ein paarmal begegnet; das war der, den DeWayne mit seiner weißen Frau Emma hatte. Terrence, den gerade verstorbenen Sohn von seiner ersten Frau, hatte ich noch seltener gesehen. Soweit ich das beurteilen konnte, waren Terrence wie Gerard die typischen Verlierer: Terrence hatte sich mit Crack eingelassen, und Gerard hatte immer etwas Bösartiges an sich und so ein verrücktes Glitzern in den Augen, als wollte er lieber eine Uzi rausziehen und einen abknallen, als anständig Guten Tag zu sagen. Mit fortschreitendem Alter waren DeWaynes Gene offenbar besser geworden; Jamal und Hakim machten sich beide gut.
Ich versuchte mich zu besinnen, wann ich Terrence das letzte Mal gesehen hatte, aber es wollte mir nicht einfallen. Ich hatte ihn nur als Kind in Erinnerung. Bei unserer ersten Begegnung kam er uns besuchen, als ich mit Jamal aus dem Krankenhaus heimkehrte. Da war er ein achtjähriger Junge mit großen Augen und wusste genau, dass seine Mama Delores mich aus tiefster Seele hasste, aber er brachte seinem neuen Brüderchen trotzdem ein Album von Grandmaster Flash and the Furious Five und eine Flasche Apfelsaft mit. Er war linkisch und dürr, und ich konnte weder eine Ähnlichkeit mit seinem Daddy bei ihm erkennen noch mir vorstellen, ob mein Sohn ihm in irgendeiner Weise gleichen würde. Wer weiß schon, was einem Kind im Laufe des Lebens alles widerfahren wird. Ich habe keine Ahnung, wann Terrence auf die schiefe Bahn geraten ist und sich mit Crack eingelassen hat und warum er im Leben so viel mitmachen musste. Aber mit zweiundzwanzig zu sterben, das hatte er nicht verdient – kein Mensch hat das verdient.
»Hey, Ma, kannst du mir ein paar Dollar geben?« Mit dieser Frage durchbrach Jamal meine Gedankengänge; er war mit einem Satz in meinem Zimmer und ließ sich zu mir aufs Bett plumpsen. Allem Anschein nach war er im Laufe des Sommers ganze dreißig Zentimeter in die Höhe geschossen, aber noch nicht recht in seinen Körper hineingewachsen. Er lief herum wie ein Giraffenbaby, bestand praktisch nur aus langen staksigen Beinen, hatte aber immer noch ein Kindergesicht, woran auch der Anflug eines Schnurrbarts nichts ändern konnte. Wenn ich ihn anschaute, sah ich immer meinen toten Bruder Johnny vor mir.
»Ich muss mit dir reden«, sagte ich. Er sah mir in die Augen, und der Ausdruck von Angst huschte über sein Gesicht.
»Was ist denn?«
»Dein Daddy hat eben angerufen. Terrence ist gestern gestorben.«
Er sagte nichts, doch seine Augen füllten sich mit Tränen, und er schaute rasch weg, damit ich sie nicht bemerkte. Er sah seine beiden älteren Brüder nur etwa ein, zwei Mal im Jahr, sprach aber immer liebevoll von ihnen – er stellte sich wohl vor, sie hätten eine Beziehung miteinander, wie er sie sich wünschte. DeWaynes Frauen und die Kinder, die er mit ihnen hatte, lebten in einer anderen Welt als wir, doch für Jamal waren diese Welten anscheinend miteinander verbunden. Für ihn waren die nicht vorhandenen Blutsbande zwischen ihm und seinen Brüdern ganz besonders stark.
»Wie ist er gestorben?«, fragte er, ohne mich anzusehen.
»Crack«, sagte ich. Genau wusste ich es nicht, nahm jedoch an, dass ihn das umgebracht hatte. »Hat dein Daddy dir erzählt, dass Terrence Crack nimmt?«
Jamal nickte. Ich hatte keine Ahnung, was DeWayne ihm erzählte und was nicht, und ich fragte nur selten. Ihre Erziehung war ihre Sache, ich hielt mich da möglichst heraus. DeWayne war ein Schwein, und ich konnte nur hoffen, dass diese schlichte Wahrheit Jamal, wenn er sie schließlich entdeckte, nicht so nahegehen würde wie mir damals.
Ich nahm ihn in die Arme und drückte ihn fest an mich, und er versuchte sich nicht loszureißen. Körperlich war er jetzt erwachsen, und der Unterschied zu dem kindlichen Körper von vor einem Jahr versetzte mir einen kurzen Schock. Mit seinen vierzehn Jahren hielt er sich für einen Mann und trat bisweilen auch so auf, doch ich sah noch immer den kleinen Jungen in ihm. Einen Augenblick später machte er sich los.
»Ist es noch lang bis zu … zu der Beerdigung? Ich möchte mich von ihm verabschieden.« Seine Stimme überschlug sich, jetzt kam das Kind zum Vorschein.
»Dein Daddy kommt in ein paar Minuten vorbei, da kannst du ihn fragen, was er arrangiert hat.« Er nickte und ging in sein Zimmer, und ein paar Minuten später dröhnte die Stimme von Ice Cube hinter der geschlossenen Tür hervor.
Ich zog Jeans und das T-Shirt von der Howard University an, das ich mir letztes Mal in Washington gekauft hatte, ging in die Küche und machte mir eine Kanne mit starkem jamaikanischem Kaffee. Dann setzte ich mich an den Küchentisch und schaute hinaus in den Regen.
Drei Dinge im Leben liegen mir am Herzen: meine Unabhängigkeit, mein Sohn Jamal und mein Seelenfrieden. DeWayne Curtis hatte die Macht, mir zwei davon zu versauen. In den letzten Jahren habe ich einige seelische Belastungen aus meinem Leben verbannen können: Ich war nämlich mal bei der Polizei. Der eine oder andere würde vielleicht sagen, dass ich den Unverschämtheiten nicht gewachsen war, die ich mir da – als Schwarze, als Frau – gefallen lassen sollte, und da mag durchaus etwas dran sein. Ich wusste, wer ich bin, und wollte mich denen zuliebe nicht ändern. Vor fünf Jahren habe ich gekündigt, und die Detektei Hayle Investigative Services, Inc., wurde geboren. Seither mache ich vieles anders. Früher habe ich geraucht; jetzt kaue ich Kaugummi. Ich esse kein Schweinefleisch mehr (außer den Grillrippchen am Nationalfeiertag) und halte mich nach Möglichkeit von DeWayne Curtis fern. Doch Blut ist dicker als Wasser, wie mein Bruder Johnny zu sagen pflegte. Als der starb, war ich zwanzig, und darum hab ich wohl auch mit einundzwanzig DeWayne geheiratet. Alles nur aus lauter Kummer.
Jetzt bin ich über dreißig und damit zu alt, es einfach hinzunehmen, wenn mir etwas oder jemand den ganzen Tag verderben will. Und doch taucht DeWayne wie ein Stehaufmännchen immer wieder in meinem Leben auf, und ich kann auch gar nicht so furchtbar viel dagegen tun. Ich darf doch meinem Sohn nicht den Vater vorenthalten. Meine Seelenruhe steht allerdings auf einem anderen Blatt, und die war in Gefahr, als ich ihm an dem Morgen beim Kaffee gegenübersaß.
»Ich habe den Jungen geliebt, Tamara. Ich habe den Jungen geliebt. Warum geht ständig alles schief? Warum darf ich nicht glücklich sein? Warum verliere ich alle, die ich liebe?« Die Fragen kamen alle auf einmal heraus und verbanden sich zu einer weinerlichen Litanei des Selbstmitleids.
Einen Moment lang musterte ich ihn schweigend. Mit über vierzig sah er noch immer so gut aus wie damals als Dreißigjähriger und wohl auch als Zwanzigjähriger, nur hatte er jetzt auch noch Geld und eine gehörige Portion Frechheit dazu. Wenn er wollte, brachte er mit seinem Charme jeden Nonnenschlüpfer zu Fall, und das wusste er auch. Selbst an diesem Morgen wirkte er bei all seinem Elend noch wie eben den Seiten eines vornehmen Herrenmagazins entsprungen. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, ein dunkelgraues Hemd aus Waschseide anzuziehen, das wie angegossen saß und gut zu der anthrazitfarbenen Hose passte. Am Handgelenk blitzte ein goldenes Uhrarmband von teurer Raffinesse. Ich sah an ihm vorbei aus dem Küchenfenster und sann darüber nach, dass das Laub an dem großen Kastanienbaum im Nachbarhof schon fast abgefallen war und dass der Fliederstrauch, den Jamal vor dem Haus gepflanzt hatte, wohl nicht bis zum Frühjahr durchhalten würde. Dann fiel mein Blick auf das im Morgenregen glitzernde Dach von DeWaynes neuem silberfarbenen Lexus. Als ich wieder zu ihm hinschaute, bemerkte ich die Tränen in seinen Augenwinkeln. Ich hatte DeWayne Curtis schon in so mancher Stimmung erlebt, aber ich hatte ihn noch nie weinen sehen.
»Magst du noch Kaffee?«, fragte ich. Er nahm an und trank ihn hastig aus. »Wenn ich doch nur was sagen könnte, DeWayne, außer dass es mir leid tut.«
»Es reicht schon, dass ich herkommen durfte, Tammy.«
»Nenn mich nicht Tammy«, sagte ich scharf. Das war sein Kosename für mich gewesen, als wir noch zusammen waren, und als ich ihn jetzt zum vierten Mal an diesem Morgen aus seinem Mund hörte, wurde mir kotzübel. Er sah mich an, erst verwundert, dann gekränkt. Ich schaute schnell weg. Es hatte Jahre gedauert, bis ich über diesen Witz von einer Ehe hinweggekommen war, da wollte ich jetzt nicht seine jähe Verletzlichkeit erleben und keine trügerische Nähe empfinden.
»Ich hatte nicht die Absicht, dich zu beleidigen. Ich wollte nur sagen, es war nett von dir, dass ich vorbeikommen durfte.« Sein Ton war gehässig und sarkastisch; das war der DeWayne, den ich kannte.
»Ich hab’s nicht böse gemeint«, sagte ich versöhnlich. Der Mann hatte schließlich Kummer; ich war ihm überlegen. »Du sollst mich nur nicht Tammy nennen.«
»Wir waren immerhin mal verheiratet.« Jetzt kam wieder der alte Charme zum Vorschein. »Das war mit die schönste Zeit meines Lebens.«
Ich erstickte fast an meinem Kaffee. Er schenkte mir keinerlei Beachtung und starrte einen Moment lang die Wand über meinem Kopf an. Ich warf einen verstohlenen Blick auf die Uhr. Er war jetzt zehn Minuten da, und von mir aus konnte er wieder gehen.
»Tam … Tamara«, sagte er nach einer Weile. »Ich muss dir etwas sagen, was ich noch keinem Menschen erzählt habe.« Sein eindringlicher Tonfall ließ mich aufhorchen. »Terrence – war nicht der Erste. Er war nicht der Erste.«
»Der erste was?«
»Er war nicht der Erste, der gestorben ist.«
»Wie meinst du das?«
»So, wie ich es sage«, entgegnete er ungeduldig.
»Wovon redest du?« Es sollte nicht wütend klingen, hörte sich aber doch so an, und ich nahm es nicht zurück. »DeWayne, wie meinst du das?«
»Hör mir doch zu, verdammt, er ist nicht der erste von meinen Jungen, der gestorben ist.« Er packte mich fester an der Schulter, als er vielleicht wollte, um der Forderung nach Aufmerksamkeit Nachdruck zu verleihen. Ich machte mich ärgerlich los, doch sein verzweifelter Tonfall erschreckte mich. »Er war nicht der erste von meinen Söhnen, der gestorben ist«, wiederholte er.
Es geht ihm noch schlechter, als ich dachte, schoss es mir durch den Kopf.
»DeWayne, du hast vier Söhne«, sagte ich geduldig. »Du hast Terrence verloren. Ich weiß, das geht dir sehr nahe, und ich teile deinen Kummer, aber du hast nur eins von deinen Kindern verloren und nicht zwei.«
Er sah mich ungläubig an, durch mich hindurch. »Hab ich dir denn nie von meinem Sohn in Virginia erzählt, in Salem? Er war da unten und ich hier oben … ich hab dir wohl nie von ihm erzählt.«
Jetzt packte mich die Wut mit solcher Wucht, dass ich sie fast auf der Zunge schmecken konnte. Noch eine Lüge, das kennen wir ja!, dachte ich und ärgerte mich dann über mich selbst, dass ich ihm die Macht gab, mich immer noch zu verletzen. Lügen war für DeWayne Curtis so natürlich wie für andere Männer das Fluchen. Während unserer fünfjährigen Ehe hatte er mich ständig angelogen – vom Preis für einen Beutel Kekse bis zu Geschichten, wo er die Nacht verbracht hatte.
»Du hast also noch ein Kind?« Ich schenkte mir Kaffee nach und wich seinem Blick aus. Ich trank einen Schluck und bemühte mich, ihn meine Gefühle nicht erkennen zu lassen. Das war das einzig Gute, das ich bei der Polizei gelernt hatte. Ich konnte so mühelos mit den Augen lügen wie der kaltschnäuzigste Typ draußen auf der Straße. Er antwortete bedächtig, sein Ton wurde plötzlich vertraulich.
»Ich war erst zweiundzwanzig und wollte mich gerade auf eigene Füße stellen. Mein erster Sohn.« Er wandte den Blick ab, woraus ich schloss, dass ich immer noch nicht die ganze Wahrheit zu hören bekam, aber ich wollte ihn nicht bedrängen. »Die Mutter war zwanzig. Das war 1969. Die Zeit der Befreiung, aber nicht dort unten, nicht in dieser Stadt. Wenn da eine Frau schwanger wurde, musste sie das Kind austragen. Aber es war keine Liebe zwischen uns. Nicht so wie zwischen dir und mir.«
Ich ließ das auf sich beruhen.
»Aber ich bin mit dem Jungen in Kontakt geblieben, und sie hat ihm meinen Namen gegeben. Sie hat ihn DeWayne genannt.«
»Hatte sie auch einen Namen?«
»Willa. Ich habe ihm zukommen lassen, was ich konnte, und zumindest wusste er, dass er einen Daddy hatte, auch wenn ich ihm nicht so ein Daddy war wie meinen anderen Jungen, das konnte ich nicht. Aber jetzt ist er tot.«
»Wann ist er gestorben?«
»Vor einem Jahr. Gestern vor einem Jahr. Am vierten Oktober, Tamara. Am gleichen Tag wie Terrence, Herrgott noch mal.« Ein Frösteln überlief mich. Das Leben gab DeWayne tatsächlich einen Fußtritt nach dem anderen. Aber ich hatte schon Merkwürdigeres gehört. Als ich bei der Polizei war, hatte ich so viel Entsetzliches ohne Sinn und Verstand erlebt, dass ich mich nicht mal mehr darüber aufregen konnte – mit ein Grund, warum ich da aufhören musste. Der heimtückische Tod liegt ständig und überall auf der Lauer; er kann bei jedem anklopfen, wann immer es ihm beliebt, und DeWayne war da keine Ausnahme. Ich übrigens auch nicht. Aber vielleicht bekam DeWayne ja nur seinen gerechten Lohn.
»Tamara, da ist etwas im Gange. Da ist etwas gegen meine Kinder im Gange, und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann.«
»DeWayne, manche Sachen passieren einfach so … es liegt ein Jahr dazwischen …«
»Warum am selben Tag, ausgerechnet am selben Tag, genau ein Jahr später? Ich trauere noch um meinen ersten Sohn, und dann so was – als ob mir da einer was sagen will, das ich nicht hören möchte. Da stimmt was nicht, Tamara, das spüre ich doch. Du weißt, wie gut mein Instinkt funktioniert. Du weißt, damit liege ich immer goldrichtig. Es gibt da einen Zusammenhang, jemand knallt mir da was vor den Latz und macht mich fertig mit einem Zusammenhang, den ich nicht kapiere.«
»Da ist kein Zusammenhang, DeWayne. Es ist einfach nur ein entsetzlicher Zufall. Wie ist dein erster Sohn gestorben?«
»Erschossen. Ein Überfall, sagt die Polizei. Er ist von der Arbeit nach Hause gekommen, und da hat ihn jemand erschossen.«
»Das ist jetzt ein Jahr her, hat man den Täter gefunden?«
»Vor ein paar Monaten haben sie sich einen jungen Burschen geschnappt. Er sitzt noch in Untersuchungshaft. Ein Junge, kaum älter als Hakim. Freunde von ihm sollen behauptet haben, dass er es war. Angeblich hatte er DeWayne Juniors Brieftasche und Autoschlüssel.«
»Und wie ist Terrence gestorben? Eine Überdosis?«
Er sah auf seinen Schoß hinunter. Vielleicht packte ihn jetzt zum ersten Mal die Scham darüber, wie sein Sohn gestorben war, wie er ihn hatte leben lassen. Plötzlich sah er alt aus, ich wusste auf einmal, wie er als Greis aussehen würde, mit Falten im Gesicht und ohne Zähne.
»Yeah«, antwortete er schließlich, immer noch mit gesenktem Kopf. »Tamara. Da ist doch was nicht in Ordnung. Dass diese Jungen so früh sterben mussten, meine Kinder …«
»Es ist nicht in Ordnung, dass sie so jung waren«, sagte ich, »und schließlich hast du sie geliebt und trauerst um sie wie noch nie.« Und, dachte ich im Stillen, jetzt packt dich endlich das schlechte Gewissen, wie du mit ihrer Mama umgesprungen bist und dass du nicht richtig für sie da warst. Das ist nicht in Ordnung mit dir.
Er fing lautlos an zu weinen, die Tränen liefen ihm nur so über das Gesicht. Jamal kam in die Küche und setzte sich neben ihn. Ich ließ die beiden allein, ging ins Wohnzimmer und machte die Küchentür hinter mir zu, aber ein paar Minuten später kam DeWayne herein und setzte sich zu mir.
»Tammy, kannst du nicht in die Wohnung von meinem Jungen gehen und mal schauen, was du da findest?«
Darauf war ich nicht gefasst. »Da ist nichts zu finden, DeWayne.«
»Geh doch mal hin und schau dich um. Für die Polizei war er nur ein ganz gewöhnlicher Junkie, mehr nicht. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Der Junge wollte die Finger vom Kokain lassen. Er hatte seit zwei Monaten nichts mehr genommen. Er wollte clean werden. Daran ist er nicht gestorben. Ich bezahle dich auch, Tamara, ich weiß ja, dass du das Geld brauchen kannst. Ich zahle dir den doppelten Satz, plus Spesen.«
Das ließ mich unwillkürlich aufhorchen. Geld, das machte DeWayne erträglich. Geld. Darauf lief es letzten Endes immer hinaus. Und er hatte recht. Ich brauchte das Geld. Es lief jetzt besser als in den ersten Jahren nach meiner Kündigung bei der Polizei, als alle – einschließlich meiner selbst – mich für verrückt hielten. Seither ging es bergauf, aber diesen Monat war das Geschäft flau. Im Frühjahr hatte ich Hochsaison – da stach die Männer der Hafer, und sie betrogen ihre Frauen, da rissen Kinder aus, um sich in der Welt umzusehen. Einer war hinter dem anderen her und bereit, mich für meine Dienste zu bezahlen. Doch wenn es auf den Winter zuging, lief niemand von zu Hause weg. Die Pflichtverteidiger schusterten mir ab und zu mal einen Fall auf Honorarbasis zu, doch auch diese Quelle schien im Oktober stets zu versiegen. Ich konnte eindeutig ein paar Dollar gebrauchen.
Jamal kam herein, setzte sich zu uns und verfolgte gespannt, was wir sagten. Als er mich anschaute, lag ein Flehen in seinem Blick, das ich nur aus seinen Kindertagen kannte, wenn er sich sehnsüchtig etwas wünschte.
»Okay, DeWayne«, sagte ich nach einem Moment. »Ich geh rüber in Terrences Wohnung und schau nach, ob ich da etwas finde.« Jamal warf mir einen dankbaren Blick zu, und ich nickte zurück. Ich tu’s für dich, dachte ich und lächelte ihm kurz zu. Und für Terrence, den dürren kleinen Jungen von einst, der sich über die Wünsche seiner Mama hinweggesetzt und dir seinen Segen gebracht hat.
2
Newark ist eine Stadt mit einem zähen Leben – eine alte Kämpfernatur, die sich einfach nicht unterkriegen lässt. Johnny hat mir immer erzählt, wie es früher auf der Broad Street aussah – Kinopaläste, Warenhäuser, Spitzenmusiker, die zuerst in Newark Station machten, und Samstag abends war vor lauter Trubel kein Durchkommen. Doch nach den Unruhen von ’67 ist alles anders geworden.
Ich bin in der Central Ward, in den Hayes Homes groß geworden. Als ich zehn war, schlug die Polizei gleich bei uns um die Ecke einen Taxifahrer zusammen, und man munkelte, sie hätten ihn umgebracht. Die Leute aus Newark lassen sich nichts gefallen, sie gingen auf die Straße. Als sich die Wogen glätteten, war nichts mehr so wie früher. Wer Geld hatte – ob viel oder wenig –, ging weg. Meine Eltern zogen ein Jahr später nach East Orange. Doch im Innern meines Herzens bin ich immer noch ein Mädchen aus Newark, und daran wird sich auch nichts ändern.
Jetzt kommt allmählich einiges zurück, ein Straßenzug nach dem anderen steigt aus der Asche auf, wie dieser berühmte ägyptische Vogel. Meine Heimatstadt hat schon allerlei durchgemacht, aber sie rappelt sich immer wieder hoch und gibt einfach nicht auf.
In den siebziger Jahren gab es eine heiße Phase, wo Grundstücke in bester Lage billig waren, und da konnte sich DeWayne ein Stück Land am Branford Place sichern. Es sah nach Geld aus, hatte aber noch den Modergeruch des Verfalls an sich.
Am Montag rief er mich zweimal an und weinte sich weiter über Terrence und den mir unbekannten Sohn aus, daher versprach ich ihm, am Dienstagvormittag zu Terrences Wohnung zu gehen und ihm abends nach der Trauerfeier zu berichten, was ich herausgefunden hatte. Von seinem Büro am Branford Place hielt ich mich möglichst fern. Ich hatte Angst, das Schicksal könnte wieder mal gegen mich sein und irgendein Spinner, den DeWayne übers Ohr gehauen hatte, käme hereinspaziert und würde ihm eine Kugel durch den Kopf jagen und mir gleich mit, bloß weil ich zufällig da herumstand.
Vor ein paar Monaten war ich dort gewesen und hatte Geld für Jamal abgeholt. DeWayne erledigte alles bar, nie per Scheck. Er war an einen hinter einem geschmacklosen Bild verborgenen Safe gegangen, hatte dreihundert Dollar in Zwanzigdollarscheinen herausgeholt und sie mir in einer fettigen Tüte von McDonald’s überreicht, die ich angewidert in die Handtasche steckte.
Während unserer jahrelangen Beziehung hat mir DeWayne nie genau erzählt, wie er sein Geld verdient, aber es war anscheinend immer reichlich davon da. Im ersten Jahr unserer Ehe war ich zu dumm, um Fragen zu stellen. Im letzten war ich zu schlau. Als ich meine Zulassung als Privatdetektivin hatte, brachte ich mir als Erstes bei, wie man etwas gegen einen Menschen in die Hand bekommt, ohne dass er es merkt, und das probierte ich gleich an DeWayne Curtis aus. Er besaß ein paar Clubs in East Orange sowie einen in New Brunswick und war stiller Teilhaber an mindestens zwei kleinen Gemischtwarenläden in der Central Ward von Newark. Ich hatte gehört, er sei Mitglied einer Autoschieberbande, und es gingen Gerüchte, er und sein Zuträger Basil Dupre hätten die Finger ganz tief in der Geldwäscherei für die Mafia. Man konnte ihm aber nie etwas anhaben. Er war verschlagen wie eine Ratte.
Als ich die Eingangshalle seines Hauses betrat, stieg Modergeruch aus dem Teppich auf. Die Wasserflecken an der abblätternden Asbestbetondecke bildeten Dollarzeichen, was mich an den Zweck meines Besuchs erinnerte.
Der Flur im fünften Stock, wo DeWayne sein Büro hatte, war menschenleer, und ich durchquerte ihn rasch, doch beim Eintreten blieb ich wie angewurzelt stehen. Bei meinem letzten Besuch hatte es hier genauso übel ausgesehen wie in der Eingangshalle. Die faustgroßen Blumen an den Wänden bissen sich mit dem billigen roten Sofa, das genau wie der Couchtisch mit Zigarettenbrandflecken übersät war.
Doch jetzt war DeWayne offenbar richtig zu Geld gekommen. Nun war alles in einem weichen Cremeton gehalten, und das schokoladenbraune Cordsofa sah nagelneu aus. An den Wänden hingen geschmackvoll arrangierte Drucke von Collagen von Romare Bearden und Varnette Honeywood. Die neue Empfangsdame, Nachfolgerin der kaugummiblasenknallenden Sister mit der künstlich verlängerten Haarpracht und den goldenen Klunkerohrringen, die bei meinem letzten Besuch dort gesessen hatte, brachte zweifellos einen Hauch von Klasse mit.
»Kann ich Ihnen helfen?« Sie artikulierte jedes einzelne Wort wie bei einer Theaterprobe. Ihre Stimme klang anders, als man es erwartet hätte; es war eine hohe, liebliche Kinderstimme, die irgendwie nicht zu ihrem Gesicht passte. Sie war dicklich – mein toter Bruder Johnny hatte das immer »gesund« genannt – und machte den Eindruck, als sei sie mit Maisbrei und gebackenem Landschinken groß geworden. In ihrem altmodischen grauen Kostüm wirkte sie zehn Jahre älter, als ich sie geschätzt hätte, aber sie war hübsch auf eine Art, die sich nicht aufdrängte. Anheimelnd hübsch.
Möchte mal wissen, ob er die auch vögelt, dachte ich im Stillen. Normalerweise fand DeWayne Mittel und Wege, hübschen jungen Dingern – und auch einigen nicht ganz so hübschen – an die Wäsche zu gehen, wenn sie bei ihm arbeiteten. Ihre rosa Seidenbluse hatte ich vor ein paar Wochen bei Bloomingdale’s gesehen, und so viel konnte DeWayne ihr schlechterdings nicht zahlen, dass sie sich die leisten konnte.
»Ist Mr. Curtis da?«
»Nein, leider nicht.«
»Guten Tag, ich bin Tamara Hayle.«
»Ich weiß, wer Sie sind.« Die Sister hatte eine ganz schön kesse Lippe. Ich beschloss, das zu ignorieren.
»Mr. Curtis hat gesagt, ich soll vorbeikommen und mir die Schlüssel zu der Wohnung seines, äh, verstorbenen Sohnes abholen. Hat er sie für mich hinterlegt?« Ich versuche immer, Bekannten von DeWayne gegenüber mein Verhältnis zu ihm möglichst nicht zu erwähnen. Je weniger man über Fehler der Vergangenheit redet, desto besser.
»Ach ja«, sagte sie mit einem sittsamen kleinen Nicken.
Sie griff in die Schublade und holte ein Schlüsselbund heraus, das sie mir reichte. Mir fiel auf, dass an der Hand ein paar Fingerspitzen fehlten. Ob das wohl ein Geburtsfehler war oder ein Unfall? Sie bemerkte meinen Blick, ballte die Hand zur Faust und legte sie wieder in den Schoß.
»Ich soll Ihnen sagen, die Adresse ist Avon Avenue zweihunderteinundvierzig, hier in Newark.« Sie sprach es Nu-rirk aus, wie es manche Einheimische tun, aber ich glaubte nicht, dass sie von hier war.
Die Avon Avenue war früher einmal eine vornehme Straße gewesen und hatte immer noch ein Flair von »Reiche Leute spielen im Garten« an sich, aber sie war doch heruntergekommen. Die älteren und größeren Häuser waren jetzt zum Teil mit Brettern vernagelt, aus anderen waren Wohnheime geworden; manche der neuen Bewohner waren zwielichtig, die meisten aber ganz solide. Terrence hatte wohl zur ersten Kategorie gehört. Ich sah noch einmal zu der Empfangsmadam hinüber, die jetzt wieder auf ihre Arbeit schaute. Ich fragte mich, woran sie wohl so angestrengt arbeitete, dass es ihre ganze Konzentration verlangte.
»Neu hier?«, fragte ich nach einem Moment, wohl wissend, dass sie neu war.
»Seit ein paar Monaten«, sagte sie und blickte auf, dann sah sie wieder zu ihrer Arbeit hinunter. »Na ja, ich bin seit Mai hier.« Sie hatte einen weichen südlichen Akzent, den sie zu verbergen suchte, doch am Wortende schlich er sich immer wieder ein.
»DeWayne hat wirklich etwas aus dem Laden gemacht.« Ich warf noch einen Blick durch das Büro und versuchte Konversation zu machen. »Ist er zu Geld gekommen? Miss …« Ich hielt inne und wartete, dass sie mir ihren Namen sagte.
»July.«
»Miss July.«
»Nein, July ist mein Vorname.«
»Sind Sie im Juli geboren?«
»Nein. Im Oktober. Meine Mama hatte einen seltsamen Humor.«
Wir lachten beide. Jetzt erkannte ich den Akzent, es war der eines Menschen vom Lande, der wie ein Städter reden will, und er berührte einen Nerv tief in meinem Innern – eine Unsicherheit, die sich verstecken will, das Bestreben, immer besser zu werden, ohne zu merken, dass es auch so schon ganz okay ist. Ihr Lachen war mädchenhaft scheu, auf ihren Wangen erschienen kleine Grübchen. Das Lächeln gefiel mir.
»Manchmal schäme ich mich für meinen Namen«, sagte sie schüchtern, ohne mir direkt in die Augen zu sehen, als spräche sie mit jemand am anderen Ende des Zimmers. Ich unterdrückte den Impuls, über meine Schulter zu blicken. »Er klingt so hinterwäldlerisch.«
»Heutzutage geben die Leute ihren Kindern alle möglichen Namen, von Evangelista Canonica bis hin zu Penis Brown, da ist July – egal, wann Sie Geburtstag haben – doch vollkommen in Ordnung«, sagte ich beruhigend. »Woher kommen Sie denn?«
Sie blickte erstaunt auf, als wäre ich ihr zu nahe getreten. Die Abwehr war wieder da.
»Weiter weg.« Sie zuckte mit den Schultern.
»Wie viel weiter weg?«
»Florida«, sagte sie schließlich. »Ich bin in South Florida aufgewachsen. Wissen Sie, welcher Schlüssel für welche Tür ist?«
Ich betrachtete die Schlüssel.
»Dürfte nicht allzu schwer herauszufinden sein. Es sind ja nur drei.« Ich hielt sie hoch und zeigte sie ihr, für den Fall, dass sie es vergessen hatte.
Sie war älter, als ich zunächst angenommen hatte, Anfang dreißig, vielleicht nur ein paar Jahre jünger als ich, aber nicht alt genug für das Kostüm, das sie da anhatte. Es war ein Kostüm für eine ältere Frau und erinnerte mich an meine Tante, die mich nach dem Tod meiner Eltern auch immer so anziehen wollte, bis meine große Schwester Pet einschritt und ein Machtwort sprach. Es sah aus wie von ihrer Mama ausgesucht – oder von meiner Tante.
»Wann hat denn die Renovierung angefangen?«, fragte ich mit einem Blick durch das Büro.
»Bevor ich kam«, sagte sie.
»Sieht gut aus.«
»Kann ich nicht beurteilen. Ich hab es ja vorher nicht gesehen.« Wieder eine Sackgasse.
»Okay, July. Bis bald«, sagte ich und wandte mich zur Tür. Vor dem Hinausgehen drehte ich mich noch einmal um und warf ihr eine Abschiedsbemerkung zu. »Jammerschade, wie es mit dem Jungen zu Ende gegangen ist. Er war ein netter Kerl.«
»Für einen Junkie ja«, sagte sie. Ihre unverblümte Art verblüffte mich und warf mich für einen kurzen Moment aus dem Konzept.
»Ich dachte, er hätte es jetzt endlich geschafft«, sagte ich. »War er je hier?« Die Frage hatte ich mir überhaupt nicht überlegt, es war reine Routine. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und nach fünf Jahren im Geschäft hatte ich gelernt, dass die besten Informationen immer in den beiläufigen Bemerkungen eines Hausmeisters, eines Krankenwagenfahrers oder einer Empfangsdame stecken, die nichts zu verbergen haben und keine eigenen Interessen verfolgen.
July wirkte einen Augenblick verwirrt und lächelte dann ein trauriges Grübchenlächeln. »Sie meinen Terrence?«, fragte sie und beantwortete dann ihre eigene Frage. »Er war ein paarmal hier, um DeWayne zu besuchen, aber mit mir hat er nie allzu viel gesprochen, und ehe man sich’s versah, war er auch schon tot. Tja, so ist das Leben nun mal. Kurz und schön.« Sie sagte das ganz beiläufig dahin, wie ein Kind, das in aller Unschuld eine so grausame Bemerkung fallen lässt, dass man ihm am liebsten ins Gesicht schlagen würde.
Ihr Blick wanderte wieder zu ihrer Arbeit, sie hatte die Hand zur Faust geballt und den Stift im Mund. Ich war entlassen.
Hoffentlich vögelt er die nicht auch!, sagte ich mir beim Weggehen und stellte gleich darauf fest, dass es mir im Grunde egal war. Jetzt hatte ich andere Dinge im Kopf: Wie lange ich wohl brauchen würde, um zur Avon Avenue zu fahren, Terrences Wohnung in Augenschein zu nehmen, Jamals Anzug aus der Reinigung zu holen, etwas zum Abendbrot zu machen, die Trauerfeier hinter uns zu bringen und dann so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Keine Zeit. Sie reichte nie.
Außerdem musste ich mit Jamals Kummer umgehen. Er brauchte Zeit zum Trauern, das war mir klar. Aber sein Leben sollte so schnell wie möglich wieder normal werden. Ich wollte ihn vor den Seiten von DeWayne beschützen, die mir Angst machten – Geld aus obskuren Quellen und in Hamburgertüten verstaut, Halbbrüder, die einen frühen Tod fanden. Ja, wir würden zu der Trauerfeier gehen. Jamal würde weinen und sich seiner Trauer hingeben. DeWayne würde mich dafür bezahlen, dass ich mir Terrences Wohnung angeschaut hatte, und dann würde unser Leben sich wieder um Mathearbeiten, Basketballspiele und Ausschlafen am Sonntagmorgen drehen. Je eher wir das alles hinter uns brachten, desto besser. Ich sah auf die Uhr, drehte den Zündschlüssel meines ’82er Jetta Diesel um und fuhr in einer stinkenden Abgaswolke los zur Avon Avenue, um zu sehen, was es da zu sehen gab.
3
Seit Sonntag hatte es nie richtig aufgehört zu regnen, und auf dem Weg zur Avon Avenue fielen schon wieder Tropfen. Es war ein frostiger Tag, viel zu kalt für Oktober; bei der feuchten Luft, die durch das gesprungene Ausstellfenster meines Jetta drang, musste ich wieder an Geld denken – daran, dass ich keins hatte.
Das Haus, in dem Terrence gewohnt hatte, ragte wie ein Schlachtschiff am Rande der Avon Avenue auf. Es war das größte Gebäude weit und breit – so unheimlich, alt und hässlich, dass die Kinder es zu Halloween bestimmt mit Eiern bewarfen. Mehrere Bäume und Hecken hielten die Sonne von dem Haus fern, und als ich die alte Eisenpforte davor aufmachte, knarrte sie wie in einem Horrorfilm.
Ich läutete zweimal, und als niemand kam, schloss ich vorsichtig mit den Schlüsseln aus DeWaynes Büro auf.
»Hallo, ist da jemand?«, rief ich beim Eintreten mit einem nervösen Blick durch die Eingangshalle. Man weiß ja nie, ob nicht ein leicht erregbarer Idiot plötzlich durchdreht und einen umlegt, weil er meint, man wäre ein Einbrecher. Ich ging ein paar Schritte weiter hinein. »Ist da jemand?«, schrie ich noch einmal ins Leere.
Die Eingangshalle war grau und mit einem abgetretenen braunen Teppich ausgelegt, bei dem stellenweise die Dielen durchguckten. Zwei klapprige Schirmständer enthielten Schirme verschiedener Größe, die alle irgendwie kaputt waren. Eine grüne Glasvase mit rosa Plastikrosen, die auf einer Kredenz an der Wand stand, sollte mal wieder abgestaubt werden. Die vier Türen auf der anderen Seite der Halle waren geschlossen. Es roch feucht und dumpf wie in einem Keller nach dem Regen. Irgendwo drang Stimmengemurmel aus einem Fernseher, und von den oberen Stockwerken kam Radiomusik heruntergeweht.
»Was wollen Sie hier?«, bellte eine tiefe Krächzstimme aus dem Nichts. Ich erstarrte. Das klang, als habe da jemand eine .22 auf meinen Hinterkopf gerichtet. Wie immer, wenn ich überrascht werde, spürte ich einen raschen Adrenalinstoß; ich drehte mich um und stand einer winzigen alten Frau in einem verblichenen gelben Nachthemd gegenüber, deren rundes Gesicht die Farbe und Form einer Kastanie hatte. Sie kam mir vage bekannt vor, ein Gesicht, das man schon irgendwo gesehen zu haben meint, sich aber nicht mehr erinnern kann, wo und mit wem.
»Was wollen Sie hier?«, fragte sie.
»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte ich und gab mir redlich Mühe, so zu tun, als hätte ich das Recht, mitten in ihrer Eingangshalle zu stehen. »Ich bin Tamara Hayle. Ich bin Privatdetektivin. Terrence Curtis’ Vater, DeWayne Curtis, hat mich gebeten, Ermittlungen zum Tod seines Sohnes anzustellen.« Ich hielt kurz inne, damit sie das alles verdauen konnte. »Ich würde gern in sein – in Terrence Curtis’ Zimmer gehen und mich dort umschauen, wenn das geht?« Ich sagte das als Frage und nicht als Feststellung, was es eigentlich war.
»Nein, das geht nicht«, sagte sie und musterte mich argwöhnisch. »In seinem Zimmer umschauen? Was wollen Sie denn da? Der Junge ist tot. Schlimm genug, dass er hier in meinem Haus gestorben ist, und keiner ist gekommen und hat in sein Zimmer geschaut. Lasst die Toten in Frieden ruhen. Friede ihrer Asche. Das ist meine Meinung.«
Sie sog entrüstet die Luft durch die Zähne und begann dann zu nicken; sie trug eine lange blauschwarze Perücke, die aussah, als wäre sie in aller Eile aufgesetzt worden.
»Der Junge ist gestorben. Tot. Keinen Sinn, darüber zu reden. Keinen Sinn, in sein Zimmer zu schauen.« Sie legte den Kopf schief und schaute mich dann wieder an, als sähe sie mich zum ersten Mal. »Ich bin Miss Lee«, sagte sie. »Die Hausbesitzerin. Was wollen Sie denn wissen?«
Für einen Moment war ich nicht ganz sicher, ob sie mich verstanden hatte, ob sie senil war oder mich einfach nur ärgern wollte.
»Ich heiße Tamara Hayle«, fing ich noch einmal an. »Ich bin Privatdetek–«
»Haben Sie mir doch schon erzählt, wer Sie sind und was Sie wollen. Ich weiß bloß nicht, ob ich Sie in das Zimmer von dem Jungen lassen soll, wo keine Polizei dabei ist und nichts.« Sie war eindeutig nicht senil. Ich entschloss mich, ihr reinen Wein einzuschenken.
»Ich bin mit Ermittlungen zu dem Tod von Terrence Curtis beauftragt. Ich war einmal mit seinem Vater verheiratet.« Ich schlug einen förmlichen Ton an und fügte das mit meiner Beziehung zu DeWayne erst nachträglich hinzu. Ihre Miene veränderte sich nicht. »Der Junge, Terrence, war mit meinem Sohn verwandt, und ich habe seinem Vater und meinem Jungen versprochen, der Sache nachzugehen.«
»Mit seinem Daddy verwandt? Seinen Daddy kenn ich.« Mir fiel auf, wie sie das sagte und wie sie mich misstrauisch beäugte, aber ich ging der Sache nicht nach. DeWayne hatte seine Finger in vielen Töpfen und kannte viele Leute.
»Also, ich möchte mich nur mal in seinem Zimmer umschauen«, sagte ich. »Ob es da irgendetwas Merkwürdiges gibt. Ich bleibe nicht länger als fünf oder zehn Minuten. Es ist ein Gefallen für seinen Daddy.«
Sie kniff leicht die Augen zusammen. »Die Polizei war schon da. Sie waren am Samstag da, als sie den Jungen abgeholt haben, und gestern waren sie wieder da und wussten gar nicht, was sie suchen sollten, und gefunden haben sie auch keinen Scheiß.«
Das Wort »Scheiß« versetzte mir einen Stich. Es erstaunt mich immer wieder, wenn Frauen über sechzig solche Wörter in den Mund nehmen, obwohl ich eines Tages wahrscheinlich selbst dazugehöre.
»Ich muss das Zimmer wieder vermieten«, fuhr sie fort. »Schlimm genug, dass der Junge hier gestorben ist, und jetzt schnüffeln auch noch Sie hier herum.«
»Zehn Minuten? Mehr brauche ich nicht. In zehn Minuten bringe ich nichts durcheinander. Ich bin bestimmt nicht hier, um irgendwie Unruhe zu stiften. Da ist nichts, das weiß ich so gut wie Sie.« Ich versuchte, sie mit einem Augenzwinkern zu beruhigen, und tätschelte ihr den Arm. »Ich will nur seinem Daddy einen Gefallen tun. Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, glauben Sie mir. Wissen Sie, es ist doch mein Job. Ich werde dafür bezahlt.« Ich hob das Wort »bezahlt« hervor. Geld. Ganz vertraulich von einer Sister zur anderen.
Sie musterte mich intensiv, den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Wahrscheinlich erwog sie verschiedene Möglichkeiten, was mich erstaunte, weil es im Grunde wirklich nur eine Kleinigkeit war. Doch manche Leute mögen es einfach nicht, wenn andere ohne triftigen Grund in ihrem Haus herumschnüffeln, und vielleicht hatte sie ja recht. Ich wollte schon sagen, sie solle das Ganze vergessen, wieder in ihr Zimmer gehen, die Perücke zurechtrücken und da weitermachen, wo ich sie unterbrochen hatte, ich würde mich trollen und mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, da fiel mir das Geld wieder ein.
»Zehn Minuten«, wiederholte ich und legte eine kleine Bitte in meinen Tonfall.
»Zehn Minuten und mehr nicht«, sagte sie, wobei sie mich weiterhin misstrauisch beäugte. Sie holte ein Schlüsselbund aus der Tasche und ging die Treppe hoch. Ich trabte brav hinterher und sagte ihr lieber nichts davon, dass ich meine eigenen Schlüssel hatte; es war ihr offenbar egal, wie ich hereingekommen war.