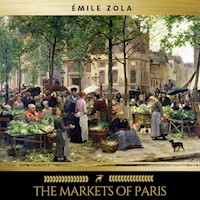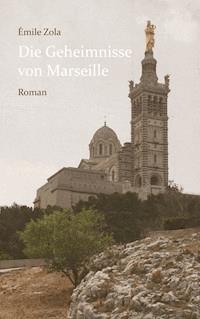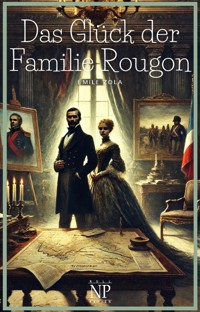Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rougon-Macquart
- Sprache: Deutsch
Der zweiundzwanzigjährige Octave Mouret, der dem Leser bereits aus den Romanen Das Glück der Familie Rougon und Die Eroberung von Plassans bekannt ist, zieht in das besagte Mietshaus ein. Er hat eine Anstellung in einem kleinen nahe gelegenen Modegeschäft, das den Namen "Paradies der Damen" führt. Octave ist attraktiv und charmant. Er hat Erfolg bei den Damen und hat somit mehrere Affären mit den Bewohnerinnen des Hauses, u. a. mit Madame Pichon. Sein Annäherungsversuch an seine Chefin Madame Hédouin scheitert und hat seine Entlassung zur Folge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein feines Haus
Emile Zola
Impressum
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
Public Domain
Erstes Kapitel
In der Rue Neuve-Saint-Augustin wurde die mit drei Koffern beladene Droschke, mit der Octave vom Gare de Lyon1 kam, durch ein Wagengedränge aufgehalten. Trotz der schon empfindlichen Kälte dieses trüben Novembernachmittags ließ der junge Mann ein Wagenfenster herunter. Er war überrascht über den jähen Einbruch der Dunkelheit in diesem Stadtviertel mit den zu engen, über und über von Menschen wimmelnden Straßen. Die Flüche der Kutscher, die auf die schnaubenden Pferde einhieben, das unaufhörliche Ellbogengestoße auf den Bürgersteigen und die dichtgedrängte Reihe der von Verkäufern und Kunden überquellenden Läden machten ihn ganz benommen; er hatte sich Paris sauberer vorgestellt, und er war auch nicht auf einen so tollen Betrieb gefaßt gewesen; er fühlte, daß diese Stadt den Begierden handfester Kerle offenstand.
Der Kutscher hatte sich herabgebeugt.
»Es ist doch in der Passage Choiseul?«
»Nicht doch, in der Rue de Choiseul ... Ein neues Haus, glaube ich.«
Und die Droschke brauchte nur um die Ecke zu biegen; es war das zweite Haus, ein großes vierstöckiges Haus, dessen steinerne Front inmitten des rostfarbenen Putzes der alten Nachbarfassaden eine kaum gerötete Blässe bewahrte. Octave war ausgestiegen und stand auf dem Bürgersteig, er musterte das Haus mit einem mechanischen abschätzenden Blick, vom Seidenwarengeschäft im Erdgeschoß und im Zwischenstock bis hinauf zu den zurücktretenden Fenstern im vierten Stock, die auf einen schmalen Altan gingen. Im ersten Stock stützten Frauenköpfe einen Balkon mit reich verziertem Gußeisengeländer. Die Fenster hatten verschnörkelte Einfassungen, die grob nach Schablonen herausgemeißelt waren; und unten entrollten über der mit Zierat noch mehr überladenen Toreinfahrt zwei Amoretten eine Zierleiste, auf der die Hausnummer stand, die nachts von einer innen angebrachten Gaslampe erleuchtet wurde.
Ein dicker blonder Herr, der aus dem Hausflur trat, blieb plötzlich stehen, als er Octave erblickte.
»Was! Sie sind schon da?« rief er. »Aber ich habe erst morgen mit Ihnen gerechnet!«
»Ja, ich bin einen Tag früher aus Plassans abgereist«, erwiderte der junge Mann. »Hat es denn mit dem Zimmer noch nicht geklappt?«
»O doch ... Ich habe es seit vierzehn Tagen gemietet und habʼs sofort eingerichtet, wie Sie mich gebeten haben. Einen Augenblick, ich werde Sie gleich hinbringen.« Trotz Octaves Einwendungen kehrte er ins Haus zurück.
Der Kutscher hatte die drei Koffer abgeladen. In der Conciergeloge2 stand ein würdevoller Mann mit langem, glattrasiertem Diplomatengesicht und überflog gewichtig den »Moniteur3«. Er geruhte jedoch, sich um diese Koffer zu kümmern, die man vor seiner Tür absetzte; und herzutretend fragte er seinen Mieter, den Architekten aus dem dritten Stock, wie er ihn zu nennen pflegte: »Herr Campardon, ist das der Betreffende?«
»Ja, Herr Gourd, das ist Herr Octave Mouret, für den ich das Zimmer im vierten Stock gemietet habe. Er wird dort oben nur schlafen und wird bei uns essen ... Herr Mouret ist ein Freund der Eltern meiner Frau, den ich Ihnen ans Herz lege.«
Octave betrachtete die mit Platten aus Stuckmarmor verkleidete Einfahrt, deren Deckengewölbe mit Rosetten geschmückt war. Der gepflasterte und auszementierte Hof im Hintergrund machte einen vornehmen, kalt-sauberen Eindruck; nur ein Kutscher rieb an der Stalltür mit einem Fell eine Kandare ab. Offenbar drang die Sonne niemals bis dort hinunter.
Unterdessen musterte Herr Gourd die Koffer. Er stieß mit dem Fuß dagegen, wurde in Anbetracht ihres Gewichts ganz eifrig zuvorkommend und sprach davon, einen Dienstmann zu holen, der sie über den Dienstbotenaufgang hinaufschaffen solle.
»Ich gehe fort, Frau«, rief er in die Conciergeloge hinein.
Diese Loge war ein kleiner Salon mit hellen Spiegelscheiben, der mit einem rotgeblümten Plüschteppich und Palisandermöbeln ausgestattet war; und durch eine halboffene Tür gewahrte man eine Ecke des Schlafzimmers, ein mit granatfarbenen Ripsvorhängen versehenes Bett. Die sehr üppige Frau Gourd, die eine Haube mit gelben Bändern aufhatte, saß lang ausgestreckt, die Hände nichtstuerisch gefaltet, in einem Sessel.
»Gut, gehen wir hinauf«, sagte der Architekt. Und als er die Mahagonitür des Hausflurs aufstieß und sah, welchen Eindruck Herrn Gourds schwarzes Samtkäppchen und seine himmelblauen Pantoffeln auf den jungen Mann gemacht hatten, setzte er hinzu: »Wissen Sie, er ist der ehemalige Kammerdiener des Herzogs von Vaugelade.«
»Aha!« machte Octave lediglich.
»Jawohl, und er hat die Witwe eines kleinen Gerichtsvollziehers aus Mort-la-Ville geheiratet. Da draußen besitzen sie sogar ein Haus. Aber sie warten, bis sie über dreitausend Francs Jahreszinsen verfügen, um sich dorthin zurückziehen zu können ... Oh, sehr anständige Conciergeleute!«
Hausflur und Treppe waren von schreiendem Luxus. Unten trug eine weibliche Figur, eine Art Neapolitanerin, die über und über vergoldet war, eine Amphora4 auf dem Kopf, aus der drei mit Mattglasglocken versehene Gasarme herausragten. Die weißen, rosa eingefaßten Stuckmarmorplatten stiegen in dem runden Treppenhaus regelmäßig empor; das mit Mahagoniholz belegte gußeiserne Treppengeländer wirkte wie Altsilber, das mit goldenem Blättergewirr verziert war. Die Stufen bedeckte ein von kupfernen Stangen festgehaltener roter Läufer. Was Octave aber beim Eintreten besonders beeindruckte, war eine Treibhauswärme, ein lauer Atem, den ihm ein Heizungsloch gleich einem Mund ins Gesicht blies.
»Nanu!« sagte er. »Die Treppe ist geheizt?«
»Aber natürlich«, erwiderte Campardon. »Das lassen sich heutzutage alle Hausbesitzer etwas kosten, die was auf sich halten ... Das ist ein sehr feines Haus, ein sehr feines ...« Er wandte sich um, als durchforsche er die Mauern des Hauses mit dem Kennerblick eines Architekten. »Sie werden ja sehen, mein Lieber, es ist ein durch und durch feines Haus ... Und ausschließlich von feinen Leuten bewohnt!«
Während sie nun langsam hinaufstiegen, nannte er die Namen der Mieter. In jedem Stockwerk waren zwei Wohnungen, die eine lag zur Straße, die andere zum Hof zu, und ihre polierten Mahagonitüren lagen einander gegenüber. Zunächst sagte er kurz ein paar Worte über Herrn Auguste Vabre: das war der älteste Sohn des Hausbesitzers; im Frühjahr hatte er das Seiden Warengeschäft im Erdgeschoß übernommen, und er bewohnte auch den ganzen Zwischenstock. Im ersten Stock hatte sodann der andere Sohn des Hausbesitzers, Herr Théophile Vabre, mit seiner Gattin die Hofwohnung inne, und die Vorderwohnung hatte der Hausbesitzer selbst, ein ehemaliger Notar aus Versailles, der übrigens bei seinem Schwiegersohn, Herrn Duveyrier, dem Appellationsgerichtsrat, wohnte.
»Ein toller Bursche, und noch keine fünfundvierzig Jahre alt«, sagte Campardon und blieb einen Augenblick stehen. »Ganz nett, was?« Er stieg zwei Stufen höher, drehte sich jäh um und setzte hinzu: »Wasser und Gas in allen Stockwerken.«
Auf jedem Treppenabsatz befand sich ein hohes Fenster, durch dessen von einer Mäanderleiste eingefaßte Scheiben helles Tageslicht auf die Treppe fiel, und unter jedem Fenster stand eine schmale Samtbank. Der Architekt machte darauf aufmerksam, daß sich betagte Leute hier ausruhen könnten.
Als er dann über den zweiten Stock hinausging, ohne die Mieter zu nennen, wies Octave auf die Tür der großen Wohnung und fragte: »Und da?«
»Ach, da«, sagte Campardon, »Leute, die man nicht zu sehen bekommt, die niemand kennt ... Auf die könnte das Haus gern verzichten. Kurzum, Flecke sind überall zu finden ...« Er blies voller Geringschätzung leise vor sich hin. »Der Herr macht Bücher, glaube ich.«
Aber im dritten Stock zeigte er wieder sein zufriedenes Lachen. Die Hofwohnung war geteilt worden: dort wohnten Frau Juzeur, eine recht unglückliche kleine Frau, und ein sehr vornehmer Herr, der ein Zimmer gemietet hatte, wo er sich einmal wöchentlich geschäftehalber aufhielt. Während Campardon noch diese Erläuterungen gab, schloß er die Tür der anderen Wohnung auf.
»Hier sind wir bei mir«, erklärte er. »Warten Sie, ich muß Ihren Schlüssel holen ... Wir werden zuerst in Ihr Zimmer hinaufgehen, und nachher können Sie meine Frau begrüßen.«
Während der zwei Minuten, die Octave allein blieb, fühlte er, wie ihn das ernste Schweigen des Treppenhauses durchdrang. Er beugte sich in der lauen Luft, die aus dem Hausflur kam, über das Geländer; er hob den Kopf und horchte, ob nicht irgendein Geräusch von oben herabdrang. Es herrschte die Totenstille eines sorgfältig abgeschlossenen bürgerlichen Salons, in den nicht ein Hauch von außen hineingelangte. Hinter den schönen Türen aus glänzendem Mahagoniholz lagen gleichsam Abgründe der Ehrbarkeit.
»Sie werden vortreffliche Nachbarn haben«, sagte Campardon, der mit dem Schlüssel in der Hand wieder zum Vorschein kam. »In der Vorderwohnung die Josserands, eine ganze Familie, der Vater Kassierer in der Kristallwarenfabrik Saint-Joseph, zwei heiratsfähige Töchter; und neben Ihnen ein kleines Angestelltenehepaar, die Pichons, Leute, die nicht gerade im Geld schwimmen, aber eine ausgezeichnete Erziehung genossen haben ... Es muß doch alles vermietet werden, nicht wahr, selbst in einem Haus wie diesem.«
Nach dem dritten Stock hörte der rote Läufer auf, und an seine Stelle trat einfache graue Leinwand. Octave fühlte sich in seiner Eigenliebe dadurch leicht gekränkt. Ganz allmählich hatte ihn die Treppe mit Ehrfurcht erfüllt; er war ganz erregt, daß er in einem so feinen Haus – wie der Architekt sich ausgedrückt hatte – wohnen sollte. Als er hinter diesem in den Gang einbog, der zu seinem Zimmer führte, gewahrte er durch eine halboffene Tür eine junge Frau, die vor einer Wiege stand. Bei dem Geräusch hob sie den Kopf. Sie war blond und hatte helle, ausdruckslose Augen; und er nahm nur diesen sehr klaren Blick mit, denn die junge Frau errötete mit einemmal und stieß schamhaft, als werde sie bei etwas überrascht, die Tür zu.
Campardon hatte sich umgewandt, um zu wiederholen:
»Wasser und Gas in allen Stockwerken, mein Lieber.« Dann deutete er auf eine Tür, die zum Dienstbotenaufgang führte. Oben lagen die Mädchenkammern. Und hinten im Gang stehenbleibend, sagte er: »Hier sind wir endlich bei Ihnen.«
Das quadratische, ziemlich große Zimmer hatte eine graue, blaugeblümte Tapete und war sehr einfach möbliert. Neben dem Alkoven war ein winziger Waschraum ausgespart, gerade groß genug, damit man sich die Hände waschen konnte. Octave ging schnurstracks zum Fenster, durch das grünliches Licht hereinfiel. Traurig und sauber versank der Hof mit seinem regelmäßigen Pflaster und seiner Wasserleitung, deren kupferner Hahn glänzte. Und noch immer kein einziges Lebewesen, kein einziges Geräusch; nichts als die gleichförmigen Fenster, ohne ein Vogelbauer, ohne einen Blumentopf, diese Fenster, die die Eintönigkeit ihrer weißen Gardinen zur Schau stellten. Um die große kahle Mauer des Hauses zur Linken, die das Viereck des Hofes abschloß, zu verdecken, hatte man auch sie mit Fenstern versehen, mit aufgemalten falschen Fenstern, deren Läden ewig geschlossen waren und hinter denen das eingemauerte Leben der Nachbarwohnungen weiterzugehen schien.
»Aber ich werde ja ausgezeichnet wohnen!« rief Octave entzückt.
»Nicht wahr?« sagte Campardon. »Ich habe ja auch alles so besorgt, als wäre es für mich; und im übrigen habe ich die Weisungen befolgt, die in Ihren Briefen standen ... Das Mobiliar gefällt Ihnen also? Es ist alles da, was ein junger Mann braucht. Später können Sie weitersehen.« Und als Octave ihm dankend die Hände drückte und sich entschuldigte, daß er ihm diese ganzen Scherereien verursacht habe, fuhr der Architekt mit ernster Miene fort: »Nur, mein Bester, keinen Krach hier, vor allem keine Frau! – Mein Ehrenwort, wenn Sie eine Frau mitbrächten, so würde das einen Aufruhr geben.«
»Seien Sie unbesorgt!« murmelte der junge Mann ein wenig beunruhigt.
»Nein, ich muß Ihnen das sagen, ich selbst würde nämlich Ungelegenheiten bekommen ... Sie haben das Haus ja gesehen. Alles gute Bürger, und dazu von einer Sittenstrenge! Sie haben sich, unter uns gesagt, sogar ein bißchen zu sehr. Niemals ein lautes Wort, niemals mehr Geräusche, als Sie soeben gehört haben ... Oje, da würde Herr Gourd bestimmt Herrn Vabre holen, und wir beide wären schön dran! Um meiner Ruhe willen bitte ich Sie, mein Lieber: halten Sie das Haus in Ehren!«
Octave, der von so viel Ehrbarkeit angesteckt wurde, schwor, es in Ehren zu halten.
Da warf Campardon einen mißtrauischen Blick um sich und dämpfte die Stimme, als könnte man ihn hören, während er funkelnden Auges hinzufügte: »Was Sie draußen machen, das geht niemand was an. Paris ist groß genug, was? Man hat ja Platz ... Ich, ich bin im Grunde genommen Künstler, mir ist das schnuppe!«
Ein Dienstmann brachte die Koffer herauf. Als alles untergebracht war, blieb der Architekt väterlich dabei, während Octave Toilette machte. Danach stand er auf und sagte:
»Jetzt wollen wir hinuntergehen zu meiner Frau.«
Im dritten Stock sagte die Zofe, ein schmächtiges schwarzbraunes und kokettes Ding, die gnädige Frau sei beschäftigt. Um bei seinem jungen Freund nicht den Eindruck entstehen zu lassen, er komme ungelegen, zeigte ihm Campardon, der übrigens durch seine Erläuterungen von vorhin in Schwung gekommen war, die Wohnung: zuerst den großen, in Weiß und Gold gehaltenen, mit aufgesetzten Gesimsen reich verzierten Salon, der zwischen einem kleinen grünen Salon, den er in ein Arbeitszimmer umgestaltet hatte, und dem Schlafzimmer lag, das die beiden jetzt nicht betreten konnten, auf dessen überaus schmale Form und malvenfarbene Tapete er Octave aber ausdrücklich hinwies. Als er ihn darauf ins Eßzimmer führte, das über und über mit imitierten, durch Rundleisten und symmetrisch bosselierte Felder überaus verschnörkelten Holztäfeleien ausgestattet war, rief Octave hingerissen aus: »Das ist ja ganz großartig!«
An der Decke durchschnitten zwei große Risse die Felder, und in einer Ecke war die Farbe abgeblättert, so daß man den Putz sehen konnte.
»Ja, das macht Eindruck«, sagte der Architekt langsam, die Augen auf die Decke geheftet. »Sie verstehen, diese Häuser hier, die sind gebaut, um Eindruck zu machen ... Allerdings sollte man die Wände nicht allzusehr abklopfen. Noch keine zwölf Jahre ist das alles alt, und schon gehtʼs ab ... Die Fassade wird aus schönem Stein mit bildhauerischen Mätzchen hingesetzt, die Treppe wird dreifach lackiert, die Wohnungen werden vergoldet und bepinselt; und das schmeichelt den Leuten, das flößt Ansehen ein ... Oh, das ist noch solide genug, solange wie wir leben, hält das immer noch!«
Er ließ ihn erneut die Diele durchqueren, die ihr Licht durch ein Mattglasfenster erhielt. Links, zum Hof zu, lag ein zweites Zimmer, in dem seine Tochter Angèle schlief; und da es ganz in Weiß gehalten war, herrschte darin an diesem Novembernachmittag Grabestraurigkeit. Hinten am Gang lag sodann die Küche, in die der Architekt ihn durchaus führen wollte, denn er sagte, man müsse alles kennenlernen.
»Treten Sie doch ein«, sagte er mehrmals und stieß die Tür auf.
Aus der Küche drang fürchterlicher Lärm. Trotz der Kälte stand das Fenster weit offen. Die Ellbogen auf die Schutzstange vor dem Fenster gestützt, beugten sich die schwarzbraune Zofe und eine fette Köchin, eine geradezu überquellende Alte, auf den engen Schacht eines Innenhofes hinaus, der die in jedem Stockwerk einander gegenüberliegenden Küchen mit Licht versorgte. Sie schrien beide zugleich herum, reckten ihre prallen Hüften, während aus der Tiefe dieses Schlauches mit Gelächter und Flüchen vermischte pöbelhafte Stimmen heraufschollen. Das war gleichsam das Abflußrohr eines Gullys: die ganze Dienerschaft des Hauses war hier versammelt und ergötzte sich. Octave entsann sich der bürgerlichen Majestät des Hauptaufgangs.
Aber von einem Instinkt gewarnt, hatten sich die beiden Frauen umgewandt. Sie standen betroffen da, als sie den Hausherrn mit einem anderen Herrn erblickten. Ein kurzes, leises Pfeifen war zu hören, Fenster schlossen sich, alles sank in Totenstille zurück.
»Was ist denn, Lisa?« fragte Campardon.
»Herr Campardon«, erwiderte die Zofe ganz aufgeregt, »es war wieder mal Adèle, diese Schmutzliese. Sie hat die Eingeweide eines Kaninchens zum Fenster hinausgeworfen ... Der Herr sollten mal mit Herrn Josserand reden.«
Campardon blieb ernst, denn er war bestrebt, sich auf nichts einzulassen. Er kehrte in sein Arbeitszimmer zurück, während er zu Octave sagte:
»Sie haben alles gesehen. Die Wohnungen sind in jedem Stockwerk gleich. Meine eigene kostet zweitausendfünfhundert Francs Jahresmiete, und das im dritten Stock! Die Mieten steigen von Tag zu Tag ... Herr Vabre muß aus seinem Haus an die zweiundzwanzigtausend Francs jährlich herausholen. Und das wird sich noch erhöhen, denn es wird davon gesprochen, daß vom Place de la Bourse bis zur neuen Oper eine breite Straße angelegt werden soll ... Ein Haus, zu dem er den Grund und Boden vor kaum zwölf Jahren umsonst gekriegt hat, als damals das Dienstmädchen eines Drogisten jenes Großfeuer verursacht hatte!«
Als sie eintraten, erblickte Octave über einem Zeichentisch im hellen Licht des Fensters ein Heiligenbild mit einem prächtigen Rahmen, eine Muttergottes, vor deren offener Brust ein riesiges Herz in Flammen stand. Er vermochte eine gewisse Überraschung nicht zu unterdrücken; er blickte Campardon an, den er in Plassans als großen Spötter kennengelernt hatte.
»Ach, das habe ich Ihnen ja gar nicht gesagt«, versetzte dieser und wurde ein klein wenig rot, »ich bin zum Diözesanarchitekten ernannt worden, ja, in Evreux. Oh, an Bezahlung bekomme ich eine Lappalie, im ganzen kaum zweitausend Francs im Jahr. Aber zu machen ist gar nichts, von Zeit zu Zeit eine Reise dahin; im übrigen habe ich einen Inspektor dort ... Und sehen Sie, es macht viel aus, wenn man ›Regierungsbaumeister‹ auf seine Visitenkarten drucken lassen kann. Sie können sich nicht vorstellen, wieviel Aufträge mir das in der feinen Gesellschaft verschafft.« Beim Reden betrachtete er die Muttergottes mit dem lodernden Herzen. »Alles in allem«, fuhr er in einer jähen Anwandlung von Offenheit fort, »sind mir ihre Mätzchen schnuppe!«
Da Octave aber angefangen hatte zu lachen, bekam es der Architekt mit der Angst zu tun. Warum sollte er sich diesem jungen Mann anvertrauen? Er warf ihm einen scheelen Blick zu, setzte eine zerknirschte Miene auf, bemühte sich, seinen Satz zurückzunehmen.
»Sie sind mir schnuppe und sind mir auch wieder nicht schnuppe ... Mein Gott, ja, ich bringe es eben zu etwas. Sie werden sehen, Sie werden sehen, mein Freund, wenn Sie ein wenig älter geworden sind, werden Sie es wie alle Welt machen.« Und er sprach von seinen zweiundvierzig Jahren, von der Leere des Daseins, gab sich melancholisch, was in schroffem Gegensatz zu seiner blühenden Gesundheit stand. An dem Künstlerkopf, den er sich mit dem lang wallenden Haar und dem nach Heinrich IV. benannten Bart5 zurechtgemacht hatte, entdeckte man den flachen Schädel und die eckige Kinnlade eines Spießbürgers mit beschränktem Verstand und gierigen Gelüsten. In jüngeren Jahren war er von einer Fröhlichkeit gewesen, die einem auf die Nerven ging.
Octaves Augen waren an einer Nummer der »Gazette de France6« haftengeblieben, die zwischen Plänen herumlag. Da läutete der immer verlegener werdende Campardon nach der Zofe, um sich zu erkundigen, ob die gnädige Frau nun endlich zu sprechen sei. Ja, der Doktor breche gerade auf, die gnädige Frau werde gleich kommen.
»Ist Ihre Gattin denn leidend?« fragte der junge Mann.
»Nein, es geht ihr wie immer«, sagte der Architekt mit verdrossener Stimme.
»Aha, und was fehlt ihr denn?«
Der Architekt, der wieder verlegen wurde, antwortete ausweichend: »Sie wissen ja, bei den Frauen geht immer was entzwei ... So geht es ihr seit dreizehn Jahren, seit ihrer Niederkunft ... Sonst ist sie kerngesund. Sie werden sogar finden, daß sie üppig geworden ist.«
Octave drang nicht weiter in ihn. Eben erschien Lisa wieder und brachte eine Visitenkarte; und der Architekt entschuldigte sich, stürzte zum Salon und bat den jungen Mann, er möge sich gedulden und inzwischen mit seiner Frau plaudern. Octave hatte durch die rasch geöffnete und wieder geschlossene Tür in der Mitte des großen in Weiß und Gold gehaltenen Raumes den schwarzen Fleck einer Soutane erblickt.
Im selben Augenblick kam Frau Campardon von der Diele her herein. Er erkannte sie nicht wieder. Früher, als er noch ein junger Bengel gewesen und sie in Plassans bei ihrem Vater, Herrn Domergue, dem Inspektor beim Brücken- und Straßenbauamt, gesehen hatte, war sie mager und häßlich gewesen und mit zwanzig Jahren so schmächtig wie ein Backfisch, dem die Pubertätskrise zu schaffen macht; und nun, da er sie wiedersah, war sie mollig, hatte die helle und ausgeruhte Gesichtsfarbe einer Nonne, zärtliche Augen, Grübchen und sah aus wie eine Naschkatze. Hatte sie auch nicht hübsch werden können, so war sie doch um die Dreißig herum gereift und hatte dabei den süßen Geschmack und den frischen Duft von Herbstobst angenommen. Es fiel Octave nur auf, daß ihr das Gehen Mühe machte und sie dabei in der Hüfte hin und her schwankte, was ihr bei dem langen, resedafarbenen seidenen Morgenrock, den sie trug, etwas Schmachtendes verlieh.
»Aber Sie sind ja jetzt ein Mann!« sagte sie fröhlich mit ausgestreckten Händen. »Wie Sie seit unserer letzten Reise gewachsen sind!« Und sie betrachtete ihn: er war groß, brünett, ein hübscher Bursche mit gepflegtem Schnurrbart und Kinnbart. Als er sein Alter nannte, zweiundzwanzig Jahre, brach sie in Verwunderung aus: er sehe mindestens wie fünfundzwanzig aus.
Er, den die Gegenwart einer Frau, selbst die des verworfensten Dienstmädchens, mit Entzücken erfüllte, lachte perlend und liebkoste sie mit dem Blick seiner samtweichen altgoldfarbenen Augen.
»Ach ja«, sagte er lässig mehrere Male, »ich bin gewachsen, ich bin gewachsen ... Erinnern Sie sich noch, wie Ihre Cousine Gasparine mir Murmeln gekauft hat?« Darauf erzählte er ihr, wie es ihren Eltern ging. Herr und Frau Domergue lebten glücklich in dem Haus, in dem sie sich zur Ruhe gesetzt hatten; sie klagten nur, daß sie recht einsam wären, sie verargten es Campardon, daß er ihnen während eines geschäftlichen Aufenthaltes in Plassans ihre kleine Rose entführt hatte. Dann suchte der junge Mann das Gespräch wieder auf die Cousine Gasparine zu bringen, denn er hatte eine alte Neugier zu befriedigen, die er als frühreifer Schlingel anläßlich eines unaufgeklärt gebliebenen Ereignisses empfunden hatte: der jähe Anfall von Leidenschaft des Architekten für Gasparine, ein schönes, großes, aber mittelloses Mädchen, und dann seine plötzliche Heirat mit der mageren Rose, die dreißigtausend Francs Mitgift bekam; und ein regelrechter Auftritt mit Tränenergüssen und ein Zerwürfnis, die Flucht der Verlassenen nach Paris zu einer Tante, die Schneiderin war.
Aber Frau Campardon, deren Sinne so abgeklärt waren, daß sie nichts mehr aus der Ruhe bringen konnte, behielt ihre rosige Blässe und schien nicht zu verstehen. Er konnte nichts Näheres aus ihr herausbringen.
»Und Ihre Eltern?« fragte nun sie. »Wie geht es Herrn und Frau Mouret?«
»Sehr gut, vielen Dank«, erwiderte er. »Meine Mutter kommt aus ihrem Garten nicht mehr heraus. Sie würden das Haus in der Rue de la Banne so wiederfinden, wie Sie es verlassen haben.«
Frau Campardon, die anscheinend nicht lange stehen konnte, ohne zu ermüden, hatte sich auf einen hohen Zeichenstuhl gesetzt und die Beine unter ihrem Morgenrock langgestreckt; und einen niedrigen Sessel heranrückend, hob Octave mit der ihm zur Gewohnheit gewordenen anbetungsvollen Miene den Kopf, um mit ihr zu reden. Trotz seiner breiten Schultern wirkte er fraulich, er hatte einen Sinn für Frauen, der ihm sogleich ihre Herzen öffnete. So plauderten sie beide denn auch nach zehn Minuten bereits wie alte Freundinnen.
»Nun bin ich also bei Ihnen in Kost?« sagte er und strich sich mit seiner schönen Hand, deren Nägel untadelig geschnitten waren, über den Bart. »Wir werden gut miteinander auskommen, das werden Sie sehen ... Es war wirklich reizend von Ihnen, sich des Bengels aus Plassans zu erinnern und sich beim ersten Wort um alles zu kümmern!«
Aber sie wehrte ab.
»Nein, mir dürfen Sie nicht danken. Ich bin viel zu träge, ich rühre mich nicht mehr vom Fleck. Achille, der hat alles geregelt ... Und genügte es denn übrigens nicht, daß meine Mutter uns Ihren Wunsch anvertraut hat, bei einer Familie in Kost zu gehen, um uns auf den Gedanken zu bringen, Ihnen unser Haus zu öffnen? Sie schneien ja nicht bei fremden Leuten herein, und wir haben dadurch ein bißchen Gesellschaft.«
Nun erzählte er von seinen Angelegenheiten. Nachdem er, um seine Familie zufriedenzustellen, endlich das Abiturientenzeugnis erlangt hatte, war er die vergangenen drei Jahre in Marseille bei einer großen Firma gewesen, die mit bedrucktem Kattun handelte und deren Fabrik in der Umgebung von Plassans lag. Der Handel war seine Leidenschaft, der Handel mit Luxusartikeln für die Frau, bei dem etwas Verlockendes mit im Spiel ist, ein langsames Besitzergreifen durch goldene Worte und schmeichlerische Blicke. Und er erzählte mit sieghaftem Lachen, wie er die fünftausend Francs verdient hatte, ohne die er sich – denn unter dem äußeren Schein eines liebenswürdigen Windhunds verbarg sich die Schläue eines Juden – niemals nach Paris gewagt hätte.
»Stellen Sie sich vor, die da hatten einen Pompadourkattun7, ein veraltetes Muster, etwas Wunderschönes ... Es biß niemand an; seit zwei Jahren lag er in den Kellerräumen ... Da kam mir, als ich gerade die Departements8 Var und Basses-Alpes abgrasen wollte, der Gedanke, den ganzen Posten aufzukaufen und ihn auf eigene Rechnung an den Mann zu bringen. Oh, das war ein Erfolg, ein toller Erfolg! Die Frauen rissen sich um die Reste; da unten gibtʼs heute nicht eine, die nicht etwas von meinem Kattun auf dem Leibe trüge ... Allerdings habe ich sie wirklich hübsch eingewickelt! Alle gehörten sie mir, ich hätte mit ihnen machen können, was ich wollte.«
Und er lachte, während ihn Frau Campardon hingerissen, verwirrt von dem Gedanken an diesen Pompadourkattun, ausfragte. Sträußchen auf ungebleichtem Grund, nicht wahr? So etwas habe sie überall für einen Sommermorgenrock gesucht.
»Zwei Jahre bin ich umhergereist, das genügt«, versetzte er. »Außerdem muß ich doch Paris erobern ... Ich werde mir unverzüglich etwas suchen.«
»Wie?« rief sie aus. »Hat Ihnen Achille nichts erzählt? Er hat doch eine Stelle für Sie, und zwar ganz in der Nähe!«
Octave bedankte sich, staunte, als wäre er im Schlaraffenland, fragte aus Spaß, ob er abends in seinem Zimmer nicht gar eine Frau und ein Vermögen mit hunderttausend Francs Jahreszinsen vorfinden würde, da stieß ein vierzehnjähriges, lang aufgeschossenes und häßliches Mädchen mit fadem Blondhaar die Tür auf und schrie leise vor Erschrecken auf.
»Komm herein und hab keine Angst«, sagte Frau Campardon. »Das ist Herr Octave Mouret, von dem du uns schon hast reden hören.« Sich zu Octave umwendend, sagte sie dann: »Meine Tochter Angèle ... Wir hatten sie bei unserer letzten Reise nicht mitgenommen. Sie war so schwächlich! Aber nun wird sie ja ein bißchen voller.«
Angèle hatte sich mit der mürrischen Befangenheit von Mädchen in diesem ungünstigen Alter hinter ihre Mutter gestellt. Sie ließ ihre Blicke über den lächelnden jungen Mann gleiten.
Fast gleich darauf kam Campardon ganz aufgekratzt wieder zum Vorschein; und er konnte nicht an sich halten, er erzählte seiner Frau in wenigen abgerissenen Sätzen von dem Glücksfall: Abbé Mauduit, Vikar an der Kirche Saint-Roch, wegen Bauarbeiten; bloß eine Reparatur, die ihn aber weit bringen könne. Er ärgerte sich zwar darüber, daß er in Octaves Gegenwart geplaudert hatte, war aber immer noch so aufgeregt, daß er in die Hände klatschte und sagte: »Hm, hm, was machen wir nun?«
»Aber Sie wollten doch ausgehen«, sagte Octave. »Ich will Sie nicht abhalten.«
»Achille«, murmelte Frau Campardon, »diese Stelle da bei den Hédouins ...«
»Ach ja, richtig!« rief der Architekt aus. »Mein Lieber, eine Stelle als erster Verkäufer in einem Modewarengeschäft. Ich kenne dort jemanden, der sich für Sie verwendet hat ... Man erwartet Sie. Es ist noch nicht vier Uhr, soll ich Sie vorstellen?«
Octave zögerte, da er wegen des Knotens seiner Krawatte besorgt war und sich bei seiner Leidenschaft für untadelige Kleidung unsicher fühlte. Er entschloß sich jedoch, als Frau Campardon ihm geschworen hatte, er sehe sehr anständig aus. Mit einer schmachtenden Bewegung hatte sie ihrem Mann die Stirn hingehalten, die dieser mit überströmender Zärtlichkeit küßte, wobei er immer wieder sagte: »Leb wohl, mein Kätzchen ... Leb wohl, mein Puttchen ...«
»Wissen Sie, wir essen um sieben Uhr zu Abend«, sagte sie, während sie beide durch den Salon begleitete, wo die Herren ihre Hüte holten.
Angèle folgte ihnen mit eckigen Bewegungen. Aber ihr Klavierlehrer wartete auf sie, und gleich darauf klimperte sie mit ihren dürren Fingern auf dem Instrument los. Octaves Stimme wurde übertönt, als er in der Diele zurückblieb, um sich abermals zu bedanken. Und als er die Treppe hinabging, schien ihn das Klavier zu verfolgen: inmitten des lauen Schweigens antworteten bei Frau Juzeur, bei den Vabres, bei den Duveyriers andere Klaviere, spielten in jedem Stockwerk andere Melodien, die fern und fromm aus der Andächtigkeit der Türen hervortönten.
Unten bog Campardon in die Rue Neuve-Saint-Augustin ein. Er schwieg, sah gedankenversunken aus, wie jemand, der nach einer Überleitung sucht.
»Erinnern Sie sich noch an Mademoiselle Gasparine?« fragte er schließlich. »Sie ist erste Verkäuferin bei den Hédouins ... Sie werden sie gleich sehen.«
Octave hielt die Gelegenheit für gekommen, seine Neugier zu befriedigen.
»Aha«, sagte er. »Wohnt sie bei Ihnen?«
»Nein, nein«, rief der Architekt lebhaft und gleichsam gekränkt aus. Da der junge Mann über seine Heftigkeit überrascht zu sein schien, fuhr er dann ziemlich verlegen und voller Sanftmut fort: »Nein, Mademoiselle Gasparine und meine Frau verkehren nicht mehr miteinander ... Sie wissen ja, wie das in den Familien so ist ... Ich bin ihr begegnet, und ich mußte ihr wohl oder übel behilflich sein, nicht wahr, zumal das arme Mädchen nicht gerade im Geld schwimmt. So kommt es, daß die beiden Frauen jetzt durch mich voneinander erfahren, wie es ihnen geht ... Bei diesen alten Streitigkeiten muß man es der Zeit überlassen, die Wunden zu heilen.«
Octave entschloß sich gerade, ihn rundheraus über seine Heirat zu fragen, als der Architekt das Gespräch kurz mit den Worten abbrach: »Da sind wir!«
Es war ein an der Ecke der Rue Neuve-Saint-Augustin und der Rue de la Michodière gelegenes Modewarengeschäft, dessen Tür zum schmalen Dreieck des Place Gaillon zu lag. Auf einem Ladenschild, das zwei Fenster des Zwischenstocks versperrte, stand in großen verblaßten Goldbuchstaben »Paradies der Damen, gegründet 1822«, während auf den Spiegelglasscheiben der Schaufenster rot aufgemalt der Firmenname »Deleuze, Hédouin & Co.« zu lesen war.
»Es hat keinen modernen Schick, ist aber ehrbar und solide«, erklärte Campardon schnell. »Herr Hédouin, ein ehemaliger Verkäufer, hat die Tochter des ältesten Deleuze geheiratet, der vor zwei Jahren gestorben ist, so daß die Firma jetzt von dem jungen Ehepaar, dem alten Onkel Deleuze und einem anderen Teilhaber, die sich, glaube ich, beide abseits halten, geleitet wird ... Sie werden Frau Hédouin ja sehen. Oh, eine Frau mit Köpfchen! – Gehen wir hinein.«
Herr Hédouin war gerade zum Einkauf von Leinwand in Lille. So wurden sie von Frau Hédouin empfangen. Sie stand da, einen Federhalter hinter dem Ohr, und erteilte zwei Ladendienern, die Stoffballen in Fächer einordneten, Anweisungen; und sie erschien Octave so groß, so bewundernswert schön mit ihrem regelmäßigen Gesicht und ihrem schlichten, glattgescheitelten Haar, so ernst lächelnd in ihrem schwarzen Kleid, von dem sich ein flacher Kragen und eine kleine Herrenkrawatte abhoben, daß er, der seinem Wesen nach doch wenig schüchtern war, zu stottern begann. Alles wurde mit ein paar Worten erledigt.
»Nun gut«, sagte sie mit ihrer ruhigen Miene in ihrer gewohnten Verbindlichkeit als Geschäftsfrau, »da Sie ja frei sind, besichtigen Sie doch den Laden.«
Sie rief einen Verkäufer und vertraute ihm Octave an; nachdem sie dann auf eine Frage Campardons höflich erwidert hatte, Fräulein Gasparine mache eine Besorgung, wandte sie sich ab, fuhr mit ihrer Arbeit fort, warf mit ihrer sanften und befehlenden Stimme Anweisungen hin.
»Nicht dorthin, Alexandre ... Legen Sie die Seidenstoffe nach oben ... Das ist nicht mehr dieselbe Marke, passen Sie doch auf!«
Zögernd sagte Campardon schließlich zu Octave, er werde wieder vorbeikommen und ihn zum Abendessen abholen.
Nun besichtigte der junge Mann zwei Stunden lang den Laden. Er fand, daß er schlecht beleuchtet, klein und mit Waren überfüllt war, die aus dem Kellergeschoß hervorquollen, sich in den Ecken stauten, so daß zwischen den hohen Mauern von Stoffballen nur überaus enge Durchgänge frei blieben. Wiederholt begegnete er dort Frau Hédouin, die geschäftig durch die schmälsten Gänge huschte, ohne je mit einem Zipfel ihres Kleides hängenzubleiben. Sie schien die lebende und ausgeglichene Seele des Hauses zu sein, dessen ganzes Personal dem leisesten Wink ihrer weißen Hände gehorchte. Octave war gekränkt, daß sie ihn nicht mehr ansah. Als er gegen drei Viertel sieben Uhr ein letztes Mal aus dem Kellergeschoß wieder nach oben stieg, sagte man ihm, Campardon sei im ersten Stock bei Fräulein Gasparine. Dort befand sich eine Wäscheabteilung, die dieses Fräulein leitete. Aber oben an der Wendeltreppe blieb der junge Mann hinter einer Pyramide aus gleichmäßig aufgestapelten Kalikoballen plötzlich stehen, als er hörte, wie der Architekt Gasparine duzte.
»Ich schwöre dir: nein!« rief er und vergaß sich dabei so weit, daß er die Stimme hob.
Es trat Stillschweigen ein.
»Wie geht es ihr?« fragte die junge Frau.
»Mein Gott, immer dasselbe. Das kommt, das vergeht ... Sie fühlt wohl, daß es jetzt aus ist. Niemals wird sich das wieder einrenken.«
Gasparine versetzte mit mitleidsvoller Stimme:
»Mein armer Freund, zu bedauern bist doch du. Da du aber schließlich auf andere Art und Weise hast zurechtkommen können ... Sag ihr, wie bekümmert ich darüber bin, daß sie stets leidend ist ...«
Ohne sie ausreden zu lassen, hatte Campardon sie bei den Schultern gepackt und küßte sie in der von der Gasbeleuchtung erwärmten Luft, die unter der niedrigen Decke bereits drückend wurde, ungestüm auf die Lippen.
Sie erwiderte seinen Kuß und murmelte: »Morgen früh um sechs, wenn du kannst ... ich werde im Bett bleiben. Klopfe dreimal.«
Octave, der wie benommen war, begann zu verstehen, er hustete und trat vor. Ihn erwartete eine weitere Überraschung: die Cousine Gasparine war vertrocknet, mager, eckig, hatte eine vorspringende Kinnlade und hartes Haar; und in ihrem erdfahl gewordenen Gesicht waren nur ihre großen, prächtigen Augen unverändert geblieben. Mit ihrer mißgünstigen Stirn, ihrem glutvollen und eigensinnigen Mund verwirrte sie ihn ebensosehr, wie ihn Rose mit ihrem späten Erblühen einer lässigen Blondine bezaubert hatte.
Gasparine war indessen höflich, doch ohne Überschwang. Sie erinnerte sich an Plassans, sie sprach mit dem jungen Mann über die Tage von einst. Als Campardon und er nach unten gingen, drückte sie ihnen die Hand.
Unten sagte Frau Hédouin zu Octave lediglich: »Bis morgen, Herr Mouret.«
Auf der Straße, wo ihn das Rollen der Droschken ganz taub machte und ihn die Passanten anrempelten, konnte der junge Mann nicht umhin zu bemerken, jene Dame sei zwar sehr schön, wirke aber nicht liebenswürdig. Auf das schwarze und schmutzbedeckte Pflaster warfen helle Schaufenster frisch dekorierter Geschäfte mit flammender Gasbeleuchtung Vierecke grellen Lichts, während alte Läden mit dunklen Auslagen den Fahrdamm durch Lücken voller Düsternis trübselig machten, Läden, die nur innen von blakenden, wie ferne Sterne brennenden Lampen erleuchtet waren. Kurz bevor die Herren von der Rue Neuve- Saint-Augustin in die Rue de Choiseul einbogen, grüßte der Architekt, als sie an einem dieser Läden vorbeikamen.
Eine schmächtige und elegante junge Frau, die sich ein Seidenmäntelchen umgehängt hatte, stand auf der Schwelle und zog einen kleinen dreijährigen Jungen an sich, damit er nicht überfahren werde. Sie plauderte mit einer alten Dame ohne Kopfbedeckung, zweifellos mit der Kaufmannsfrau, zu der sie du sagte. Octave konnte in diesem finsteren Türrahmen unter den tanzenden Reflexen der Gaslaternen in der Nähe ihre Züge nicht erkennen; sie kam ihm hübsch vor, er sah nur zwei glühende Augen, die sich einen Augenblick wie zwei Flammen auf ihn hefteten. Hinten versank der feuchte Laden gleich einem Keller, aus dem ein unbestimmter Salpetergeruch emporstieg.
»Das ist Madame Valérie, die Frau von Herrn Théophile Vabre, dem jüngeren Sohn des Hausbesitzers, Sie wissen ja, die Leute aus dem ersten Stock«, erklärte Campardon, als er einige Schritte weitergegangen war. »Oh, eine ganz reizende Dame! – Sie ist in diesem Laden geboren, eines der am besten gehenden Kurzwarengeschäfte im Viertel, das ihre Eltern, Herr und Frau Louhette, immer noch führen, damit sie was zu tun haben. Ganz hübsch haben sie da verdient, das kann ich Ihnen versichern!«
Aber Octave hatte kein Verständnis für einen derartigen Handel in diesen Löchern des alten Paris, wo ehemals ein Ballen Stoff an Stelle eines Ladenschilds genügte. Er schwor, um nichts in der Welt würde er einwilligen, auf dem Grunde einer solchen Gruft zu leben. Da müsse man sich ja schön was wegholen!
Plaudernd waren sie die Treppe hinaufgestiegen. Sie wurden bereits erwartet. Frau Campardon hatte ein graues Seidenkleid angezogen, hatte sich kokett frisiert und war sehr gepflegt in ihrer ganzen Erscheinung. Mit der Rührung eines guten Ehemannes küßte Campardon sie auf den Hals.
»Guten Abend, mein Kätzchen ... Guten Abend, mein Puttchen ...«
Und man ging ins Eßzimmer hinüber. Das Abendessen verlief reizend. Frau Campardon plauderte zunächst über die Deleuzes und die Hédouins: eine vom ganzen Viertel geachtete Familie, deren Mitglieder sehr bekannt seien: ein Vetter sei Papierwarenhändler in der Rue Gaillon, ein Onkel Regenschirmhändler in der Passage Choiseul, mehrere Neffen und Nichten seien, überall in der Umgegend verstreut, selbständige Geschäftsleute. Dann nahm das Gespräch eine andere Wendung, man befaßte sich mit Angèle, die steif auf ihrem Stuhl saß und mit eckigen Bewegungen aß. Ihre Mutter erzog sie zu Hause, das sei sicherer; und da sie nichts weiter darüber sagen wollte, blinzelte sie mit den Augen, um anzudeuten, daß die jungen Damen häßliche Dinge in den Pensionaten lernten. Soeben hatte das junge Mädchen heimlich ihren Teller schön ausbalanciert auf das Messer gestellt. Da Lisa, die servierte, ihn beinahe zerbrochen hätte, rief sie: »Daran sind Sie schuld, Mademoiselle!«
Ein gewaltsam zurückgehaltenes irres Gelächter glitt über Angèles Gesicht.
Frau Campardon hatte sich damit begnügt, den Kopf zu schütteln; und als Lisa hinausgegangen war, um den Nachtisch zu holen, sang sie eine Lobeshymne auf Lisa: sie sei sehr klug, sehr rührig, ein Pariser Mädchen, das sich stets zu drehen und zu wenden wisse. Victoire, die Köchin, die wegen ihres hohen Alters nicht mehr sehr reinlich sei, hätte man entbehren können; aber sie sei schon dabeigewesen, als Herr Campardon im Hause seines Vaters zur Welt kam, sie sei wie ein alter baufälliger Familienbesitz, den alle achteten. Dann, als die Zofe mit Bratäpfeln wieder hereinkam, fuhr Frau Campardon fort, indem sie Octave ins Ohr flüsterte: »Tadelloses Betragen. Ich habe noch nichts entdeckt ... Ein einziger Ausgangstag im Monat, damit sie ihre alte Tante besuchen kann, die sehr weit entfernt wohnt.«
Octave betrachtete Lisa. Als er sie so sah, nervös, mit flacher Brust, blau unterlaufenen Augenlidern, kam ihm der Gedanke, daß sie bei ihrer alten Tante verdammt flottmachen müsse. Im übrigen pflichtete er der Mutter nachdrücklich bei, die fortfuhr, ihm ihre Ansichten über Erziehung zu unterbreiten: ein junges Mädchen stelle eine so schwere Verantwortung dar, selbst den Hauch der Straße müsse man von ihr fernhalten.
Und währenddessen kniff Angèle Lisa jedesmal, wenn diese sich neben ihrem Stuhl herabbeugte, um einen Teller zu wechseln, in einem rasenden Verlangen nach Vertraulichkeiten in die Schenkel, ohne daß eine von beiden, die ganz ernst blieben, auch nur mit den Lidern gezuckt hätte.
»Man muß tugendhaft gegen sich selbst sein«, sagte der Architekt gelehrt, als Schlußfolgerung auf Gedanken, die er nicht äußerte. »Mir ist die Meinung der Leute schnuppe, ich bin Künstler!«
Nach Tisch blieb man bis Mitternacht im Salon. Zur Feier von Octaves Ankunft schlug man also über die Stränge. Frau Campardon machte einen sehr müden Eindruck; auf einem Kanapee zurückgelehnt, ließ sie sich nach und nach gehen.
»Hast du Schmerzen, mein Kätzchen?« fragte sie ihr Mann.
»Nein«, erwiderte sie mit gedämpfter Stimme. »Es ist immer dasselbe.« Sie schaute ihn an, dann sagte sie leise: »Hast du sie bei Hédouins gesehen?«
»Ja ... Sie hat sich nach deinem Befinden erkundigt.«
Tränen stiegen Rose in die Augen.
»Ihr geht es ja auch gut!«
»Na, na«, sagte der Architekt und drückte ihr leise Küsse aufs Haar, wobei er vergaß, daß sie nicht allein waren. »Du wirst dir noch schaden ... Weißt du denn nicht, daß ich dich trotz alledem liebe, mein armes Puttchen?«
Octave, der taktvoll zum Fenster gegangen war, als wolle er auf die Straße sehen, kam zurück und durchforschte Frau Campardons Gesicht, denn seine Neugier war wieder erwacht, und er fragte sich, ob sie Bescheid wisse.
Aber sie hatte wieder ihr liebenswürdiges und wehleidiges Gesicht aufgesetzt, sie kuschelte sich tief in das Kanapee hinein, wie eine Frau, die sich ihr eigenes Vergnügen verschafft und sich notgedrungen mit dem ihr zukommenden Anteil an Liebkosungen abfindet.
Schließlich wünschte Octave ihnen eine gute Nacht. Mit seinem Leuchter in der Hand stand er noch auf dem Treppenabsatz, als er das Rascheln von Seidenkleidern hörte, die die Stufen streiften. Aus Höflichkeit trat er beiseite. Offensichtlich waren es die Damen aus dem vierten Stock, Frau Josserand und ihre beiden Töchter, die von einer Abendgesellschaft zurückkehrten. Als sie vorübergingen, faßte ihn die Mutter, eine beleibte und stolze Frau, scharf ins Auge, während sich die ältere Tochter mit frostiger Miene abwandte und die jüngere ihn im hellen Licht der Kerze unbesonnen anlachte. Sie war reizend, diese Kleine mit ihrem unregelmäßigen, aber ansprechenden Gesicht, dem hellen Teint, dem kastanienbraunen, von blonden Reflexen vergoldeten Haar; und sie hatte eine kecke Anmut an sich, den ungezwungenen Gang einer Jungverheirateten Frau, die in einer mit Schleifen und Spitzen überladenen Toilette, wie heiratsfähige Mädchen sie sonst nicht zu tragen pflegen, von einem Ball heimkehrt. Die Schleppen verschwanden längs des Geländers, eine Tür ging zu. Octave ergötzte sich noch immer an der Fröhlichkeit ihrer Augen.
Langsam ging nun auch er nach oben. Eine einzige Gaslampe brannte, die Treppe schlief in drückender Wärme ein. Sie kam ihm jetzt andächtiger vor mit ihren keuschen Türen, ihren kostbaren Mahagonitüren, die vor ehrbaren Alkoven verschlossen waren. Kein Seufzer drang hindurch, es herrschte das Schweigen wohlerzogener Menschen, die ihren Atem anhalten. Allerdings war ein leises Geräusch zu hören; er beugte sich vor und gewahrte Herrn Gourd in Pantoffeln und Käppchen, der die letzte Gaslampe auslöschte. Da stürzte alles gleichsam in einen Abgrund, das Haus sank in die Feierlichkeit der Finsternis zurück, als löse es sich völlig auf in der Vornehmheit und der Sittsamkeit seines Schlummers.
Octave jedoch fiel es sehr schwer einzuschlafen. Er warf sich fieberhaft hin und her, sein Gehirn war mit den neuen Gesichtern beschäftigt, die er gesehen hatte. Warum zum Teufel zeigten sich die Campardons so liebenswürdig? Träumten sie etwa davon, ihm später ihre Tochter zur Frau zu geben? Vielleicht nahm ihn der Ehemann auch nur deshalb in Kost, damit er seine Frau beschäftigte und aufheiterte? Und diese arme Dame, was für eine wunderliche Krankheit mochte sie wohl haben? Dann verwirrten sich seine Gedanken noch mehr, er sah Schatten vorüberhuschen: die kleine Frau Pichon, seine Nachbarin, mit ihren hellen und ausdruckslosen Blicken; die schöne Frau Hédouin, untadelig und ernst in ihrem schwarzen Kleid; und Frau Valéries glühende Augen; und Fräulein Josserands fröhliches Lachen. Wie das alles in wenigen Stunden auf dem Pariser Pflaster emporschoß! Schon immer hatte er davon geträumt, von Damen, die ihn an die Hand nehmen und ihm bei seinen Unternehmungen helfen würden. Aber jene Frauen kamen immer wieder, verschwammen mit ermüdender Hartnäckigkeit ineinander. Er wußte nicht, welche er wählen sollte, er bemühte sich, seine zärtliche Stimme, seine schmeichlerischen Gebärden beizubehalten. Und jäh gab er niedergedrückt und erbittert seiner tief eingewurzelten Brutalität nach, der wilden Verachtung, die er unter seiner Miene verliebter Anbetung für die Frauen empfand.
»Werden sie mich nun endlich schlafen lassen!« sagte er laut und legte sich ungestüm wieder auf den Rücken. »Die erste, die will ... Welche, ist mir egal! Und von mir aus auch alle auf einmal, wenn ihnen das Spaß macht! Schlafen wir, morgen ist auch noch ein Tag.«
Zweites Kapitel
Als Frau Josserand mit ihren Töchtern, die vor ihr her gingen, die Abendgesellschaft bei Frau Dambreville verließ, die im vierten Stock eines Hauses in der Rue de Rivoli an der Ecke der Rue de lʼOratoire wohnte, warf sie in dem jähen Ausbruch eines seit zwei Stunden mühsam unterdrückten Zorns heftig die Haustür zu. Wieder einmal hatte Berthe, ihre jüngere Tochter, vorhin eine Partie verpaßt.
»Na, was macht ihr denn da?« sagte sie aufbrausend zu den jungen Mädchen, die unter den Arkaden stehengeblieben waren und vorüberfahrenden Droschken nachblickten. »So geht doch! – Glaubt ja nicht, daß wir einen Wagen nehmen! Damit noch zwei Francs ausgegeben werden, nicht wahr?«
Und als Hortense, die ältere, murmelte: »Das kann ja nett werden bei diesem Schmutz. Das überstehen meine Schuhe nicht«, entgegnete die Mutter, nun völlig wütend: »Vorwärts! Wenn ihr keine Schuhe mehr habt, dann bleibt ihr eben im Bett, ganz einfach. Es kommt ja sowieso nichts dabei heraus, wenn man euch ausführt!«
Berthe und Hortense, die den Kopf hängenließen, bogen in die Rue de lʼOratoire ein. Sie rafften ihre langen Röcke so hoch wie möglich über ihre Krinolinen, zogen die Schultern ein und bibberten unter ihren dünnen Ballumhängen. Frau Josserand ging hinterher, eingehüllt in einen alten Pelz, Fehwammen, schäbig wie Katzenfelle. Alle drei waren ohne Hut und hatten einen Spitzenschal um das Haar geschlungen, weshalb sich die letzten Passanten nach ihnen umdrehten, weil sie überrascht waren, sie in diesem Aufzug eine hinter der anderen mit krummem Buckel und auf die Pfützen gehefteten Augen an den Häusern entlangflitzen zu sehen. Und die Erbitterung der Mutter nahm noch zu, als sie an so viele ähnliche Heimwege in den letzten drei Wintern dachte, an das mühselige Gehen in den sich verheddernden Toiletten, an den schwarzen Straßendreck und an das höhnische Grinsen der Gassenlümmel, die sich noch spät in der Nacht herumtrieben. Nein, sie hatte es entschieden satt, ihre Töchter an alle vier Ecken von Paris mitzuschleppen, ohne sich den Luxus einer Droschke gönnen zu dürfen, aus Furcht, am nächsten Tag ein Gericht beim Abendessen streichen zu müssen!
»Und so was stiftet Ehen!« sagte sie ganz laut, auf Frau Dambreville zurückkommend, lediglich, um ihrem Herzen Luft zu machen, ohne sich etwa an ihre Töchter zu wenden, die in die Rue Saint-Honoré eingebogen waren. »Hübsch sind sie, ihre Ehen! Ein Haufen Zimtzicken, die wer weiß woher zu ihr kommen! Ach, wenn man nicht dazu gezwungen wäre! – Genau wie ihr neuester Erfolg, diese Jungverheiratete Frau, die sie herausgestellt hat, um uns zu zeigen, daß es nicht immer schiefgeht: ein schönes Beispiel! Ein unglückseliges Kind, das nach einem Fehltritt wieder ein halbes Jahr lang ins Kloster gesteckt werden mußte, um es wieder rein zu waschen!«
Die jungen Mädchen überquerten gerade den Place du Palais-Royal, da prasselte plötzlich ein Platzregen nieder. Nun gab es eine wilde Flucht. Sie blieben stehen, rutschten aus, patschten umher, blickten erneut nach den leer vorüberrollenden Droschken.
»Vorwärts!« schrie die Mutter unbarmherzig. »Jetzt ist es zu nahe, das lohnt keine vierzig Sous ... Euer Bruder Léon hat sich ja auch geweigert mitzukommen, aus Furcht, wir könnten ihn bezahlen lassen! Um so besser, wenn er seine Angelegenheiten bei dieser Dame erledigt! Aber anständig ist das gerade nicht, das dürfen wir wohl sagen. Eine Frau, die über die Fünfzig hinaus ist und die nur junge Leute empfängt! Ein ehemaliges nichtsnutziges Frauenzimmer, das eine hochstehende Persönlichkeit mit Dambreville, diesem Schwachkopf, verheiratet und den zum Bürochef ernannt hat!«
Hortense und Berthe trabten im Regen hintereinander her und schienen nicht zu hören. Wenn ihre Mutter sich auf diese Weise Luft machte, mit allem rausplatzte und die übertriebene Strenge der guten Erziehung vergaß, mit der sie sie umgab, war es ausgemacht, daß sie taub wurden. Doch als sie sich in die düstere und menschenleere Rue de lʼEchelle wandten, empörte sich Berthe.
»Ach, du meine Güte«, sagte sie. »Jetzt geht mein Absatz ab ... Ich kann nicht mehr weiter!«
Frau Josserand wurde böse.
»Wollt ihr wohl gehen! – Beklage ich mich denn? Kommt es mir denn zu, bei solchem Wetter zu dieser Stunde auf der Straße zu sein? – Wenn ihr wenigstens noch so einen Vater hättet, wie andere Väter sind! Aber nein, der Herr bleibt zu Hause und läßt sichʼs wohl sein. Immer bin ich dran, euch in Gesellschaft zu begleiten, nie würde er die Fron auf sich nehmen. Aber ich sage euch ein für allemal, daß mir das bis obenhin steht. Soll euer Vater euch ausführen, wenn er will; ich will des Teufels sein, wenn ich euch in Zukunft noch mal in Häuser führe, wo man mich ärgert! – Ein Mann, der mich über seine Fähigkeiten getäuscht hat und dem ich eine Annehmlichkeit geradezu herausziehen muß! Ach, Herrgott! So einen würde ich nicht heiraten, wenn ich mich noch mal entscheiden könnte!«
Die jungen Mädchen pflegten nicht mehr zu widersprechen.
Dieses unerschöpfliche Kapitel der zerschlagenen Hoffnungen ihrer Mutter kannten sie. Den Spitzenschal gegen das Gesicht geklatscht, gingen sie mit durchgeweichten Schuhen schnell die Rue Sainte- Anne entlang. Aber an ihrem Haustor in der Rue de Choiseul stand Frau Josserand eine letzte Demütigung bevor: die Kutsche der heimkehrenden Duveyriers bespritzte sie mit Straßendreck.
Obgleich Mutter und Töchter kreuzlahm und wütend waren, hatten sie ihre liebenswürdige Miene wieder aufgesetzt, als sie auf der Treppe an Octave vorbeigehen mußten. Aber nachdem sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, schossen sie wie wild durch die dunkle Wohnung, so daß sie sich an den Möbeln stießen, und stürzten ins Eßzimmer, wo Herr Josserand beim spärlichen Schimmer einer kleinen Lampe schrieb.
»Wieder nichts!« schrie Frau Josserand und sank auf einen Stuhl hin. Und mit roher Gebärde riß sie den Spitzenschal herunter, der ihren Kopf verhüllte, warf sie ihren Pelz auf die Stuhllehne zurück und kam in einem feuerroten, mit schwarzem Atlas besetzten, sehr tief ausgeschnittenen Kleid zum Vorschein, wirkte gewaltig mit ihren Schultern, die noch immer schön waren und den glänzenden Schenkeln einer Stute glichen. Ihr vierschrötiges Gesicht mit den Hängebacken und der zu starken Nase drückte die tragische Wut einer Königin aus, die an sich hält, um nicht in die Worte eines Fischweibs zu verfallen.
»Aha!« machte Herr Josserand lediglich, ganz verdattert über dieses Hereinstürmen. Von Besorgnis erfaßt, zuckte er mit den Lidern. Seine Frau erdrückte ihn schier, wenn sie diesen Riesenbusen zur Schau stellte, den er wie einen Erdrutsch auf seinem Nacken zu spüren glaubte. Er hatte einen alten, zerschlissenen Überrock an, den er zu Hause abtrug, sein Gesicht war von fünfunddreißig Bürojahren gleichsam aufgeweicht und verblichen, und er sah seine Frau einen Augenblick mit den glanzlosen Blicken seiner geschwollenen blauen Augen an. Nachdem er dann die Locken seines angegrauten Haares hinter die Ohren zurückgestrichen hatte, versuchte er sich ganz verlegen und kein Wort herausbringend wieder an seine Arbeit zu machen.
»Aber begreifst du denn nicht?« schmetterte ihm Frau Josserand mit schriller Stimme entgegen. »Ich sage dir, daß wieder mal eine Partie im Eimer ist, und das ist nun die vierte!«
»Ja, ja, ich weiß, die vierte«, murmelte er. »Das ist verdrießlich, recht verdrießlich ...« Und um der schreckenerregenden Nacktheit seiner Frau zu entgehen, wandte er sich mit einem freundlichen Lächeln zu seinen Töchtern um.
Sie legten ebenfalls ihre Spitzenschals und Ballumhänge ab; die ältere war blau gekleidet, die jüngere rosa; und ihre allzu frei geschnittenen, allzu reich besetzten Toiletten waren gleichsam eine Herausforderung. Hortense, die einen gelben Teint hatte und deren Gesicht durch die Nase ihrer Mutter verunstaltet wurde, die ihr den Ausdruck hochnäsiger Eigensinnigkeit verlieh, war gerade dreiundzwanzig Jahre alt geworden und sah aus wie achtundzwanzig, während die zwei Jahre jüngere Berthe eine unversehrte kindliche Anmut bewahrte, denn sie hatte zwar dieselben Züge, aber sie waren bei ihr feiner und blendend weiß, und ihr drohte nur die plumpe Maske, die in der Familie um die Fünfzig herum zum Vorschein kam.
»Wenn du uns bloß alle drei ansehen wolltest!« schrie Frau Josserand. »Und laß um Gottes willen deine Schreiberei sein, die geht mir auf die Nerven!«
»Aber, meine Beste«, sagte er friedfertig, »ich mache doch Streifbänder.«
»Ach ja, deine Streifbänder zu drei Francs das Tausend! – Wenn du hoffst, etwa deine Töchter mit diesen drei Francs unter die Haube zu bringen!«
Der vom spärlichen Schimmer der kleinen Lampe beleuchtete Tisch war in der Tat mit breiten Bogen grauen Papiers übersät, mit bedruckten Streifbändern, die Herr Josserand für einen großen Verlag, der mehrere periodisch erscheinende Zeitschriften herausgab, ausfüllte. Da sein Gehalt als Kassierer keineswegs ausreichte, verbrachte er ganze Nächte mit dieser undankbaren Arbeit, sich verbergend, von Scham erfaßt bei dem Gedanken, man könnte die Geldverlegenheit der Familie entdecken.
»Drei Francs sind drei Francs«, erwiderte er mit seiner schleppenden und müden Stimme. »Diese drei Francs da erlauben euch, zusätzlich Bänder für eure Kleider zu kaufen und euren Gästen beim Dienstagsempfang Kuchen anzubieten.«
Ihm tat dieser Satz sofort leid, denn er fühlte, daß er Frau Josserand mitten ins Herz, in die empfindliche Wunde ihres Stolzes traf. Eine Woge von Blut färbte ihre Schultern purpurrot, sie schien nahe daran, in rächende Worte auszubrechen; dann stammelte sie, mühsam nach Würde ringend, lediglich: »O mein Gott! O mein Gott!« Und sie blickte auf ihre Töchter, sie zerschmetterte ihren Mann herrisch mit einem Zucken ihrer gewaltigen Schultern, als wolle sie sagen: He! Hört ihr, was er sagt? So ein Blödling!
Die Töchter schüttelten den Kopf.
Da der Vater sich geschlagen sah, legte er widerstrebend seine Feder hin und faltete die Zeitung »Le Temps9« auseinander, die er jeden Abend aus dem Büro mitbrachte.
»Schläft Saturnin?« fragte Frau Josserand schroff; sie sprach von ihrem jüngsten Sohn.
»Schon lange«, erwiderte ihr Mann. »Adèle habe ich auch weggeschickt ... Und Léon, habt ihr ihn bei Dambrevilles gesehen?«
»Mein Gott noch mal! Er schläft ja dort!« brachte sie in einem grollerfüllten Schrei hervor, den sie nicht unterdrücken konnte.
Vor Überraschung war der Vater so naiv hinzuzufügen: »Ach, glaubst du?«
Hortense und Berthe waren taub geworden. Über ihre Lippen huschte jedoch ein leises Lächeln, und sie taten so, als beschäftigten sie sich mit ihren Schuhen, die in einem jämmerlichen Zustand waren.
Um abzulenken, suchte Frau Josserand einen anderen Streit mit ihrem Mann: sie bat ihn, er solle seine Zeitung jeden Morgen wieder mitnehmen und sie nicht einen ganzen Tag lang in der Wohnung herumliegen lassen wie zum Beispiel gestern; ausgerechnet eine Nummer, in der etwas über einen abscheulichen Prozeß gestanden habe, was seine Töchter hätten lesen können. Daran erkenne sie genau seinen geringen sittlichen Wert.
»Na, gehen wir schlafen?« fragte Hortense. »Ich, ich habe Hunger.«
»Oh, und ich erst!« sagte Berthe. »Ich komme fast um vor Hunger.«
»Wie! Hunger habt ihr?« schrie Frau Josserand außer sich. »Habt ihr denn dort keine Brioches10 gegessen? Sind das dumme Gänse! Aber man ißt doch, wenn man eingeladen ist! Ich habe jedenfalls gegessen.«
Die Töchter wehrten sich. Sie hätten Hunger, sie seien krank vor Hunger. Und schließlich begleitete die Mutter sie in die Küche, um nachzusehen, ob nicht etwas übriggeblieben war. Sogleich machte sich der Vater verstohlen wieder an seine Streifbänder. Er wußte genau, daß der Luxus des Haushalts ohne seine Streifbänder dahin wäre; und deshalb harrte er trotz der Geringschätzung und der ungerechten Zänkereien eigensinnig bis zum Tagesanbruch bei dieser heimlichen Arbeit aus, glücklich wie ein rechtschaffener Mensch, wenn er sich einbildete, ein Endchen Spitze mehr könnte über eine reiche Partie entscheiden. Da man ja bereits am Essen abknapste, ohne deshalb die Toiletten und die Dienstagsempfänge bestreiten zu können, schickte er sich darein, in Lumpen gekleidet wie ein Märtyrer zu schuften, während Mutter und Töchter mit Blumen im Haar die Salons abklapperten.
»Aber hier stinktʼs ja wie die Pest!« schrie Frau Josserand, als sie in die Küche trat. »Es ist doch nicht zu sagen, daß ich Adèle, diese Schlampe, nicht dazu kriegen kann, daß sie das Fenster halb offen läßt! Sie behauptet, der Raum wäre am Morgen eiskalt.«
Sie war zum Fenster gegangen und hatte es geöffnet, und von dem engen Dienstbotenhof stieg eine eisige Feuchtigkeit empor, ein schaler, muffiger Kellergeruch. Die Kerze, die Berthe angezündet hatte, ließ riesige Schatten nackter Schultern über die gegenüberliegende Wand tanzen.
»Und wie die Küche wieder aussieht!« fuhr Frau Josserand fort, die überall herumschnüffelte, ihre Nase in alle unsauberen Ecken steckte. »Ihren Tisch hat sie seit vierzehn Tagen nicht abgewischt ... Da stehen ja noch Teller von vorgestern. Wahrhaftig, das ist ja ekelhaft! Und ihr Ausguß, seht doch mal! Riecht mir doch mal an ihrem Ausguß!« Ihr Zorn peitschte sich hoch. Mit ihren von Reispuder weiß gefärbten und mit Goldreifen überladenen Armen stieß sie das Geschirr umher; sie schleifte ihr feuerrotes Kleid mitten durch die Flecken, blieb an Küchengeräten hängen, die unter die Tische geworfen worden waren, brachte zwischen den Küchenabfällen ihren mühselig erworbenen Luxus in Gefahr. Schließlich ließ der Anblick eines schartigen Messers sie losplatzen: »Morgen früh schmeiße ich sie raus!«
»Da hast du aber was erreicht«, sagte Hortense ruhig. »Nicht eine behalten wir. Das ist die erste, die ein Vierteljahr geblieben ist ... Sobald sie ein bißchen sauber sind und eine Mehlschwitze machen können, hauen sie ab.«
Frau Josserand kniff die Lippen zusammen. In der Tat konnte es allein die gerade erst aus ihrer Bretagne frisch eingetroffene, dumme und verlauste Adèle in diesem dünkelhaften Elend von Spießbürgern aushalten, die ihre Unwissenheit und Schmutzigkeit ausnutzten, um sie schlecht zu beköstigen. Zwanzigmal schon hatten sie davon gesprochen, sie zu entlassen, wenn sie auf dem Brot einen Kamm fanden oder ein Fleischgericht so abscheulich war, daß sie Leibschneiden bekamen; dann aber fanden sie sich angesichts der Schwierigkeit, sie zu ersetzen, immer wieder damit ab, denn selbst die Diebinnen weigerten sich, bei ihnen in Dienst zu treten, in dieser Bruchbude, wo die Stücken Zucker abgezählt wurden.
»Ich sehe aber auch gar nichts!« murmelte Berthe, die einen Schrank durchwühlte.
Die Bretter zeigten die trübsinnige Leere und den falschen Luxus von Familien, bei denen man die schlechteste Sorte Fleisch kauft, um Blumen auf den Tisch stellen zu können. Dort standen nur völlig kahle Porzellanteller mit Goldrand herum, ein Tischbesen, von dessen Griff die Versilberung abging, Fläschchen, in denen öl und Essig eingetrocknet waren; und nicht eine vergessene Rinde, nicht ein Krümchen von den abgeräumten Speisen, kein Stück Obst, keine Süßigkeit, kein Käserest. Man merkte, daß Adèles nie gestillter Hunger die seltenen von der Herrschaft übriggelassenen Saucenreste so gründlich auswischte, daß sie die Vergoldung von den Schüsseln mit abkratzte.
»Aber sie hat ja das ganze Kaninchen aufgegessen!« schrie Frau Josserand.
»Allerdings«, sagte Hortense, »das Schwanzstück war noch übrig ... Ach nein, hier ist es ja. Es hätte mich auch gewundert, daß sie es gewagt haben sollte ... Wißt ihr, ich nehme es. Es ist zwar kalt, aber da ist halt nichts zu machen!«
Nun schnüffelte auch Berthe vergebens herum. Schließlich belegte sie eine Flasche mit Beschlag, in der ihre Mutter einen alten Topf Eingemachtes mit Wasser verdünnt hatte, um Johannisbeersaft für ihre Abendgesellschaften herzustellen. Sie schenkte sich ein halbes Glas davon ein und sagte:
»Halt, ich habe eine Idee! Da werde ich mir Brot drin eintunken! Wo doch weiter nichts da ist!«
Aber die besorgte Frau Josserand schaute sie streng an.
»Tu dir keinen Zwang an, schenke dir das Glas voll ein, wenn du schon mal dabei bist! Morgen setze ich den Damen und Herren Wasser vor, nicht wahr?«
Zum Glück wurde ihre Strafpredigt durch eine neue Missetat Adèles unterbrochen. Frau Josserand, die immer noch hin und her ging und suchte, was Adèle wohl sonst noch verbrochen haben könnte, gewahrte auf dem Tisch ein Buch; und nun gab es einen nicht mehr zu überbietenden Ausbruch.
»Oh, dieses Dreckstück! Schon wieder hat sie meinen Lamartine11 in die Küche mitgenommen!«
Es war ein Exemplar von »Jocelyn«. Sie nahm es, rieb daran herum, als wolle sie es abtrocknen; und sie sagte immer wieder, zwanzigmal habe sie ihr schon verboten, es überall so herumliegen zu lassen, um ihre Rechnungen darauf zu schreiben.
Berthe und Hortense hatten sich unterdessen das übriggebliebene Stückchen Brot geteilt; mit ihrem Abendbrot in der Hand zogen sie los, sie wollten sich zuerst einmal ausziehen. Die Mutter warf einen letzten Blick auf den eiskalten Herd und kehrte, ihren Lamartine unter dem überquellenden Fleisch ihres Armes fest an sich gepreßt, ins Eßzimmer zurück.
Herr Josserand schrieb weiter. Er hoffte, seine Frau werde sich damit begnügen, ihn mit einem verächtlichen Blick niederzuschmettern, wenn sie durch das Zimmer kam, um schlafen zu gehen. Aber sie ließ sich wiederum ihm gegenüber auf einen Stuhl sinken und starrte ihn an, ohne ein Wort zu sprechen. Er spürte diesen Blick, ihn überkam eine solche Bangigkeit, daß seine Feder das dünne Papier der Streifbänder zerkratzte.
»Du also hast Adèle daran gehindert, eine Cremespeise für morgen abend zu machen?« sagte sie schließlich.
Verdutzt entschloß er sich, den Kopf zu heben.
»Ich, meine Liebe?«