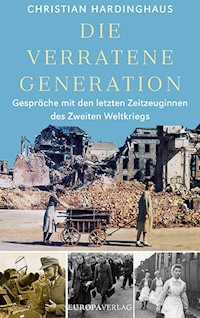Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winter 1941/42, deutsche Stellungen in der Südukraine. Wilhelm Möckel, Unterarzt in der Panzer-Aufklärungs-Abteilung 16, kämpft einen verzweifelten Kampf – er benötigt das Eiserne Kreuz I. Klasse. Es ist die einzige Chance, in den Offiziersrang aufzusteigen und beim Führer ein Gnadengesuch einzureichen, um seine halbjüdische Frau "arisieren" zu lassen. Eine Ausnahmeregelung der Nazis verspricht ihr "deutsches Blut", wenn er zum Helden wird … Als er Annemarie im Sommer 1932 kennenlernt, ist er wie vom Blitz getroffen. Sie ist die Frau, die er heiraten will, und auch für Annemarie ist es die große Liebe. Doch das junge Glück währt nicht lange, schon bald ziehen dunkle Wolken auf, und mit Hitlers Machtübernahme 1933 beginnt die offene Verfolgung von Regimegegnern und "rassischen Minderheiten". Trotz eindringlicher Warnungen seines Zwillingsbruders Karl, der auf der Karriereleiter der NSDAP rasch emporsteigt, heiratet Wilhelm und schwört seiner Frau die Treue. Auch als er seine Kassenzulassung verliert, hält er zu ihr und den beiden Kindern. Da er Deutschland nicht verlassen will, sieht er nur noch einen Ausweg: Er meldet sich freiwillig zum Kriegseinsatz, um durch hervorragende Leistungen für das Deutsche Reich beim Führer eine Arisierung für seine Familie zu erbitten. Und so verschlägt es Wilhelm an die Ostfront, wo im eisigen Winter 1941/42 die russische Gegenoffensive beginnt, während Annemarie und die Kinder zu Hause immer stärker von NSDAP-Leuten bedrängt werden. Wird es Wilhelm rechtzeitig gelingen, sein Ziel zu erreichen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTIAN HARDINGHAUS
EIN HELD DUNKLER ZEIT
ROMAN
1. eBook-Ausgabe 2018
© 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG,Berlin · München · Zürich · WienUmschlaggestaltung und Motiv:Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © Collaboration JS/Trevillion ImagesLayout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: BookwireePub-ISBN: 978-3-95890-199-5ePDF-ISBN: 978-3-95890-200-8
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
ANFANG
Das grüne Biest im Schnee
Die Schreibmaschine
TEIL I
Prolog
In Annemaries Augen
Der beunruhigte Professor
Das blaue Licht
Lippenbekenntnisse
Bittere Pillen
Unter Brüdern
In ewiger Liebe und Treue
Eine Frage der Rasse
Ruiniert
Wilhelm der Soldat
TEIL II
Angst und Leichtsinn
Makkaroni auf der Flucht
Hundsleben
Heimatfront
Stille Nacht
Die Falle
Die zwei Leutnants
Blutige Ernte des Todes
Katerstimmung
Das Russenlazarett
Erlösung
Hinterhalt
Unternehmen Wilhelm
Epilog
ENDE
Abschied
Nachwort
ANFANG
DAS GRÜNE BIEST IM SCHNEE
Lipowka, Sowjetunion, 29. Januar 1942
Nicht mehr die Eiseskälte ist es, sondern Todesangst, die mich in unserem Erdloch erstarren lässt. Eingehüllt in einen grauen Filzmantel, den weißen Kopfschützer über den Stahlhelm gezogen, stehe ich mit den schweren Marschstiefeln im Dreck und schaue aus der Grube.
Mein Herz rast, ich hyperventiliere unter dem bis zur Nasenwurzel hochgezogenen Wollschal. Der Grund für meine Panik ist der Panzer, der etwa 150 Meter entfernt von mir schräg auf einer Anhöhe im Schnee steckt. Ich habe ihn im Gefechtsrabatz zu spät bemerkt. Ein sowjetischer T-34, der seine 76-Millimeter-Kanone direkt auf mich ausrichtet. Wie gebannt starre ich in die Mündung. Warum haben unsere Spähwagen den Panzer nicht aufgespürt? Wie ist er durchgekommen, und wieso zielt er auf unser heute Morgen eilig ausgehobenes Verwundetennest? Wir haben vorschriftsmäßig und deutlich sichtbar die Rotkreuzflagge aufgestellt, die nicht nur den Verwundeten und Sanitätsleuten der eigenen Truppen den Weg weisen, sondern auch den Feind dazu anhalten soll, hier nicht rumzukoffern. Verdammter Krieg!
Ich kann mir nicht erklären, warum ich beim Anblick des grünen Stahlbiestes an Mutter denke und in Gedanken nach einem passenden Gebet suche, statt mich einfach wegzuducken. Ich weiß jetzt, der Panzer wird schießen, Verwundetennest hin oder her.
»Was ist?!« Wilhelm, der unter mir im Graben kniet, verhindert mit seinem Geschrei meine frühzeitige Verabschiedung aus dieser Schlacht. Ich lasse mich nach hinten fallen und lande mit dem Gesäß auf einem Haufen aus gefrorenem Schnee. Als ich den Kopf zur Seite drehe, bemerke ich, wie sich mein Arzt über den jungen Soldaten beugt, der eben blutüberströmt und angstverzerrt in die Grube gesprungen ist. Ich kenne ihn nicht. Vermutlich ist er ganz frisch an der Front, im ersten Gefecht. Aus Angst wird schnell Leichtsinn. Wilhelm pumpt mit den Händen, die in dicken Fingerhandschuhen stecken, gegen den Brustkorb des Gefreiten, dem mit jedem Druck Blut aus dem Mund sprudelt. »Hilf mir hier! Der verreckt uns!«
Ich vergrabe den Kopf in meinen Armbeugen und schreie, so laut ich kann: »Achtung! Panzer!«
»Was?«
Im selben Moment höre ich einen gewaltigen Knall, der den Boden unter mir zum Vibrieren bringt. Als ich die Augen öffne, erkenne ich, dass der Unterschlupf unversehrt ist. Rauchschwaden ziehen über uns hinweg. Der Iwan hat nicht getroffen, weit verfehlt. Jemand schreit, flucht auf Russisch: »Sukiny deti, faschisty!«
Ich weiß, was passiert ist. Unser Flak-Zug ist nachgerückt, und eine Granate muss den Panzer in letzter Sekunde erwischt haben. Ein russischer Soldat hat es aus dem Kettenfahrzeug geschafft und läuft auf uns zu. Während ich aufspringe, löse ich das Halfter des Pistolengurtes, nehme die Luger in die Hand, hebe sie über meinen Helm. Ich entsichere die Waffe und feuere aus dem Loch, ohne etwas anzuvisieren. Aber genau in die Richtung, in der ich den Panzer bemerkt habe und aus der jetzt das Gefluche herüberschallt.
Das Schreien verstummt. Vorsichtig hebe ich den Kopf und schaue aus dem Loch. Der Rotarmist liegt bäuchlings auf halbem Weg zwischen dem in Flammen stehenden T-34 und uns. Sein grüner Mantel brennt. Neben ihm ist der Schnee mit Blut gesprenkelt, dahinter kokeln Kleidungsfetzen.
Ich mache einen breiten Riss in der hinteren Wannenseite des T-34 aus, dessen Räder gebrochen und Ketten zersprengt sind. Durch alle Luken und aus dem Kanonenrohr schlagen glutrote Feuerwolken. Aus dem hochgeklappten, wuchtigen Turmdeckel schießt schwarzer Qualm wie Rohöl aus einem Bohrloch in den kristallklaren Winterhimmel. Dieses todbringende Schauspiel habe ich schon oft beobachtet. Auch den unerträglichen Gestank von brennendem Treibstoff kenne ich nur zu gut.
Ein zweiter Russe hat es fast rausgeschafft. Die Arme voran hängt er mit dem Oberkörper aus dem Turm, der lichterloh brennt. Ein Volltreffer unserer Flak. Die Gefahr scheint gebannt. Ich schaue zu Wilhelm rüber, der aufgestanden ist und sich Schnee vom Mantel klopft. Der Soldat am Boden rührt sich nicht.
»Gut gemacht, Junge«, sagt mein Arzt. »Gibt doch mehr Widerstand als erwartet in Lipowka.«
Ich möchte ihm gestehen, dass ich soeben das erste Mal einen Menschen getötet habe, aber es bleibt keine Zeit dafür. Wir hören von der Spitze des schneebedeckten Hügels, der vor uns emporragt, einen Kameraden rufen. Es ist ein Melder, er stolpert in langem Gummimantel den Abhang hinunter, das Gewehr vor sich, mit den Händen fest umklammert. Zweimal rutscht er aus, bis er an unserem Nest ankommt. Ohne zu grüßen, schreit er, als ob wir noch einen Kilometer entfernt stünden: »Da oben ist Jahrmarkt! Der Russe stürmt von allen Seiten!«
»Beruhigen Sie sich, Kamerad!«, ruft Wilhelm zurück. »Verwundete?«
»Überall. Ich verliere den Überblick. Elende Scheiße. Meine Brille ist gebrochen.« Der Mann fummelt an der dunkel getönten Schutzbrille, die ihm um den Hals hängt. Sein Stahlhelm ist seitlich eingedrückt, das Gesicht rußverschmiert.
»Kommen Sie zur Besinnung!«, rufe ich. »Sie stehen unter Schock.«
Wilhelm nimmt ein halb volles Röhrchen mit Pervitin-Tabletten aus der Manteltasche und reicht sie dem Melder, dessen Hände zitternd danach greifen. »Zur Beruhigung, aber teilen Sie sich die Pillen ein!«
»Danke. Entschuldigung, Herr Doktor. Mich hätte es beinahe erwischt. Granateneinschlag, direkt neben mir. Mache Meldung. Leutnant Jungmann liegt schwer verwundet in einem Gebäude auf der linken Flanke.«
»Von wo wird geschossen?«, fragt Wilhelm.
»Das lässt sich nicht sagen. Von überall. Sie können da über den Kamm laufen!« Der Mann deutet mit der flachen Hand in die Richtung, aus der er gekommen ist. »Hinter der MG-Stellung her. Da kriegen Sie Feuerschutz. Dann zur Straße ins Dorf, dreihundert Meter.« Der Soldat ist immer noch außer Atem und spricht hektisch. »Der Leutnant befindet sich gleich im ersten oder zweiten Haus auf der linken Seite.«
»Ja, was? Im ersten oder im zweiten?« Wilhelm schaut ihn fragend an.
»Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr.« Der Melder schüttelt den Kopf, wirkt verzweifelt.
»Na, wunderbar«, sagt mein Arzt und dreht sich zu mir. »Beeilung, Friedrich, pack zusammen! Wir werden gebraucht.« Er wirft eine Decke über den toten Soldaten, schultert seinen mit braunem Fell bezogenen Sanitätstornister, der mit Verbandsmaterial, Operationsinstrumenten und Medikamenten gefüllt ist, und hängt sich den Trageriemen der schwarzen Maschinenpistole um den Hals. Er zieht sich aus dem Graben. Ich schultere die beiden ledernen Sanitätstaschen, in denen ich Verbandstücher, Abschnürbinden, anatomische Pinzetten und Scheren transportiere. Dann werfe ich einen letzten Blick auf den verstorbenen Kameraden und folge dem Doktor.
Wir stampfen den Hang nach oben, der Schnee knirscht unter den Sohlen, und wir müssen die Spitzen unserer Stiefel fest in das Eis schlagen, um nicht auszurutschen. Dichter Rauch zieht hinter der Kuppe hervor, ich erkenne ein paar Dächer darüber. Es knallt und zischt unaufhörlich. Von weiter fort höre ich das Rattern sowjetischer Waffen, direkt über uns das zackige Hämmern und Rasseln deutscher Maschinengewehre. Das verschossene Pulver brennt in meinen Lungen. Gleichzeitig spüre ich wieder Eiseskälte im Rest meines Körpers aufsteigen. Der Melder läuft hinter uns, kommt kaum nach. Als wir oben ankommen, rennen wir um die MG-Stellung herum, aus der pausenlos geschossen wird, und biegen die unebene Straße ab ins Dorf. Blitze zucken hinter Fenstern. Granatwerfer ploppen auf, brennende Trümmer liegen auf der Straße. Ich höre Schweine quieken. Oder sind es Männer? Ein Schuppen steht in hellen Flammen, ich kann bei dem dicken Qualm vor mir kaum etwas erkennen. Es hat keinen Sinn. Gleich im ersten Gebäude an der Böschung müssen wir Deckung suchen, da der Feind das Feuer unserer MGs erwidert. Kugeln zischen an uns vorbei, schlagen in die Hauswand ein. Rückseitig der Mauer kauert ein rauchender Landser. Zwischen den bis zu den Ohren hochgezogenen Mantelkrägen glotzt er uns mit leeren Augen an.
»Wo liegt Leutnant Jungmann?«, brüllt Wilhelm ihm zu.
»Das Haus rechts über die Straße«, antwortet er, während er Rauch ausbläst.
»Gegenüber?«
»Ja, auf der anderen Seite.«
»So eine Scheiße. Verdammte Falschmeldung.« Wilhelm lehnt sich an den Hauseingang und schnürt den Riemen seines Stahlhelmes zu, auf den ein rotes Kreuz auf weißem Grund gemalt ist. Er legt den Finger an den Abzug der MP 40.
»Ich würde da jetzt nicht raus«, blökt der Soldat.
»Halten Sie den Mund. Sehen Sie den Äskulapstab auf meiner Schulter? Ich bin Arzt.«
»Ja, aber …«
»Schnauze, geben Sie mir einfach Feuerschutz!«, ruft Wilhelm und schaut dann mich an: »Du kommst nach, wenn der Russe Ruhe gibt.«
Mein Arzt rennt, die Pistole abfeuernd, aus dem Haus. Sofort schlagen Kugeln um ihn herum im Boden ein. Es sieht aus, als tanzte er um die aufgewirbelten Schnee- und Dreckfontänen, welche die Geschosse auf der Trasse hinterlassen.
Der Landser schaut mit offenem Mund nach draußen.
»Schießen Sie, verflucht noch mal!«, rufe ich ihm zu, aber der Mann rührt sich nicht. »Sie können doch nicht …« Wilhelms gellender Schrei unterbricht meinen Wutausbruch. Ich zucke zusammen und starre entsetzt auf die Straße. Er ist gestürzt, hält sich den Hals. Getroffen!
»Wilhelm, Wilhelm!«
»Arzt verwundet!«, höre ich jemanden aus dem Nebengebäude krakeelen.
»Halt durch!« Ich muss helfen, renne, den Kopf voran, in gebückter Haltung nach draußen, meine beiden Taschen schleifen über den Boden. Maschinengewehre rattern, Kugeln zischen an mir vorbei. Auch ich tanze um Geschossfontänen. Noch ein paar Meter, bin gleich bei ihm. Er bewegt sich, blutet im Nacken. »Wilhelm! Bist du …«
Die Druckwelle einer gewaltigen Explosion katapultiert mich durch die Luft. Ich krache hart auf dem Asphalt auf, spüre einen dumpfen Schmerz am Rücken und danach in den Knien. Ich kann kaum etwas sehen und huste wie verrückt. Wo ist mein Arzt, wo die Straße? Alles voller Rauch. Von überall dringen Schreie an mein Ohr. Ich versuche aufzustehen, doch merke, dass ich zu keiner Bewegung imstande bin. Gewehrkugeln schlagen neben mir ein. Ein diffuser Schwindel überkommt mich. Ich ringe nach Luft, dann wird mir schwarz vor Augen.
DIE SCHREIBMASCHINE
Was ist passiert? Wie lange war ich weg? Bin ich verletzt? Nein! Aber es ist so kalt, dass ich kaum Luft bekomme. Das kann nicht sein, denke ich, als ich mich umschaue. Ich bin verwirrt. Da stehe ich wieder im Verwundetennest unter der Rotkreuzflagge, das wir vorhin verlassen haben. Es war doch vorhin? Aber ich bin alleine. Wilhelm ist nicht da, auch der tote Kamerad liegt nicht im Schnee. Ein böser Verdacht ereilt mich, verängstigt schaue ich aus der Grube heraus. Panik. Ich bin wie gelähmt, als ich den T-34 ausmache. Ist das ein Déjà-vu? Es ist doch genau die gleiche Szene wie eben. Nein, nicht ganz: Der Panzer bewegt sich mit einem schrillen Quietschen direkt auf mich zu. Ich höre den Dieselmotor brummen, die Kanone dreht in meine Richtung. Wo bleibt die Flak? Sie feuert nicht!
Dann passiert etwas völlig Groteskes: Je näher das Kettenfahrzeug kommt, desto mehr scheint es zu schrumpfen. Was ist da los? Was ist mit mir los? Jetzt wird er schießen. Die Russen, sie kommen. Sie kommen zurück. Um mich zu holen. Sie haben mich doch noch gekriegt, die verdammten Schweinehunde. Nein, das lasse ich nicht zu. Nicht nach alldem!
Mit letzter verbliebener Kraft schmeiße ich die Flasche, die ich in der Hand halte, auf den T-34. Sie verfehlt ihn knapp und landet scheppernd auf dem Pflaster. Glas zerspringt, Malzbier spritzt auf den Weg.
»Ey, Mann, was soll das denn?«, schreit der blonde Junge, der mit einer Fernsteuerung hantiert und etwa zwanzig Meter entfernt auf der Wiese steht.
Was tut ein Kind auf dem Feld? Das ergibt keinen Sinn. Oh, verdammt. Ich hatte einen dieser Flashbacks. Schon wieder. Ich zittere vor Erregung.
»Sie spinnen doch, Opa. Wissen Sie, wie teuer der war? Das könnten Sie gar nicht bezahlen, wenn die Flasche getroffen hätte.«
»Ist ja gut jetzt.« Ich bemerke die Stimme meiner Betreuerin Nina Winter, die sich eben zum Telefonieren zurückgezogen hat.
»Ich habe genau gesehen, dass du Herrn Tönnies geärgert hast«, ruft sie dem Bengel zu. »Nimm dein blödes Spielzeugauto und verschwinde!«
»Auto?«, der Kleine schüttelt mit dem Kopf und zeigt auf mich. »Das ist ein RC Battle Tank T34 von Heng Long. Maßstab 1:16. Der kostet fast zweihundert Euro, und der Typ da wollte den kaputt machen.«
»Der Typ da ist ein empfindlicher alter Mann.« Nina schimpft. »Außerdem wohnt der Typ da hier. Nicht du. Du befindest dich im Garten einer Seniorenresidenz, nicht auf einem Kinderspielplatz.«
Ich kann Fräulein Nina in ihrem blauen Arbeitskleid direkt vor mir erkennen. Mit dem Zeigefinger weist sie auf den Ausgang des Parks, in dem ich seit ein paar Wochen in etwa um diese Zeit gemeinsam mit ihr sitze. Sie ist ein liebes, fürsorgliches Mädchen mit ehrlichen Augen. Insgesamt schon meine dritte Betreuerin. Freiwilliges soziales Jahr. Wundervoll, dass es so etwas gibt. Mir ist der Abschied von meiner letzten Pflegerin nicht leichtgefallen, man lernt sich zu schätzen nach einer Weile intensiver Zweisamkeit. Außer mit meinen Betreuerinnen habe ich mit kaum jemandem mehr gesprochen, seit ich hier bin. Die anderen Heimbewohner halten mich mittlerweile schon für etwas sonderlich. Aber obwohl sie mich betreut, habe ich mit Nina bis jetzt noch kein einziges Wort gewechselt, habe mir gedacht, wenn ich nicht so viel von mir preisgebe, würde die Beziehung nicht zu eng werden und mir dann der Abschied eines Tages nicht so schwerfallen. Mittlerweile halte ich das aber für albern. Ich weiß ja nicht mal, ob ich das Jahr überhaupt noch durchstehe. Außerdem ist mir gerade unwohl, und es imponiert mir, wie meine Neue sich für mich einsetzt.
»Verschwinde oder ich rufe den Typ von der Security!«, ruft Nina dem Jungen zu. »Der hat nicht Maßstab 1:16, sondern 1:1, und ist damit doppelt so groß und viermal so breit wie du.«
Sechzehn. Mir wird schlecht. Ich halte diese Zahl nicht aus. Immer, wenn ich sie höre, schaudert es mich, und meine wenigen noch verbliebenen Körperhaare stellen sich auf.
»Ach, leck mich doch!«, ruft der Bengel, hebt seinen Spielzeugpanzer auf, klemmt die Fernsteuerung daran fest und rennt weg.
Nina dreht sich um und schaut besorgt. »Alles in Ordnung? So kenne ich Sie nicht, Herr Tönnies. Hat Sie das so erschreckt?«
Ich zucke mit den Schultern. Sie setzt sich neben mich auf die Bank und streichelt mir über den Rücken. Sie tut gut, die Wärme, die sie ausstrahlt. Eine Frau beruhigt. Sie beweist, dass ich im Hier und Jetzt und nicht zurück in Russland bin.
»Das tut mir leid«, sagt Nina. »Die Kids wissen genau, dass sie hier nicht rumlungern dürfen. Kein Respekt vor dem Alter. Keine Achtung vor niemandem.«
Ich, sage ich – nein, denke es nur. Doch fast hätte ich gesprochen. Ja, ich habe gemerkt, wie sich meine Lippen geöffnet haben. Mein Brustkorb vibriert. Ich bin wütend, muss mich jetzt jemandem anvertrauen, denn schon lange ist ein fester Entschluss in mir gereift. Und dafür brauche ich Hilfe. Der Spielzeugpanzer und dieser erneute Flashback müssen Initialzündungen gewesen sein.
»Ich«, pruste ich los und räuspere mich sofort. Ich bin erschrocken, aber es klappt. »Deswegen bin ich Sanitäter geworden.« Meine Stimme klingt heiser. »Denn ich kann einfach nicht gut zielen.«
Nina zuckt auf der Bank neben mir zusammen, als ob ich irgendetwas Obszönes von mir gegeben hätte. Aber ich verstehe: Sie kennt mich so nicht.
»Herr Tönnies, Sie sprechen mit mir!«
»Ja.«
»Ich dachte …«
»Eigentlich wollte ich auch meine Ruhe haben und nicht kommunizieren«, krächze ich. »Aber das hier ging zu weit. Es hat mich an etwas Fürchterliches erinnert. Es wird Zeit, dass ich aufhöre zu schweigen.«
Nina schaut mit geöffnetem Mund und großen Augen zu mir herüber. Ihr Streichen über meinem Rücken wird fester. »Herr Tönnies, um Gottes willen, Sie weinen ja!« Sie legt den Arm um meine Schultern. Es beruhigt. Ich weiß weder, ob ich tatsächlich heule, noch, warum. Ich bin genauso wütend wie traurig und erleichtert. So viel Empfinden war lange nicht in mir. Ich lebe!
»Also, daran muss ich mich jetzt erst gewöhnen«, sagt meine Betreuerin nach einer Weile so betont laut, als ob ich von einer Sekunde auf die andere schlechter hören würde. »Ich meine, ich habe mit Ihnen schon so viele Tage hier gesessen und rede doch immer nur mit mir selbst.« Sie lässt mich los.
Ich drehe den Kopf zu ihr. »Hören Sie, Fräulein Nina. Dass ich nicht mit Ihnen sprechen wollte, heißt nicht, dass ich das Geschehen um mich herum nicht genau beobachte. Ich bin nicht verrückt geworden und leide nicht an Alzheimer wie manch anderer in dieser Anstalt.« Ich lächele und ergänze: »Außerdem waren das gar nicht so viele Tage. In meinem Alter zählt man anders.« Meine Stimme klingt weniger eingetrocknet. »Mir ist die Lust auf Kommunikation einfach vergangen.« Ich zögere. »Habe wohl Angst, eine weitere persönliche Beziehung zu jemandem einzugehen. Irgendwann gehen Sie doch alle wieder und lassen mich alleine. Was bringt es also?«
»Ach, Herr Tönnies«, sagt Nina, lächelt und legt den Arm erneut um meine Schulter. »Ich habe doch gerade erst hier angefangen und auch nicht vor, die Stelle zu wechseln. Sie dachten, Sie könnten ein ganzes Jahr schweigen, damit Sie mich nicht kennenlernen brauchen?«
Ich lächele zurück, ich mag die Neue. »Es war albern, Entschuldigung«, antworte ich und schaue ihr in die blauen Augen. »Wissen Sie, ich habe in meinem Leben über so vieles geredet, aber das Wichtigste vergessen. Ich musste eine Zeit lang einfach in Ruhe nachdenken. Aber Ihnen habe ich dennoch immer zugehört. Wollen Sie ein Beispiel?« Nina sagt nichts.
»Hier ist eins: Sie haben in letzter Zeit oft davon gesprochen, dass Sie nach Ihrem sozialen Jahr gerne Germanistik und Geschichte studieren würden. Sie lieben deutsche Literatur, träumen davon, selbst mal ein Buch zu schreiben. Sie überlegen, Ihre Erlebnisse in der Seniorenbetreuung zu verschriftlichen. Und dann ist da noch dieser junge Mann, den Sie so bewundern, weil …«
»Schon okay, schon gut!«, ruft Nina, deren Wangen sich rot gefärbt haben. »Ich bin eine fürchterliche Plaudertasche, nicht wahr?« Sie streicht sich verlegen durch die blonden Haare.
»Ja.« Ich lache, und als Nina es bemerkt, tut sie das auch. »Aber eine liebenswerte Plaudertasche«, sage ich. »Und deswegen werde ich Sie um etwas bitten, was Ihnen bestimmt auch gefallen wird.«
»Wie jetzt? Was soll ich tun?« Sie schaut mich fragend an. Ich will sie nicht zappeln lassen.
»Entschuldigen Sie, das war salopp formuliert. Ich habe ein ähnliches Interesse an Literatur und Geschichte wie Sie, und ich habe etwas erlebt, das ich in einem Buch niederschreiben will – nein, muss!«
Nina schaut mich verdutzt an. »Das hört sich spannend an! Klasse! Aber noch mal: Wie kann ich dabei helfen?« Sie rutscht nervös auf der Bank vor und zurück.
»Sind Sie in der Lage, mir eine Schreibmaschine zu besorgen?«, antworte ich in ruhigem Ton.
»Eine was? Entschuldigung, aber …« Sie lacht dermaßen laut, dass es mich ein wenig ärgert.
»Ich weiß, dass die Schreibmaschinen von heute Laptops oder Notebooks heißen. Es ist nur so, die sind mir zu kompliziert. Ich möchte mein Buch auf einer klassischen, praktischen Maschine verfassen.«
»Verstehe, habe das Wort nur ewig nicht gehört.« Sie überlegt und tippt dann mit dem Zeigefinger auf ihre Schläfe. »Mein Vater besitzt eine.«
»Das ist wunderbar. Sehen Sie sich in der Lage, ihn zu fragen, ob er sie mir wegen des erwähnten Vorhabens leiht?«
»Na klar, das wird er bestimmt«, sagt Nina. »Ich frage ihn, wenn ich zu Hause bin.«
»Sehr gut! Wie schnell könnten Sie den Transport in mein Apartment arrangieren?«
Nina zuckt mit den Achseln. »Von mir aus sofort. Ich mache gleich Feierabend. Wenn es dringend ist, bringe ich sie heute Abend noch vorbei. So schwer ist die nicht. Ist in einem weißen Klappkoffer. Und Papier dürfte auch irgendwo vorhanden sein.«
»Es ist dringend!« Ich drücke mich zu forsch aus, doch mir kribbelt es in den Fingern. In meinem Kopf formen sich unaufhörlich Worte zu Sätzen, Sätze zu Absätzen und die dann zu Seiten. Mich überfällt die Angst, dass ich es mir doch noch anders überlegen könnte.
»Na gut, dann begleite ich Sie jetzt nach oben und werde so in einer Stunde zurückkommen. Aber …?«
»Ja?«
»Werden Sie mich einweihen? Ich erfahre doch, worüber Sie schreiben werden?«
Ich denke einen Moment nach. »Wenn ich das Buch beendet habe. Sie werden die Erste sein, die es lesen darf. Das verspreche ich! Ein paar Wochen werde ich aber brauchen.«
Nina nickt und lächelt, aber mir ist nicht zum Lachen zumute. Ich weiß, dass ich in den nächsten Tagen mit mir kämpfen werde. Aber ich bin fest entschlossen und will dieses letzte Gefecht annehmen.
Nina bemerkt meine Nervosität, hilft mir auf und begleitet mich ins Apartment.
Eine Stunde später kommt meine Betreuerin zurück. In ihren Händen eine weiße Olympia Splendid aus den Siebzigerjahren, ein ansehnliches Stück. Sie hievt mir das Gerät auf den Küchentisch, an dem ich arbeiten möchte. Dann verabschiede ich sie und verspreche ihr, dass ich von nun an immer ein paar Worte mit ihr wechseln werde, wenn sie mir die Einkäufe bringt und sich um das Zimmer kümmert. Wenn auch noch nicht über das, was ich verfassen werde. Da muss sie sich gedulden. Ich benötige absolute Konzentration.
Lange brauche ich nicht, um mich mit der Olympia zurechtzufinden. Ich hatte früher eine ähnliche Maschine und immer viel damit geschrieben. Welch ein Glück, dass meine Handgelenke von Arthritis verschont geblieben sind. Ein wenig erstaunt bemerke ich, dass meine Finger wie automatisch die richtigen Tasten finden. Natürlich bin ich nicht mehr ganz so flink, aber es reicht. Ich werde mir zwischendurch Pausen gönnen. Wie meine Feinmotorik funktioniert auch die Maschine ausgezeichnet.
Ein Schauer zieht mir über den Rücken. Kopf und Finger sind bereit, nur die Knie schlottern noch. Ich setze mir die Brille auf, wickele meine Beine in eine Baumwolldecke ein. Nun will ich die letzte entscheidende Aufgabe, die ich in dieser Welt zu erfüllen habe, angehen.
TEIL I
PROLOG
Mein Name ist Friedrich Tönnies. Ich wurde 1922 geboren und bin heute 95 Jahre alt. Ich befinde mich in vollem Besitz meiner geistigen Kräfte.
Von 1940 bis 1945 diente ich als Sanitätssoldat in der Wehrmacht. Was ich hier aufschreiben werde, möchte ich eine Heldengeschichte nennen. Es handelt sich um eine unglaubliche Begebenheit, eine nervenaufreibende Liebesgeschichte und eine Offenlegung über Krieg, Sterben, Freundschaft und Hoffnung.
Klingt das spannend? Ich hoffe es. Denn was Sie lesen werden, ist nicht nur genauso passiert, wie ich es niederschreibe, sondern historisch außerordentlich bedeutungsvoll. Ich fühle mich dazu verpflichtet, der Nachwelt all dies nicht länger vorzuenthalten.
Kennen Sie einen Soldaten? Haben Sie gedient? Dann wissen Sie, dass Soldaten im Ernstfall in eine große Schlacht ziehen, um mit dem Gewehr in der Hand ihr Land zu verteidigen, für das sie bereit sind zu töten und zu sterben. Die einen bezeichnen das als dumm, die anderen als ehrenhaft. Ich konnte mich in der Hinsicht nie festlegen.
Sicherlich aber ist Ihnen ein Arzt bekannt. Wenn nicht, rate ich Ihnen, sich gelegentlich einen zu suchen. Mediziner sind Menschen, die im Ernstfall Leben retten. Im Grunde genommen ein Widerspruch, dass es auch solche gibt, die gleichzeitig als Arzt und Soldat Dienst verrichten, die also Leben schützen und nehmen. Ist das dumm oder ehrenhaft oder beides zugleich?
Als ich 1940 in die Armee eintrat, hätte ich mir jedenfalls Schöneres vorstellen können. Ich hatte die Mittelschule und danach den Reichsarbeitsdienst abgeschlossen und meine Eltern gerade überredet, noch das weiterführende Gymnasium besuchen zu dürfen. Ich wollte Medizin studieren und Arzt werden. Doch Adolf Hitler hatte es spätestens seit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 geschafft, meine Pläne und die vieler Zeitgenossen zu durchkreuzen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wusste ich, dass ich Abitur und Studium würde verlegen müssen. Ich dachte dabei an ein paar Monate. An einen langen Krieg haben wir damals alle nicht geglaubt. Als ich gemustert wurde, hatte die Wehrmacht gerade Frankreich eingenommen. Die Deutschen jubelten, der restlichen Welt schien es egal zu sein. Die Engländer jagten uns keine Angst ein. Ich nahm nicht an, überhaupt noch aufs Schlachtfeld ziehen zu müssen. Wie falsch ich mit der Einschätzung lag!
Doch wie hätte ich es besser wissen können?
Da ich schon damals ein ausgesprochener Pragmatiker war, entschied ich mich dafür, die Pflichtzeit beim Militär zu nutzen, um mich schon ein wenig mit den Grundlagen der Medizin vertraut zu machen. Es lag nahe, dass ich nach der Grundausbildung einen Abschluss an einer Sanitätsschule absolvierte. Hätte mir zu diesem Zeitpunkt jemand erklärt, dass am Ende sechzehn Jahre vergehen sollten, bis ich das Abitur würde angehen können, ich hätte ihn als meschugge bezeichnet.
Die Sechszehn. Eine Zahl, die mich das ganze Leben verfolgt und quält. Wenn ich sie höre, überkommt mich Schüttelfrost. Auch jetzt schlottern meine Knie. Würde ich einen Mediziner konsultieren, er würde Parkinson diagnostizieren. Aber das tue ich nicht. Ich bin selbst Arzt, wenn auch lange nicht mehr praktizierend. Und ich weiß genau, warum ich zittere. Dass es seit letztem Jahr heftiger geworden ist, wundert mich nicht. 2016 war die Zahl Sechzehn allgegenwärtig. Wenn ich die Zeitung aufgeschlagen habe, überlas ich das Datum mit Bedacht. Beim Radiohören oder Fernsehen klappte das nicht. Ob es Zufall war, dass ich mich ausgerechnet im vergangenen Jahr dazu entschlossen habe, die Geschichte meines Lebens aufzuschreiben? Ich weiß es nicht. Es fällt schwer, nach all dem an Vorherbestimmungen zu denken. Aber es hat noch ein Jahr gedauert, bis ich nun endlich bereit bin, alles aus dieser dunklen Zeit zu erzählen. Der Junge mit dem Spielzeugpanzer war vielleicht das auslösende Moment. Ich sollte ihm dankbar sein.
Der Krieg kam, ich musste hin. Mir blieb wie allen wehrfähigen Männern keine Wahl. Die Deutschen schlugen Polen, die Beneluxstaaten und Frankreich, besetzten Norwegen und Dänemark. Doch Hitler wollte mehr. Etwas, das wir uns bis zum Tag des Einmarsches in die Sowjetunion am 22. Juni 1941 nicht hatten vorstellen können: einen Krieg mit dem mächtigen Russland wagen. Hitler wollte für sein Volk Lebensraum im Osten. Warum, das habe ich bis heute nicht verstanden. Für uns Soldaten hieß es damals, wir müssten unsere Heimat vor der angriffsbereiten Sowjetunion schützen und hätten keine Wahl. Und so bin ich mitmarschiert in diesen tödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Und ich kann vieles bezeugen. Das Grauen, all die menschlichen Abgründe von Anfang bis zum bitteren Ende habe ich durchlebt und durchlitten.
Noch während der Ausbildung haben andere Rekruten uns als Pillendreher oder Drückeberger verspottet. Wir wären keine wahren Soldaten. Heute lache ich darüber. Wie schnell sich die Meinung eben dieser Spötter änderte, wenn zum ersten Mal eine russische Granate neben ihnen einschlug. »Sani, Hilfe!«, »Sani, hierher!«, »Sani, mein Bein!« Tausendfach schrien sie nach uns, unter höllischen Schmerzen, im Anblick des nahenden Todes. Auf dem Schlachtfeld mauserten wir Sanitäter uns zusammen mit Köchen und Essensträgern bald zu den gefragtesten Männern. Einigen Kameraden konnte ich das Leben retten und sie zur Notversorgung rechtzeitig in ein Verwundetennest schleppen. Für andere war ich nur noch imstande, ein kurzes Gebet zu sprechen, einen Brief an die Angehörigen entgegenzunehmen oder ihnen »Es wird alles gut« zuzuhauchen.
An schlimmen Tagen habe ich mehr Tote als Verletzte gesehen. Es lagen dann mehr Erkennungsmarken in meiner Tasche als Mullbinden. Natürlich hatte ich unfassbares Glück. Allen Soldaten, die den Krieg überlebt haben, erging es so. Als Sanitäter besaß man aber noch mehr davon, wenn man es denn schaffte, aus Russland rauszukommen. Denn wir standen nicht weniger in der Schusslinie als die Schützen, sondern noch tiefer drin. Schließlich sind wir aus den Gräben gesprungen, um zu den Verwundeten zu eilen. Wie gering doch der Respekt des Feindes im Angriffsfall für eine Rotkreuzbinde am Uniformärmel ausfällt! Es kam vor, dass während eines schweren Häuserkampfes neben einem erschossenen Schützen bereits ein toter Sanitäter lag, der ihn hatte bergen wollen. Daneben ein verletzter Sani, der seinem Vorgänger zu Hilfe kommen wollte und den ich dann rausziehen musste.
Ich lief selbst Gefahr, jederzeit getötet zu werden. Aber nachgedacht darüber habe ich damals nicht. Erstaunlich! Ich wurde angeschossen und schwer verwundet und auch ich habe getötet. Mit meiner Pistole musste ich die angreifenden Russen doch vom Verbandsplatz fernhalten oder nicht? Ich war gezwungen, sie zu töten, wenn Rotarmisten mit einem Gewehrkolben auf den am Boden liegenden Landser einschlugen. Ich feuerte mein Gewehr ab, wenn ich ins Visier genommen wurde. Die Kameraden brauchten mich. Ich besaß Verantwortung und nur dank der konnte ich überleben. Wer sich während eines Gefechtes fürchtet, hat meist schon verloren, und zwar sein Leben. Angst ist ein schlechter Ratgeber und Begleiter im Krieg. Und wenn ich in späteren Friedenszeiten gefragt worden bin, ob ich mich denn nicht gefürchtet habe an der Ostfront, so habe ich immer geantwortet: »Nein, denn ich trug Verantwortung.«
Und doch bleibt man im Krieg nicht ohne Emotion. Im Gegenteil. Es sind nur andere Gefühle, die den Soldaten befallen. Möglich, dass die Erklärung für überschwängliche Freude nach der gelungenen Einnahme eines Dorfes oder die tiefe Trauer, wenn ein treuer Kamerad stirbt, die eigene, unterdrückte Angst ist.
Die unmittelbare Furcht kann aber überwunden werden. Im Grunde ähnelt ein Gefecht der sportlichen Betätigung. Der mit Adrenalin vollgepumpte Körper funktioniert wie automatisiert, wenn man gut trainiert ist. Und das waren wir zweifellos in der Wehrmacht. Doch wenn keine russische Artillerie feuerte, wenn Ratas – so haben wir die feindlichen Kampfflieger Polikarpow I-16 genannt – am Himmel nicht kreuzten, dann waren es nur noch die Köpfe, die ratterten. Wer dann nicht trank, Briefe schrieb, Karten oder Fußball spielte, der versank schnell in eine nicht enden wollende Grübelei. Da konnte man machen, was man wollte. Die war nicht so leicht zu stoppen wie ein ungepanzertes Fahrzeug mit einem Maschinengewehr. Jedenfalls so lange nicht, bis weitergekämpft wurde. An ruhigen Tagen dachte man nach über die Heimat, über den Sinn des Krieges. Über die, die gegangen waren. Darüber, ob man es selbst schaffen würde. Und überhaupt, wie lange das alles noch weitergehen sollte. Und dieses ewige Warum, das einem im Kopf herumschwirrte. Auch kreisten die Gedanken ständig um den Feind. Wann greift er an? Wann gibt er auf? Trauert auch er um seine gefallenen Kameraden? Alles drehte sich um den Tod in den ruhigen Frontmomenten.
Ich kann nicht sagen, wie viele Tote ich gesehen habe. Hunderte? Eher Tausende! Deutsche, Russen, Ukrainer. Alte, Junge. Hauptmänner, Gefreite. Draufgänger, Feiglinge. Erschossen, erfroren, verhungert, an Krankheiten kläglich verreckt. Auch Frauen und Kinder. Das war besonders bedrückend und ließ einen nie mehr los. Ganz bestimmt nicht. Natürlich, der Verlust der eigenen Kameraden, zumindest derer, die man mochte – es gab auch genug Arschlöcher –, ging einem nahe. Denn man kannte sich, hatte über Monate oder Wochen zusammengesessen und gegessen, das Quartier geteilt, sich gegenseitig beschützt, gemeinsam gekämpft, sich die Wunden gepflegt. Wir hatten uns motiviert, uns Geschichten aus der Heimat erzählt, waren Freunde geworden. Wir haben dem anderen zugehört, wenn er verletzt war oder am Boden lag – sprichwörtlich oder nicht – physisch oder psychisch. Im Schützengraben, im Panzerspähwagen, eingegraben im Eis. Nachts, wenn die Sterne über Russland schienen. Dieselben, die über der fernen Heimat leuchteten und doch den Angehörigen zu Hause ein kaum weniger schreckliches Bild ihrer zerbombten Umgebung zeigten. Was wir in dem Ausmaß, in dem sich die Zerstörung später offenbarte, aber damals ebenso wenig zu ahnen vermochten wie unsere Liebsten, war das, was wir durchmachen mussten. Ein Werk der Propaganda, und die Nazis bewiesen sich als wahre Meister dieser feigen Disziplin. Sie ließen unsere Familien in den Wochenschauen, die in den Heimatkinos liefen, glauben, wir überrollten unsere Feinde. Uns war es bei Strafe verboten, in Briefen nach Hause von Niederlagen zu berichten. In den Zeitungen, die wir aus dem Reich erhielten, lasen wir, dass man die Bomber über dem deutschen Himmel abschieße wie Fliegen.
Ich diente als Sanitätssoldat in der Panzer-Aufklärungs-Abteilung 16 der 16. Panzer-Division. Darum verängstigt mich die 16 so. Ich bin Teil der Division gewesen, seit sie die Grenzen zur Sowjetunion überschritten hat und auch als sie in Stalingrad eingeschlossen und vorzeitig aufgelöst wurde. Ich war dabei, als sie neu aufgestellt worden ist und in den letzten Wochen vor der Kapitulation in Berlin kämpfte. Die gesamte Zeit des Deutsch-Sowjetischen-Krieges also, in dessen Zuge über dreißig Millionen Menschen den Tod fanden. Die Hälfte aller Opfer, die der komplette Zweite Weltkrieg eingefordert hat. Der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte. Erst Anfang Mai 1945 wurde ich Gefangener der Sowjetunion und blieb es bis 1956. Sechzehn Jahre Kampf und Gefangenschaft. Verfluchte Zahl.
Aber, obwohl ich Teil der Geschichte bin, will ich in diesem Buch nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist mir besonders wichtig. Ich werde vielmehr von einem Mann berichten, der ebenfalls der Panzer-Aufklärungs-Abteilung 16 angehörte. Jener Mann hieß Wilhelm Möckel, und der war ein Held. Zumindest sehe ich ihn als einen solchen, auch wenn er Teil der Wehrmacht war und kein Widerstandskämpfer. Ich möchte behaupten, er war ein Held dunkler Zeit. Und wer war denn schon im Widerstand? Ich habe während meiner Kriegseinsätze nie jemanden kennengelernt. Sophie Scholl? Oskar Schindler? Graf von Stauffenberg? Von all denen habe ich erst nach dem Krieg erfahren, das bekam man an der Front nicht mit. Doch im Kugelhagel, da wurde ich Zeuge von Heldentaten. Ich habe Menschen gesehen, die ihr eigenes Leben riskiert oder im schlimmsten und nicht seltenen Fall verloren haben, um viele andere Leben zu retten. Ist das nicht heldenhaft?
Von den meisten dieser Taten hat man nie gehört, denn die Frontsoldaten, die man hätte als Helden bezeichnen können, haben darüber geschwiegen bis zu ihrem Tode. Manche, die noch leben – es sind wenige – schweigen noch immer. Zu schnell wollten die Deutschen nach dem Krieg den Schrecken vergessen, den Hitler über Deutschland und auf die Welt geworfen hatte. Als zu grausam stellten sich die Verbrechen an den europäischen Juden, Sinti und Roma und anderen Verfolgten heraus, als dass die Kinder und Enkel uns noch fragen mochten, wie es uns Deutschen an der Front ergangen ist.
Sie haben vergessen, uns zu fragen, was das Wesen des Krieges ausmacht. Dabei ist es so wichtig, das zu begreifen. Gerade heute. Wenn ich die Nachrichten anstelle, möchte ich kaum wahrhaben, wo überall und ständig neue militärische Konflikte ausbrechen. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Nicht genug, fürchte ich!
Ich habe nie Kinder bekommen, somit auch keine Enkel, die mich hätten befragen können. Jetzt lebe ich alleine. Doch früher, wenn sich ein neugieriger Patient oder ein jüngerer Bekannter für meine Zeit interessierte, dann lautete die erste Frage stets: »Und, haben Sie das gewusst mit den Juden?«
Die Antwort, die ich darauf gab, bestand dann immer aus einem schlichten Nein. Dann hakte niemand weiter nach. Ein für alle zu schamhaftes und peinliches Thema. Es reichte ihnen zu wissen, dass ich nicht zu den Bösen zählte. Das Nein entspricht der Wahrheit, sonst wäre ich nicht imstande, dies hier zu verfassen. Dass ich vom Krieg jedoch nie erzählt habe, tut mir heute unfassbar leid, denn ich merke, dass die Jugend von heute zu wenig weiß. Die Gefahr, neue Kriege zu führen, ist groß. Ich gehörte zeit meines Lebens einer schweigenden Generation an. Als Entschuldigungsschreiben biete ich dieses Buch, in dem ich alles offenlegen werde.
Wir schreiben das Jahr 2017, und ich kann nicht davon ausgehen, dass ich hundert werde, aus dem Fenster springe und noch tolle Abenteuer erlebe. Die Zeit ist gekommen, Zeugnis abzulegen. Ich fühle mich verpflichtet, denn ich kannte einen Helden.
Doktor Wilhelm Möckel diente als Truppenarzt in meiner Kompanie. Er zog als renommierter, rein arischer Arzt mit 35 Jahren freiwillig in den Krieg. Obwohl er das aufgrund des Alters und der Fachausbildung nicht gemusst hätte. Wäre da nicht seine Familie gewesen. Seine Frau Annemarie und die Kinder Max und Martin. Wegen dieser drei geliebten Menschen hatte er keine andere Wahl, als so zu handeln. Von dieser Geschichte handelt mein Buch.
Als Wilhelm Annemarie 1932 kennenlernte, war ich gerade zehn Jahre alt, und es sollte noch acht Jahre dauern, bis ich das erste Mal von ihr hörte. Ich lernte Wilhelm ein paar Wochen, nachdem wir in Russland einmarschiert waren, kennen. Wir gehörten damals noch beide der Sanitätskompanie 16 an. Ich bin heute der letzte noch Lebende dieser Kompanie. Kein Sanitätsoffizier, kein Hilfsarzt, kein Apotheker, der den Krieg überlebt hat, weilt mehr unter uns. Kein Fahrer, kein Krankenträger, kein Schreiber, kein Schneider. Nicht ein einziger Sanitätssoldat. Außer mir, einem anfangs einfachen Burschen.
Eine Sanitätskompanie kann man als eine eigens geschaffene Truppe bezeichnen, die sich um alle Bereiche der Verwundetenversorgung der zugeteilten Division kümmert. Durchschnittlich etwa zweihundert Mann stark. Bevor sich die Division in ein Gefecht wagte, errichteten wir fünf bis sechs Kilometer hinter der Kampflinie einen Hauptverbandsplatz. Wenn wir kein Gebäude dafür fanden, bauten wir Zelte. Die Ausrüstung, die uns zur Verfügung stand, darf man als ausgezeichnet beschreiben. Wir verfügten über alle Instrumente, um so gut wie jede Operation durchführen zu können. Bei uns arbeiteten bestens geschulte Chirurgen und Anästhesisten und jede Menge Pflegepersonal. Wer nicht starb auf dem Hauptverbandsplatz, sondern Aussicht auf Genesung hatte, wurde weiter ins Kriegslazarett und danach bestenfalls in ein Reservelazarett in die Heimat verlegt. Neue Verletzte rückten ständig nach. Sie wurden mit Sankas – so nannten wir die Krankenwagen – vom Truppenverbandsplatz abtransportiert. Vier Liegen konnte man in einem solchen Wagen unterbringen, und sie waren immer besetzt. Beinschüsse, Bauchschüsse, Lungenschüsse. Oft kamen die Kameraden tot an.
Auch den Truppenverbandsplatz, der direkt vor der Kampflinie lag, führte die Sanitätskompanie. Hier machten Ärzte die Verwundeten transportfähig und versorgten sie mit starken Schmerzmitteln. Auch an diesem blutigen Ort herrschte reges Kommen und Gehen. Oft brachten die Krankenträger im Minutentakt verletzte Kameraden, die sie aus den Verwundetennestern gezogen hatten. Solche Stätten lagen unmittelbar im Kampfgeschehen. Hier leisteten die Sanitätsdienstgrade und Sanitätssoldaten der kämpfenden Truppe Erstversorgung, meist ging es um reine Blutstillung, um das Abklemmen von Arterien, Anlegen von Druckverbänden, Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Truppensanitäter orientierten sich an den Hilfeschreien der Kameraden und zogen sie direkt aus der Schusslinie. Eine der gefährlichsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann in einem Gefecht. Und genau das sollte meine Tätigkeit für eine lange Kriegsetappe werden. Und seine.
Wilhelm ließ sich im September 1941 von der Sanitätskompanie 16 zur Panzer-Aufklärungs-Abteilung 16 versetzen, also vom geschützten Hauptverbandsplatz mitten aufs Schlachtfeld. Kein Mensch kann das verstehen, der die Geschichte um seine Familie nicht kennt. Ich habe nie von einem anderen Arzt gehört, der so etwas Verrücktes freiwillig getan hätte.
Ich hatte zuvor schon einige Zeit mit Wilhelm zu schaffen gehabt, hatte ihn bei Operationen beobachten können, ihm als Krankenträger die schreienden Patienten auf den OP-Tisch gehievt. Ich war mir darüber von Anfang an bewusst, was für ein verdammt guter Arzt da vor mir medizinische Eingriffe vornahm. Manchmal bin ich kurz stehen geblieben und habe mir angeschaut, wie er arbeitete. Ich staunte, wie flink er mit dem Skalpell umging, mit welch geschultem Auge und welcher Präzision er immer genau wusste, wo er ansetzen musste. Wie ruhig und fachmännisch er vorging. Er bemerkte meine Neugier, aber auch das unermüdliche Umsorgen der Verwundeten, das ich zu leisten vermochte.
Eines Tages kam er nach dem Essen zu mir herüber und bot mir eine Zigarette an. Ob das Zufall war? Ich glaube es heute nicht. Er erzählte mir von seinem Burschen, über den er heftig schimpfte. Wilhelm fungierte als Unterarzt und somit als Sanitätsoffiziersanwärter. Damit stand ihm schon ein sogenannter Offiziersbursche zu. Diesen Dienerjob verrichteten in der Regel untere Dienstgrade, die gerade sonst nirgendwo gebraucht wurden. Die Aufgaben bestanden darin, ihren Herrn herumzufahren, für ihn zu kochen, ihm die Feldpost zu bringen, ihn einfach in allem zu unterstützen, was ihm das Soldatenleben abseits des Schlachtfeldes angenehmer gestaltete.
»Der Jakob, der für mich arbeitet, macht einen guten Haushälter, ist mir aber als Arzt ein denkbar schlechter Gehilfe«, sagte Wilhelm damals zu mir. Er meinte, einem Arzt müsse unbedingt ein Bursche zugeteilt werden, der auch etwas von Medizin verstand. Jakob sei aber zu blöd, eine Salbe gegen Pilzinfektionen von einer Aspirin-Tablette zu unterscheiden. »So einen kann ich nicht gebrauchen, schließlich bin ich als Arzt immer im Dienst. Da benötige ich einen Burschen, der medizinisch begabt ist und mitdenkt. Gerade jetzt, wo ich mich versetzen lasse, kann ich mit Jakob nichts mehr anfangen. Nicht so nah an der Kampflinie.«
Wilhelm berichtete mir von seinem freiwilligen und stattgegebenen Gesuch, sich von der Sanitätskompanie zu den Aufklärern versetzen zu lassen. Und er fragte mich, ob ich einen geeigneten Burschen kennen würde, der ihn dahin begleiten könnte. Ich schaute ihn lange an, und er lächelte mir zu. Verstand ich das richtig? Wollte er mich dafür anwerben? Er bemerkte mein Erstaunen und sagte: »Ich käme selbstverständlich niemals auf die Idee, einen ausgebildeten Sanitätsgefreiten zu fragen, ob er so etwas tun würde. Es sei denn, er bäte mich von sich aus darum.«
Ich wusste nicht so recht, was ich entgegnen sollte, und blieb verdutzt stumm.
»Derjenige dürfte natürlich höher qualifizierte Aufgaben verrichten. Ich suche eine Mischung aus Sanitätssoldat, der mir auf dem Feld assistiert, und einem Burschen, der ein paar Fahrertätigkeiten und Alltägliches erledigt. Ohne dass ich ihm dreimal erklären muss, was der Unterschied zwischen einem Attestblock und einem Verwundetenzettel ist.« Wilhelm musterte mich und lächelte wieder. »Diese besonders qualifizierte Ordonnanz würde ich natürlich auch nie meine Stiefel putzen lassen, das ist Ehrensache.«
Ich verstand, nickte und sagte: »Herr Unterarzt, ich kenne einen solchen Soldaten. Er steht vor Ihnen und bittet Sie darum, Ihr besonderer Bursche im Felde und in der Freizeit sein zu dürfen.«
»Gut.« Er klopfte mir auf die Schulter. »Ich glaube dir, dass du das kannst. Ich werde zum Divisionsarzt Doktor Ahrens gehen und um Erlaubnis bitten. Er wird garantiert nichts dagegen haben. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht besonders. Innerlich hat er sich ins Fäustchen gelacht, als ich freiwillig um Frontversetzung gebeten habe. Ahrens ist froh, wenn ich weg bin. Er glaubt sicher, ich falle schnell. Also hat er mir versichert, ich habe seine uneingeschränkte Unterstützung für den Fronteinsatz. Das sollte dann wohl einen Burschen einschließen! Wenn es klappt, heißt das dann für dich: Ab nächste Woche Sachen packen. Wir ziehen zur kämpfenden Truppe.«
Ich hatte in jenem bewegenden Moment nicht darüber nachgedacht, dass ich mich mit der getroffenen Entscheidung freiwillig in Lebensgefahr begeben würde. Ich fühlte mich so geehrt, witterte ein Abenteuer. Und eine Fliegerbombe konnte mich schließlich auch auf dem Hauptverbandsplatz erledigen. Ich wollte lernen und assistieren – ihm. Mein Wunsch, selbst Arzt zu werden, hatte sich in den ersten Monaten des Krieges immer mehr gefestigt, und an manchen Tagen wähnte ich mich bereits als einer. Doch das sagte ich lieber nicht laut.
In der Aufklärungs-Abteilung herrschte ein anderer Ton, das merkte ich schnell. Soldatisch rau und dennoch freundlich. Ich lebte mich langsam, aber gut ein. Doch davon will ich später schreiben.
Auf jeden Fall lernte ich Wilhelm in jener Zeit nach und nach persönlich immer besser kennen und schätzen. Ich wuselte ja ständig um ihn herum. Mit der Zeit sprach er immer öfter über private Dinge mit mir. So habe ich erfahren, warum er freiwillig die Gefahr suchte. Die Geschichte dahinter, Wilhelms tragisches Dilemma, ist der Grund für dieses Buch.
Ich werde den Tag niemals vergessen, an dem mir Wilhelm das erste Mal von Annemarie erzählte. Es ereignete sich am 19. Oktober 1941, als wir nach harten und verlustreichen Kämpfen in Grekowo-Balka kampierten. Ein kleines Dorf in der Südukraine, abseits von Wegen und Schienen. Ein paar Dutzend Lehmhütten, eine Kirche und einen Marktplatz gab es dort. Am Nachmittag jenes Tages, der Feind hatte sich weit zurückgezogen, wir die Wäsche und uns selbst gewaschen, gingen Wilhelm und ich an einem nahen Flüsschen spazieren und sichteten dort ein paar Kolchos-Gänse. Wir bekamen mächtig Hunger, verabscheuten es allerdings beide, Tiere zu schießen. Da aber ich sein Bursche war, übernahm ich die unangenehme Tätigkeit. Er reichte mir seine Maschinenpistole, ich suchte die zwei fettesten Gänse aus und erlegte sie. Ich hätte nie auf Hunde oder Katzen geschossen. Bei Vögeln jedoch konnte ich mich überwinden. Eine Gans sollte für uns und die zwei Kameraden sein, mit denen wir Quartier teilten, die andere schenkten wir unseren Gastgebern – eine ukrainische Familie, deren Bauernhaus wir bewohnten. Wir schälten gemeinsam Kartoffeln und schnitten Zwiebeln und Paprika klein. Die fremden Frauen legten sich richtig ins Zeug. Was man nicht alles aus einer Gans rausholen kann. Als Vorspeise gab es Gänseleber, dann Gänsesuppe mit Einlage, dazu Brot mit Gänsefett und schließlich einen schmackhaften Gänsebraten. Ich glaube, es sollte für die nächsten sechzehn Jahre der letzte sein. Später nahmen Wilhelm und ich uns eine Flasche erbeuteten russischen Wodka mit aufs Zimmer, setzten uns an den kleinen, maroden Holztisch, zündeten eine Kerze an, tranken und rauchten.
Ich fragte meinen Arzt, warum er denn keinen Heimaturlaub einreichen wolle, wie es sonst jeder in der Kompanie tat. Ob er denn nicht Frau und Kinder habe, die er vermisse. Er antwortete. »Doch, und eben weil ich meine Familie so sehr liebe, verzichte ich auf Urlaub.«
Wir redeten die ganze Nacht, und als die ersten Sonnenstrahlen in unser Zimmer drangen, verstand ich, was er damit gemeint hatte. Bei seinen Erzählungen wollten mir oft die Tränen kommen. Mit Mühe nur hielt ich sie zurück. Fortan aber verstand ich Wilhelm und sein scheinbar aberwitziges Streben danach, um jeden Preis ein Held werden zu wollen.
IN ANNEMARIES AUGEN
»Psst! Annemie, Beeilung!« Luise lehnte am weit geöffneten Fenster ihres Jugendzimmers in der elterlichen Villa, versteckte die Hälfte des Gesichtes hinter dem eng an der Hausfassade wachsenden, moosgrünen Efeu und lugte hinunter auf die Straße. Mit der linken Hand winkte sie ihren Freundinnen Annemarie und Sophie zu, die im einfallenden Sonnenlicht auf den elfenbeinfarbenen Ledersesseln saßen. Die Vögel draußen zwitscherten abwechslungsreiche Konzerte, und der Geruch von frischen Blumen durchströmte das Zimmer an diesem angenehmen, nicht zu heißen Junitag.
»Los nun, da kommt er«, zischte Luise.
Annemaries Oberkörper schnellte nach vorne. »Der Arzt, den ich unbedingt sehen muss?«, fragte sie und stellte ihr kristallenes Weinglas auf der Glasplatte des runden Beistelltisches ab. Ein edler halbtrockener französischer Rotwein aus dem Keller von Luises Vater. Für Annemarie war es das erste Mal, dass sie mitten am Tag Alkohol trank. Aber ihre beste Freundin hatte unbedingt auf Annemaries Semesterferien anstoßen wollen. Da Luises Eltern nicht zu Hause waren und sie sich alle erwachsen genug fühlten, hatte sie die Flasche schließlich stibitzt und nun tranken sie. Annemarie schaute Sophie an, die ihre Zigarette im kleinen Aschenbecher aus Marmor ausdrückte und ihr zuflüsterte: »Na, wer denn sonst? Komm, wir schauen uns den Traumdoktor an!«
Annemarie stand auf, zog die Falten ihres rosa Sommerkleides glatt und schlich Sophie in leicht gebückter Haltung nach. Sie stellten sich hinter ihre Freundin und schauten hinunter auf den Gehweg der gegenüberliegenden Seite.
»Ist er nicht unglaublich niedlich, genau dein Kaliber, oder?«, fragte Luise und zog Annemarie am Ärmel näher ans Fenster heran. »Passt auf! Gleich wechselt er die Straßenseite!«
Sie erkannte einen schlanken, großgewachsenen Mann, der seine Hände lässig in die Taschen einer weitgeschnittenen sandfarbenen Flanellhose gesteckt hatte. Darüber trug er ein schwarz-weiß kariertes Sakko, auf dem Kopf einen cremefarbenen Hut mit weiter Krempe. Jetzt, wo er diagonal am Haus vorbei über das Pflaster der Straße schlenderte, vermochte Annemarie einen Blick auf sein Profil zu werfen. Donnerknispel, dachte sie: blonde Haare, markante Gesichtszüge, kein Bart. »Hat er etwa blaue Augen?«, flüsterte sie.
»Hellblau wie das Mittelmeer«, antwortete Luise.
Annemarie musste sich schnell eingestehen, dass ihre Freundin recht hatte. Der Doktor Wilhelm Möckel, von dem sie ihr seit Tagen erzählt hatte, besaß Format und entsprach rein optisch ihrem Männergeschmack. Und so einer begegnete ihr selten fernab der Kinoleinwände. Obwohl sie Osnabrückerin war, hatte sie den attraktiven Mann nie gesehen. Aber sie verbrachte ja seit einem halben Jahr auch die meisten Tage an der Universität Münster, wo sie im vergangenen Herbst ihr Medizinstudium aufgenommen hatte. Ihr Traum, für den sie alles tat und für den sie auch den Großteil der Zeit, die sie zu Hause verweilte, Bücher wälzte. Und der Doktor wäre noch nicht lange in der Stadt, hatte Luise ihr verraten.
Jetzt in den Ferien wollte Annemarie die freie Zeit auskosten, um mit ihren Freundinnen zu entspannen. Luise studierte nicht, ihre Eltern besaßen ein großes Kaufhaus, in dem sie ab und an aushalf. Und Sophie hatte sich, obwohl sie über die Hochschulreife verfügte, für eine Ausbildung an der Krankenschwesternschule eingeschrieben, die auch gerade unterrichtsfreie Zeit hatte. Schade, dass sie sich seit dem Abschluss an der Schule nicht mehr so oft sahen, dachte Annemarie. Aber wenn, dann war es schön wie eh und je.
»Wollen doch mal sehen, ob unser Augenarzt auch gute Augen besitzt«, sagte Luise und rief dann laut: »Kuckuck!«
Annemarie zuckte zusammen und bemerkte, wie Wilhelm den Kopf hob und in ihre Richtung schaute. Wie peinlich, hatte er sie gesehen? Vor Schreck ließ sie sich auf den Boden fallen, während ihre beiden Freundinnen wegsprangen und zu kichern begannen.
»Oh, Annemie, sei doch bloß nicht so schüchtern, passt doch nicht zu dir«, sagte Luise und zog sie an den Händen über dem Fußboden vom Fenster weg.
»Das war gemein.« Annemarie strich mit dem Handrücken ihre braunen Locken nach hinten. »Ich habe mich zu Tode erschreckt, als er sich umgedreht hat.«
»Na, wir müssen ihn halt auf dich aufmerksam machen«, sagte Luise, ging zurück zum Tisch, nahm die Karaffe Wein und goss die drei Gläser randvoll. »Du bist die Einzige von uns, die sich noch nie mit einem Mann getroffen hat. Obwohl du die Hübscheste von uns geworden bist.« Luise musterte ihre Freundin. »Das geht nicht mehr. Du kommst ins heiratsfähige Alter. Du musst, wie wir das auch tun, wenigstens schon mal üben, bis der Passende dabei ist!«
Luise und Sophie klatschten sich gegenseitig in die Hände und lachten laut.
»Aber, doch nicht einfach so«, sagte Annemarie und setzte sich zu den anderen an den Tisch. »Er ist attraktiv. Aber ob er auch nett ist? Und überhaupt: Wieso sollte er mich mögen?«
Sophie gluckste vor Vergnügen, warf sich auf ihren Stuhl zurück, nahm eine Zigarette aus ihrem Etui und entzündete sie mit einem Streichholz. »Siehst du, du hast Interesse. Von dem wirst du schon was halten, schließlich ist er Arzt. Das Beste, was dir als Medizinstudenten-Grünschnabel doch passieren kann.« Genussvoll zog sie an der Zigarette und blies den Rauch an die Zimmerdecke. »Der bringt dir noch was bei. Nicht nur in der Medizin.« Sie kicherte.
»Also wirklich«, antwortete Annemarie. »So eine bin ich ja nun nicht.«
»Iwo, biste nicht«, sagte Luise, nachdem sie einen großen Schluck Wein heruntergespült hatte. Sie nahm Annemaries Glas und reichte es ihr über die Tischplatte. »Wir bringen dich mit ihm in Kontakt und dann sehen wir weiter. Das wird bestimmt lustig und aufregend. Ich habe auch bereits einen Plan entwickelt. Lehn dich zurück, trink und hör zu! Also, wenn es nachher …«
Wilhelm schloss die Tür zur Praxis auf, trat ein, steckte Sakko und Hut an den Garderobenständer und lief geradeaus über den rot gekachelten Flur ins Untersuchungszimmer. Er nahm den Arztkittel aus einem schmalen Schrank, zog ihn über und setzte sich an seinen in glänzend weißem Lack gestrichenen Eichenholzschreibtisch. Darauf standen ein Tischfernsprecher und die edle Continental-Schreibmaschine mit goldenen Tasten. Wilhelms Blick fiel auf das eingerahmte Foto seines älteren Bruders Peter, das er so positioniert hatte, dass er es immer gut sehen konnte. Keinen Tag wollte er vergessen, wem er all das zu verdanken hatte, was ihn gerade ausmachte. Er dachte daran, wie gut es ihm ging.
In jenem Sommer 1932 sahen die meisten Deutschen das Ende der ersten Demokratie auf ihrem Boden bedrohlich nahekommen. Die Regierungen der Weimarer Republik hatten es nicht vermocht, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wie ein Schatten über Deutschland lagen, zu reparieren. Inflation und Weltwirtschaftskrise trieben viele Menschen in Massenarbeitslosigkeit, Zukunftsängste und in Wut. Dazu kamen der gekränkte Nationalstolz und Politiker, die mit der ganzen Gemengelage schlicht überfordert waren. Im Volk gor es. Aber nicht alle zeigten sich unzufrieden. Wilhelm ging es in diesem Sommer blendend, obwohl auch er die Spannungen und Risse in der Gesellschaft mit Sorge bemerkte, die auch in der Stadt zu spüren waren. Von knapp 100.000 Einwohnern bezog in diesem Sommer schon fast ein Viertel staatliche Unterstützung, um durchzukommen. Die Patienten, die jeden Tag auf seinem Behandlungsstuhl saßen, klagten neben körperlichen Beschwerden zunehmend über seelische Leiden, und so manch einer sah die unruhige Zeit als Ursache für die ihn befallende Krankheit an.
Der Doktor selbst beschwerte sich nicht. Im Vorjahr hatte er ein Medizinstudium an der Universität Münster mit überdurchschnittlich guter Promotionsnote abgeschlossen und sich danach den Traum von einer eigenen Praxis in seiner Heimatstadt Osnabrück erfüllen können. Mit neunundzwanzig Jahren blickte er frohen Mutes in die Zukunft – und jede Woche in dutzende Frauenaugen.
Nein, Wilhelm war kein Hallodri, und fairerweise muss man sagen, dass er in eine nicht minder große Anzahl von Männeraugen schaute. Er war Facharzt für Augenheilkunde und das mit hinlänglicher Leidenschaft. Wenn ihm überhaupt etwas fehlte, dann die Frau an seiner Seite. Da tat er sich schwer. Obwohl es ihm an Angeboten wahrlich nie gemangelt hatte. Im Gegenteil. Die Damen beschrieben Wilhelm als intelligent, charmant und vergnüglich. Auch erschien er äußerlich von stattlicher, gepflegter und attraktiver Natur. So wunderte es kaum, dass sich während seiner Hochschulzeit die hübschesten Kommilitoninnen regelrecht darum gerissen hatten, sich mit dem stets adrett gekleideten Wilhelm für einen Tanzabend oder einen Kinobesuch verabreden zu dürfen. Und der begehrte Studiosus hatte keineswegs all diesen verlockenden Offerten widerstanden. Doch sobald ein Mädchen Interesse an etwas Ernsthaftem erkennen ließ, hatte er schon wieder den Fachbüchern die größere Aufmerksamkeit gewidmet.
Das Ergebnis seiner Strebsamkeit lag in jenem Jahr in Form der eigenen, modern ausgestatteten Praxis vor ihm. Er hatte sich gut eingerichtet. Das weiß gekachelte Behandlungszimmer verfügte über einen abgetrennten Bereich, in dem unter einem Deckenstrahler eine Patientenliege stand. Hier konnte er kleinere Operationen an Lidern oder am Tränenapparat durchführen. Neben dem lederüberzogenen Untersuchungsstuhl hatte er eine teure, auf Rollen stehende Spaltlampe zur mikroskopischen Untersuchung des Auges, ein Tonometer zur Messung des Augendrucks und ein Perimeter für die genaue Gesichtsfeldmessung aufgebaut. Der wuchtige Medizinschrank war mit Salben, Tinkturen, Augentropfen, Verbandsmaterial, Hygieneartikeln und Operationsbesteck immer gut gefüllt.
»Ach, Peter«, sagte Wilhelm laut und nahm das Bild des zehn Jahre älteren Bruders in die Hand. Sein Geld war es gewesen, das ihm die Existenzgründung inklusive eigener Praxis ermöglicht hatte. Ohne ihn, der nach dem Ersten Weltkrieg frustriert ausgewandert war und sein kurzes Glück in Brasilien gefunden hatte, wäre für Wilhelm selbst das Studium nicht möglich gewesen. Die Brüder entstammten einer einfachen Bauernfamilie, die für die Ausbildung ihrer Kinder kein Geld aufbringen konnte. Peter war der Enge seines Elternhauses nach Übersee entflohen. Dort hatte er es geschafft, sich vom Bohnenpflücker zum Besitzer einer kleinen Kaffeeplantage in São Paulo zu mausern. Doch noch bevor Wilhelm ihn dort hatte besuchen können – was er gerne getan hätte, denn er liebte den Bruder –, war dieser bei einem tragischen Autounfall verstorben.
Sein Geld hatte Peter testamentarisch der Mutter vermacht. Der Tod des Erstgeborenen brach ihr das Herz zum zweiten Mal, nachdem bereits 1916 ihr Mann in Verdun sein Leben im Schützengraben hatte lassen müssen. Wilhelm und sein Zwillingsbruder Karl hatten gerade das dreizehnte Lebensjahr vollendet, als sie erfuhren, dass ihr Vater nie mehr nach Hause kommen würde. Ein Schicksal, das sie mit vielen Kindern dieser dunklen Epoche teilten. Durch Peters Geld hatte die Familie zwar überleben können, aber die Gemütserkrankung der Mutter hatte auch bei den Söhnen Spuren hinterlassen. Nach dem Tod des Vaters hatten die Zwillingsbrüder den Hof alleine weitergeführt. Sie hatten bis spät abends auf dem Feld geackert und anschließend noch die Mutter getröstet. Eine kaum zu ertragene Doppelbelastung, zumal sie selbst schwer unter dem Verlust gelitten hatten.
Ihr sollt es mal besser haben als wir