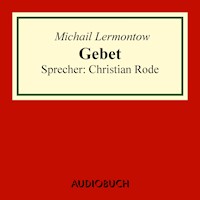10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Langeweile und Lebensüberdruss prägen das Leben des adligen Offiziers und Lebemanns Petschorin. Längst hat er die edlen Ideale Anstand, Ehre und Aufrichtigkeit aufgegeben und treibt ein leichtfertiges und intrigantes Spiel mit der Liebe der Tscherkessin Bela und mit der Zuneigung der Petersburger Prinzessin Mary. Zu wahrem Gefühl scheint er unfähig ... 1841 erschien Michail Lermontows einziges vollendetes Prosawerk »Ein Held unserer Zeit«. Petschorin ist der Inbegriff des „überflüssigen Menschen“, dem wir später in den Werken von Tolstoj, Dostojewski, Turgenjew und Gontscharow wiederbegegnen. Lermontow zählt mit diesem Roman zu den Begründern des großen russischen realistischen Romans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Langeweile und Lebensüberdruss prägen das Leben des adligen Offiziers und Lebemanns Petschorin. Längst hat er die edlen Ideale Anstand, Ehre und Aufrichtigkeit aufgegeben und treibt ein leichtfertiges und intrigantes Spiel mit der Liebe der Tscherkessin Bela und mit der Zuneigung der Petersburger Prinzessin Mary. Zu wahrem Gefühl scheint er unfähig …
1841 erschien Michail Lermontows einziges vollendetes Prosawerk Ein Held unserer Zeit. Petschorin ist der Inbegriff des »überflüssigen Menschen«, dem wir später in den Werken von Tolstoj, Dostojewski, Turgenjew und Gontscharow wiederbegegnen. Lermontow zählt mit diesem Roman zu den Begründern des großen russischen realistischen Romans.
Michail Lermontow, geboren am 15. Oktober 1814 in Moskau, ist neben Puschkin der wichtigste Vertreter der russischen Romantik. Seine Lyrik ist stark von Byron beeinflusst. Ein Held unserer Zeit ist sein einziges vollendetes Prosawerk und der erste große russische realistische Roman. Lermontow starb am 27. Juli 1841 im Duell in Pjatigorsk.
Michail LermontowEin Held unserer Zeit
RomanAus dem Russischenvon Günther Stein
eBook Insel Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4329.
Insel Verlag Berlin 2014
Titel der 1840 erschienenen Originalausgabe: Geroj našego vremeni
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 1963, 2008 (vorliegende Übersetzung erschien erstmals 1963 bei Rütten & Loening Berlin; Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau GmbH)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagabbildung: Antonio Ciccone, Selbstporträt, 1959
Foto: The Bridgeman Art Library, Berlin
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-458-73913-5
www.insel-verlag.de
Inhalt
Bela
Maxim Maximytsch
Petschorins Tagebuch:
Vorwort
Taman
Prinzeß Mary
Ein Held unserer Zeit
In jedem Buch ist das Vorwort das Erste und Letzte zugleich; es dient entweder als Erklärung der Ideen des Werkes oder als Rechtfertigung und Antwort auf Kritiken. Aber gewöhnlich kümmern sich die Leser nicht um die moralischen Ideen und die Angriffe in den Journalen, und deswegen lesen sie die Vorworte nicht. Schade, daß dies so ist, und gerade bei uns. Unser Publikum ist noch so jung und unerfahren, daß es die Fabel nicht versteht, wenn es am Schluß nicht die Moral findet. Es erfaßt den Humor nicht, spürt nicht die Ironie; es ist einfach schlecht erzogen. Es weiß nicht, daß es sich in einer anständigen Gesellschaft und in einem anständigen Buch nicht ziemt, laut zu schimpfen, daß die neuzeitliche Bildung eine schärfere, beinahe unsichtbare, aber desto tödlichere Waffe erfunden hat, die unter dem Deckmantel der Schmeichelei unfehlbar und sicher trifft. Unser Publikum gleicht dem Provinzler, der aus der Unterhaltung zweier Diplomaten einander feindlich gesinnter Höfe die Überzeugung gewinnt, daß sie der gegenseitigen zärtlichsten Freundschaft zuliebe ihre Regierung betrügen.
Dieses Buch hatte noch vor kurzem unter der unglückseligen Arglosigkeit einiger Leser und sogar einiger Journale zu leiden, die darin jedes Wort für bare Münze nahmen. Die einen waren allen Ernstes furchtbar beleidigt, daß ihnen ein solcher verderbter Mensch wie der Held unserer Zeit als Vorbild hingestellt würde; andere bewiesen sehr feinsinnig, der Verfasser habe sich und seine Bekannten porträtiert … Der alte, erbärmliche Witz! Aber Rußland ist anscheinend so eingerichtet, daß sich alles außer derartigen Torheiten erneuert. Selbst das zauberhafteste Zaubermärchen würde bei uns wohl kaum dem Vorwurf entgehen, es trachte nach Beleidigung der Persönlichkeit.
Der Held unserer Zeit, meine sehr geschätzten Herren, ist tatsächlich ein Porträt, aber nicht das eines einzelnen Menschen; es ist ein Porträt, das sich aus den voll ausgereiften Lastern unserer ganzen Generation zusammensetzt. Sie werden mir wiederum sagen, der Mensch könne nicht so schlecht sein, aber ich sage Ihnen: Wenn Sie die Existenz all der tragischen und romantischen Bösewichte für möglich gehalten haben, warum glauben Sie dann nicht an die Wirklichkeit eines Petschorin? Wenn Sie sich an bedeutend schrecklicheren und mißgestalteteren Phantasiegeschöpfen ergötzt haben, warum findet dann dieser Charakter, dieses Phantasiegeschöpf, vor Ihnen keine Gnade? Etwa weil in ihm mehr Wahrheit ist, als Ihnen lieb wäre?
Sie sagen, die Sittlichkeit gewinne dadurch nichts? Entschuldigen Sie – die Menschen sind zur Genüge mit Süßigkeiten gefüttert worden; sie haben sich daran den Magen verdorben. Was not tut, sind bittere Medizin, unangenehme Wahrheiten. Denken Sie nun aber nicht, der Verfasser dieses Buches habe je den stolzen Traum gehegt, er werde die Menschen von ihren Lastern heilen. Gott behüte ihn vor solcher Verblendung! Es hat ihm einfach Spaß gemacht, seinen Zeitgenossen so darzustellen, wie er ihn sieht und wie er ihm, zu seinem und Ihrem Unglück, nur allzuoft begegnet ist. Es genügt, daß die Krankheit gezeigt ist. Wie sie geheilt werden muß – das weiß Gott allein!
Bela
Ich reiste von Tiflis aus mit der Post. Das ganze Gepäck auf dem kleinen Wagen bestand aus einem einzigen, nicht sehr großen Koffer, der zur Hälfte mit Reisenotizen über Georgien angefüllt war. Ein großer Teil davon ist, zu Ihrem Glück, verlorengegangen, aber der Koffer mit den übrigen Sachen blieb, zu meinem Glück, unversehrt.
Die Sonne versank schon hinter den verschneiten Gipfeln, als ich das Koischaur-Tal erreichte. Der Fuhrmann, ein Ossete, trieb unablässig die Pferde an, weil er noch vor Anbruch der Nacht auf den Gipfel des Koischaur gelangen wollte, und sang aus vollem Halse. Ein herrliches Fleckchen Erde ist dieses Tal! Ringsum unbezwingbare Berge, rötliche Felsen, die Efeu umrankt und Platanen krönen, gelbe Abhänge, von Rinnen durchfurcht, die das Wasser wusch, und hoch oben der goldene Saum des Schnees; unten aber die Aragwa, die wie eine Schlangenhaut glitzert und sich wie ein Silberfaden dahinzieht, nachdem sie ein anderes, namenloses Flüßchen umarmt hat, das tosend aus einer schwarzen, nebelwogenden Schlucht hervorbricht.
Am Fuße des Koischaur hielten wir vor einem Gasthaus. Hier drängten sich lärmend an die zwanzig Georgier und Gebirgsbewohner; in der Nähe richtete sich eine Kamelkarawane für die Nacht ein.
Ich mußte mir Ochsen mieten, um mit meinem Wagen auf den verdammten Berg hinaufzukommen, denn es war schon Herbst, die Straßen waren vereist, und dieser Berg ist rund zwei Werst hoch.
Ich mietete mir also sechs Ochsen und mehrere Osseten. Was blieb mir anderes übrig? Der eine lud sich meinen Koffer auf die Schulter, die anderen halfen beinahe nur durch Geschrei den Ochsen.
Mir folgte ein Wagen, der mühelos von vier Ochsen gezogen wurde, obwohl er bis oben hin beladen war. Das wunderte mich. Der Mann, dem der Wagen gehörte, ging hinterher und rauchte eine kleine, mit Silber beschlagene Kabardinerpfeife. Er trug einen Offiziersrock ohne Epauletten und eine tscherkessische Fellmütze. Er schien fünfzig Jahre alt zu sein; die Bräune seines Gesichts bewies, daß es schon lange mit der Sonne des Kaukasus bekannt war, und der vorzeitig ergraute Schnurrbart paßte nicht zu seinem festen Gang und seinem frischen Aussehen. Ich trat zu ihm und verbeugte mich; er dankte schweigend und stieß eine mächtige Rauchwolke aus.
»Wir sind anscheinend Weggenossen?«
Er verbeugte sich abermals schweigend.
»Sie fahren gewiß nach Stawropol?«
»Ganz recht … dienstlich.«
»Sagen Sie bitte, wie kommt es, daß Ihr schwerer Wagen spielend von vier Ochsen gezogen wird, während meinen leeren sechs Ochsen mit Hilfe dieser Osseten kaum vom Fleck bringen?«
Er lächelte verschmitzt und sah mich bedeutsam an.
»Sie sind sicherlich noch nicht lange im Kaukasus?«
»Ungefähr ein Jahr«, antwortete ich. »Wieso?«
Er lächelte wieder.
»Nur so, abscheuliche Bestien sind diese Asiaten! Denken Sie, die helfen, weil sie schreien? Weiß der Teufel, was sie da grölen. Die Ochsen verstehen es; Sie können getrost zwanzig vorspannen, sobald die losschreien, rühren sich die Ochsen nicht von der Stelle. Schreckliche Gauner sind das! Aber was kann man gegen sie ausrichten? Ziehen den Reisenden gern das Geld aus der Tasche … Die Strolche sind verwöhnt. Sie werden sehen, die lassen sich von Ihnen Trinkgeld geben. Ich kenne sie, mir machen sie nichts vor.«
»Tun Sie hier schon lange Dienst?«
»Ja, ich habe schon unter Alexej Petrowitsch[1] hier gedient«, antwortete er und richtete sich würdevoll auf. »Als er in mein Linienbataillon kam, war ich Unterleutnant«, fügte er hinzu, »unter ihm bin ich zweimal für Kämpfe mit den Gebirgsbewohnern befördert worden.«
»Und wo sind Sie jetzt?«
»Jetzt stehe ich beim dritten Linienbataillon. Und Sie, wenn ich fragen darf?«
Ich sagte es ihm.
Damit endete die Unterhaltung, und wir setzten schweigend nebeneinander den Weg fort. Auf dem Gipfel des Berges lag Schnee. Die Sonne ging unter, und die Nacht folgte jäh dem Tag, wie das im Süden ist, aber dank dem Glitzern des Schnees konnten wir die Straße leicht erkennen, die zwar immer noch bergauf ging, aber nicht mehr so steil war. Ich ließ den Koffer in meinen Wagen legen, für die Ochsen Pferde einspannen und blickte ein letztes Mal zurück ins Tal – doch der dichte Nebel, der in Wellen aus den Felsspalten quoll, verhüllte es ganz, und kein Laut erreichte von dorther unser Ohr. Die Osseten umringten mich lärmend und verlangten ein Trinkgeld; der Stabskapitän schrie sie jedoch drohend an, daß sie sogleich das Weite suchten.
»Das ist ein Volk«, sagte er, »kann nicht einmal Brot auf russisch sagen. Offizier, gib Trinkgeld! – das haben sie gelernt. Da sind mir die Tataren lieber, die trinken wenigstens nicht.«
Bis zur Station war es noch ungefähr eine Werst. Ringsum war es still, so still, daß man am Gesumm einer Mücke ihren Flug bestimmten konnte. Linker Hand gähnte eine dunkle Schlucht, dahinter und vor uns zeichneten sich, wie von Runzeln durchzogen, mit Schnee bedeckt, die dunkelblauen Gipfel der Berge am bleichen Horizont ab, an dem der letzte Widerschein der Abendröte verglomm. Am dunklen Himmel leuchteten nacheinander die Sterne auf, und seltsam, es kam mir so vor, als stünden sie bedeutend höher als bei uns im Norden. Zu beiden Seiten der Straße ragten nackte schwarze Steine auf; hier und da lugten kleine Sträucher unter dem Schnee hervor, aber kein einziges trockenes Blatt regte sich, und es tat wohl, in diesem Totenschlaf der Natur das Schnauben der müden Postpferde und das launische Geklingel des russischen Glöckchens zu hören.
»Morgen wird herrliches Wetter«, sagte ich.
Der Stabskapitän antwortete nicht, sondern wies mit dem Finger auf den hohen Berg vor uns.
»Was ist das?« fragte ich.
»Der Gud.«
»Na und?«
»Sehen Sie, wie er raucht.«
In der Tat, der Gud rauchte; duftige Wolkenzeilen erklommen zu beiden Seiten seinen Gipfel, auf dem eine schwarze Wolke lagerte; sie war so schwarz, daß sie an dem dunklen Himmel wie ein Fleck wirkte.
Schon erkannten wir die Poststation, die Dächer der sie umgebenden Sakljas, und vor uns schimmerten anheimelnde Lichter, als uns plötzlich ein feuchter und kalter Wind entgegenschlug, die Schlucht begann zu tosen, und es nieselte. Ich hatte mir kaum meine Burka umgehängt, da schneite es. Ich blickte den Stabskapitän ehrfürchtig an.
»Wir müssen hier übernachten«, sagte er mürrisch. »Bei solch einem Schneetreiben kommt man nicht über die Berge. – Sind am Krestowaja schon Lawinen niedergegangen?« fragte er einen Fuhrmann.
»Noch nicht, Herr«, antwortete der Ossete, »aber es hängen viele, viele.«
Da es auf der Station keine Zimmer für Reisende gab, wurde uns ein Nachtquartier in einer rauchigen Saklja zugewiesen. Ich lud meinen Weggenossen zu einem Glas Tee ein, denn ich hatte einen gußeisernen Teekessel bei mir – mein einziges Vergnügen auf den Kaukasusreisen.
Die Saklja klebte mit der einen Seite an einer Felswand; drei glitschige, feuchte Stufen führten zu ihrer Tür. Ich tastete mich hinein und stieß auf eine Kuh (diese Leute benutzen den Stall als Gesindestube). Ich wußte nicht, wohin ich mich wenden sollte. Hier blökten Schafe, da knurrte ein Hund. Zum Glück schimmerte in einer Ecke ein mattes Licht und half mir eine zweite türähnliche Öffnung zu finden. Dort bot sich mir ein sonderbares Bild: Die geräumige Saklja, deren Dach auf zwei verrußten Pfählen ruhte, war voller Menschen. In der Mitte knisterte auf der nackten Erde ein kleines Feuer, und der Rauch, den der Wind durch die Öffnung im Dach zurückblies, legte über alles einen so dichten Schleier, daß es lange dauerte, bis ich etwas erkennen konnte; am Feuer saßen zwei alte Frauen, viele Kinder und ein hagerer Georgier, alle in Lumpen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als uns ans Feuer zu setzen; wir zündeten unsere Pfeifen an, und bald begann der Teekessel anheimelnd zu summen.
»Bedauernswerte Menschen!« sagte ich zu dem Stabskapitän, und dabei wies ich auf unsere schmutzigen Gastgeber, die uns stumm und starr ansahen.
»Ein strohdummes Volk«, antwortete er. »Glauben Sie mir, die können nichts, sind keinerlei Bildung fähig! Unsere Kabardiner und Tschetschenzen sind zwar Räuber und Taugenichtse, aber tollkühne Burschen. Diese hier haben aber nicht einmal an einer Waffe Freude, kein einziger trägt einen ordentlichen Dolch. Es sind eben richtige Osseten!«
»Sind Sie lange in der Tschetschnja gewesen?«
»Ja, ich habe zehn Jahre mit einer Kompanie in der Festung gelegen. Bei Kamenny Brod. Kennen Sie die Gegend?«
»Ich habe davon gehört.«
»Wissen Sie, mein Lieber, wir haben genug von diesen Galgenvögeln; heute geht es ja, Gott sei Dank, friedlicher zu. Aber damals – man brauchte sich nur hundert Schritt vom Wall zu entfernen, schon lag irgendwo so ein zottiger Satan auf der Lauer. Wenn man nicht aufpaßte, hatte man eins, zwei, drei entweder die Fangschlinge um den Hals oder eine Kugel im Rücken. Wüste Burschen!«
»Sie haben wohl so mancherlei erlebt?« fragte ich, von Neugier gepackt.
»Und ob! Eine ganze Menge …«
Er zupfte an der linken Schnurrbartspitze, senkte den Kopf und wurde nachdenklich. Ich hätte ihm schrecklich gern eine kleine Geschichte entlockt – ein Wunsch, den alle reisenden und schreibenden Menschen hegen. Unterdessen war der Tee fertig, ich holte zwei Feldbecher aus dem Koffer, schenkte ein und stellte einen vor ihn hin. Er nahm einen Schluck und sagte, als spräche er mit sich selber: »Ja, eine ganze Menge …« Dieser Ausruf erweckte in mir große Hoffnungen. Ich weiß, die alten Kaukasier plaudern und erzählen gern; sie haben so selten Gelegenheit dazu; manch einer liegt fünf Jahre mit seiner Kompanie in einer öden Gegend, und die ganzen fünf Jahre sagt kein Mensch »Guten Tag!« zu ihm (denn der Feldwebel schnarrt: »Wünsche, wohl geruht zu haben!«). Doch ließe sich über so manches plaudern: ringsum lebt ein wildes, interessantes Volk, jeden Tag lauert Gefahr, es geschehen die merkwürdigsten Dinge, und man bedauert unwillkürlich, daß bei uns so wenig aufgeschrieben wird.
»Wollen Sie nicht etwas Rum dazu nehmen?« fragte ich meinen Weggenossen. »Ich habe jungen aus Tiflis; jetzt ist es kalt.«
»Nein, danke vielmals, ich trinke nicht.«
»Wie kommt das?«
»Ganz einfach. Ich habe es mir geschworen. Als ich noch Unterleutnant war, wissen Sie, haben wir mal im kleinen Kreis gefeiert. In derselben Nacht gab es Alarm, und wir traten angeheitert vor die Front. Was wir da zu hören bekamen, als Alexej Petrowitsch das erfuhr! Du lieber Gott, hat er getobt! Er hätte uns beinahe vor Gericht gestellt. Es ist schon so – manchmal lebt man ein Jahr und sieht keine Menschenseele. Kommt dann noch der Schnaps hinzu, ist man verloren.«
Als ich das vernahm, wollte ich fast schon die Hoffnung aufgeben.
»Sobald zum Beispiel die Tscherkessen auf einer Hochzeit oder bei einem Begräbnis ihre Busa trinken«, fuhr er fort, »fangen sie an zu raufen. Einmal wäre es beinahe um mich geschehen gewesen, obwohl ich bei einem friedlichen Fürsten zu Gast war.«
»Wie ist denn das zugegangen?«
»Sehen Sie« (er stopfte sich die Pfeife, tat einen Zug und fing an zu erzählen), »sehen Sie, ich lag damals mit meiner Kompanie in einer Festung jenseits des Terek; es ist bald fünf Jahre her. Eines Tages, im Herbst, traf ein Provianttransport ein; mit dem Transport kam ein Offizier, ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren. Er meldete sich bei mir in voller Uniform und erklärte, er habe den Befehl, bei mir in der Festung zu bleiben. Er war so schmal und blaß, und seine Uniform war so neu, daß ich sofort erriet: er war erst vor kurzem zu uns in den Kaukasus gekommen. ›Sie sind sicherlich aus Rußland hierher versetzt worden?‹ fragte ich. ›Zu Befehl, Herr Stabskapitän‹, antwortete er. Ich ergriff seine Hand und sagte: ›Sehr erfreut, sehr erfreut. Sie werden sich hier ein wenig langweilen. Na, wir werden schon gut miteinander auskommen. Nennen Sie mich bitte einfach Maxim Maximytsch, und bitte – wozu die volle Uniform? Sie können zu mir jederzeit mit Mütze kommen.‹ Es wurde ihm ein Quartier angewiesen, und er richtete sich in der Festung ein.«
»Wie hieß er eigentlich?« fragte ich Maxim Maximytsch.
»Er hieß … Grigori Alexandrowitsch Petschorin. Er war ein Prachtkerl, versichere ich Ihnen; bloß ein bißchen eigenartig. Waren wir zum Beispiel bei Regen und Kälte den ganzen Tag auf der Jagd und alle durchgefroren und todmüde – ihm machte es nichts aus. Ein andermal aber sitzt er in seiner Stube, ein Lüftchen weht, und schon behauptet er, er habe sich erkältet; der Fensterladen klappert, er zuckt zusammen und erbleicht. Doch habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie er mutterseelenallein auf einen Eber losging; bisweilen hörte man von ihm stundenlang kein Wort, wenn er aber gelegentlich zu erzählen anfing, mußte man so lachen, daß einem der Bauch weh tat. Ja, er war sehr eigenartig und muß wohlhabend gewesen sein. Was für kostbare Sachen er hatte!«
»Blieb er lange bei Ihnen?« fragte ich wieder.
»Ungefähr ein Jahr. Dieses Jahr werde ich nie vergessen; er hat mir mehr als genug Scherereien gemacht – er möge es mir verzeihen! Es gibt Menschen, denen es vom Schicksal vorherbestimmt ist, daß sie mancherlei ungewöhnliche Dinge erleben.«
»Ungewöhnliche?« rief ich neugierig aus, während ich ihm Tee eingoß.
»Nun, ich werde es Ihnen erzählen. An die sechs Werst von der Festung entfernt wohnte ein friedlicher Fürst. Sein Sohn, ein Junge von fünfzehn Jahren, kam oft zu uns geritten. Jeden Tag erschien er, bald wegen dieser, bald wegen jener Sache; und Grigori Alexandrowitsch und ich haben ihn regelrecht verwöhnt. Er war ein verwegener Bursche, er konnte alles – im vollen Galopp eine Mütze vom Boden aufheben oder mit dem Gewehr schießen. Einen schlechten Zug hatte er an sich, er war schrecklich geldgierig. Einmal versprach Grigori Alexandrowitsch ihm aus Spaß einen Tscherwonez, wenn er für ihn den besten Ziegenbock aus der Herde seines Vaters stehlen würde. Und was denken Sie? In der Nacht darauf schleppte er ihn an den Hörnern herbei. Neckten wir ihn manchmal, wurden seine Augen blutunterlaufen – und schon hatte er den Dolch in der Hand. ›Paß auf, Asamat, das kostet dich noch einmal den Kopf‹, sagte ich zu ihm. ›Hüte dich!‹
Eines Tages kam der alte Fürst selber geritten, um uns zur Hochzeit einzuladen. Er verheiratete seine älteste Tochter, und wir waren seine Kunaks – wissen Sie, das durfte man nicht abschlagen, obwohl er nur ein Tatare war. Wir machten uns auf den Weg. In dem Aul empfingen uns eine Unmenge Hunde mit lautem Gebell. Die Frauen versteckten sich, als sie uns sahen; diejenigen, deren Gesichter wir sehen konnten, waren alles andere als schön. ›Ich habe mir die Tscherkessinnen bedeutend schöner vorgestellt‹, sagte Grigori Alexandrowitsch zu mir. ›Warten Sie ab‹, erwiderte ich schmunzelnd. Ich dachte mir mein Teil.
In der Saklja des Fürsten hatte sich schon viel Volk eingefunden. Bei den Asiaten, müssen Sie wissen, ist es Sitte, alle Menschen, die einem über den Weg laufen, zur Hochzeit einzuladen. Wir wurden mit allen Ehren empfangen und in die Kunazka geleitet. Ich merkte mir vorher jedoch, wo unsere Pferde standen, wissen Sie, für alle Fälle.«
»Wie feiern diese Leute denn Hochzeit?« fragte ich den Stabskapitän.
»Wie üblich. Zuerst liest ihnen der Mulla etwas aus dem Koran vor, anschließend werden das junge Paar und seine ganze Verwandtschaft beschenkt, man ißt, trinkt Busa, und dann fängt die Dschigitowka an, und immer ist ein zerlumpter Kerl dabei, speckig, auf einem abscheulichen, lahmen Gaul; er schneidet Grimassen und bringt die ganze ehrenwerte Gesellschaft zum Lachen; wenn es dämmert, fängt in der Kunazka das an, was wir einen Ball nennen. Ein armes altes Männchen spielt auf einer Art dreisaitiger Balalaika – ich weiß nicht mehr, wie sie es nennen. Die Mädchen und die jungen Burschen stellen sich einander gegenüber in zwei Reihen auf, klatschen in die Hände und singen. Dann treten ein Mädchen und ein Bursche in die Mitte und sagen einander in singendem Tonfall in Versen, was ihnen gerade in den Sinn kommt, und die übrigen fallen im Chor ein. – Petschorin und ich saßen auf dem Ehrenplatz, da trat die jüngste Tochter des Fürsten auf ihn zu, ein Mädchen von sechzehn Jahren, und sang für ihn … Wie soll man es nennen? Es klang wie ein Kompliment.«
»Erinnern Sie sich nicht, was sie gesungen hat?«
»Der Text lautete etwa so: Schlank sind unsere jungen Dschigiten und ihre Röcke mit Silber verziert, aber schlanker als sie ist der russische Offizier, und die Tressen, die er trägt, sind golden. Wie eine Pappel steht er zwischen ihnen; doch in unserem Garten zu wachsen, zu blühen ist ihm versagt. – Petschorin stand auf, verbeugte sich vor ihr, legte seine Rechte an die Stirn und an das Herz und bat mich, ihr zu antworten; ich kenne ihre Sprache gut und übersetzte seine Antwort.
Als sie sich entfernte, fragte ich ihn flüsternd: ›Na, wie finden Sie sie?‹ – ›Zauberhaft!‹ antwortete er. ›Wie heißt sie?‹ – ›Bela‹, erwiderte ich.
Sie war wirklich schön: Groß, zierlich, und ihre schwarzen Gemsenaugen sahen einem bis ins Herz. Gedankenverloren blickte Petschorin sie unverwandt an, und sie streifte ihn des öfteren mit einem verstohlenen Blick. Nur war Petschorin nicht der einzige, der die hübsche Fürstentochter anstaunte. Aus einer Ecke des Zimmers folgte ihr ein anderes Augenpaar, starr und feurig. Ich sah genauer hin und bemerkte meinen alten Bekannten Kasbitsch. Wissen Sie, er war weder friedlich noch unfriedlich. Man hegte so mancherlei Verdacht gegen ihn, obwohl er bisher bei keiner Übeltat ertappt worden war. Er brachte uns manchmal Hammel in die Festung und verkaufte sie billig, aber aufs Feilschen ließ er sich nie ein. Was er verlangte, mußte man zahlen; selbst wenn es um seinen Kopf gegangen wäre, er hätte nichts nachgelassen. Es hieß, er triebe sich gern jenseits des Kubans mit Abreken herum, und er hatte, um die Wahrheit zu sagen, eine richtige Räubervisage, er war klein, hager, breitschultrig … und geschickt, geschickt wie ein Teufel. Sein Beschmet hatte immer Risse und Flicken, aber seine Waffen waren mit Silber beschlagen. Sein Pferd war in der ganzen Kabarda berühmt, und tatsächlich, es gab kein besseres. Nicht ohne Grund beneideten ihn alle Reiter darum, und nicht nur einmal versuchte man, es ihm zu stehlen, was allerdings nie gelang. Ich sehe dieses Tier wie heute vor mir: pechschwarz, die Beine wie Saiten gespannt und Augen nicht häßlicher als Belas, und was für eine Kraft! Mit dem konntest du getrost fünfzig Werst reiten; und eingeritten war es – wie ein Hund lief es hinter seinem Herrn her, es kannte sogar seine Stimme! Er hat es wohl nie angebunden. Es war ein richtiges Räuberpferd!
An diesem Abend war Kasbitsch finsterer denn je, und ich bemerkte, daß er unter seinem Beschmet ein Panzerhemd trug. Das Panzerhemd hat er nicht umsonst angezogen, dachte ich, er führt bestimmt etwas im Schilde.
Es wurde heiß in der Saklja, und ich ging in die Luft, um mich zu erfrischen. Die Nacht hatte sich schon auf die Berge gesenkt, und der Nebel strich durch die Schluchten.
Ich kam auf den Gedanken, in den Schuppen zu gehen, in dem unsere Pferde standen, und nachzusehen, ob sie Futter hatten; und außerdem kann Vorsicht nie schaden: ich hatte ein prächtiges Pferd, und manch ein Kabardiner hatte ihm schon verliebt nachgeschaut und dabei gesagt: Jakschi tche, tschek jakschi!
Ich schlich am Zaun entlang und hörte plötzlich Stimmen; die eine Stimme erkannte ich sofort – das war der Galgenstrick Asamat, der Sohn unseres Gastgebers; die andere sprach seltener und gedämpfter. Was besprechen die hier? dachte ich. Geht es etwa um mein Pferdchen? Ich hockte mich am Zaun hin und horchte angestrengt, damit mir ja kein Wort entginge. Hin und wieder übertönte der Klang der Lieder und das Stimmengewirr, das aus der Saklja flog, das für mich interessante Gespräch.
›Du hast ein herrliches Pferd!‹ sagte Asamat. ›Wenn ich der Herr im Hause wäre und eine Herde von dreihundert Pferden besäße, würde ich die Hälfte für deinen Renner geben, Kasbitsch!‹
Aha, Kasbitsch ist es! dachte ich und erinnerte mich wieder an das Panzerhemd.
›Ja‹, antwortete Kasbitsch nach längerem Schweigen, ›in der ganzen Kabarda findest du kein solches. Einmal – es war jenseits des Terek – ritt ich mit den Abreken, um den Russen Herden wegzutreiben; es glückte uns nicht, und wir zerstreuten uns in alle Winde. Mich verfolgten vier Kosaken. Schon hörte ich hinter mir die Schreie der Giaurs, und vor mir stand ein dichter Wald. Ich legte mich auf den Sattel, empfahl meine Seele Allah und kränkte mein Pferd zum erstenmal im Leben mit einem Peitschenhieb. Wie ein Vogel schlüpfte es durch die Zweige; scharfe Dornen zerrissen meine Kleidung, die trockenen Äste der Feldulme schlugen mir ins Gesicht. Mein Pferd setzte über Baumstümpfe hinweg, teilte das Gebüsch mit der Brust. Für mich wäre es besser gewesen, ich hätte es am Waldrand stehenlassen und wäre zu Fuß im Wald verschwunden, aber ich brachte es nicht übers Herz, mich von ihm zu trennen, und der Prophet hat es mir vergolten. Ein paar Kugeln pfiffen mir um die Ohren; ich hörte schon, wie die Kosaken, die abgesessen waren, meinen Spuren folgten … Plötzlich tat sich vor mir eine tiefe Schlucht auf; mein Renner zögerte – und sprang. Seine Hinterhufe rutschten drüben am Rand ab, und er hing an den Vorderbeinen; ich ließ die Zügel los und flog in die Schlucht; das rettete mein Pferd; es erklomm den Hang. Die Kosaken hatten das alles beobachtet, aber keiner stieg herab, um mich zu suchen. Sie dachten sicherlich, ich sei tot, und ich hörte, wie sie eilends hinter meinem Pferd herjagten. Mir blutete das Herz; ich kroch im dichten Gras die Schlucht entlang und sah, der Wald war zu Ende, ein paar Kosaken ritten aufs freie Feld hinaus, und da rannte mein Karagös geradewegs auf sie zu; alle stürzten mit Geschrei ihm nach; lange, lange verfolgten sie ihn. Besonders einer. Er hatte ihm zweimal beinahe schon die Fangschlinge um den Hals geworfen; ich fing an zu zittern, schlug die Augen nieder und betete. Nach ein paar Augenblicken sah ich wieder auf: mein Karagös fliegt mit wehendem Schweif dahin, frei wie der Wind, und die Giaurs trotten in großem Abstand einer hinter dem andern auf ihren erschöpften Pferden durch die Steppe. Bei Allah! Das ist die Wahrheit, die reine Wahrheit! Bis spät in die Nacht hinein habe ich in meiner Schlucht gesessen. Und plötzlich – was denkst du wohl, Asamat? – hörte ich im Dunkel, wie am Rande der Schlucht ein Pferd entlangläuft, es schnaubt, es wiehert und schlägt mit den Hufen die Erde; ich erkannte die Stimme meines Karagös. Er war es, mein Kamerad! Seitdem haben wir uns nie wieder getrennt.‹
Ich hörte, wie er den glatten Hals seines Renners tätschelte und ihm Kosenamen ins Ohr flüsterte.
›Wenn ich eine Herde von tausend Stuten besäße‹, sagte Asamat, ›ich würde sie dir für deinen Karagös geben.‹
›Yok, ich will nicht‹, antwortete Kasbitsch ungerührt.
›Hör mal, Kasbitsch‹, sagte Asamat einschmeichelnd, ›du bist ein guter Mensch, du bist ein tapferer Dschigit, aber mein Vater hat Angst vor den Russen und läßt mich nicht in die Berge; gib mir dein Pferd, und ich tue alles, was du willst, ich stehle für dich die beste Flinte oder den besten Säbel meines Vaters – du brauchst bloß den Wunsch zu äußern; und sein Säbel ist ein echter Gurda, legst du die Klinge an die Hand, dringt sie von selbst in das Fleisch ein; solch ein Panzerhemd, wie du es hast, hilft da nichts.‹
Kasbitsch schwieg.
›Als ich dein Pferd zum erstenmal sah‹, fuhr Asamat fort, ›tänzelte und sprang es unter dir, blähte die Nüstern, und Kiesel stoben unter seinen Hufen auf. Da vollzog sich in meinem Innern etwas Unbegreifliches, und seitdem ist mir alles zuwider; ich betrachte die besten Renner meines Vaters voller Verachtung, ich schäme mich, mich auf ihnen zu zeigen, und Sehnsucht erfaßt mich; voller Sehnsucht saß ich tagelang auf dem Felsvorsprung und sah in Gedanken alle Augenblicke deinen Rappen mit seinem tänzelnden Gang und seinem glatten, pfeilgeraden Rücken vor mir; er blickte mich mit seinen wilden Augen an, als wollte er mir etwas zurufen. Kasbitsch, ich sterbe, wenn du ihn mir nicht verkaufst!‹ sagte Asamat mit bebender Stimme.
Es war mir, als hörte ich ihn weinen. Aber ich muß Ihnen sagen, daß Asamat ein äußerst starrköpfiges Bürschchen war und sich trotz seiner Jugend durch nichts zum Weinen bringen ließ.
Als Antwort auf seine Tränen vernahm ich ein leises Lachen.
›Hör zu!‹ sagte Asamat mit fester Stimme. ›Du siehst, ich bin zu allem bereit. Wenn du willst, raube ich für dich meine Schwester. Wie sie tanzt! Wie sie singt! Und Goldstickereien macht sie – wahre Wunderwerke! So eine Frau hat nicht einmal der türkische Padischah … Willst du? Erwarte mich morgen nacht in der Schlucht, unten am Fluß. Ich komme mit ihr dort vorüber auf dem Weg zum Nachbaraul, und sie gehört dir. Ist Bela etwa deinen Renner nicht wert?‹
Lange, sehr lange schwieg Kasbitsch; endlich stimmte er halblaut ein altes Lied an:
›Manch schönes Mädchen im Dorfe mir lacht,
Es glänzt ihr Aug' wie der Stern in der Nacht.
Beneidenswert der Dschigit, der sie liebt.
Allein der Freiheitsdrang Lebenslust gibt.
Vier Frauen kriegt man für Gold, wie ich weiß,
Ein edles Pferd aber nicht für den Preis.
Als Wirbel stürmt es, den Sporen sich fügend,
Nie falschen Sinns, nie den Jüngling betrügend.‹[2]
Asamat flehte ihn an, weinte, schmeichelte und schwor – vergebens; schließlich fiel ihm Kasbitsch ungeduldig ins Wort: ›Pack dich, törichter Junge! Wie willst du auf meinem Pferd reiten? Nach den ersten drei Schritten wirft es dich ab, und du brichst dir an den Steinen den Hals.‹
›Mich?‹ rief Asamat, rasend vor Wut, und klirrend stieß sein Kinderdolch gegen das Panzerhemd. Eine starke Hand stieß Asamat zurück, und er fiel mit solcher Wucht gegen den Zaun, daß der Zaun ins Wanken geriet. Jetzt geht's los! dachte ich, stürzte in den Pferdestall, sattelte unsere Pferde und führte sie in den hinteren Hof. Zwei Minuten später herrschte in der Saklja ein schrecklicher Tumult. Was war geschehen? Asamat war mit seinem zerrissenen Beschmet hineingelaufen und hatte gesagt, Kasbitsch habe ihn ermorden wollen. Alle sprangen auf, griffen nach ihren Gewehren – und los ging's. Geschrei, Getöse, Schüsse; Kasbitsch saß schon im Sattel. Er drehte sich in dem Getümmel auf der Straße wie ein Teufel und schwang nach allen Seiten den Säbel.
›Eine faule Geschichte, wenn man büßen muß, was andere verschuldet haben‹, sagte ich zu Grigori Alexandrowitsch, als ich ihn am Ärmel erwischte, ›ob wir nicht lieber aufbrechen?‹
›Warten Sie noch, wie es ausgeht.‹
›Es wird bestimmt schlimm ausgehen; bei diesen Asiaten ist es immer so – erst lassen sie sich vollaufen, dann ziehen sie blank.‹ Wir saßen auf und ritten nach Hause.«
»Und was wurde aus Kasbitsch?« fragte ich ungeduldig den Stabskapitän.
»Was passiert solchen wie ihm schon?« antwortete er, während er sein Glas leerte. »Aus dem Staub gemacht hat er sich.«
»Wurde er nicht verwundet?«
»Das weiß der liebe Gott! So leicht lassen sich diese Räuber nicht unterkriegen! Manch einen von ihnen hab ich im Gefecht gesehen, der war wie ein Sieb von Bajonetten durchbohrt und schwang immer noch den Säbel.« Der Stabskapitän schwieg eine Weile, dann stampfte er mit dem Fuß auf und fuhr fort: »Eins werde ich mir nie verzeihen – der Teufel muß mich geritten haben, daß ich nach meiner Rückkehr in die Festung Grigori Alexandrowitsch alles erzählt habe, was ich hinter dem Zaun belauschte; er lachte – so ein gerissener Kerl! – und faßte im stillen einen Entschluß.«
»Was denn? Erzählen Sie doch, bitte!«
»Na schön, habe ich einmal angefangen, muß ich auch weitererzählen.