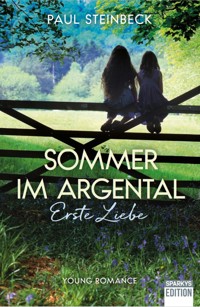3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sparkys Edition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reges Treiben herrscht an diesem sonnigen Tag auf dem Marktplatz. Und mittendrin sie. Die alte, greise Dame. Gebückt und auf ihren Stock gestützt. Wie ein Standbild. Kaum Bewegung. Bastians Augen wollen weiter gleiten. Dann bemerkt er ihren Blick, sieht etwas in ihrem Antlitz. Angst, Unsicherheit. Der Anhänger des Obsthändlers bewegt sich rückwärts auf sie zu. Sie rührt sich. Nur leicht, unmerklich. Mal nach links, mal nach rechts. Sucht den Fluchtweg. Sie öffnet den Mund zum stummen Aufschrei, hebt mit zittrigem Arm den Stock in die Höhe. Doch der Fahrer beachtet sie nicht. Verdammt! Warum hilft niemand? Bastian reagiert....steht auf. Endlich! Schnappt die Kaffeetasse und schleudert sie gegen das Fahrzeug des Händlers. Rennt los und trommelt mit den Händen gegen den Anhänger. Gerade noch rechtzeitig. „Und plötzlich entwickelt sich aus der Begegnung mit dieser unscheinbaren, ja unsichtbaren alten Dame eine Reise durch ein unglaubliches Leben eines besonderen Menschen, wie Bastian es noch nie zuvor gekannt hat. Gemeinsam mit den Jugendlichen Mike und Laura durchwandert er Welten, voller Liebe, Erfüllung und Dramaturgie. Die Wege der Generationen durchkreuzen sich, werden zum Schmelztiegel voller Energie, Inspiration und Konflikte.“ (Paul Steinbeck) Doch der Abschied naht unweigerlich. Eine einfühlsame Geschichte, die sich über Generationen hinweg entfaltet und die Vielfalt des Lebens hervorzaubert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Paul Steinbeck
Ein letztes Bild
Abschied von Anni
Eine einfühlsame Geschichte, die sich über Generationen hinweg entfaltet und die Vielfalt des Lebens hervorzaubert.Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
29.
30.
31.
32.
33.
Der Autor
Paul Steinbeck in den Social Media
Sparkys Edition
Zum Buch
Reges Treiben herrscht an diesem sonnigen Tag auf dem Marktplatz. Die Kastanienbäume tragen noch ihre Blätterpracht. Ich blinzle gegen die Sonne, entschlüssele das bunte Bild vor mir. Teenies lungern auf Steinblöcken herum, die wie Würfel lose aufgereiht sind. Mütter mit ihren Kindern, Knirpse auf ihren Rollern und Bankangestellte in ihren grauen Anzügen auf dem Weg zurück an ihre Arbeitsplätze kreuzen meinen verträumten Blick. Liebespärchen hier und dort. Aus den Augenwinkeln beobachtend, heimliche Liebe. Die letzten Marktstände werden abgebaut. Ordnungshüter patrouillieren durch das Gemenge.
Und mittendrin sie. Die alte, greise Dame. Gebeugt und auf ihren Stock gestützt. Auf mich wirkt sie wie ein Standbild. Kaum Bewegung. Meine Augen wollen weitergleiten. Ich bemerke, wie sich Angst und Unsicherheit in ihr ausbreiten. Der Anhänger des Obsthändlers bewegt sich rückwärts auf sie zu. Sie versucht, zu reagieren. Nur leicht, unmerklich. Mal nach links, mal nach rechts. Man spürt, wie sie abschätzt, was sie mit ihrer Geschwindigkeit schaffen kann. Sie sucht den Fluchtweg. Der Anhänger bewegt sich langsam, aber unaufhaltsam auf die alte Frau zu. Sie öffnet den Mund zum stummen Aufschrei, hebt mit zittrigem Arm den Stock in die Höhe. Doch der Fahrer beachtet sie nicht. Nur noch wenige Zentimeter, und schon würde das klobige Gefährt die alte Frau erfassen. Mein Blick hastet über den Marktplatz hinweg. Ist denn kein Mensch da, der ihr helfen will? Wo ist das Ordnungsamt, die Polizei oder wo sind einfach nur helfende Passanten? Der Wagen fährt weiter rückwärts. Ich möchte meinen Kaffee nicht loslassen und meine gemütliche Sitzhaltung nicht aufgeben. Verdammt! Warum hilft niemand? Ich reagiere, stehe auf. Endlich! Ich schnappe die Kaffeetasse und schleudere sie gegen das Fahrzeug des Händlers. Renne los und trommle mit den Händen gegen den Anhänger. Gerade noch rechtzeitig. Es hätte nicht mehr viel gefehlt.
Und plötzlich beginnt, mit der Begegnung, eine Reise durch ein unglaubliches Leben eines besonderen Menschen, wie ich es noch nie zuvor gekannt habe. Gemeinsam mit den Jugendlichen Mike und Laura durchwandern wir Welten, voller Liebe, Erfüllung und Dramaturgie. Die Wege der Generationen durchkreuzen sich, werden zum Schmelztiegel voller Energie, Inspiration und Konflikte.
Doch der Abschied naht unweigerlich.
Eine einfühlsame Geschichte, die sich über Generationen hinweg entfaltet und die Vielfalt des Lebens hervorzaubert.
Impressum
Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind reiner Zufall.
Vielen Dank an Susanne Sachs für die professionelle Prüfung der medizinischen Details.
Alle Rechte unterliegen dem Urheberrecht.
Verwendung und Vervielfältigung von Text und Bild nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Ute Graus
Korrektorat: Ursula Schötzig
Umschlaggestaltung: Designwerk-Kussmaul, Weilheim/Teck, www.designwerk-kussmaul.de
© 2024 Sparkys Edition
Herstellung und Verlag: Sparkys Edition,
Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck
Druck: Stückle Druck Ettenheim
ISBN: Softcover: 978-3-949768-20-0
1.
Es ist wie ein Standbild. Eher ein Wimmelbild aus einem dieser Kinderbücher, das sich mir zeigt, während ich mich an diesem Mittwochnachmittag im Spätsommer auf den Marktplatz setze. Endlich ein freier Nachmittag nach langen Tagen im Operationssaal. Ich lehne mich zurück und sauge die sommerlich-würzige Luft tief ein. Reges Treiben herrscht an diesem sonnigen Tag. Die Kastanienbäume tragen noch ihre Blätterpracht. Noch, bald wird der Herbst kommen.
Ich erwidere das freundliche Lächeln der Bedienung und nehme die Porzellantasse in beide Hände, genieße intensiv den Duft des frisch gebrühten Kaffees, bevor ich die Tasse zum Mund führe. Anerkennend nicke ich ihr zu und beginne, das bunte Bild vor mir zu entschlüsseln. Teenies lungern auf Steinblöcken herum, die wie Würfel lose aufgereiht sind. Mütter flanieren mit ihren Kindern. Knirpse schießen auf ihren Rollern vorbei. Meine eigenen Kinder könnten jetzt mitten unter ihnen sein. Mit ihrer Mama. Doch das fehlt in diesem Bild. Leider. Bankangestellte in ihren grauen Anzügen auf dem Weg zurück an ihre Arbeitsplätze kreuzen meinen verträumten Blick. Rentner in Wanderkleidung begrüßen Gleichgesinnte in der immer größer werdenden Gruppe. Gleich geht es raus ins Grüne. Liebespärchen hier und dort. Verstohlene Blicke, heimliche Liebe. Die letzten Marktstände werden abgebaut. Ordnungshüter patrouillieren durch das Gemenge.
Und mittendrin sie. Die alte, greise Dame. Gebeugt und auf ihren Stock gestützt.
Auf mich wirkt sie wie ein Standbild. Kaum Bewegung. Meine Augen wollen weitergleiten. Dann bemerke ich ihren Blick, sehe etwas in ihren Augen. Angst, Unsicherheit. Der Anhänger des Obsthändlers bewegt sich rückwärts auf sie zu. Am Straßenrand stehen auf beiden Seiten Mülltonnen. Sie regt sich. Nur leicht, unmerklich. Mal nach links, mal nach rechts. Man spürt, wie sie abschätzt, was sie mit ihrer Geschwindigkeit schaffen kann. Sie sucht den Fluchtweg. Die Jugendlichen haben die Szene ebenfalls bemerkt. Abwechslung in der Langeweile. Sie lachen, spotten, feuern die hilflose Dame an. Der Anhänger bewegt sich unaufhaltsam auf die alte Frau zu. Sie öffnet den Mund zum stummen Aufschrei, hebt mit zittrigem Arm den Stock in die Höhe. Doch der Fahrer beachtet sie nicht. Seine Konzentration wird von den Mülltonnen und Steinen in Anspruch genommen. Nur noch wenige Zentimeter, und schon würde der Anhänger die alte Frau erfassen. Mein Blick hastet über den Marktplatz hinweg. Ist denn kein Mensch da, der ihr helfen will? Wo ist das Ordnungsamt, die Polizei oder wo sind einfach nur helfende Passanten? Niemand scheint davon Kenntnis zu nehmen. Der Wagen rollt weiter rückwärts. Ich möchte meinen Kaffee nicht loslassen und meine gemütliche Sitzhaltung nicht aufgeben. Verdammt! Warum hilft niemand?
Ich reagiere, stehe auf. Endlich! Ich schnappe die Kaffeetasse und schleudere sie gegen das Fahrzeug des Händlers. Renne los und trommle mit den Händen gegen den Anhänger. Gerade noch rechtzeitig. Es hätte nicht mehr viel gefehlt. Ich nehme die Frau beim Arm und helfe ihr etwas auf die Seite. Ich spüre ihr Zittern. Wie Espenlaub. Beschimpfe die jungen Menschen. Ihnen ist das egal. Sie haben schon etwas Neues entdeckt, was ihre Aufmerksamkeit verdient. Ein Fluch entlockt sich meiner Kehle. Breitbeinig stelle ich mich dem Anhänger entgegen und beobachte die Bewegungen des Fahrers. Wehe, er setzt seine Fahrt fort!
Erst jetzt betrachte ich die alte Frau. Ich möchte ihr kurz gut zureden, wie einem hilflosen kleinen Kind. Sie wirkt auf mich orientierungslos. Ist sie eventuell dement und aus ihrem Heim entflohen? Vorsichtig führe ich sie ein wenig vom Gefahrenpunkt weg. Mein Blick haftet einen Tick zu lange auf ihr. Will sie durchdringen. Sie wird unruhig, bedankt sich schüchtern. Schaut mich zögernd an. Ist sie offenbar erstaunt, dass jemand sie, die Unsichtbare, sieht?
Ich nicke freundlich, frage, ob alles okay ist, warte ihr kurzes „Ja“ ab und gehe rasch zu meinem Tisch zurück. Das Brüllen des Marktbeschickers, der die Beule im Auto bezahlt haben will, ignoriere ich zunächst. Doch irgendwann ist der Bogen überspannt. Ich kann nicht anders, schreite auf den Mann zu und schnauze ihn an: „Seien Sie mir einfach nur dankbar, Sie Idiot. Das hätte tödlich enden können. Sperren Sie nächstes Mal Ihre Augen auf.“ Ich zeige ihm voller Wut den Stinkefinger und drehe mich weg. Die Bedienung bringt mir einen neuen Kaffee und kommentiert: „Geht aufs Haus. Mutige Menschen haben wir immer gern.“ Ich lächle, bedanke mich und suche nach der alten Dame. Doch sie ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Hat das Wimmelbild verlassen. Ich finde sie nicht mehr wieder. Haben alte Menschen eine Tarnkappe, die sie unsichtbar werden lässt? Plötzlich entdecke ich zahlreiche andere Menschen, die wie Statisten in diesem Bild stehen, sitzen: der Straßenmusiker, die Verkäuferin des Obdachlosen-Magazins, der Bettler mit seinem treuen Hund. Dann das traurige, einsame Mädchen, das abseits auf der Bank sitzt. Liebeskummer? Sie tut mir ein wenig leid, als ich sehe, wie ihr die Tränen die Wangen herunterkullern. Sie trösten? Auf einen Kaffee einladen? Das geziemt sich nicht, so gern ich ihr geholfen hätte. Eine Freundin taucht auf, setzt sich zu ihr. Schön zu sehen, wie sie tröstend ihren Arm um die Traurige legt. Erleichtert lehne ich mich zurück. Es ist ein schöner Nachmittag an diesem Spätsommertag in dieser wunderbaren Kleinstadt südlich von Stuttgart. Ich will ihn genießen. Es ist einer meiner wenigen freien Momente in diesem Monat. Ich sauge die Luft ein, genieße das spätsommerlich milde Aroma in dieser, spüre Wehmut, die sich in mir breitmacht, wenn ich an den Herbst denke, der regnerisch-trüb in den bitterkalten Winter überleiten wird.
Das Handy vor mir auf dem Tisch gibt ein Vibrieren von sich, reißt mich aus meinen Träumereien. Ich blicke auf das Display, um nicht lange die Nummer entziffern zu müssen: meine Frau. Besser gesagt, in Scheidung lebende Frau. Ich seufze tief und voller Schwermut auf. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Die Bedienung blickt mich irritiert an, als sie vorbeikommt. „Alles gut?“, will sie von mir wissen. Ich nicke. „Jaja, passt. Sind nur die schlechten Nachrichten.“ Ich halte das Handy in die Höhe. Die Erklärung reicht. Ein mitleidiges Lächeln schwebt mir entgegen. Ich lehne den Anruf ab und das Display wird dunkel. Nein, ich will jetzt nichts von der Mutter meiner Kinder wissen, will keine Nachrichten von dieser Frau. Sie ist vor wenigen Monaten von einem Tag auf den anderen verschwunden. Mitsamt den Kindern. Drei Kinder. Zwei ältere und ein Nachzügler. Ich atme tief durch, nehme einen Schluck Kaffee und blicke verträumt in die Sonne. Warum können sie und die Kinder nicht Teil dieser Szene hier in Kirchheim sein? Warum muss sie weit entfernt wohnen? Noch immer verstehe ich nicht, warum sie mich so urplötzlich verlassen hat. Ich war offenbar zu blöd, um die Zeichen zu verstehen. Das weiß ich jetzt. Sie, meine Frau, meinte, ich hätte es schon längst kapieren müssen. Aber das wäre ja gerade mein Problem und der Grund für unser Beziehungsende – dass ich es einfach nie geschnallt hatte, wenn was nicht okay war. Meine Freunde sagen, meine ehemalige Frau stellt das Problem dar. Sie wäre einfach ein schwieriger Typus, der nicht zu Kompromissen fähig ist. Egal, wie. Sie waren nicht mehr hier. Sondern weit weg an der Küste, im Norden. Möglichst weit weg von dieser schönen Stadt. Eine schwierige Situation für mich, wollte ich den Kontakt zu meinen Kindern nicht verlieren. Denn die Besuchszeiten zu planen, bedeutet jedes Mal einen enormen logistischen Aufwand. Gut acht bis zehn Stunden Fahrt für eine Strecke. Mieten eines Appartements, komplizierte Übergabepossen, die nie bei ihr zu Hause stattfinden durften, und vor allem sehr hohe Kosten. Ganz zu schweigen von meinen Schichten, die es nicht immer zulassen, alles so zu organisieren, wie meine Frau es wünscht. Am Ende aber stellt sie die Hauptschwierigkeit dar: Meine Ehemalige beabsichtigt, es generell nicht zuzulassen, dass ich meine Kinder weiterhin sehe. Sie wünscht sich, dass die Kinder sich von mir entwöhnen. Das ist meine eigene Geschichte. Kompliziert. Genervt zücke ich meinen Geldbeutel und winke der Bedienung. Innere Unruhe macht sich breit.
2.
Khesrau Behroz – komplizierter Name. Aber ein begnadeter Podcaster! Ich habe gerade meinen aktuellen Podcast Cui Bono, Wer hat Angst vor dem Drachenlord? abgeschlossen. Nur wenige Storys haben mich so gepackt wie diese. Podcasts sind mein Leben, daher höre ich mir viele an. Sie passen perfekt in meine Operationspausen und sorgen normalerweise für hervorragende Entspannung. Dieser allerdings nicht! Der Podcast wühlt mich auf und beinahe hätte ich eine Operation verschoben, um noch schnell die aktuelle Episode zu Ende zu hören. Ein armer Kerl namens Rainer Winkler ist der Drachenlord. Ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Franken. Sein Vergehen? Er hat Videos auf seinen YouTube-Channel hochgeladen, die nicht zwingend den Geschmack der breiten Bevölkerung treffen. Sein Unglück: dass eine spezielle Seite auf ihn aufmerksam wurde und eine inzwischen mehr als zehnjährige Hetzjagd auf ihn eröffnet wurde. Sein Problem dabei, er hat eine „kurze Lunte“, wie Khesrau Behroz das beschreibt.
Schlimmer aber ist die Massendynamik, die sich bei den sogenannten Hatern entwickelt hat. Sie haben Winkler entmenschlicht, ihn zur Sache, zum Feindbild gemacht. An sich geht es nicht um ihn. Er ist nur der Spiegel ihrer Wünsche, Aggression zu zeigen, jemand Schwächeres zu mobben. Ich würde es mit eigenen Worten als weit unter dem Niveau der Neandertaler bezeichnen. Sie begeben sich in ihr Drachen-Game, das sie mit Winkler in einer eigenen Blase spielen, verlieren jeglichen Bezug zu Werten, moralischen Grenzen oder einem Gefühl, was das mit diesem Menschen macht. Jetzt endlich verstehe ich, wie ein Großteil einer Nation kollektiv dem Nationalsozialismus und seinen krankhaften Geschichten verfallen konnte. Mit derselben Spirale innerhalb der abgeschotteten Blase, in der sich diese Gruppe befand. Ich bin komplett schockiert nach dem Podcast.
Meine nächste OP wartet. Ich muss mich beeilen! Doch die Gedanken daran kann ich nicht loslassen. Auch, als ich schon das sterile Skalpell in der Hand halte und meine Hand beobachte, wie sie in Richtung der markierten Stelle wandert, um den Körper meines Patienten zu öffnen. Wie können Menschen komplett ihren moralischen Kompass verlieren? Wie können sie vorsätzlich und bewusst ein Leben zerstören? Klar, indem sie alle Schuld zu ihm schieben. Ihn zum Bösen machen, ihn verteufeln. Wie armselig ist das alles nur? Ich schäme mich für diese Menschen. Der Warnruf meiner Arztkollegin holt mich aus meinen Gedanken zurück. Erschrocken halte ich inne und fokussiere mich auf den Eingriff. Es gilt, ein Menschenleben zu retten.
***
Müde komme ich aus dem OP heraus, schlendere den Gang hinunter. Ich habe beinahe vierundzwanzwig Stunden in diesem Haus verbracht. Mit Patiententerminen, Operationen, Pausen auf einer harten Liege und bei starkem Kaffee im Schwesternzimmer. Ich will nur noch nach Hause und schlafen. Morgen, Freitag, soll es fürs Wochenende nach Norden gehen. Zu meinen Kindern. Endlich. Meine Frau hat es gnädigerweise erlaubt. Ich darf mein Besuchsrecht ausüben. Schnell lese ich nochmals die Nachricht, die sie mir über den Messenger geschickt hat: „Vermassel es ja nicht! Du bist selbst verantwortlich, wie es weitergeht.“ Artig nicke ich mit dem Kopf. So, als ob sie es durch das Handy hindurch mitbekommen würde. Ich habe den starken Willen, es ihr gerade recht zu machen. Aus Sicht meiner Frau ein Ding der Unmöglichkeit. Wut macht sich breit über diese unmögliche Frau. Wie kann sie nur so niederträchtig sein? Ich bin ihr schutzlos ausgeliefert. Und das weiß sie auch. Ich balle die Fäuste. Lasse die Luft zischend durch meine Zähne sausen, während ich knurre: „Warte nur, wenn meine Anwältin ihren Schriftsatz angefertigt hat, dann bekommst du die volle Breitseite.“ Ich bin nicht mehr bereit, mir das noch lange gefallen zu lassen. Ich gehe den Gang entlang, bemühe mich, andere Gedanken in meinen Kopf zu bekommen. Mich an schöne Momente mit meinen Kindern zu erinnern, wenn wir endlich wieder mal gemeinsam freche Dinge tun, wie Eis essen ohne Limit. Pommes bei Mäces verschlingen, natürlich mit Mayo und Ketchup, und abends schauen wir eine Serie nach der anderen von den Pfefferkörnern, bis wir todmüde auf dem Sofa einschlummern.
Dafür habe ich bei einem netten Menschen ein Appartement einbuchen können. Dank einer Vereinigung von geschiedenen oder von ihren Kindern getrenntlebenden Vätern. Ich freue mich wie Bolle.
Ein Schatten huscht an mir vorbei, kaum sichtbar. Kaum merkbar. Ich bleibe stehen, drehe mich um. Beobachte die alte Dame, die den Gang hinunterschleicht und rechts in ein Zimmer eintritt. Ist das nicht die alte Dame vom Marktplatz? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte aber auch eine andere Seniorin sein. Warum erinnere ich mich an sie?
Ich schüttle den Kopf. Schüttle die Gedanken ab und gehe in mein Zimmer, um schnell meine Sachen zusammenzupacken. Der wohlverdiente Schlaf ruft.
Mein Blick fällt auf zwei Patientenakten. Spezialfälle, die auf meinem Tisch landen. „Für den Bezwinger der hoffnungslosen Fälle, hoffe, du kannst ihnen helfen“, steht auf einem Begleitzettel. Geschrieben von einem Kollegen. Ich bin so gesehen die letzte Anlaufstelle im Haus. Je komplizierter, desto besser.
„Na, Dr. House, geht die Arbeit mit nach Hause?“ Meine Kollegin lächelt mich an. Berührt mich sanft am Arm, während sie das sagt.
„Na, na, zu viel der Ehre, Petra.“ Ich erwidere ihr Lächeln. „Bis zu diesem großen Vorbild dauert es noch einige Zeit. Ganz zu schweigen von den geringeren Möglichkeiten in diesem kleinen Kreiskrankenhaus.“ Wir schlendern ein wenig nebeneinander her. Berühren uns leicht. Petra blickt mich mit ihren tiefblauen Augen an: „Also, mein Bester, da sagen die Patienten aber etwas anderes. Ich übrigens auch.“ Blut schießt mir ins Gesicht, als sie mich mit ihren tiefgründigen Augen anschaut. Ich stottere etwas, stolpere vor Verlegenheit und wünsche ihr einen schönen Tag. Dabei berühre ich sie ebenfalls sanft an der Schulter. „Petra, du tust mir gut“, sage ich in Gedanken. Dies laut auszusprechen, traue ich mich nicht. Sie lächelt. „Erhol dich gut“, flüstert sie und geht in ihr Zimmer. Ich blicke ihr über die Schulter hinterher. Ein toller Mensch. Ja, ich mag sie. Sehr.
Doch im Moment ist das zu kompliziert. Für mein eigenes Leben zu kompliziert, meine ich.
Ich muss mich jetzt auf meine Kinder konzentrieren und dass ich sie nicht verliere. Was, wenn sie eines Tages nicht mehr wissen, wie ich aussehe? Wenn ein neuer Mann ins Leben meiner Frau eintritt und ihn die Kinder als ihren Vater betrachten?
Der Gedanke raubt mir beinahe den Atem. Ich schnappe nach Luft, während ich mein Rad aus der Tiefgarage des Krankenhauses schiebe. Mein Herz flattert. Ich kann das nicht ertragen, solche Gedanken. Vor allem jetzt nicht, wenn man eine lange Schicht hinter sich hat, mit einer Reihe an komplizierten Operationen. Am liebsten würde ich bei solchen angstvollen Gedanken einen ordentlichen Whisky trinken oder einen Stapel Holz hacken, vielleicht auch in den Wald radeln und mir meine Lunge herausbrüllen. Oder gleich nach Norden in dieses beschissene Emden fahren, um meinem Rivalen die Eier abzureißen. Dumme Idee. Die Kollegen müssten das wieder nähen. Also doch gleich bei Ebbe in der Nordsee an einen Pfahl binden. Manches Mal kann meine Fantasie ganz schön mit mir durchgehen. Ich schüttle mein braun gelocktes Haar aus dem Gesicht und nehme Fahrt auf in Richtung Würstlesberg. Nur noch einen kurzen, aber steilen Anstieg hoch, und schon darf ich mich auf mein Bett schmeißen.
Ich bin zwar müde, doch die Gedanken lassen mich nicht einschlafen. Ich quäle mich noch eine Ewigkeit. Es dreht sich alles im Kreis herum. Die Gedanken rund um mein Leben, mein soziales Umfeld. Meine Arbeit. Meine Einsamkeit. Um den Drachenlord, genauso wie um die Teenies auf dem Marktplatz, die alte Frau. Ein Brei in meinem Kopf. „Du bist wie der Drachenlord, Basti. Einsam. Sie verfolgen dich. Deine Frau, deren Anwälte.“ Die Stimme, die im Dämmerzustand zu mir dringt, quält mich. „Nein, nein, ich bin doch nicht einsam“, versuche ich mich zu wehren. „Da gibt es doch den Rudi Selke und …“ Selbst im Halbschlaf schaffe ich es nicht, weitere Namen zu erfinden. „Rudi Selke?“ Die Stimme lacht höhnisch auf: „Das war doch dein Lehrer für Gemeinschaftskunde und Philosophie, der ist leider schon tot.“ Ich will widersprechen. Doch dazu fehlt mir die Kraft.
Diese dumme Stimme hat tatsächlich recht: Mein Beruf lässt mir wenig Zeit zu sozialen Kontakten. Es gibt ein paar Freunde, ja. Aber wie eng sind diese Kontakte? Wie viel Tiefgründigkeit besitzen diese? Petra vielleicht. Ja, Petra! Wenn ich es zulassen könnte. Meine Familie, genauer gesagt, meine Kinder, war für mich mein ganzes Leben. Bis meine Frau mir das alles genommen hat. Damit hat sie mir einen großen Teil meines Daseins gestohlen. Die Leere spüre ich unentwegt.
Ich schlafe endlich ein, obwohl es draußen noch hell ist. Unruhige Träume begleiten mich.
3.
Der Montagmorgen empfängt mich mit großer Erschöpfung.
Leichter Nieselregen begleitet meinen Weg zur Arbeit. Unkonzentriert schieße ich den Berg hinunter. Beinahe wäre ich an der Kreuzung bei Rot über die Ampel gerauscht, hätten mich die quietschenden Reifen nicht aus meinen Gedanken geholt. Dankend winke ich dem hupenden Autofahrer zu und warte geduldig auf Grün. Die restliche Fahrt durch das kleinstädtische Wohnviertel hinter dem Krankenhaus präsentiert mir hübsche, frisch restaurierte Häuschen. Schwäbisch ordentlich wieder in Schuss gebracht. Junge Familien folgen älteren Menschen, die dort oftmals über viele Jahrzehnte gewohnt haben. Übernehmen deren Heimat, machen alles neu und blicken auf ihre Zukunft. So hat es bei uns auch mal ausgesehen. Wir besaßen ein großes Haus, oben auf dem Berg. Mit weitläufigem Garten, Swimmingpool, Außensauna und noch anderem Luxus. Ach ja, der Weber-Grill hatte auch seinen edel eingefassten Platz in diesem kleinen Paradies. Eingerichtet für unsere eigene Ewigkeit. Es schien, dass wir unseren Olymp erklommen hatten und es jetzt so bleiben dürfte. Und nun? Ich bin von meinem Olymp heruntergepurzelt. Wohne aktuell ohne Frau, Kinder, Grill, Pool und Sauna in einem spartanisch eingerichteten Mini-Appartement, angedockt an eine große Villa. Es wird für meine Vermieter eines Tages als Wohnung für die Pflegekraft dienen, die sie aus welchem Land auch immer engagieren werden. Ich seufze schwerfällig, während ich mein Rad abstelle und im Gehen den Helm abnehme, Handschuhe und Radlerbrille hineinlege, bevor ich an der Pforte der netten Dame ein „Schönen guten Morgen“ zurufe. Ich lächle und werde sofort von meiner beruflichen Welt absorbiert. Ich sehe die vielen Kranken einchecken. Einzelne von ihnen werden wohl in Kürze auf meinem OP-Tisch liegen.
Ein Krankenhaus ist eine magische, gleichsam eigene Welt. Es ächzt, krächzt, stampft, krampft, verschlingt Schmerz und Leiden. Es sendet Zuversicht. Nimmt Leben. Schenkt Gemeinschaft. Es ist meine Heimat.
„Wie war die Fahrt?“ Unser Assistenzarzt steht neben Petra und genießt seinen frischen Kaffee. Sie warten geduldig, bis ich alles abgelegt und meinen weißen Kittel angezogen habe.
„Unendlich“, stöhne ich.
„Und mit den Kindern? Alles gut?“
„Alles gut. Hervorragend sogar.“
Ich lächle in mich hinein. Szenen von Sonne, Strand, Kinderlachen und einem wild tobenden Papa tauchen vor meinen Augen auf. Wir haben heimlich Pommes mit massenhaft Mayo am Strandkiosk gegessen. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Kindsmutter „zufällig“ an den Strand kam. Nach kurzem Check, ob mit den Kindern alles gut ist, hat sie sich wieder zurückgezogen.
„Es tut meiner Seele einfach nur gut, meine Kinder zu sehen. Sie zu erleben, mit ihnen Zeit zu verbringen, zu lachen, zu toben.“ Ich öffne mich gerade mehr, als mir sonst lieb ist. Doch egal. „Das ist ja schön.“ Petras Lächeln verzaubert mich sofort. Doch mein Kollege studiert mit zusammengekniffenen Augen meinen Gesichtsausdruck. „Und warum schaust du dann so zerknittert aus?“ Ertappt! „Es ist der Abschied“, sage ich nur.
Mir schien, als ob mir das Herz beim Wegfahren herausgerissen und in Emden zurückgehalten wurde. Je weiter ich mich von meinen Kindern entfernte, desto leerer und lebloser fühlte ich mich. Erst spät in der Nacht, als ich die Ausfahrt Kirchheim West genommen hatte und in meine vertraute Heimat gelangte, spürte ich Wärme und Dankbarkeit über das gerade Erlebte. Seither ist es immer wieder ein Wechselbad der Gefühle in mir.
Der Duft von Desinfektionsmitteln dringt in meine Nase und holt mich just wieder ins Hier und Jetzt zurück, als unsere Chefärztin das Zimmer betritt. „Visite in zehn Minuten. Bereit?“ Würden wir sein. Ich möchte ihr einen Kaffee einschenken, doch sie lehnt ab. „Ich muss vorher noch mit der Leitung telefonieren. Heute sind die Finanzpläne fällig.“ So schnell, wie sie gekommen ist, verschwindet sie wieder durch die Tür und wir bleiben entspannt zurück. „Zum Glück habe ich das nicht am Hals.“ Micha schmunzelt. „Pflichten gehören eben dazu, wenn man was im Leben erreichen will“, denke ich und verstecke mein Gesicht hinter der Tasse. Diesen Verwaltungskram brauche ich auch nicht. Lieber will ich knifflige Patientenleiden knacken und deren Rätsel lösen. „Braunauge, träumst du schon wieder?“ Petra stupst mich an. „Ein Königreich für deine Gedanken. Wo bist du denn schon wieder in deinem Kopfkino?“ Ich werde rot. Ja, das Träumen ist manches Mal ein Thema. Gerade bei den Operationen. Man muss zu 100 % und mehr bei der Sache sein. Gerne entgleite ich in meine inneren Welten, was für die Patientinnen und Patienten gefährlich werden kann.
Der spätsommerliche Regen ist hartnäckig, trübt diesen Morgen ein wenig. Macht ihn grau. Doch dank des Kaffeeduftes und den Menschen im Schwesternzimmer, die ich schon viele Jahre kenne, wirkt das alles etwas kuschelig-gemütlich. Ich genieße noch einen Moment die Gemeinsamkeit, winke Petra zu, die mir gegenüber an der Wand lehnt und gerade an ihrer Tasse nippt, mich aufmerksam beobachtend. Dann muss ich los. Die Visite wird in wenigen Minuten beginnen.
Ich trete auf den Gang. Micha im Schlepptau. Ich sehe erneut diesen Schatten. Ich bleibe stehen und schaue genau hin. Da ist sie wieder, diese Dame. Ja, ich erinnere mich nun sehr genau an ihren Blick und ihr Gesicht. Geduldig sitzt sie auf ihrem Stuhl vor einem Anmeldezimmer und schaut mich mit einem vorsichtigen Lächeln an. „Basti, komm. Da vorne warten sie schon.“ Micha zeigt in Richtung der Aufzüge, wo sich bereits eine kleine Ansammlung von Weißkitteln eingefunden hat. Ich bleibe stehen. Warum begegnet sie mir so oft in letzter Zeit? Diese eigenartige Dame. Die Gruppe ist bereits in den Aufzügen verschwunden, als ich mich endlich losreißen kann und Micha hinterhereile. Schnell nehme ich die Treppen, um drei Stockwerke höher vollkommen außer Puste zeitgleich mit den Kolleginnen und Kollegen anzukommen.
Die nächste gute Stunde marschieren wir durch die Gänge, von Zimmer zu Zimmer.
In anderen Krankenhäusern liegt in der Regel die Zeit für eine Visite bei drei bis vier Minuten pro Patient. Dabei ist die Redezeit des Arztes doppelt so lang wie die des Patienten, sagen die Statistiker. Aber lassen Sie mal einen Dorfbewohner von der Alb-Hochfläche zu Wort kommen! Das kann schon länger gehen. Und unsere Chefärztin liebt das irgendwie auch. Als Hamburgerin muss sie sich ohnehin einiges von uns übersetzen lassen. Wir verharmlosen gerne auch den ein oder anderen Kraftausdruck beim Übersetzen. Unter anderem unser Herr Samuel Schäufele. Schäfer in Rente seines Zeichens. An sich ein kerngesunder Mensch, wenn es nicht so kompliziert mit seiner Verdauung wäre. Seine Liebste zu Hause kocht einfach zu herzhaft für ihn. So meint er. Wir sehen auf unseren Ultraschallbildern leider etwas anderes. Doch Samu, wie er genannt werden will, lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. Er gehört zu meinen Spezialfällen, die ich intensiver betreuen kann. Samu zu heilen, wäre entgegen allen Prognosen eines meiner schönsten Ziele. Ich habe diesen ehrlichen und geradlinigen Kerl gern.
Wir verabschieden uns von dem Älbler und ziehen mit unserer Karawane weiter. Es ist schon jetzt klar, dass ich zu meiner ersten Patientensprechstunde zu spät komme. Sie würden das verstehen.
***
Eine halbe Stunde später ist mein Erstaunen groß, als ich das mir zugewiesene Sprechzimmer betrete, denn da sitzt sie wieder. Die Dame. Sie wird zu meinem Schatten.
„Wir kennen uns, nicht?“ Ich versuche zu lächeln, was mir nicht so richtig gelingt. Verfolgt sie mich jetzt? Habe ich nun eine Stalkerin aufgrund der Hilfe, die ich ihr habe zukommen lassen? Kann doch gut sein, dass sie wegen ihrer Einsamkeit anhänglich wird, weil ihr ein Mensch seine Aufmerksamkeit schenkt. Mir wird ein wenig unbehaglich. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und beobachte sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
Sie nickt auf meine Frage hin und antwortet: „Kennen, das weiß ich nicht. Aber wir haben uns schon gesehen.“
„Hier?“
Sie nickt. „Ja, ich bin in den vergangenen Jahren schon ein paarmal hier gewesen. Auch bei Ihnen. Mein Mann war Ihr Patient.“ Beschämt wende ich meinen Blick ab. Sie war mir nie aufgefallen oder ich habe sie tatsächlich wieder vergessen. Aber kürzlich, an jenem Nachmittag auf dem Marktplatz. Da habe ich sie getroffen. Ich habe ihr geholfen.
„Sie sind doch die Dame vom Marktplatz, oder?“
Jetzt blickt sie etwas beschämt, verunsichert. Leise flüstert sie „Ja“. Es ist ihr peinlich. Ich merke das.
Mit Erstaunen stelle ich fest, dass sie sich schick kleidet. Markenkleidung, Lagerfeld, Joop, Handtasche von Louis Vuitton. Ich bin beeindruckt. Lippen mit einem dezenten Rot geschminkt. Leichte Akzente um die Augen, Lidschatten? Ich kenne mich da nicht aus. Aber man sieht, sie achtet auf sich. Das macht man doch, wenn man gesehen werden will. Ich bin verunsichert. Sie wirkte vorhin aus der Ferne unscheinbar und grau. Sind nicht alle alten Menschen – unsichtbar? Für wen macht sie das?
Wir kommen ins Gespräch.
„Rheuma?“ Ich berühre sie vorsichtig an den Gelenken. Mache meine Tests und taste ihren Rücken ab, genauso wie die Gelenke.
„So sagen es die Ärzte, Ihre Kollegen. Manche meinen auch Arthrose, da könne man nichts mehr machen.“
Stumm nehme ich das zur Kenntnis. Arthrose ist immer das Totschlagargument, wenn dem Arzt nichts anderes einfällt.
Ich würde noch einige Termine mit dieser Dame machen wollen. So leicht geben wir nicht auf. Mein Entdeckergeist ist von einer Sekunde auf die andere geweckt.
„Schmerzen?“ Ich drücke vorsichtig etwas fester.
Sie zuckt kurz zusammen: „Geht so.“ Tapfere Frau.
Ich nehme ihren rechten Arm, fasse mit einer Hand unter ihren Ellenbogen und hebe ihn vorsichtig an. Die schmerzerfüllten Reaktionen bemerkte ich sofort. Doch sie sagt nichts.
„Es gibt noch einige andere mögliche Ursachen, die wir prüfen wollen, bevor wir die finale Diagnose stellen. Einverstanden?“
Ich gebe ihr mit einem Nicken zu verstehen, dass sie sich gerne wieder ankleiden kann. Dabei beobachte ich aufmerksam ihre Bewegungen. Registriere ihre Hand, die sie auf ihre Hüfte legt, schützend, helfend. Ich stelle mich nochmals prüfend vor sie.
„Was hat es mit dem Gehen auf sich? Wie kam es zu den Einschränkungen?“
„Es soll die Hüfte sein, sagen sie.“ Resigniert hebt sie die Hand. „Muss ich wohl mit leben.“
„Wann wurde das diagnostiziert?“ Ich hatte vorhin beim Abtasten im Bereich ihrer Lendenwirbel einen anderen Gedanken gewonnen.
„Vor wenigen Monaten. Bis dahin konnte ich recht ordentlich gehen. Selbst schöne Wanderungen oben beim Waldfriedhof waren kein Problem.“ Sie seufzt.
Ich erwidere: „Keine Sorge, das regeln wir. Ich verspreche Ihnen, in Kürze werden Sie wieder Seilhüpfen können.“
Sie lacht herzhaft heraus. Begeistert blicke ich auf und erfreue mich an ihrer kurz aufflammenden Lebendigkeit. Nicht mehr dieses gehemmte Benehmen, wie ich erfreut feststelle. Vom drahtigen Körperbau und der guten Muskelstruktur her könnte sie das durchaus gut schaffen, denke ich für mich. „Den nächsten Untersuchungstermin wird meine Sprechstunden-Hilfe vereinbaren. Wir bekommen das schon hin.“ Ich lächle sie an.
„Darf ich Sie zum Kaffee einladen? Als Dankeschön für Mittwoch?“
Überrascht halte ich mit meinem Bericht inne, den ich gerade in den Computer tippen will. Immerhin mit Vier-Finger-System. Also doch eine Stalkerin? Ich runzle die Stirn.
„Sind Sie beim ersten Mal immer so forsch?“, witzele ich.
Schnell kommt der Konter: „Natürlich, morgen könnte ich schon tot sein. Da muss man die Zeit nutzen. Nicht?“ Sie ist bereits an der Tür. Dort hält sie kurz inne. Dreht sich um und schaut mich an: „Und?“
„Ja, sehr gerne. Danke.“
„Also gut, wunderbar.“ Sie freut sich. „Wir wäre es am Mittwoch, gleiche Zeit, im Café am Markt?“ Ich zögere etwas, sage aber höflicherweise zu. Ohne daran zu denken, dass ich es annehmen werde.
Mein Handy piept. Gibt Signal. „Was hast du mit den Kindern angestellt? Sie sind aufsässig. Hast du sie gegen mich aufgewiegelt?“ Meine Frau scheint erbost zu sein. Ich spüre Genugtuung. Als ich wieder aufblicke, ist die Frau verschwunden.
Der nächste Patient erscheint in der Tür, mit ihm die Sprechstundenhilfe, die mir kurze Notizen gibt und die Patientenakte im Computer hochlädt. Aha, einer meiner Spezialfälle. Eifrig springe ich auf und hole ihn ab. „Kommen Sie herein, Herr Bäuerle. Ich habe am Wochenende etwas entdeckt. Ich glaube, das kann Ihnen helfen.“ Freudig wende ich mich ihm zu. Der Tag vergeht im Fluge. Genauso wie der Dienstag.
Ein Operationstag, der sich zum schwarzen Dienstag entwickelt. Der Eingriff war an sich simpel und einfach. Routine, wenn man das von einer Blinddarm-Entfernung behaupten darf. Doch die junge Patientin stirbt unserem Kollegen unter der Hand weg. Ich werde noch hinzugerufen und versuche, was in meiner Macht steht. Doch vergebens. Die junge Frau liegt regungslos vor uns. Der Bauch ist noch geöffnet und ich blicke auf einen geplatzten Blinddarm, alles hochgradig entzündet, schon längere Zeit. Wir sind zu spät. Erschreckte Gesichter verfolgen, wie ich das chirurgische Besteck resigniert zur Seite lege und die Handschuhe abziehe. Mein Kopfschütteln sagt alles. Schluchzen ist zu vernehmen. Es fühlt sich wie Faustschläge eines Profiboxers ins Gesicht und in den Bauch an. Schnell und mit voller Wucht. Alles zieht sich zusammen und es raubt dir beinahe die Besinnung. Wir stehen unter Schock. Nicht nur der unglückliche Kollege. Einen Menschen zu verlieren, der sich vertrauensvoll in deine Hand legt, ist unsagbar brutal. Man kann das Gefühl nicht beschreiben. Es ist ein tiefes Loch, das dich verschlingt und nicht mehr freigeben will.
Die Untersuchungen laufen an. Externe kommen samt Polizei ins Haus. Ein großer Aufruhr, der das Geschäft lahmlegt.
Rückblickend ist es für mich der Tag, an dem die Schwierigkeiten im Krankenhaus begonnen haben.
„Liegt es daran, dass die Patientin eine junge Frau war? Würden sie denselben Aufwand betreiben, wenn ein älterer Mensch gestorben wäre?“ Das kommt aus Michas Mund. Wir blicken zu dem Platz, an dem der Kollege sonst sitzt, dem das Unglück passiert ist. Ich muss Micha für seinen Kommentar nicht zurechtweisen. Ich weiß, wie sehr ihm das ans Herz geht, mit der toten Frau. Doch er denkt dabei an alle. Menschen sterben bei uns häufiger, als man denkt.
Der Mittwoch kommt – und geht. Das Date mit der Dame vergesse ich im dramatischen Durcheinander, das im Krankenhaus herrscht.
Ich muss an diesem Nachmittag zudem aufs Amt, nachdem ich auch am Morgen wegen des Todesfalles in der Klinik für die Befragungen zur Verfügung stehen muss. Der Fall zieht größere Kreise als gedacht. Von Fahrlässigkeit ist die Rede. Schon möglich. Doch Fließbandarbeit ist immer mit der Gefahr verbunden, dass einem die Konzentration zwischendurch entflieht. Kein Mensch kann so lange Schichten bedienen und immer auf höchstem Niveau agieren. Nein, es soll keine Entschuldigung sein. Aber die Ursache ist in unserem brutalen System zu suchen. Ein System, bei dem der Mensch immer mehr zur Ware wird. Betriebswirtschaftlich bewertet, damit auch unsere Krankenhausleitungen bestmögliche Rendite erbringen können.
Ich klopfe auf meinen Fahrradhelm, während ich vor dem Amtsgebäude mein Rad abstelle. Ein hoffentlich guter Garant, dass ich selbst nie unters Messer muss.
Die steinernen, schon tief ausgetretenen Stufen des mittelalterlichen Hauses hochzusteigen, verlangt meine Aufmerksamkeit. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Der Amtsgang ist auch nach so langer Zeit noch immer keine Routine, denn es geht nach wie vor ums Sorgerecht, und vor allem um meine Besuchszeiten. Ich bin bereit, zu kämpfen.
***
Das Schicksal treibt sein Spielchen mit mir. Rückblickend scheint es tatsächlich so gewesen zu sein, dass es sie und mich immer wieder zusammengebracht hat. Ich bin mir sicher: Dahinter steckt ein Plan.
Dieses Schicksal. Es hat das alles eingefädelt. Nicht nur zwischen uns beiden. Auch die anderen Ereignisse. Denn Zufall kann das wahrhaftig nicht sein.
Doch der Reihe nach: Am Samstag dieser Woche streune ich etwas ziellos über den Wochenmarkt. Ich peile vage mein Stamm-Café an, will mir einen guten Kaffee bestellen und das heutige „Wimmelbild“ auf dem Marktplatz aufsaugen. Es ist voller Leben. Bunt und quirlig. Die Menschen freuen sich über das Wochenende. Man spürt die Leichtigkeit. Beim Gemüsehändler am Markt will ich vorher noch etwas Salat für meine Hasen einkaufen. Sparky und Giordi. Zwei Überbleibsel aus der Zeit, als meine Kinder noch im Haus waren und die beiden Hasenherren von ihnen großgezogen wurden. Jetzt bilden die süßen Kerle mit mir eine Männer-WG. Ganz ohne Käfig oder Gitter. Sie bewegen sich so frei wie ich. Wie kleine Hunde folgen sie mir und benehmen sich in bester Weise als stubenreine Wollknäuel, die ihr Hasenklo haben. „Na, der Herr, am Mittwoch Angst vor dem Rendezvous gehabt?“ Erschrocken blicke ich neben mich und entdecke sie. Meine alte Dame. Hochrot laufe ich an. „Ach herrje, Frau …“, verdammt, warum merke ich mir nicht schon beim ersten Mal die Namen meiner Patienten? „Nennen Sie mich einfach Anni.“ Sie tippt mir auf den Arm. „Das war keine feine Sache am Mittwoch. Ich musste zahllose Verehrer abwimmeln, während ich ganz allein am Tisch gewartet habe.“ Ich schäme mich und finde keine Worte der Entschuldigung. Ich zahle rasch und nehme meine Einkäufe entgegen. Dann wende ich mich der Dame zu und hebe beide Arme, den Rechten bepackt mit der Stofftasche voller Salat, bevor ich entgegne: „Das tut mir sehr leid, also, es ist so, dass … Aber aller guten Dinge sind drei. Jetzt muss ich wohl. Oder?“ Prüfend schaut sie mich an und erwidert: „Sie müssen nicht aus Mitleid mit mir Kaffee trinken.“ Ihre Stimme klingt fast schon beleidigt. „Ich wollte Danke sagen, aber das muss nicht sein.“ Sie hat eine volle Einkaufstasche in der Hand, wechselt sie von einer Hand in die andere. Sie schickt sich an, wegzugehen. Schnell analysiere ich die Lage: Es ist Samstag. Ich darf meine Kinder nicht sehen. Wir wollten uns eigentlich zum Video-Chat treffen. Irgendein doofer Einfall meiner Frau hat das aber verhindert. Außerdem plagt mich das schlechte Gewissen. „Stopp, warten Sie!“, rufe ich laut. Einige Passanten drehen sich irritiert zu mir um. Ob ich sie etwa meine? Energisch laufe ich der Dame hinterher. Beinahe schon empört, dass sie mir davonlaufen will. Ich stottere, obwohl ich bestimmt und klar wirken möchte: „Ja, aber ja doch. Ich freue mich, mit Ihnen Kaffee trinken zu dürfen … Anni. Wirklich wahr.“ Ich nuschle noch was von Amt, Sorgerecht, Kinder und wild gewordener Ehefrau. Doch das hat sie sicherlich nicht verstanden. Egal. Ich bugsiere die Dame quer über den Marktplatz hinüber zu meinem Café. „Das lieben Sie, nicht?“ Frau Anni, so nenne ich sie insgeheim, zeigt auf die Café-Tische vor uns. „Da kann man in Ruhe beobachten, ohne dabei aufzufallen, gell?“ Ich bin ein wenig verdutzt. Aber sie hat recht. Ich will der unbeteiligte Beobachter sein. Nie mitten in der Szene. Wir setzen uns, bestellen unseren Kaffee, Kuchen und viel Sahne. Es wird ein langer Samstagnachmittag im Café in der Stadt. Wir reden über dieses und jenes, die Stadt, die Lokalpolitik, die Bundespolitik und alle anderen möglichen Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. „Frau Anni, Sie sind gut informiert. Respekt. Vor allem auch über die Regionen der Welt und was dort geschieht.“ Ich blicke sie irritiert an. Alzheimer und Demenz kann ich sofort ausschließen, im Gegensatz zu meiner Vermutung bei unserer ersten Begegnung. Das ist mir schnell klar. Ich beuge mich vor und schaue sie interessiert an: „Warum kennen Sie sich so gut in der Welt aus, Anni?“ Ich bemerke gar nicht, dass ich zum ersten Mal mit einem Menschen aus meinen Wimmelbildern rede, die ich mir sonst immer aus sicherer Distanz anschaue. Sie winkt ab und erwidert: „Das ist eine sehr lange Geschichte … Aber erzählen Sie, Herr Doktor, haben Sie Familie und Kinder?“ Mein Gesicht verdüstert sich von einer Sekunde auf die andere. Die Stimmung schlägt in einer Geschwindigkeit um, wie es sonst nur das Wetter in den Bergen tun kann. Die alte Dame erkennt das sofort und hebt entschuldigend die Hand. „Oh, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Entschuldigen Sie bitte.“ Sie ist erschrocken. Ich lege besänftigend meine Hand auf ihren Arm und beruhige sie: „Alles gut. Es ist nur so. Also, es ist alles kompliziert.“ Ich schlucke kräftig. Und dann lege ich los. Erzähle einem wildfremden Menschen alles. Es sprudelt nur so aus mir heraus: meine Kinder, die Ehe, Familie, das Denken, es ginge ewig so weiter. Der Schock der Trennung, die Einsamkeit. Jawohl, die Einsamkeit. Nach zwei Kaffee und viel Mineralwasser beende ich meine Erzählungen. Ich bin erschöpft und vollkommen erstaunt über mich. Erst jetzt erkenne ich, dass ich meine eigenen Grenzen überschritten habe. Jene, die ich mit Schutzzaun, großen Mauern und vielen Abwehrsystemen versehen habe. „Entschuldigen Sie“, murmle ich. Doch sie winkt ab und flüstert ein „Alles gut“. Erst nach einiger Zeit ergänzt sie: „Die Einsamkeit. Diese große Einsamkeit. Ich dachte, sie ist nur für die Alten und Kranken reserviert. Ich wusste nicht …“ Sie pocht mit ihrer kleinen Faust auf den Tisch und spricht entschieden: „Nein und nochmals nein! Sie sind zu jung für die Einsamkeit. Tun Sie etwas. Sie haben jetzt noch die Möglichkeiten und alle Chancen. Es könnte sonst eines Tages zu spät sein.“ Eine Träne kullert ihr die Wange herunter. Lange schweigen wir. Wir trauen uns nicht, uns anzuschauen. Diese Gefühlsausbrüche und diese Offenheit sind eigentlich ziemlich unangemessen, mitten in einem kleinen schwäbisch-protestantischen Städtchen, am helllichten Tag, bei zwei Menschen, die sich beinahe nicht kennen und von denen die eine Person mit Sicherheit mehr als doppelt so alt ist wie ich. Geziemt sich so etwas?
Egal: Ich fühle Erleichterung. Seit sehr langer Zeit zum ersten Mal. Es tut gut, darüber zu reden. „Vielen Dank“, sage ich nur und ziehe etwas beschämt über mich den Geldbeutel aus der Jackentasche.
***
Gegen späten Nachmittag trage ich der Dame die Tasche nach Hause. Vor ihrer Haustür entschuldige ich mich nochmals für den Mittwoch und sage mit nuschelnder Stimme, wie unangenehm es mir noch immer ist. Doch Frau Anni winkt ab. „Schon okay. Mir ist auch ein dringender Geschäftstermin dazwischengekommen.“ Überrascht schaue ich sie an. Zwinkernd spricht sie weiter: „… nämlich Hollywood, wissen Sie?“
Wieder dieses verschmitzte Lächeln. Das gefällt mir.
Schäkert sie mit mir? Charmant, charmant.
„Kommen Sie noch mit herein?“ Neugierig mustert sie mich. Ich nicke und betrachte das Gebäude. Modern, offenbar neu gebaut. Schöner Anblick. So also geht betreutes Wohnen heute.
„Sie fragen sich, was am Mittwoch wirklich war?“ Will sie von mir wissen. Ich nicke. „Es war nicht Hollywood, sondern der Todestag von meinem geliebten Nikolas. Es ist erst zwei Jahre her.“ Jetzt schnürt es mir den Hals zu. Mein schlechtes Gewissen wird gleich doppelt so groß. Ich sehe, sie beschäftigt das noch immer. Ist ja logisch, vermute ich. „Ich war ziemlich traurig und mitgenommen an diesem Tag. Kam gerade vom Friedhof, wo ich ihn besucht habe. Zum Café bin ich nur gegangen, weil ich nicht unzuverlässig sein wollte. Aber dass Sie nicht gekommen sind, kam mir entgegen.“ Ich verstehe und schweige.
Sie bringt zwei Campari Orange. Gerne nehme ich das kühle Glas entgegen und proste ihr zu. „Auf Nikolas“, sage ich und freue mich, dass ein Lächeln über ihr Gesicht huscht. „Auf Nikolas“, bestätigt sie. Ich betrachte die Bilder, die an der Wand hängen oder auf dem Sims stehen. Schaue die Person an, die mich mit demselben Lächeln anschaut wie Anni. Erkenne die wunderschöne junge Frau in ihr wieder. Ich sehe das ebenmäßige Gesicht, die glatte Haut. Lange Haare, mit dem Pagenschnitt jener Zeit. Jugend sprüht aus allen Pixeln des Bildes. Eine Frau zum Verlieben. In dieser Zeit.
Neugierde weckt sich in mir.
Anni folgt meinem Blick, stellt sich neben mich und prostet ihrem eigenen Bild zu. „Das war damals in Uruguay.“ Sie scheint mit diesen Worten in jene Zeit zurückzureisen. Ihre Augen erhalten einen eigenartigen Glanz. „Sie waren einmal in Südamerika?“, will ich wissen. Erstaunt, dass ein alter Mensch … Wie dumm man nur denken kann, beschimpfe ich mich selbst. Anni war auch einmal jung. „Natürlich war sie das“, tadelt mich eine innere Stimme. Jung, hübsch und dynamisch. Die Frau neben mir nickt. „Nicht nur dort und nicht nur einmal. Ich habe die ganze Welt bereist. Über viele Jahrzehnte. Gemeinsam mit meinem geliebten Nikolas. Wir folgten allen Routen dieser Ratten und stöberten sie in ihren Nestern auf. In den USA, Mexiko, Argentinien, Uruguay, Brasilien – und nicht nur dort.“ Sie hält kurz inne. Anni ringt mit sich, ob sie weitersprechen soll. Doch dann gibt sie sich einen Ruck: „Wir schworen uns, so lange deren Spuren hinterherzureisen, bis wir IHN zur Strecke gebracht haben.“ Ihre Augen verengen sich. Ich sehe, wie sie die Rechte zur Faust ballt. „Ihr habt einen Menschen gejagt? Warst du bei der Polizei? Bei Interpool?“ Eigentlich habe ich mich bereits aufgerafft, um zu gehen. Doch ich bin zu neugierig, lehne mich gegen die Kommode und schlürfe an meinem restlichen Campari. Ich versuche in dem Gesicht zu lesen, das immer mehr seine grauen Schatten verliert, Konturen bekommt und vom Charakter dieser Frau ein wenig durchschimmern lässt. „Waren Sie etwa Agentin?“ Ich versuche zu scherzen. Doch Anni bleibt ernst, schüttelt den Kopf. „Nein, das war ich nicht. Aber ich habe mit einzelnen speziellen Organisationen zusammengearbeitet.“ Mehr sagt sie nicht. Ich zögere zunächst, bevor ich meine Frage loswerden will: „Haben Sie denn diese Menschen umgebracht? Was heißt, zur Strecke gebracht?“ Doch Anni antwortet nicht. Schweigt nur.
An der Tür, als sie mich verabschiedet, sagt sie nur: „Unser Wunsch war, für Gerechtigkeit zu sorgen. Schlimme Taten zu rächen. Vielen Dank für den Besuch, Herr Doktor. Hat mich sehr gefreut.“ Ich gebe ihr zum Abschied die Hand und verlasse das Haus.
4.
Ich knülle den vorläufigen Untersuchungsbericht zusammen. Drücke ihn, presse ihn. Forme eine Kugel. Mit der Linken hebe ich ihn in die Luft, konzentriere mich und schmeiße ihn in Richtung Miniatur-Basketballkorb, den ich über dem Papierkorb angebracht habe. „Yes“, schießt es aus meiner Kehle. Ich recke siegesbewusst die Hand in die Luft. „Toooor.“ Das ist die beste Verwertung dieses blöden Berichtes!
Man möchte den Kollegen disziplinarisch belangen. Ich glaube, zu Unrecht. Er ist ein Guter. Das System müsste man belangen. Genauso wie meine Frau. Ex-Frau, hoffentlich. Ich überlege mir, ob ich sie wegen Mobbings anzeigen soll. Diese ständigen Messenger-Nachrichten sind wie Faustschläge in die Magengrube. Sie beabsichtigt, mir die Zeiten mit meinen Kindern verbieten zu lassen. Ich täte ihnen nicht gut, behauptet sie. Eine Therapeutin hätte das bestätigt. Vermutlich eine Freundin. Ich schnaufe laut auf. Ja, das macht mich wütend. Ist sie eifersüchtig, weil ich mich mit den Kids so gut verstehe? Tausende Zeugen könnte ich dafür aufrufen: die vom Strand, von der Pommes-Bude, der Kartbahn und allen anderen Orten, an denen wir waren. Wir haben immer eine gute Zeit und viel Spaß miteinander. Die Kinder erzählen viel und wir sprechen über so viele Dinge, die sie beschäftigen. So ist das eben.
Auf dem Baum direkt vor meinem Fenster sitzt eine Amsel. Sie schaut mich auffordernd an, beschimpft mich durch das offene Fenster hindurch. „Was?“, rufe ich ihr zu. Und ja, ich rede mit Tieren. Liebe diese Kreaturen. Die Amsel schimpft weiter. Auch, als sich die Tür öffnet und meine Sprechstundenhilfe den nächsten Patienten ankündigt.
„Danke“, sage ich etwas abwesend und winke der Amsel zum Abschied zu. Sie hält kurz inne, meckert weiter und fliegt los. Ich werde mir später Gedanken machen, was sie mir sagen wollte.
„Wer ist es?“, will ich wissen.
„Niemand von Ihrem bestehenden Patientenstamm. Eine junge Frau wartet. Sie ist neu. Die Kollegen von der Inneren schicken sie. Hat offenbar starke Unterleibsschmerzen.“ Sofort bin ich hellwach. Eine junge Frau mit starken Unterleibsschmerzen? Sie wurde von den Kollegen geschickt, die das nicht veranlassen würden, wäre es nichts Ernstes. Das klingt nicht gut.
„Ich komme“, sage ich rasch und schnelle aus dem Bürostuhl hoch.
„Behandlungszimmer 4“, ruft mir meine Kollegin nach, während ich in den Gang hinaustrete.
Bekannte Gesichter grüßen, die an mir vorbeieilen und im Gewusel verschwinden. Wieder einmal sehr viel los nach einem sonnigen Wochenende.
„Guten Morgen, mein Name ist Dr. Wohlfart.“ Ich schaue sie gar nicht richtig an. Setze mich an meinen Tisch und studiere die Krankenakte. „Und Sie sind?“ Ich schaue auf das Namensfeld in der Akte: „… Frau Laura Jordan, richtig?“ Erst jetzt blicke ich auf und sehe ihr Nicken. Ihre funkelnden, grünen Augen blicken mich an. Eine Mischung aus Schmerz, Angst und Flehen spricht aus ihrem ovalen Gesicht, dessen Stirn Falten wirft. Sie muss Krämpfe haben, so wie sie nach vorne gebeugt, etwas zusammengekrümmt auf dem Stuhl sitzt. Laut meinen Unterlagen ist sie siebzehn Jahre alt. Bald achtzehn. Die roten Haare fallen bis zu ihren Schulterblättern herunter. Lange, lockige Haare. Tiefe, dunkle Augenränder nehmen ihr die jugendliche Frische.
„Wie geht es Ihnen?“, will ich wissen.
„Gut“, ihre lapidare Antwort. Höre ich da Misstrauen und Trotz aus ihrer Stimme?
Ich setze mich auf meinem Drehhocker ihr gegenüber und betrachte sie aufmerksam: „Und wie geht es Ihnen wirklich?“
Sie kneift die Augen zusammen und meckert: „Na, wie soll es mir gehen, wenn ich hier bin? Scheiße geht es mir.“ Sie bedeckt mit beiden Händen ihren Bauch unterhalb des Nabels. „Krämpfe?“, will ich wissen, ohne auf ihre schnippische Art einzugehen. Sie nickt stumm. „Hat man Ihnen ein Schmerzmittel verabreicht?“ Wieder nickt sie. „Die Tabletten wirken aber nicht.“
Ich beginne mit meinen Untersuchungen. Die junge Frau will mich erst nicht an sich heranlassen. Misstrauen schlägt mir entgegen.
Ich versuche sie zu beruhigen und sage in sanftem Ton: „Ich möchte gerne verstehen, was die Ursache für Ihre Schmerzen ist. Dafür muss ich Sie untersuchen, wenn das okay für Sie ist.“ Ich zeige auf die Liege: „Wäre es möglich, dass Sie Ihr T-Shirt ausziehen und sich hierauf legen?“
„Warum? Es gibt doch schon eine schlimme Diagnose“, bellt sie mich an. „Die Überlebenschancen sind nicht hoch.“ Erschrocken halte ich inne. „Wer sagt das?“ Ich hatte den Bericht bislang nicht gelesen. Mache ich eigentlich nie, um mir mein eigenes erstes Bild zu machen.
„Na, Ihre Kollegen, die Götter in Weiß aus der anderen Abteilung.“ Sie stöhnt, als sie das sagt. „Sie sagen, ich hätte einen Tumor oder irgend so was. Steht alles da.“ Sie zeigt auf den Computer und meint damit wohl die Krankenakte.
„Na ja, noch leben Sie und das ist ein gutes Zeichen. Wir haben also noch Optionen.“ Ich versuche, mit meinem vermeintlichen Scherz die Situation zu entspannen. Doch der Schuss geht nach hinten los. Tränen schießen aus den Augenwinkeln der jungen Frau. Sie schluchzt: „Ich will nicht sterben.“ Ich könnte mir selbst in den Hintern treten wegen meiner flapsigen Art.
„Darf ich Sie nun untersuchen?“, frage ich in sanftem Ton und zeige erneut auf die Liege. Sie nickt und zieht das T-Shirt aus.
Vorsichtig taste ich ihren Bauch ab. Registriere jedes Zucken, erfühle feste Stellen und nehme die enorme Hitze wahr, die ihre untere Bauchregion ausstrahlt. Beinahe wie ein Ofen.
„Sie sind doch der Mann vom Marktplatz, oder?“
Ich schaue sie erstaunt an. „Marktplatz? Was meinen Sie?“ Erst jetzt beginne ich, die Bilder meiner Kollegen anzuschauen, die sie mit ihren kostspieligen Geräten gemacht haben. „Na, neulich, als die alte Frau beinahe überfahren worden wäre.“ Ich kann mich erst nicht erinnern. Doch dann merke ich, dass sie Frau Anni meint. „Ja, der bin ich. Und Sie? Waren Sie auch vor Ort?“
Sie nickt und schaut etwas beschämt weg.
„Ich saß mit meinen Freunden und Freundinnen dort.“
„Die Clique, die gelästert hat?“ Ich runzle die Stirn und betrachte sie mir genauer. Sie nickt zögerlich. „Ja, das waren wir. Wir haben sie doch nicht wirklich ausgelacht!“ Die Entschuldigung kommt nicht authentisch herüber.
Ich scanne ihr Gesicht und erinnere mich vage. Es sind die roten Haare, die mir helfen. Sie waren an dem Tag unter einem Base-Cap halbwegs versteckt. „Ihr habt ihr nicht geholfen. Sie wäre beinahe unter die Räder gekommen“, tadle ich, während ich behutsam ihre Lymphknoten in der Beuge abtaste. Fühlen sich wie ein Knoten an. Kein gutes Zeichen. „Was für ein Zufall“, sage ich, um sie von meinem ernsten Blick abzulenken, den sie registriert. „Ja“, sagt sie nur. Ich gebe ihr ein Zeichen, dass sie sich wieder anziehen kann, was sie auch schnell macht. „Irgendwann liegt die ganze Stadt bei mir auf dem Tisch“, versuche ich dabei zu scherzen. Ich sehe ihren Blick. Angst und Sorge.
Bauchschmerzen. Lymphknoten. Schmerz. Keine gute Kombination.
Ich reiße mich zusammen. Verzichte darauf, sie wegen der Frau weiter zur Rede zu stellen.
„Frau Jordan, ich verspreche Ihnen, dass wir das hinbekommen. Ich muss mit den Kollegen sprechen und wir müssen noch ein paar Untersuchungen durchführen. Okay für Sie?“ Sie nickt.
„Ich sehe, dass Sie in der Stadt wohnen? Wie kann man Sie erreichen?“ Meine Patientin zögert etwas: „Am besten übers Handy.“ – „Und Ihre Eltern? Sind die informiert? Kann man die auch erreichen?“
Schnell kommt ein „Nein“ aus ihr heraus. „Meine Eltern haben hiermit nichts zu tun. Die Adresse ist die einer betreuten Wohngruppe. Doch da bin ich nur selten. Also notieren Sie bitte meine Handynummer.“ Ich meine zu verstehen, nicke und tippe die Nummer ein.
Ich werde intensiver mit ihr in Kontakt kommen. Über längere Zeit. Das wird mir schnell klar. Es wird ein Kampf um ihre Gesundheit werden. Hoffentlich nicht um ihr Überleben! „Wir schaffen das.“ Ich schüttle ihr die Hand zum Abschied. Dabei entdecke ich braune Flecken an ihren Lippen. Wie Leberflecke. Nur an einer Stelle, wo sie nicht hingehören. Und Brandflecken sehen anders aus. Es rattert in meinem Kopf, wie bei einem Rechner, der seine Archive durchstöbert. Bits und Bytes rasen in wilder Geschwindigkeit hin und her. „Bis bald.“ – „Ja, Tschüss.“ Ich sehe ihr noch nach, wie sie aus dem Zimmer geht. Traurig lässt sie mich zurück. Das sind die Momente, in denen ich meinen Beruf nicht wirklich gernhabe. Momente, in denen ich Angst habe, zu versagen und ein Menschenleben zu verlieren.
Werde ich Laura helfen können? Ich nage in Gedanken verloren an meinem Bleistift.
Die Tür öffnet sich und Petra tritt ein. Meine Stimmung hellt sich auf und dankbar gehe ich auf sie zu. Zum ersten Mal umarme ich die überraschte Kollegin und sage einfach nur „Danke“. Weiß sie eigentlich, dass sie in meiner Jugend die Liebe meines Lebens war? Wir hatten uns über viele Jahre aus den Augen verloren. Sie war nach Köln gezogen, um dort zu arbeiten und zu leben. Erst im vergangenen Jahr kam sie in ihre Heimatstadt zurück und seit dieser Zeit haben wir uns wieder gesehen. „Wofür?“, will sie wissen. „Einfach so, dass es dich gibt“, antworte ich. Sie blickt mich intensiv an. „Du bist traurig? Was ist passiert?“ Ich fange an, es ihr zu erzählen.
***
Am nächsten Morgen verlasse ich Petras Wohnung deutlich früher als sie, damit niemand Verdacht schöpft. Doch wie es der Zufall will, kommt ausgerechnet jetzt der Internisten-Kollege um die Ecke und freut sich über meinen Anblick. „Hi, Basti, auch schon so früh unterwegs?“ Er blickt mich verschwörerisch an. „Auch aus einer anderen Haustür herausgekommen? Willkommen im Club.“ Er klopft mir auf die Schulter und freut sich wie ein kleiner Junge. Ich stottere etwas von „Wollte beim weltbesten Bäcker ’ne Seele holen“ und so weiter. Doch Kollege Internist geht nicht darauf ein. „Wir Singles dürfen das ja. Das stört niemanden. Aber wenn zu Hause jemand auf dich wartet und die Kollegen erzählen, sie sind auf Fortbildung, in Wirklichkeit aber zwei Viertel weiter im siebten Himmel, ist das nicht ganz stressfrei.“ Er lacht. Ich wusste das alles gar nicht. „Wer denn mit wem?“, will ich wissen. Doch mein Mitverschwörer schüttelt mit dem Kopf und legt den Finger an den Mund: „Betriebsgeheimnis. So etwas geht nicht heraus.“ Na klar. Aber er weiß alles. Klatschweib!
„Wie bist du denn mit der Kleinen zurechtgekommen, die wir dir gestern geschickt haben? Siehste ’ne Chance?“
Ich brauche ein paar Sekunden, um umzuschalten. „Meinst du Laura, die junge Frau?“ Er nickt und antwortet: „Die eigenartigen Verwachsungen und Wucherungen habe ich bisher nicht gesehen. Vor allem bei so einem jungen Menschen. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?“ Ich zucke mit den Schultern. „Keine Ahnung. Sie war erst zu einer Sitzung bei mir. Es braucht noch mehr Untersuchungen und wir müssen Gewebeproben nehmen, um sie ins Labor zu schicken.“ Dieser Spruch gilt als Aufforderung für ihn und sein Team, das zu übernehmen. Doch Arno bleibt stehen und schaut mich an: „So viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Diese eigenartige Wucherung hat die Nieren erreicht und bereits regelrecht umschlungen.“ Er geht den Weg entlang. Ich versuche, mit ihm Schritt zu halten, während ich das Fahrrad auf dem engen Gehweg herumjongliere. „Wie viele Tage?“, will ich von ihm wissen. Er schaut weiterhin nach vorne, während er antwortet: „Keine Ahnung. Ein paar wenige Wochen?“ Mir stockt der Atem. Diese junge Frau soll bald sterben? „Das wäre bei den aktuellen Untersuchungen zu der Toten in der OP keine gute Meldung, schätze ich.“ Ich werde kurz wütend. So viel Zynismus ist nicht angebracht. Gerade bei dieser jungen Patientin. „Dann lass uns sofort etwas tun. Verlieren wir keine Zeit!“, rufe ich ihm hinterher. Doch er winkt ab: „Wir sind doch schon dabei, Basti. Gegen alle ihre Widerstände haben wir sie gestern bereits auf die Station gebracht. Ich sag’s dir. Beinahe hätten wir sie fesseln müssen. Das ist ein wildes Ding.“ Ich sehe die kupferroten Lockenhaare vor meinen Augen, die energisch durch die Luft wirbeln, wenn ihre Trägerin wütend wird. Ich muss lächeln. Schnell hake ich fachlich nach: „Behandlungsform aktuell?“ „Das Standardprogramm. Wir haben sie an den Tropf gehängt und mit einem ersten Medikamentencocktail versehen.“ Er beginnt, alle Medikamente aufzuzählen, die enthalten sind. Klingt vernünftig, denke ich. Doch als wir im Krankenhaus ankommen, empfängt uns schon die Stationsschwester. Aufgeregt fuchtelt sie mit den Armen: „Soso, die Herren! Wozu hat man einen Piepser? Sicherlich nicht, um ihn zu Hause liegenzulassen.“ Erschrocken fasse ich mir an den Gürtel. Da ist nichts. Ich muss ihn bei Petra vergessen haben. Noch bevor wir nach ihrer Aufregung fragen können, zieht sie uns mit sich. „Es ist der Neuzugang von gestern. Sie ist in der Nacht kollabiert. Sie scheint eines der Mittel nicht zu vertragen.“ Sofort sind wir alarmiert und hellwach. „Wo ist sie jetzt?“, will ich wissen. „Auf der Intensiv.“ Wir eilen den Gang hinunter und zwei Treppen nach oben.
„Sie hat offenbar Allergien, von denen wir nichts wissen“, begrüßt uns der diensthabende Kollege, während wir an ihr Bett treten. Ich erkenne nichts mehr von der Lebendigkeit der jungen Frau wieder, die gestern in meiner Sprechstunde war. Zu dem Kollegen gewandt fordere ich in einem barscheren Ton als notwendig: „Könnt ihr mir die genaue Liste der Medikamente geben, die ihr verabreicht wurden?“ Irritiert blickt mich der Angesprochene an. Nickt aber. „Schlecht geschlafen?“, will er von mir wissen.
„Nein, in großer Sorge. Aus der Patientin scheint das ganze Leben gewichen zu sein. Wie lautet eure Diagnose?“
Der Kollege zieht die Schultern hoch und erwidert: „Offen gesagt, weiß ich es noch nicht. Sie hat einen lebensgefährlichen Schock erlitten. Wir stabilisieren sie gerade und haben alle anderen Medikation sofort abgesetzt.“ – Ich nicke und wiederhole: „Die Liste bitte.“
Kurz öffnet die junge Frau die Augen und lächelt, als sie mich erkennt. Ich drücke sanft ihre Hand und flüstere: „Schlafen Sie jetzt. Alles wird gut.“ Mit einem Lächeln schläft sie wieder ein.
Ich blicke mich auf der Station um. Fünf Betten sind belegt. Man erkennt die Menschen hinter den Geräten und Schläuchen beinahe nicht mehr. Junge wie alte Menschen sind hier versammelt. Eine gemeinsame Sache vereint sie: der Wunsch, wieder gesund zu werden. „Komm, wir gehen in dein Zimmer und suchen nach einem Weg für die junge Dame.“ Arno zieht mich mit sich.
Auf dem Weg zu meinem Büro treffe ich Frau Anni. Erstaunt bleibe ich stehen und frage: „Haben wir einen Termin heute?“ Sie aber schüttelt den Kopf und zwinkert mit dem Auge, als sie mir antwortet: „Nein, nein. Keine Angst. Ich stalke Sie nicht. Ich besuche eine Freundin. Sie liegt mit einem gebrochenen Bein im dritten Stock.“ Ich berühre freundschaftlich ihre Schulter und wünsche ihr einen schönen Tag.
Ich schaue meinen Kollegen an. Seit heute Morgen, als er mich vor Petras Tür ertappt hat, fühlt sich die Beziehung an wie mit einem Verbündeten. Wir haben ein gemeinsames Geheimnis: „Aus welcher Tür bist du eigentlich heute Morgen gekommen, Arno? Wer ist die Angebetete?“ Ich zwinkere ihm zu. Doch er wehrt mit erhobenem Zeigefinger ab: „Na, na, na. Nur nicht zu naseweis. Du weißt doch, alles bleibt geheim.“ Ich lasse nicht locker. „Sag schon!“ Er lächelt verschmitzt und gibt sich einen Ruck: „Es ist keine Sie. Es ist ein Er.“ Ich wirke etwas überrascht. Das sieht er. Aber nur kurz. Ich klopfe ihm auf den Rücken. „Na, wunderbar. Glückwunsch. Jemand aus dem Haus?“ Er nickt. Dann schweigen wir aber darüber. Ich selbst gehe in Gedanken alle Namen und Gesichter durch. Wer könnte es sein?