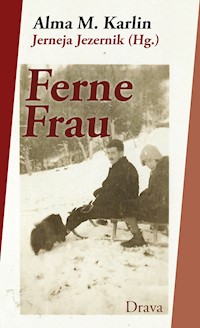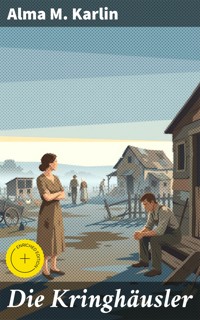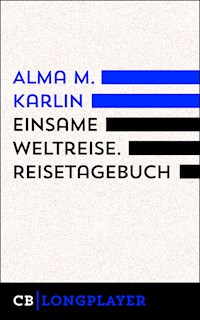12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wird aus dem mit einer halbseitigen Lähmung geborenen Kind, das laut Aussage der Ärzte sein – kurzes – Leben lang geistig behindert bleiben sollte, eine wagemutige und idealistische Pionierin? 1930/31, auf der Höhe ihres Schriftstellerinnenruhms, schreibt Alma M. Karlin eine Autobiografie voller Witz und (Selbst-) Ironie über die ersten dreißig Jahre ihres Lebens – zugleich eine kühne, humorvolle und kritische Betrachtung des beginnenden 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. 1908 entflieht Alma M. Karlin der Enge ihrer Heimatstadt Cilli (Celje) und geht nach London. Dort studiert sie Sprachen und verdient ihren Lebensunterhalt mit Übersetzungen und Privatstunden. 1914 muss sie London wegen des Ersten Weltkriegs verlassen und lebt danach in Norwegen und Schweden. 1919 bricht sie zu einer achtjährigen Weltreise durch fünf Kontinente auf. Nach ihrer Rückkehr wird sie eine der berühmtesten europäischen Reiseschriftstellerinnen. Mit ihrer bislang unveröffentlichten Autobiografie ist die ungewöhnliche Weltreisende wiederzuentdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2020
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © AvivA
© Alma M. Karlin:www.sanjepublishing.com
Zusammenstellung, Anmerkungen und
deutsche Übersetzung des Nachworts:
© 2018 AvivA Verlag
Die Publikation wurde gefördert durch die Slowenische
Buchagentur JAK. Herzlichen Dank!
Erscheinungsdatum: Dezember 2020
ISBN 978-3-95988-178-4
Über das Buch
Wie wird aus dem mit einer halbseitigen Lähmung geborenen Kind, das laut Aussage der Ärzte sein – kurzes – Leben lang geistig behindert bleiben sollte, eine wagemutige und idealistische Pionierin? 1930/31, auf der Höhe ihres Schriftstellerinnenruhms, schreibt Alma M. Karlin eine Autobiografie voller Witz und (Selbst-) Ironie über die ersten dreißig Jahre ihres Lebens – zugleich eine kühne, humorvolle und kritische Betrachtung des beginnenden 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges.
1908 entflieht Alma M. Karlin der Enge ihrer Heimatstadt Cilli (Celje) und geht nach London. Dort studiert sie Sprachen und verdient ihren Lebensunterhalt mit Übersetzungen und Privatstunden. 1914 muss sie London wegen des Ersten Weltkriegs verlassen und lebt danach in Norwegen und Schweden. 1919 bricht sie zu einer achtjährigen Weltreise durch fünf Kontinente auf. Nach ihrer Rückkehr wird sie eine der berühmtesten europäischen Reiseschriftstellerinnen.
Mit ihrer bislang unveröffentlichten Autobiografie ist die ungewöhnliche Weltreisende wiederzuentdecken.
»›Ein Mensch wird‹ stimmt einen abenteuerlustig und welthungrig – es ist ein Reisebuch im besten Sinne.« Cornelia Wolter, FAZ
Über die Autorin
1889 kommt Alma Maximiliana Karlin im deutschslowenischen Cilli (Celje) im damaligen Österreich-Ungarn zur Welt. 1908 geht sie nach London, wo sie sich dem Sprachenstudium widmet und ihren Lebensunterhalt mit Übersetzungen und Privatstunden verdient.
Nach dem Ausbruch des ersten Weltkriegs 1914 verlässt sie London und lebt bis 1918 in Norwegen und Schweden, bevor sie für kurze Zeit nach Cilli zurückkehrt. 1919 bricht sie schließlich zu ihrer Weltreise auf, die sie in den folgenden acht Jahren durch fünf Kontinente führen sollte. Durch ihre Reiseerlebnisbücher »Einsame Weltreise« und »Im Banne der Südsee«, die sie nach ihrer Heimkehr nach Cilli verfasst, wird sie zu einer der berühmtesten und meistbewunderten europäischen Reiseschriftstellerinnen.
Sie ist im Gegensatz zu den meisten ihrer zur deutschen Minderheit gehörigen Verwandten und Bekannten eine entschiedene Gegnerin des Nationalsozialismus, unterstützt jüdische Flüchtlinge und wird nach der Besetzung Jugoslawiens durch die Deutschen sofort inhaftiert. Nach ihrer Entlassung schließt sie sich dem slowenischen Widerstand an, gemeinsam mit Thea Schreiber-Gammelin, mit der sie seit 1931 zusammenlebt.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist sie dennoch als deutschsprachige Schriftstellerin in Jugoslawien verpönt, bekommt auch keinen Reisepass. Sie stirbt 1950 arm und vergessen in der Nähe von Cilli. Erst seit der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 wird sie allmählich wiederentdeckt.
Über die Herausgeberin
Jerneja Jezernik wurde 1970 in Celje/Slowenien geboren, studierte Deutsch und Slowenisch in Ljubljana und war mehrere Jahre in Deutschland und in Österreich als Sprachlehrerin, Redakteurin und Leiterin einer Slowenischen Studienbibliothek tätig. Jerneja Jezernik hat Alma M. Karlins Werke ins Slowenische übersetzt und verfasste 2009 die erste Monografie über Alma M. Karlin, auf die 2016 eine umfangreichere Biografie folgte. Sie lebt als freie Redakteurin und Lektorin, Schriftstellerin und Übersetzerin in Ljubljana.
Alma M. Karlin
Ein Mensch wird
Auf dem Weg zur Weltreisenden
Vorwort
Viele Leute, die mein Reisewerk Einsame Weltreise, Im Banne der Südsee gelesen haben, wollen nun wissen, wie ich zu solchem Entschluß gekommen, ja wie ich überhaupt der Mensch geworden, der ich bin, und da diese Fragen sich unaufhörlich mehren, fühle ich mich bemüßigt, einem Begehren Folge zu leisten, das ich zwar durchaus berechtigt finde, dessen Erfüllen mich jedoch starke Überwindung kostet.
Es ist nämlich sehr schwer, seine eigene Geschichte zu schreiben. Man steht da im Mittelpunkt der Dinge und gewinnt nur mit Mühe jenen Abstand vom Ich, der wenigstens eine bedingt unpersönliche Beurteilung zuläßt. Ferner entsteht die Frage, was wegbleiben darf, ohne einerseits das Verstehen des Entwicklungsganges zu stören und ohne, andrerseits, den letzten Schleier von der Seele zu ziehen, den eine Frau immer über ihr innerstes und tiefstes Fühlen breitet. Und noch ein großes Hindernis legt sich dem Schreiben der eigenen Lebensgeschichte in den Weg: Jeder Mensch, der uns streift, ist unser Lehrer, der unbewußte oder bewußte Former unseres Charakters, so daß unsere Seele einem Paß vergleichbar ist, in dem jeder, der irgendwie in unser Schicksal eingegriffen, sein Visum oder seinen Stempel zurückgelassen hat. Ob kräftig oder schwach, keiner verwischt sich jemals ganz.
Daraus erwächst indessen die unangenehme Notwendigkeit, die wichtigsten Stempel zu beschreiben, die einem aufgedrückt worden sind, und da in der Regel die schmerzhaftesten Aufdrücke die kräftigsten zu sein pflegen, verletzt man leicht – selbst nach vielen Jahren und wenn längst aller Groll geschwunden ist – Leute, mit denen jeder innere sowie äußere Zusammenhang verloren gegangen ist. Noch weit schwerer ist es, Erziehungsfehler aufzurollen, da darin zuzeiten etwas wie ein Vorwurf gegen die Toten liegt, und wenn ich es dennoch tue, so geschieht es, weil meine Eigenart (eine auffallende, um nicht zu sagen unangenehme Eigenart) sonst völlig unverständlich bliebe. Vorwiegend aber tue ich es, damit Erziehende und vor allem Eltern, die dieses Buch lesen, Irrtümer vermeiden, deren Tragweite oft gar nicht zu ermessen ist.
Weil man sich über den eigenen Werdegang am leichtesten klar wird, wenn man ihn mit dem anderer vergleicht, und weil das eigene Schicksal weniger hart scheint, sobald man es mit einem härteren verglichen hat, wollte ich – für die vielen Frauen der Welt – dieses Buch schreiben, denn sie werden daraus mehr lesen als in kargen Worten, die doch immer nur brüchigem Laub gleichen, geschrieben steht, und vielleicht wird gerade an dem Ungeschriebenen eine kämpfende Seele erstarken.
Deshalb enthülle ich das, worüber ich weit lieber schweigen möchte.
Die Verfasserin,
Cilli, im Herbst 1931.
DIE VERKÜNDIGUNG
Mein Vater und meine Mutter waren beide alt. Sie hatten ungewöhnlich spät geheiratet und hofften, den Rest ihrer Tage in angenehmer Beschaulichkeit zu verleben. Sie kauften das Haus an der Laibachermaut, wo im Mittelalter das Stadttor gestanden und bis wohin sich zur Römerzeit die Ausläufer der Arx erstreckt hatten – damals, als man Cilli noch Claudia Celeja und ein zweites Troja nannte. Als mein Vater einmal ein Loch im Keller näher untersuchte, stieß er auf den seicht im Boden vergrabenen Grabstein eines römischen Kriegers und mauerte ihn über dem Kellertor ein. Der Geist dieses Römers soll heute noch umgehen...
Niemand dachte an Kinder, denn meine Mutter näherte sich den Fünfzigern. Sie hatte, um vollkommen unabhängig zu bleiben, ihren Lehrberuf nicht aufgegeben, als sie den alten und kränklichen Offizier heiratete. Tagesausflüge mit froher Einkehr, ruhige Sommerfrischen, kurze Reisen in eine Großstadt bildeten den Grundriß alles Wünschens und Planens. Wie zwei Kähne im Abendschein kaum merklich dem Ankerplatz zutreiben, hofften meine Eltern, in den Abend ihres Seins auf friedvollen Wassern hineinzugleiten, und die durch diese Heirat zuerst bitter erregten Gemüter der nächsten Angehörigen beruhigten sich nach und nach. Es gab am alten Laibachertor eben ein sehr bejahrtes Ehepaar mehr, dem eine ebenfalls alte Köchin diente, die samt Haus und Hof übernommen worden war, und sogar einen uralten grünen Papagei, der »Herr Major! Herr Major!« krächzte, so oft die Stiegentüre aufging.
Eines schönen Tages – mein Vater glitt sanft in sein sechzigstes Lebensjahr – sagte meine Mutter, die eine bewunderte Gestalt (eine sogenannte Wespentaille) und die Haltung einer Königin hatte: »Leider ist ein Irrtum ausgeschlossen! Ich gehe auf wie ein Germteig; mein ganzes Aussehen ist verdorben. Gewiß habe ich irgend ein Gewächs im Bauch.«
»Das ist manchmal so, im Wechsel«, meinte der Vater in seliger Ungewißheit.
Sie versuchten, den lästigen Fremdkörper mit Essigumschlägen und zahlreichen Seidlitzpulvern loszuwerden, doch als anstelle eines Schwindens ein dauerndes Zunehmen zu merken war, fuhr meine Mutter zum bekannten Frauenarzt Dr. Valenta in Laibach, ließ sich genau untersuchen und fragte endlich seufzend: »Wann muß er denn schon entfernt werden – der Polyp?«
»Nicht nötig!« erwiderte der alte Frauenarzt schmunzelnd, »er wird in vier Monaten selbst kommen und essen und trinken wollen...«
Ich glaube, daß diese Antwort zu einer Ohnmacht führte. Bestimmt weiß ich es nicht, obschon ich ja gewissermaßen mit dabei war. Jedenfalls war das ein Blitz aus heiterem oder doch nur mäßig bewölktem Himmel. Ein Gewächs schnitt man heraus und so war die Geschichte erledigt. Mit einem Kind fing die Sache erst an...
Es gab viele, viele Tränen, und selbst mein Vater, der lungenleidend und dem Grabe nahe war, fühlte sich seltsam erschüttert, doch war er nicht umsonst in vier Schlachten gewesen und daher gewohnt, dem Feinde in die Augen zu schauen. Er sagte beruhigend: »Ich war immer ein Pechvogel, aber einige Zeit lebe ich wohl noch und mit sieben Jahren kann der Knabe in die Kadettenschule aufgenommen werden.«
Er nannte die Namen mehrerer einflußreicher Waffenbrüder, die das Kind schon fördern würden, setzte sich auch sogleich mit ihnen wieder in Verbindung, schwankte, ob er, meiner künftigen Laufbahn willen, das Adelsprädikat »von Waldisheim« annehmen sollte, und fand sich mit dem Kommenden wie ein alter Soldat mit einem verlorenen Bein ab.
Meine Mutter dagegen weinte bitterlich. In diesem Alter war eine Geburt gefährlich und dann: alle die, die sich über diese verspätete Heirat geärgert hatten, ließen es an Spott und an Schreckreden nicht fehlen. In jenen seligen Vorkriegsjahren galt eine Frau mit dreißig als »passee«. Man kann sich also denken, was zwei weitere Jahrzehnte ausmachten! So wurde ich schon vor meinem Erscheinen zu einem Wunder, und Wunder sind und bleiben unbeliebt.
Unterdessen wurde ein himmelblaues Taufkissen für den Sohn vorbereitet und nur die Lehrerinnen der städtischen Mädchenvolksschule – Frauen haben gar oft einen kleinen Hang zu Ironie – schenkten Mutter ein Taufkissen in Rosa.
In dieser Welt des Jammers konnte man nie wissen...
DIE GEBURT
Bis auf die leidige Tatsache, daß ich eben im Kommen und ein ganz unvermeidliches Übel war, benahm ich mich durchaus anständig. Ich verursachte meiner Mutter weder Unbehagen noch Schmerzen und als ich auftauchen sollte, erschien ich mit lobenswerter Schnelligkeit, an einem Oktobersonntag gegen halb zehn Uhr nachts.
»Wo ist der kleine Maximilian?« erkundigte sich mein Vater, der diesen Namen (vielleicht nach dem unter Diokletian in Celeja enthaupteten Heiligen) für den zukünftigen Kadetten und angehenden Feldmarschall gewählt hatte.
Die weise Frau hielt mich im Beisein mehrerer Interessenten hoch.
»Es ist nur ein Mädchen, Herr Major!«
Ein gelbgrünes, linksseitig leicht gelähmtes Mädchen, das sich ein Jahr lang weder zum Bleiben noch (leider!) zum Gehen entschließen konnte, war das Ergebnis von so viel peinigender Ungewißheit. Daß ich dennoch auf dieser Erd- und Wasserkugel verblieben bin, hat mich mein ganzes Leben hindurch bitter gereut.
Mein Vater, der wußte, daß nicht alle Schlachten gewonnen wurden, schickte sich ins Unvermeidliche. Man steckte mich in das rosa Taufkissen, und da ich mehr nach Seele als nach Leib aussah, nannte man mich Alma Maximiliana.
Mein Erscheinen, wie gar vieles, was ich im späteren Leben tat und insbesondere das, was zu tun ich mich weigerte, wurde stets als überlegte Unverschämtheit meinerseits gedeutet.
DER WASSERKOPF
Ich schlug die Augen nur selten auf, wohl aus dem richtigen Gefühl heraus, daß es für mich auf Erden noch genug Unangenehmes zu schauen geben würde, und so vergingen volle sechs Wochen, ehe meine Eltern wahrnahmen, daß ich die Augen unrichtig eingehängt hatte. Meine Mutter war trostlos darüber, weil es ein Schönheitsfehler, eine weitere Handhabe zu bösartigem Spott war, aber mein Vater sagte sich, daß an einem Zwetschkenbaum keine Pfirsiche hängen und von sehr alten Eltern keine körperlich bevorzugten Kinder kommen konnten, und deshalb erklärte er mir, als ich in die Jahre des Verstehens gekommen war, daß ich ihm so, wie ich eben ausgefallen war, ganz gut paßte. Diese seine Einstellung freute mich um so mehr, als er darin vereinsamt dastand, denn nicht einmal von mir selbst dürfte ich Gleiches behaupten. Ein Menschenleben hat nicht genügt, mich mit meinem Äußern zu versöhnen.
Weil ein Fehler rasch auf einen anderen Fehler aufmerksam macht, schien es meiner Mutter, daß auch sonst nicht alles in Ordnung sein könne, und so fuhr sie – von ihrer Schwester und der Amme begleitet – mit mir nach Graz zu einem ganz berühmten Professor, der mich von oben bis unten mit Mißfallen betrachtete, die Achseln zuckte und vielsagend fragte: »Was wollen Sie eigentlich mit diesem Kind?! Es hat einen Wasserkopf und lebt kein halbes Jahr mehr!«
Der Professor ist seit einem Vierteljahrhundert tot und mein Körper ist langsam dem einst zu großen Kopf nachgewachsen. Auch ist es mir einigermaßen zu beweisen gelungen, daß nicht nur Wasser darin gewesen... Für meine arme Mutter aber war das ein fürchterlicher Schlag.
MEINE ERSTE FAHRT INS BLAUE
Mein Vater war ein ungeheuer regsamer, wenngleich sehr stiller, fast verschlossener Mensch, und als er infolge seines Lungenleidens den Dienst quittieren mußte, unterhielt es ihn, zu zimmern und zu basteln. Dreißig burgartige Vogelbauer für seine zahlreiche Kanarienfamilie zierten in meiner Kindheit unseren geräumigen Dachboden, und wo ein Nagel fehlte, ein Brett zu befestigen, ein Ziegel einzuschieben war, dort traf man ihn am sichersten. Seine peinliche Ordnungsliebe ist nicht einmal in Bruchstücken auf mich übergangen. Nur mit echtem Fleiß, verbunden mit zäher Ausdauer – übrigens die einzigen glattweg nachweisbaren Tugenden, die ich je an mir wahrgenommen habe – bin ich beiderseitig erblich belastet.
Nach meinem taktlosen Erscheinen in einer Welt, die sich ohne mich angeblich wohler befunden hätte, wurde er Kindermädchen. Jedenfalls war es seine Aufgabe, die Amme mit Wagen und Inhalt als Aufsichtsrat zu begleiten, und da er gleich mir Vorliebe für Höhen besaß, ließ er die Kinderkutsche auf den Reiterkogel fahren, von dem aus man einen herrlichen Überblick über die Stadt, die weite Ebene gegen Hochenegg, die einst ein See gewesen sein soll, und auf all die niederen Hügel ringsumher genießt. Ob die Schönheit der Gegend oder sonst irgend ein Umstand ablenkend auf meine beiden Wächter wirkte, weiß ich nicht. Vermutlich gab ich mit der mir angeborenen Ungeduld dem Fahrzeug einen Stoß und auf der schiefen Ebene genügte dieser geringfügige Umstand, um das Wägelchen in Schwung zu bringen. Ich fuhr mit meinen neun Monaten so unerschrocken und so blindlings davon, wie ich später auf die Ozeane des Erdballs hinausfuhr. Hinter mir rannten Vater und Amme, aber so sehr sie auch liefen, so gewann ich doch immer mehr Vorsprung. Bei der allerletzten Kurve hüpfte der Wagen über eine Wasserrinne, verlor den Kurs und rollte den Abhang hinab. Dabei flog ich samt Kissen, Kopf nach vorn, auf den Rasen...
Als mich mein Vater keuchend auflas, lag ich auf der Nase, und er überzeugte sich von der erfreulichen Tatsache, daß ich, in einer Beziehung wenigstens, einen harten Schädel hatte; daß dies von allen Gesichtspunkten aus der Fall war, davon überzeugte er sich, wohl mit geringerer Genugtuung, später.
Diese meine erste Fahrt ins Blaue wurde sorgfältig geheimgehalten, doch da ich meinen Purzelbaum auf der Wiese über dem Stadtpark gemacht hatte, der in jenen Tagen von Schulkindern und untätigen Pensionisten wimmelte, sprach sich diese aufregende Nachricht bald herum und es setzte ein Donnerwetter.
GEBRECHEN
Die Hand, die zuerst nie zupacken wollte, wurde so lange geschwungen, gerieben und geübt, bis ich linkshändig wurde. Dagegen überlegte ich es mir zwei Jahre lang, ob es dafür stand, auf dieser Welt allein zu laufen. Man schüttelte vielsagend den Kopf, man flüsterte mitleidig um mich herum, bis ich eines Tages – von der Illusion eines weißen Stoffhasen betört – durch das Zimmer lief. Kaum hatte ich jedoch die Macht eigener Füße entdeckt, als ich jede fremde Hilfe ablehnte. »Alma t’allein!« erklärte ich, sobald sich eine Hand nach mir ausstreckte, und diese Lust an selbständigem Tun und Handeln ist mir geblieben. Soll ich, hier anschließend, eingestehen, daß ich später oft dümmeren Illusionen als der eines weißen Stoffhasens nachgejagt bin?
Aus meinem rasch zunehmenden Selbständigkeitsgefühl heraus entwickelte sich eine Redensart, die meine Mutter belustigte, meinen Vater dagegen ernstlich kränkte und ärgerte. So oft mir etwas verboten oder ausgeteilt wurde, erklärte ich sehr energisch: »Ich geh’ nach ’merika!« Als ich vier Jahre alt geworden war, stand richtig unter dem Weihnachtsbaum ein kleiner mausgrauer Koffer mit einem Unterrock, einem Paar schwarzer Strümpfe und einem Cul-de-Paris aus schwarzem Organdi – scheinbar die wichtigsten Dinge für eine Ozeanfahrt. Diese Gabe war bestimmt, mir einen gelinden Schrecken einzujagen, aber an der Tochter meines Vaters prallte die Drohung ab. Ich war ein außerordentlich schüchternes, stilles und verschlossen zu nennendes Kind, doch nie furchtsam, und selbst in diesem Alter die Hüterin manch eines Liebesgeheimnisses unseres Gesindes oder irgend einer Hausbewohnerin.
»Du wirst schweigen, kleine Alma?«
Und die kleine Alma schwieg wie das Grab.
So oft ich Ringelspiel fahren durfte, stellte ich mir vor, daß ich mich in Europa einschiffte und in Amerika ausstieg. Dann überkam mich immer ein seltsames Gefühl des Losgelöstseins, des Tretens in unbekanntes Gebiet, und die altvertrauten Bäume nahmen andere Formen an. Ich ging wie im Traum und bedauerte es immer, wenn ich angesprochen und damit der Zauber gebrochen wurde.
Zu den qualvollsten Erinnerungen meiner frühesten Kindheit gehört das Schschschsch und das Sßßßßßßßß. Es gab zum Beispiel Abende, an denen man mich zu Bett brachte und ich sofort beruhigt einschlief. Es gab leider auch andere Abende, an denen das Schschschsch begann, noch ehe ich den Kopf richtig auf dem Kissen hatte. Es begann immer in den Ohren und endete, plötzlich, irgendwo im Gehirn mit einem ganz fühlbaren Knax. Das war schlimm genug, doch wenn gar das seltenere Sßßßßß losging, das mitten in der Schädeldecke ansetzte und wie die Nadel einer Grammophonplatte von innen nach außen rund und rund lief, da hätte ich vor Elend und innerer Angst laut aufwimmern mögen. Ich war indessen unfähig, einen einzigen Laut von mir zu geben, und noch so klein, daß ich niemandem davon Mitteilung zu machen imstande war. Auch scheute ich mich später, als ich größer wurde, davon zu sprechen, als ob der böse Sßßßßß sich dann an mir rächen würde. Nach dem fünften Lebensjahr hörten diese nächtlichen Kopfgeräusche auf, doch durfte im ganzen Haus keine Uhr ticken, wenn ich ohne Nervenzuckungen schlafen sollte, und diese hohe Lautempfindlichkeit, die ebenso peinigend für meine nächste Umgebung wie für mich selbst ist, ist mir für mein ganzes Leben geblieben...
Einmal jährlich fuhren Mutter und ich zum Augenarzt nach Graz, der meinte, daß sich der Fehler mit den Jahren von selbst verlieren werde. Mein Vater war gegen eine Operation, da er sagte: »Besser sie sieht gut mit verdrehten als schlecht mit geraden Augen!«, und da mir das Schicksal im Ausgleich ungewöhnlich scharfe Schaubirnen eingehängt hat, entdeckte ich ja zum Schluß die Silberseite meiner Kummerwolke, doch durch meine ganze Kindheit und Jugend sah ich nichts als die tiefschwarze Unterseite, denn Kinder wie Erwachsene wetteiferten darin, mich auf den Fehler aufmerksam zu machen. Am allermeisten litt wohl meine Mutter darunter, die schon alter Widersacher halber gerne ein schönes Kind gehabt hätte. Aus diesem Grunde mußte ich auch Ohrenlascherl tragen, die meine Ohren fest an den Kopf drückten. Selbst der väterliche Einwand, daß ich mit abhängenden Lautfängern besser hören könnte, wurde hohnvoll zurückgewiesen. So wanderte ich oft durch die düsteren alten Räume, Augenblende und Ohrenlascherl um, die Hände auf dem Rücken verschränkt, um eine schönere Haltung zu haben und mit dem strengen Befehl, die Füße nach außen zu drehen.
Für so viele kindheitstrübende Verschönerungversuche ist das Ergebnis als ein höchst mäßiges zu werten.
KAMERADEN
Obschon mehr als ein halbes Jahrhundert zwischen uns lag, verstanden Vater und ich uns vorzüglich. Wir hatten das gleiche Temperament und – so weit dies bei so ungeheurem Altersunterschied denkbar ist – den gleichen Geschmack. Wir mieden die Menschen und suchten einsame Wege. Er holte immer wieder geduldig den verlorenen Ball aus Loch oder Bach, er hieß mich Heuschrecken fangen, obschon meine weiße Schürze darunter litt, und wenn er alte Kriegskameraden traf und mit ihnen über den Rückzug bei Königgrätz oder über die Falschheit der Zivilbevölkerung anno dazumal in Mailand oder Florenz (seiner Lieblingsgarnison) sprach, so hörte ich andächtig zu. In seiner Lade daheim lag ein Stück Schokolade, das den Feldzug in 1866 mitgemacht hatte, und wenn ich sehr brav gewesen war, durfte ich das silberne Besteck bewundern, das er vierzig Jahre lang benützt und ausnahmslos in allen Feldzügen bei sich geführt hatte. Wir wohnten oft dem Exerzieren bei, die Leutnants schnitten mit ihrem Säbel die Kastanienblüten für mich vom Baum und wenn Vater mich necken wollte, so sagte er: »Ha – du könntest kein Soldat werden, denn du hast krumme Zehen!« Indessen schien mir dieser Verlust nie sonderlich groß.
Seine Erziehungspläne deckten sich nicht mit denen meiner Mutter. Er wünschte, mich körperlich kräftig und seelisch stark zu machen, und schied daher jedes Bangewerden aus. Er trachtete, mich stets als Knaben zu behandeln, und daher sollte ich recht militärisch mit den Armen schlenkern, wenn wir gemeinsam ausmarschierten. Eins-zwei, eins-zwei! Die Handschuhe, von Mutter mühsam hinaufgezwängt, wurden sofort hinter der Laibachermaut wieder abverlangt, und wenn er nicht beide verlor, so verlor er doch sicher einen. Ob mit, ob ohne Absicht, vermag ich nicht zu sagen. Im Frühjahr führte er mich zum Friseur und ließ mich glatt scheren, zum Entsetzen meiner Mutter und meinem nicht geringen Stolz, weil sich das Haar dann so wunderbar wie eine Bürste anfühlte. Wenn ich hinfiel und mir den Ellbogen blutig schlug, sagte er mir: »Halt’ die Hand auf dem Rücken, damit Mama nichts merkt!«
Einmal ging es uns mit unserer Kühnheit indessen schlecht.
Es muß Anfang November gewesen sein, denn es war kalt und die Luft feucht. Mutter hatte mir einen funkelnagelneuen lichtbraunen Mantel mit einem gestickten Zierkragen angezogen und Vater und mir tausendmal eingeschärft, wie unendlich achtsam wir zu sein hatten. Mit den besten Vorsätzen verließen wir das Haus. Auf dem Exerzierplatz standen breite Pfützen in der langen Lindenallee und am Ende, da wo der Straßengraben mit der Allee zusammenstieß, war eine ganz besonders breite, bräunliche Lache.
»Kannst du darüber springen?« fragte mich der Geber meiner Tage.
»Ich glaube nicht, Papa!« erwiderte ich zweifelnd.
»Eine Kleinigkeit! Versuch’s einmal. Nimm einen ordentlichen Anlauf – schau, von jenem Baum dort – und dann eins-zwei-hoppla!«
Ich lief bis zum Baum zurück, nahm richtig Anlauf, flog heran und landete – mitten in der Pfütze! Eine dicke Brühe schlug rund um mich hoch. Mein Vater packte mich am Kragen und stellte mich ärgerlich auf den Weg.
»Du Gans!« und während wir heimwärts trotteten, immer wieder: »Du dumme Gans!«
Ganz leicht öffnete er die Vorzimmertüre, holte selbst Wasser im Schaff, nahm die Bodenreibbürste mit einer und mich mit der anderen Hand und begann draußen auf der überglasten Veranda, meine Kehrseite zu bearbeiten. Mitten in unsere nicht ganz geräuschlose Tätigkeit hinein erschien meine Mutter.
»Jesus, Jesus, Jesus ... der schöne, neue Mantel!« Und daraufhin bekamen wir es zu hören, aus was für einem Teig wir waren. Ich wurde des Mantels beraubt und ins Zimmer geschickt, wo Mimi meine triefende Wenigkeit in trockene Gewandung steckte, und mein armer Vater wurde ebenfalls in Acht und Bann getan.
»Du bist wirklich eine dumme Gans!« sagte er mir bei unserem nächsten Zusammentreffen. Das war indessen das einzige Mal, das er mich so schlecht betitelte, und selbst da ungerechterweise.
Doch ihm trug ich nie etwas nach. Man vergibt es leicht, wo man liebt...
Schrecklich waren die Spaziergänge mit meiner Mutter. Bis ich genug gewaschen und geputzt und belehrt und bedroht worden war, bis die Handschuhe saßen und ich artig die Hand zum Halten gegeben hatte, waren schon Bäche von Tränen geflossen und dann, im Park, wo der liebe Gott alle unangenehmen Frauen der Welt versammelt zu haben schien, jagte man mich von einer zur anderen und bei jeder hieß es: »Engerl, mach einen Knicks!«
Oft kümmerten sich die alten Damen nicht um mich und zwei Knickse vergingen unbeachtet. Keine Macht veranlaßte mich zu einem dritten. »Ich habe schon zwei Knickse gemacht!« erklärte ich gebrochen und wandte mich ab. Außerdem regnete es törichte Fragen.
»Schatzerle, wen hast du lieber – deinen Vater oder deine Mutter?« Und ich prompt darauf: »Meinen Vater!« Sofort die weise Lehre: »Seine Mutter muß man mehr lieben!«
Im Allgemeinen konnte man von Glück reden, wenn ich mich als Antwort nur in Schweigen hüllte.
In den Pausen zwischen den alten Damen hieß es ununterbrochen: »Um Himmels willen, schlenkere doch nicht so mit den Armen! Das schickt sich nicht!«
Selbst in jenen Jahren fühlte ich schon, daß diese Redensart wie trockenes Laub raschelte und wie solches zerbröckelte. Ein Ding mag gut oder schlecht sein, aber das leidige »Es schickt sich nicht!« ist nur ein Warnungszeichen, daß dieses oder jenes den Erwachsenen nicht angenehm war, gleichviel ob an und für sich tadelswert oder nicht.
Vater dagegen sagte immer: »Das tut man nicht ...!« mit klarer Erläuterung des Warums.
Ihn verstand und ihm gehorchte ich.
DIE KUSSFRAGE
Ich war ein unliebenswürdiges Kind.
Gerne würde ich das Gegenteil behaupten, aber meine Wahrheitsliebe siegt. Ich vermochte nie Gefühle zu heucheln, die ich nicht besaß, und was ich nicht tun wollte, das tat ich nicht. Einmal setzte ich mich mitten auf der Landstraße in den Staub und ein beladener Heuwagen mußte mir ausweichen. Jeden Abend sollte ich einen ganzen Teller Gries aufessen (warum plagt man Kinder nutzlos mit dem, was ihnen längst zum Ekel geworden?) und damit ich leichter den Geschmack vergaß, erzählte mir Mimi eine Geschichte. Wenn sich die Blume im Tellermuster zeigte, wußte ich, daß ich nahezu den Schluß der leidigen Abendmahlzeit erreicht hatte, und wehe, wenn die Geschichte da plötzlich endete! In weitem Bogen kam der Gries, seit langem im Munde verstaut, auf den Teller zurück und keine Drohung brachte mich zum Weiteressen.
Den Familiengeburtstagen ging immer eine lange und hochnotpeinliche Vorbereitung voraus. Ein Gedicht mußte gelernt werden. Das war schnell erreicht, denn ich lernte rasch und willig, aber wenn ich, ganz in Maschen und Spitzen, den Blumenstrauß mit der damals üblichen steifen Manschette in der Hand, durch die Straßen geführt wurde, hieß es immer eindringlicher: »Den Strauß mußt du der Tante nach dem Aufsagen des Gedichts ohne Widerstand überreichen (bis dahin war es mir leid geworden, mich von dem Wunder aus Papier, Rosen und Draht zu trennen) und vor allem hüte dich, mit den Beinen zu zappeln, um auf den Boden gestellt zu werden, weil dich die liebe Tante küssen will! Auch darfst du dir nach dem Kuß nicht den Mund abwischen oder gar mit den Beinen nach Tantes Bauch stoßen, um frei zu werden! Hörst du, Alma? Das schickt sich nicht!«
»Es sticht aber!« entschuldigte ich mich.
»Wenn man geküßt wird, muß man sich küssen lassen!« Ein Grundsatz, den ich ins Gegenteil umzusetzen später im Leben allzeit beflissen war.
So weit ich mich zurückerinnern kann, küßte mich mein Vater nie oder höchstens auf die Stirne, vermutlich weil er immer hustete und eine Ansteckung fürchtete. Die Küsse meiner Mutter glichen einem Trommelfeuer; unzählige, rasch hintereinander, wohin sie eben trafen.
Ich war immer froh, wenn das Trommelfeuer stoppte. Zärtlichkeit liegt mir vielleicht nicht. Oder ich vermißte Tiefe und Innigkeit. Es ist jedenfalls eine erprobte Tatsache, daß ich einen Menschen viele Jahre lang gerne haben kann, ohne ihn deshalb jemals berühren zu wollen.
Aus diesem Unbehagen bei Berührung entwickelte sich wohl auch meine Abneigung gegen den Handkuß.
»Es schickt sich!« meinte Mama.
»Mir graust...!« erklärte ich.
Und Vater, der als Offizier wahrscheinlich mehr als ihm lieb gewesen Damenhände an seine Lippen gehoben hatte, erklärte bündig: »Das Kind hat recht!«
Und wenn Mutter weiteren Einwand erhob, fügte er barsch hinzu:
»Wie kann man wissen, ob sich die alten Vetteln die Hände gewaschen haben oder nicht?«
Durch unsere ehrfurchtlose Anschauung fielen wir beide in Ungnade.
DIE CYKLAMENNASE
Unsere alte Köchin hieß Neža und war mit Haus und Hof übernommen worden. Sie hatte die Bevorzugung der Amme und deren auserlesene Kost so lange hartnäckig bekämpft, daß Mutter ihr eines Tages gesagt hatte: »Gut, wenn es euch nicht paßt, so geht selber hinein und stillt das Kind!«
In ihrer Jungfrauenehre verletzt, schwieg sie von da ab, sah es jedoch ohne Trauer, als die Amme – nachdem ich durch ihre Unaufmerksamkeit eine schwere Ohrenentzündung entwickelt hatte – Knall auf Fall entlassen wurde und die sechzehnjährige Mimi zu meiner weiteren Betreuung ins Haus kam. Später, als aus der Hüterin das Stubenmädchen wurde, erwuchs ihr dadurch eine nicht unbedeutende Entlastung.
Kurz nachdem Mimi bei uns eingetreten war, lief sie auf der ehemaligen Schütt, dem späteren Burgplatz, eines Abends in ein Eisengitter, und da die Stäbe nicht ausweichen wollten, mußte ihre Nase es tun. Sie blieb von da ab etwas gekrümmt. Ob meinem kindlichen Sinn nun die eigenartige Spitzigkeit oder diese leichte Unregelmäßigkeit den Vergleich aufdrängte, vermag ich nicht zu sagen: Genug! Von da ab nannte ich Mimi, wenn ich zärtlich sein wollte, »Die Cyklamennase«.
Heute verstehe ich, daß Frauen, die einen Beruf haben, nicht Mütter sein können, deshalb geht heute die Ehe zugrunde, erlischt so viel Schönes schon in der aufwachsenden Jugend. Ich wünschte, jede Frau dächte über diesen Punkt nach. Sie kann vollkommen gut den Haushalt in Schwung setzen, die Kinder von Erziehern aufgehoben glauben, sie kräftig und gesund vor sich zu sehen – sie ist doch keine Mutter. Alles, was sie im besten Falle bleiben kann, ist Vorsteherin ihres eigenen Heims.
Warum? Weil eine Frau, die im Beruf steht, ihre Interessen außer Haus verankert hat; weil sie – nach Erfüllung bezahlter Pflichten – müde und abgespannt heimkehrt und da wirklich Unterhaltung braucht, nicht solche noch zu bieten vermag; weil sie den erschöpften Geist nicht nochmals anstrengen kann und weil ihr, die tagsüber vom Heim weg war, der innere Zusammenhang mit den darin befindlichen Personen und Sachen fehlt. Sie ist bei sich selbst zu Gast.
Und so lange Frauen bei sich selbst zu Gast sind, werden Kinder keine richtigen Mütter, Gatten keine echte Behaglichkeit und der Staat keine Sicherung von Glück und Wohlstand haben. Wenn die Durchschnittsfrau künftighin wirklich immer verdienen muß, dann sollen die Kinder in öffentlichen Anstalten vom Staat aus erzogen werden. Wenn nichts, so finden sie da Jugend und etwas Frohsinn.
Mutter stand ganz im Beruf. Sie war eine ausgezeichnete und sehr beliebte Lehrerin, der alle Kinderherzen zuflogen mit Ausnahme des meinen. Für mich waren Vater und Mimi diejenigen, an die ich mich schloß, die den Heimbegriff für mich verkörperten, die nicht zu abgespannt waren, um von mir nichts hören und nichts sehen zu wollen, und vor allem waren das die Menschen, die sich zu mir herabließen, mit mir wie mit ihresgleichen verkehrten. Geistig beschäftigte sich meine Mutter natürlich sehr viel mit mir, sprach mir endlose Gedichte vor, erzählte mir Lessings Fabeln, nannte mir auf Spaziergängen alle Namen der Blumen, Bäume und Kräuter, erweckte mein Interesse für vaterländische Geschichte und benützte jede Gelegenheit, mich zu belehren. Wenn Gäste kamen, wurde ich hervorgeholt und trug dann meine Gedichte vor, vorausgesetzt, daß mir der Besuch paßte. Mir unangenehmen Leuten gegenüber verblieb ich stumm wie ein Fisch.
DIE ZUCKERL
Gewisse Ereignisse meiner frühesten Kindheit brechen wie Klatschrosen aus dem einförmigen Grün meiner Erinnerungsfelder; so z.B. die Abendstunden, an denen mein Vater ein Buch aus dem Bücherschrank nahm und mir den Tod zeigte (einen Dürerschen Holzschnitt), wie er mit Sense und knöcherner Hand nach dem Menschen griff. Ich empfand dabei keinen Schrecken, nur ein angenehmes Gruseln, denn ich vermochte vom Sterben nichts zu verstehen als das: Leute waren – sie gingen, sprachen, aßen, tranken – und dann, auf einmal, waren sie nicht mehr.
Stärker, überwältigender war der Eindruck, den ich von der Größe der Erdkugel erhielt. Eines Tages wanderten Vater und ich über die Felder der Sanntaler Ebene, die zu jener Zeit noch nicht Hopfenanlagen, sondern Getreide aufwies und hinter der, fern und dunstig, die Sulzbacheralpen im ersten Abendschein flimmerten. Der Wind verwandelte die reifenden Ähren in ein strohgelbes Meer, aus dessen Gewoge da und dort hellroter Mohn oder leuchtende Kornblumen brachen. So weit das Auge schaute, nichts als wogendes Korn und wieder wogendes Korn, in bläulicher Ferne von Bergen eingeschlossen.
»Jenseits jener Berge liegen wieder solche Felder und es kommen wieder Berge und andere Felder und dahinter kommt Wasser, unendlich viel Wasser und dann neuerdings Berge und Felder, Felder und Berge...«
»So viele? Bis wohin?«
»Wenn du immer weiter nach Westen gehst, der sinkenden Sonne nach, kommst du nach vielen, vielen Monaten oder Jahren nach Cilli von Osten zurück.«
Vielleicht stammt mein Fernweh aus jener Zeit. Jedenfalls blieb ein Getreidefeld für mich lange der Inbegriff von Unbegrenztheit und goldiger Weite.
Meine Mutter war überängstlich.
Ich durfte in ihrer Gegenwart nie springen, weil man sich dabei Arm oder Bein brechen konnte; nie mit anderen Kindern spielen, außer wenn sie meiner eigenen gesellschaftlichen Sphäre angehörten; nie einem Hunde in die Nähe gehen und keine Katzen halten, daher fürchtete ich mich vor allem, was nicht Kaninchen war, denn Kaninchen hatte ich in einem Rückenkorb täglich auf die Weide getragen. Dahin pflegte das Ziehkind der Waltermami aus der Gasfabrik zu kommen, und wenn ich Geburtstag hatte, überreichte mir Finni (die ein Jahr jünger war) eine Torte unter Aufsagung eines Gedichts, wie ich es bei den Tanten tat. Ungeheure Ehre! Aber nach der feierlichen Handlung umarmten wir uns und quetschten uns so lange, daß die Erwachsenen uns trennen mußten, damit wir uns vor lauter Liebe nicht gegenseitig erwürgten. Finni starb an Scharlach, noch ehe ich sieben war.
Meinen Vater besuchte unter anderen alten Kriegskameraden auch ein gewisser Hauptmann Galimberti, der einen grämlichen Zwergrattler namens Zuckerl hatte. So lange die beiden Herren neben dem verdächtigen Kläffer blieben, empfand ich eine wenigstens vor meinem Vater zur Schau getragene Ruhe, aber wenn sie sich aus Gott weiß welchen Gründen entfernten, flüchtete ich regelmäßig auf die hohe Rückenlehne des Sofas und zog die Beine hoch. Unten, mit überlegenem Spott heraufblinzelnd, saß die Zuckerl.
Tagelang vor dem großen Abenteuer mit dem Zwergrattler hatte ich mich vergeblich bemüht, einen Purzelbaum zu schlagen, eine Kunst, die mein Vater hoch einzuschätzen schien. Es betrübte mich, daß meine Ungeschicklichkeit das Herz meines Erzeugers mit Bitterkeit erfüllte, aber die Beine wollten und wollten nicht über den Kopf. Gerade als ich diese Frage erwog, stellte sich die Zuckerl mit den Vorderfüßen gegen den Sofarand und traf Anstalten, zu mir in die Höhe zu klettern. Tausend Geschichten von der Gefährlichkeit der Hunde als Träger von Würmern, als Tollwütige und so weiter schossen mir durch den Sinn; ich wollte die rettende Türe erreichen, erhob mich überstürzt, verlor das Gleichgewicht und schlug den allerschönsten Purzelbaum meines Lebens. Meine Nase landete zwei Zentimeter von der des Hundes, dann strich eine rosa Zunge beruhigend über meine Wange und ich wußte, daß die Zuckerl eine gefahrlose Bekanntschaft war.
Als die Herren zurückkehrten, teilte ich ihnen sofort den gelungenen Purzelbaum mit, verschwieg indessen die beschämende Ursache meines rasch entwickelten Talentes. Hauptmann Galimberti nickte zufrieden. Er hatte es ohnedies nie begriffen, wie man sich vor diesem winzigen Zwergrattler zu fürchten vermochte. Vater ließ sich später meine neue Kunst vorführen, obschon dabei nach und nach die Federn des alten Möbelstückes zugrunde gingen.
IN DER SCHULE
Meine Kindheit (die wenigen spaßhaften Erlebnisse abgerechnet, die komischer im Rückblick als im Erleben sind) war eine geschlossene Kette von Augenblende, Ohrenlascherln, Salzbädern, Thymianreibungen, lästigem Nachmittagsschlaf, Ärztebesuchen, aufgenötigtem Schabefleisch und Berufungen auf den sagenhaften Herrn »Es schickt sich nicht!«
Der heilige Nikolaus mußte mir in Gegenwart von zwei Engeln und einem kettenrasselnden Krampus irdische und himmlische Strafen androhen, ehe ich zu Fleischgenuß gebracht wurde, und die Wörtchen »Es könnte ihr schaden!« brüteten über der harmlosesten Freude. Aus diesem Grunde sollten bejahrte Frauen nicht Kinder haben. In der Jugend hat man in der Regel keine Nerven, überhört den Lärm; man vergißt, daß man fallen, sich sein Bein brechen, sich erkälten, sich einmal nicht standesgemäß benehmen könnte. Der reife Mensch, dem um Bewegung nichts mehr ist, bei dem andere Freuden an die Stelle jugendlichen Austobens getreten sind, versteht nicht mehr den Drang nach froher Hast. Bei alten Eltern sind beide Teile arm; deshalb ist weiser Verzicht geboten.
Mein Vater erriet meine Vereinsamung und als das Kind seiner Schwester plötzlich Vollwaise wurde, wollte er die kleine Hanna gerne ins Haus nehmen und mit mir zusammen aufwachsen lassen. Ich wurde daher spaßweise gefragt, ob ich mir eine Schwester wünsche, und ich antwortete, jedes Einmengen in mein ohnehin beschränktes Tun fürchtend, nach einigem Überlegen: »Ja – aber in einem anderen Haus!«
Komischerweise habe ich mir später alle meine näheren Beziehungen – selbst einen eventuellen Gatten – in einem anderen Haus gewünscht. So zu zeitweiligem Treffen...
Vermutlich hätte die glühendste Begeisterung für den Vorschlag meine Eltern zu keinem anderen Entschlusse kommen lassen, denn meine Mutter war sehr gegen den Plan, aber ich habe später diese meine kindliche Selbstsucht oft bereut.
Weil ich solch ein »Zusammenkratzerl« alter Eltern war, wollte man mich erst mit sieben Jahren zu unterrichten anfangen, aber als ich bei einer Halsentzündung meiner Mutter unbedingt Vorleserin zu werden wünschte, zeigte mir mein Vater die I und E und A im Fremdenblatt und ich machte so geschickte und freudige Jagd auf sie, daß beschlossen wurde, mich sofort lernen zu lassen. Mutter unterrichtete mich täglich eine Stunde in ihrer Freizeit und Mimi erteilte den Religionsunterricht mit mehr Eifer als der eifrigste junge Katechet. Im Sommer legte ich die Prüfung ab: für die zweite Klasse fand sich eine Lehrerin und die dritte sollte ich wie andere Kinder besuchen.
Jubel! Ich zog als Siegerin ein, denn als Kind meiner Mutter wurde ich von allen Mitschülerinnen sehr verhätschelt. Alle kannten sie mich, denn so oft wir nach der Schule Mutter abgeholt hatten, waren einige Mädchen in die Klasse gestürzt und hatten geschrien: »Bitt’ Frailn, Ihnerer Mann und Ihnerer Madel sein draußen!«
Meine Klassenlehrerin rief mich in der ersten Gesangstunde aufs Podium hinauf und sagte: »Alma, ich möchte gerne wissen, ob du die schöne Stimme deiner Mutter hast! Sing mir ›O Tannenbaum, o Tannenbaum‹!«
So lange mein Vater lebte, litt ich weder an Schüchternheit noch an Minderwertigkeitskomplexen, daher stellte ich mich ohne weiteres hin und sang den Tannenbaum herunter. Sie sagte nichts, aber sie verriet nie wieder die geringste Lust, mich zu hören, und nur ihre Freundschaft für meine Mutter tönte den verdienten Dreier zu einem Gut mit Fragezeichen herab.
In der Pause um zehn Uhr fragte sie uns immer, ob wir lieber Robinson Crusoe anhören oder im Hofe herumlaufen wollten, und unter denen, die den Robinson wählten, war auch ich, nicht ahnend, daß es mir bestimmt war, auch einmal einige seiner Schicksale zu teilen und Inseln kennen zu lernen, die noch eigenartiger als die seine waren. Aus jener Zeit stammt vielleicht meine stille Schwärmerei für Llamas.
Natürlich wurde Mimi »robinsoniert« und mußte mein Freitag werden. Selbst den Papagei besaßen wir...
In friedvollen Abendstunden, wenn Mutter Kartengesellschaft oder Konferenz hatte – für Vater bedeutete das Kommen von älteren Damen eine Heimsuchung ähnlich der der ägyptischen Plagen und er floh sie sozusagen heulend – spielte er Fegefeuer mit mir, wobei ich ihm zu Füßen kauerte und er mich an Haaren und Armen riß, bis ich kreischte und schrie und mich wand. Vielleicht wollte er mich dadurch auf mein späteres Schicksal vorbereiten. Oder es kam die kleine Minka aus dem Hinterhaus zu mir hinauf und wir spielten zusammen oder lernten von Neža in der Küche ein slawisches Lied (denn Deutsch erlernte sie in dreißig Jahren nicht!), und wenn er mit unserem Vortrag ungewöhnlich zufrieden war, schenkte er jeder von uns fünf Kreuzer! Das war ein überwältigender Reichtum, den ich zu dunklen Zukunftszwecken in ein tönernes Sparschwein verschwinden ließ, denn genäschig war ich nicht und von Zeit zu Zeit brachte ein Besuch beim rundgesichtigen Herrn der Handlung ja doch ein Säckchen Erdbeeren oder Rettigzuckerln ein.
Minka war sehr wohlerzogen, vier oder fünf Jahre älter und ein sehr netter Verkehr, den Mutter indessen als nicht standesgemäß zurückzuweisen versuchte, bis Vater ihr kurzweg erklärte, ich könnte wahrhaftig nicht mit ’ner alten Exzellenz spielen und sollte ja nicht Feldmarschall, sondern ein vernünftiges Mädel werden. Endlich gehöre ich zu Menschen, die auf der richtigen Seite von fünfzig stünden und nicht auf der verkehrten.
DER SCHATTEN FÄLLT
Als ich in meinem sechsten Lebensjahr stand, hatte Vater einen sehr schweren Lungenblutsturz, der mir indessen nur als Nasenbluten mitgeteilt wurde. Aus der Sicherheit meiner »Unter-dem-Tisch-Stellung« heraus teilte ich diese Nachricht den herbeieilenden Verwandten mit, bei denen ich, weil ich schweigsam war, als geistig minderwertig galt. Diese meine Zurückhaltung und Wortkargheit war indessen vor Vaters Ableben nicht so sehr ein Ausdruck von Schüchternheit als ein Ablehnen. Ich fühlte ganz genau, daß ich unbeliebt und unwillkommen war. Ich hatte mich der unglaublichen Keckheit schuldig gemacht, in eine Welt, die meiner nicht bedurfte, eingedrungen zu sein, und einer noch weit unverantwortlicheren, sie nicht sofort wieder verlassen zu haben. Das sollte ich büßen.
Und ich büßte es.
Vater erholte sich nach einem Sommer in Gleichenberg anscheinend ein wenig. In wie weit war schwer zu sagen, da er nie klagte. Wenn er, das Haupt in die Hand gestützt, dasaß und Mimi ihn fragte, ob er sich krank fühle, pflegte er nur zu erwidern: »Nicht sonderlich gut!« Ich selbst erinnere mich vorwiegend an den schrecklichen Husten, der für mich ein Teil seines Ichs war und den ich, als letztes Reis des alten Stammes, getreulich übernommen habe.
An einem Maria-Lichtmeßtag (der in Ermangelung einer heiligen Alma als mein Namenstag galt) erkrankte er gegen Abend an einer Lungenentzündung und mußte das Bett hüten. Mimi, die streng katholisch dachte, war in tausend Sorgen, daß er ohne die heiligen Sterbesakramente hinübergehen könnte, und so schrieben wir vereint an meinen Onkel Jernej, den damaligen Hauptpfarrer von Gonobitz, der uns richtig den Abt von Cilli – der mit unserer Familie befreundet war – ins Haus schickte. Er plauderte mit dem Kranken und als er ging, beruhigte sich meine aufgerüttelte Kinderseele.
Was wußte ich vom Sterben?
Ich kannte den Tod nur als Bild mit Gerippe, Sense und Stundenglas und verstand höchstens, daß er kluftbildend war. Das Tote lag im Vergangenen, das Lebende im Zukünftigen.
Um so seltsamer mutet es mich heute an, daß ich Anfang November jenes Jahres ganz plötzlich nicht mehr allein, oder wenigstens nicht ohne Nachtlicht, einschlafen wollte. Ich fürchtete mich. Warum?
»Der Tod steht an meinem Bett«, erklärte ich weinend. Ich hatte dabei nicht das Gefühl, daß er um meinetwillen dastand, eine Hand auf der Schranke meines Gitters; er war einfach da und seine Nähe schreckte mich. Früher hatte ich immer mein ganzes Spielzeug ins Bett genommen und vor dem Einschlafen oft noch lange gespielt. Ganz im Dunkeln. Mutter pflegte mit Vater drüben im Speisezimmer zu bleiben.
Fürwahr: große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus ...
Es war der neunte Tag von Vaters Erkrankung. Ich wußte, daß sich der Zustand der Krise näherte, aber er schien so wohl an diesem Tage und ging sogar im Mantel einmal über die geschlossene Veranda. Immer war er gut gegen mich gewesen, aber an jenem Nachmittag war er zärtlich und nannte mich »Almerl«, eine Verkleinerung meines Namens, die er sonst nicht gebrauchte. Er haßte Verstümmelungen.
Die papierenen Holzschneider oben auf dem Ofen, die von der Wärme bewegt wurden, waren mitten in lustiger Tätigkeit; gegen die Scheiben rieb sich die harte Faust des zunehmenden Frostes; Vater saß auf dem Bettrand und beobachtete mich. Ahnte er?
Nur der Papagei war weg; das Rasseln der Kette hatte den Leidenden seit langem gestört und so war er verkauft worden.
Mitten in der Nacht weckte mich ein schrecklicher Lärm. Fernes Geräusch, ein ununterbrochenes heiseres Schreien, der Schwall vieler Stimmen, ein Kommen und Gehen, dann flog die Türe auf und man brachte Mutter zu Bett. Sie hatte Herzkrämpfe.
Ganz deutlich vernahm ich, die ich mäuschenstill hinter dem schützenden Vorhang meines Gitterbettchens lag, wie eine meiner Tanten sagte: »Du trinkst ja wie ein Frosch!«
Mutters beide Schwäger waren anwesend, beide Schwestern, ein Arzt. Jeden Laut unterdrückend, dachte ich immerfort voll Sorge: »Alle sind sie hier, alle, und nur um Mutter! Drüben liegt mein Vater allein ...«
Wenn ich hinginge?
Als ich überlegte, wie ich ungesehen dem Bett entweichen könnte, schlug das grause Wort »Seelenmesse« und unmittelbar darauf etwas wie »Sterbebett« oder eine andere Zusammensetzung mit »Sterbe« an mein Ohr.
So war er tot! Sie hatten ihn allein gelassen, weil er tot war. Wenn jemand tot dalag, bedurfte er keiner fremden Gegenwart. Ganz ruhig lag ich im Bettchen und lauschte den Reden und Gegenreden der Erwachsenen. Ein anderes Kind hätte geweint oder hinausverlangt, oder hätte sich aufschluchzend in die Arme der Mutter geworfen. Ich rührte mich nicht. Der Gedanke Tod mußte einsinken und mit ihm das Gefühl des Getrenntseins von meinem Vater. Ein Verstehen der Scheidewand, die nichts zu verrücken imstande sein würde, aber jenseits von Schrecken und Grauen und schlecht erfaßtem Kummer war etwas Stärkeres: eine klare Furcht vor denen, die da draußen standen, deren ungeheurer Schatten oben auf der Zimmerdecke auf- und niedertanzte. Bisher war ich meines Vaters Tochter gewesen; nun dämmerte es auf in mir, daß ich in Zukunft für all diese Menschen nichts sein würde als »dieser Mutter Kind«. Kein wünschenswertes Kind! Das Kind einer Mutter, die ganz in ihrem Bannkreis stand. Schlimmer noch als die Scheidewand zwischen dem geliebten Toten und mir war der Sturz dieser anderen Scheidewand, hinter der ich bis zu dem Tag wie unter einer Zauberkappe verborgen gelebt hatte.
Man darf natürlich nicht glauben, daß ich all das auch nur im entferntesten in Worte umzusetzen vermochte oder in zusammenhängende Gedanken, doch tief drinnen fühlte ich all das und verspürte Furcht vor dem Neuen.
Neben mir wurden die Partezettel verfaßt, die Kranzschleifen besprochen, die Art der Aufbahrung, zahllose andere Dinge. Als es gegen Morgen ging, sagte eine harte Stimme mit leichtem Vorwurf: »Schläft die Kleine noch immer?«
Als der Teppich weggezogen wurde, sahen sie, daß ich wach war. Man hob mich auf den Boden. Mutter rief mich zu sich und sagte: »Nun sind wir allein!«
Ich weinte nicht.
Noch war es kein fassungsloser Schmerz. Es war ein eigenes Gefühl, das ich in der Art nie wieder empfunden habe. Ich hätte auf einsamem Berg stehen und einen Choral singen mögen; etwas unendlich Ernstes, Weiches, Feierliches; ich wäre allzu gerne irgendwo, fern von allen Leuten, gesessen und hätte das Ungeheure durchdenken mögen, aber nicht in einem finsteren Raum, überhaupt nicht in einem geschlossenen. Es war etwas erschütternd Großes in mein Leben getreten und um mich her summte der Alltag. Wieder nur ein Empfinden, kein klares Denken, doch nach außen hin eine Ruhe, ein Nichtweinenkönnen, das die Mitwelt entsetzte.
»Sie ist zu klein, um zu verstehen!« hieß es im Dienstbotenreich.
»Eine gefühllose Kleine!« hörte ich im Zimmer jemand sagen, denn die ganze Verwandtschaft hatte sich eingefunden.
Man begriff nicht das Überwuchtende eines solchen Erlebens. Man weint um eine zerbrochene Puppe, aber wie kann man weinen, wenn man staunt und staunt und sich wiederholt »Nie mehr!« und sich fragt, wohin mag er gegangen sein und wie? Alle Erzählungen von Fegefeuermarter und Höllenpein schossen mir durch den Sinn; alle Geister- und Gruselgeschichten wurden lebendig und draußen vernahm man unaufhörlich das rastlose Kommen und Gehen der Leute, die den »Mann von der Frailn Lehrerin« sehen wollten.
Jeder Augenblick war dramatisch. Man steckte mich in schwarze Kleider, das Testament wurde verlesen und ich erfuhr, daß Vater dringend wünschte, das Haus mir erhalten zu wissen; Kränze mit langen Schleifen trafen ein und verschwanden im schwarztapezierten Raum, in dem fremde, schwarzgekleidete Männer ihr Unwesen trieben.
Ich glitt in die Küche.
Mimi erwischte mich beim Ärmel und fragte: »Möchtest du deinen Goldpa noch einmal sehen?« Sie führte mich in das finstere, kranzgeschmückte Stübchen, das sonst unser freundliches Wohnzimmer war. Ich sah alles wie durch einen Nebel: steife Totenkränze aus Kunstblumen an den Wänden, flackernde Wachskerzen, einen Sprengel in einem Weihwasserbecken, eine Flut Neugieriger, die flüsterte und sich stieß und den Sprengel handhabte und ewig wechselte. Mimi hob mich hoch und fragte halblaut: »Siehst du ihn?«
Ich schaute betroffen in ein stilles, wächsernes Gesicht, dem der Abglanz eines Lächelns etwas unendlich Ruhetiefes verlieh; sah wächserne verschlungene Finger über einer blauen Uniform und auf einem Kissen daneben Orden, Säbel, Portepee ...
Er schien mir unfaßbar entrückt, fremd, nicht mehr eigen, einer mir verschlossenen Welt angehörend. Mimi wollte mich näher an ihn heranheben und fragte mich, ob ich nicht wünschte, ihn zu küssen, doch ich wehrte mich in jäher Furcht. Was da so regungslos lag, war nicht mein Vater; war etwas, dem der Kern genommen war. Um jeden Preis zappelte ich an meinem Faktotum nieder.
Mir graute.
Als ich noch ganz benommen in Mutters Schlafzimmer trat, das voll lebhaft redender Menschen war, beugte sich meine älteste Kusine zu mir nieder und sagte hohnvoll, hart, als hätte ich mich eines großen Vergehens schuldig gemacht: »So bist du ihn doch auf der Bahre anschauen gewesen?«
Ich hatte es weder aus eigenem Antrieb noch aus müßiger Neugierde getan und leicht war es nicht gewesen, in dieses wächserne Gesicht zu schauen, an dem mir nichts gehörte als das Erkennen der Züge.
Sie sprach zu mir wie zu einer Schuldigen, sie – die siebenundzwanzigjährige Pädagogin zu dem Kinde von acht!
Ich errötete, zuckte zusammen und schwieg. Was sonst hätte ich tun sollen?
DAS POCHEN IN DER NACHT
Über das, was hier folgt, vermag ich keinerlei Erklärungen zu geben; ich beschränke mich darauf, mitzuteilen, was sich ereignet hat.
Die Nacht zwischen dem Sterbetag und dem Begräbnis hatten wir unten bei Tante Ida geschlafen und am Begräbnistage selbst saß Mutter im Salon und empfing unzählige Trauergäste. Jeder Besuch ließ sich den Verlauf der Krankheit haarklein berichten und weinte im entscheidenden Augenblick tapfer mit.
Damals war es mir unmöglich, meine Gefühle zu zergliedern, ich empfand es nur, ohne es in klare Worte umsetzen zu können. Heute weiß ich es, weil ich anderen Trauerbesuchen beigewohnt habe. Alle diese Damen, die da meine auf dem Sofa in einem von Tante geborgten Samtschlafrock sitzende Mutter umgaben, weinten nicht aus Mitgefühl: sie weinten aus Genuß, aus Freude. Es tat ihnen wohl, die Tränensäcke zu entleeren, während ihre Herzen ruhig schlugen und die Hälfte ihres Gehirns damit beschäftigt war, zu ergründen, ob sie zu Mittag, der Schnelligkeit halber, lieber Rüben und geröstete Erdäpfel oder doch eine falsche Suppe mit einer Draufgabe von Palatschinken kochen sollten. Es stimmte mich daher nicht zum Mitweinen; es gehörten all diese Besuche nur so mit zu den Grabkränzen und Waschkerzen und Blumen und schwarzen Kleidern ...
Als ich jedoch gegen Mittag ausgehen mußte – ich weiß nicht mehr, aus welchem Grunde –, läutete das Ziegenglöcklein in der Marienkirche und Mimi fragte: »Ahnst du, für wen geläutet wird?«
Da ging mir das traurige Läuten durch Mark und Bein. Es schien das einsame Glöcklein im Turm in den grauen Winterhimmel hinein zu klagen: O je ... O je ... O je ...
Mein Vater war tot. Tot bedeutet: Nie wiederkehren.
Am 15. Februar trug man ihn zu Grabe. Es war hoher Schnee und viele Schulkinder liefen neben meinem Wagen her. Ich fuhr alleine mit den Tanten, denn Mutter hatte ihres Herzens willen daheim bleiben müssen.
Alle Leute starrten mich neugierig an und weil sie starrten und auf meine Tränen warteten, vermochte ich nicht zu weinen. Etwas in mir ließ es nicht zu. Ich schaufelte Erde auf den Sarg, als die Ehrensalven vorüber waren. Mein Kranz – der Kranz seines einzigen Kindes – polterte in die Tiefen, schmiegte sich an das kalte Metall...
So also sah das »Nie mehr!« aus?!
In jener Nacht nach der Beerdigung schliefen wir wieder daheim in unserer eigenen Wohnung und eine entferntere Verwandte teilte nebst Mimi unseren Schlafraum, so daß wir zu viert schliefen, ich im Gitterbett, die Kusine meiner Mutter auf dem Diwan und Mimi beim Ofen auf einer Matratze.
Um zwei Uhr nachts – nach späteren Angaben der Erwachsenen – erwachten wie alle vier plötzlich durch ein sehr lautes, eindringliches Pochen an unserer Salontür, die an das Schlafzimmer grenzte. Ich hörte, wie Licht gemacht wurde. Mutter befahl Mimi, hinauszugehen und nachzuschauen, wer so spät Einlaß begehre.
»Hast du denn die Stiegentüre nicht abgesperrt?« fragte sie unwirsch.
»Ich selbst drehte den Schlüssel zweimal um«, erwiderte die Kusine.
Mimi flog durch den Salon und flog noch viel schneller, totenbleich, zurück und diesmal wagte ich, einen Blick durch meinen Vorhang zu werfen. Sie zitterte an allen Gliedern.
»Es ist niemand draußen, gnädige Frau! Aber ...«
»Aber?!«
»Ein schrecklicher Leichengeruch ...«
Es dauerte viele Jahre, ehe ich das Grauen dieser Nacht ganz überwunden hatte und in einem Zimmer ohne Licht schlafen wollte. Mein Vater wurde mir von diesem Augenblick an zum ruhelosen Gespenst, vor dem ich mich über alles Beschreiben hinaus fürchtete. Es geschah nach Jahren noch zuzeiten, daß Mimi und ich in den Salon stürmten und zurücktaumelten, weil uns ein entsetzlicher Leichengeruch entgegenschlug. Nur auf Minuten. Meine ohnedies sehr schwachen Nerven wurden durch diesen Vorfall nicht eben besser.
AUF DER WANDERSCHAFT
Mit dem Ableben meines Vaters war das Sonnige meines Daseins vorüber. Vorher hatte ich immer das sichere Gefühl gehabt, unter einer schützenden Wölbung zu sitzen; nun merkte ich mit Erschrecken, daß in dieses Schutzdach ein breites Loch geschlagen war, durch das es hereinregnete und blies. Starb gar meine Mutter, so brach der ganze Überbau zusammen und dann war ich Fremden ausgeliefert.
Zunächst empfand ich das noch nicht in all seiner Schroffheit, denn der Arzt hatte meiner Mutter Luftveränderung empfohlen und so fuhren wir nach Abbazia. Ich sammelte Muscheln am Strand, wandelte unter Palmen und Lorbeersträuchern und speiste mittags und abends ganz wie eine Erwachsene im Hotel. Meine Mutter hatte sich mit einer Jüdin angefreundet und diese hatte ihr eine Schönheitspomade verschrieben, mit der sie sich jeden Abend das ganze Gesicht einrieb. Es klingt albern, aber meine Nerven waren so zerrüttet, daß ich mich vor der harten Haut fürchtete, wenn ich nachts damit zufällig in Berührung kam. Mir schien es, als sei Mutter in ein anderes Wesen verwandelt.
Einer meiner Onkel war Hafenkapitän in Gravosa und er lud meine Mutter dringend ein, ihn zu besuchen und sich bei dieser Gelegenheit Dalmatien genau anzuschauen. Nach einigem Zögern (Mutter hatte eine große Angst vor dem nassen Element) schifften wir uns richtig auf der »Panonia« ein und durften als bevorzugte Passagiere die Luxuskabine bewohnen. Auch unsere Bekannte reiste mit. Für mich war das Erfreulichste an dieser Fahrt der Umstand, daß die ganze Nacht hindurch Licht brannte. Das gestattete mir endlich einen ruhevollen Schlaf.
Das war auch weit besser als ein Ringelspiel, denn nun konnte ich mir mit weit mehr Begründung einbilden, auf der Fahrt nach Amerika zu sein. Leider störte mich der Umstand, daß wir zwischen Inseln dahinglitten, denn auf dem Ozean sah man angeblich nichts als Himmel und Wasser.
Inzwischen sollte mir auch dieser Genuß werden, denn zwischen Lissa und Lesina kommt man ins offene Meer. Meine Mutter legte sich hin und zahlte Tribut, bis wir wieder ins Inselreich kamen, doch ich erholte mich rascher und genoß eine Freiheit, die durch die völlige Widerstandslosigkeit meiner Umgebung zu einer uneingeschränkten wurde.