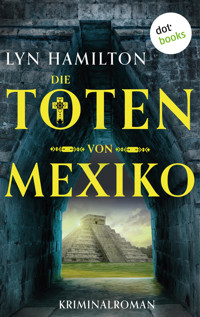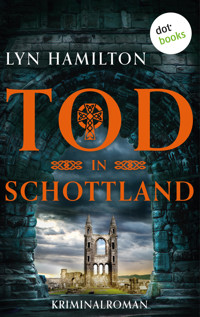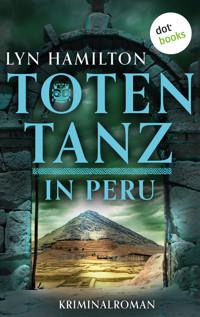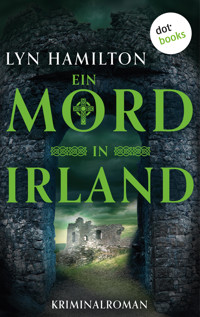
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Antiquitätenhändlerin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine Familie, die über Leichen geht: Der packende Kriminalroman »Ein Mord in Irland« von Lyn Hamilton jetzt als eBook bei dotbooks. Die dunklen Geheimnisse der Kelten – und ihrer Nachfahren … Die Kunsthändlerin Lara McClintoch reist nach Irland, um ihrem Freund Alex bei der Testamentseröffnung eines alten Bekannten beizustehen. Die Verwandten von Eamon Byrne sind alles andere als eine harmonische Familie: Hinter jeder falschen Träne lauert die Gier nach dem Geld des Verstorbenen. Byrne schien dies genau zu wissen und hat ihnen deswegen ein altes keltisches Rätsel hinterlassen: Nur wer es lösen kann, wird den Löwenanteil des Erbes bekommen. Schon bald fordert die Jagd nach dem legendären Schatz ihr erstes Opfer – und Lara, die fest entschlossen ist, Alex zu schützen, stürzt sich mitten hinein in die Gefahr, die zwischen scheinbar idyllischen grünen Hügeln auf sie lauert … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Ein Mord in Irland« von Lyn Hamilton ist der vierte Band der Lara-McClintock-Reihe, der auch unabhängig von den anderen gelesen werden kann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die dunklen Geheimnisse der Kelten – und ihrer Nachfahren … Die Kunsthändlerin Lara McClintoch reist nach Irland, um ihrem Freund Alex bei der Testamentseröffnung eines alten Bekannten beizustehen. Die Verwandten von Eamon Byrne sind alles andere als eine harmonische Familie: Hinter jeder falschen Träne lauert die Gier nach dem Geld des Verstorbenen. Byrne schien dies genau zu wissen und hat ihnen deswegen ein altes keltisches Rätsel hinterlassen: Nur wer es lösen kann, wird den Löwenanteil des Erbes bekommen. Schon bald fordert die Jagd nach dem legendären Schatz ihr erstes Opfer – und Lara, die fest entschlossen ist, Alex zu schützen, stürzt sich mitten hinein in die Gefahr, die zwischen scheinbar idyllischen grünen Hügeln auf sie lauert …
Über die Autorin:
Lyn Hamilton (1944-2009) wuchs in Etobicoke, Toronto auf und studierte Anthropologie, Psychologie und Englisch an der University of Toronto, wobei sie 1967 in Englisch abschloss. Sie war in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und bildete sich in Mythologie und Anthropologie weiter. Ein Urlaub in Yucatán veranlasste sie dazu, ihren ersten Kriminalroman »Die Toten von Mexiko« zu schreiben.
Lyn Hamilton veröffentlichte bei dotbooks bereits »Die Toten von Mexiko«, »Todesfurcht auf Malta«, »Totentanz in Peru«, »Todesklage in Italien« und »Tod in Schottland«.
Die Website der Autorin: www.lynhamiltonmysteries.com/
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »The Celtic Riddle« bei The Berkley Publishing Group, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Das keltische Labyrinth« bei Weltbild.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2000 by Lyn Hamilton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2006 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt 67, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/buchandbee, AllSaintsDay, Cynthia Skirk
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-095-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein Mord in Irland« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lyn Hamilton
Ein Mord in Irland
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Christiane Winkler
dotbooks.
Song of Amairgen – Amairgens Gesang
Ic tabairt a choisse dessi nHerind asbert Amairgen Glúngel mac Miled in laídseo sís:
Als Amairgen of the White Knee seinen rechten Fuß auf irischen Boden setzte, sprach er dieses Gedicht:
Am gáeth i mmuir
Ich bin der Seegang
Am tonn trethain
Die tosende Woge
Am fúaimm mara
Das Brausen der See
Am dam secbt ndrenn
Ein Hirsch in sieben Schlachten
Am séig i n-aill
Ein Falke über der Klippe
Am dér gréne
Ein Sonnenstrahl
Am caín lubae
Die Schönheit einer Pflanze
Am torc ar gàil
Ein wütender Keiler
Am hé i llind
Ein Lachs im Becken
Am loch i mmaig
Ein See in der Ebene
Am bí dánae
Eine mutige Flamme
Am gae i fodb feras fechtu
Ein Speer, der durchbohrt, führt Krieg
Am dé delbas do chin codnu
Ein Gott, der Helden für einen Herrn schafft
Cóich é no-d-gléitb clochur sléibe
Er, der die Bergwege räumt
Cía ón co-ta-gair áesa éscai
Er, der den Mondenlauf beschreibt
Cía dú i llaig funiud gréne
Der Ort, an dem die Sonne untergeht
Cía beir búar o thig Temrach
Er, der das Vieh von Tara wegtreibt
Cía búar tethrach tibis cech dáin
Diese herrliche Herde berührt jeden Verstand
Cía dé delbas fáebru áine
Ein Gott, der ruhmreiche Waffen schafft
Commus caínte Cáinte gáeth
Ein kluger Dichter. Weise bin ich.
Vorwort
Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Sie trug sich vor sehr langer Zeit zu, bevor Amairgen und Mils Söhne ihren Fuß an diese Küste setzten. Bevor die Kinder der Göttin Danu sich nach Sidhe zurückzogen. Sie ist nicht so lange her wie die Seuche, welche die Söhne und Töchter des Partholan dahinraffte, aber dennoch ereignete sie sich vor sehr langer Zeit.
In jenen Tagen bewohnten noch Riesen die Erde, und Geschöpfe, die nur ein Bein und einen Arm hatten, wie Schlangen, entstiegen der See. Damals erzählten gezückte Waffen Geschichten, vom Himmel konnte es Feuer regnen, und des Nachts vernahm man die Schreie der Hexe. Und es war die Zeit, als die Schlacht aller Schlachten, der Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit ausgefochten und von den Tuatha de Danaan gewonnen wurde. Zuerst schlugen sie die Für Bolgs in die Flucht, dann verbannten sie in der Schlacht von Mag Tuired die gefürchteten Formorier.
Die Geschichten ihrer Helden, ihrer Anführer in der Schlacht, erzählen wir uns bis heute: Von Lugh, dem Leuchtenden, Strahlenden, Vernichter des Bösen Auges. Von Diancecht, dem Druiden. Von Nuada Silberhand. Aber vor allem von Dagda.
Nun, da gab es einen Gott! Nach ihm selbst zu schließen, muss er außerordentlich gewesen sein. Lin Riese, mit einem ebenso riesigen Appetit. Man erzählt, der Dagda habe einen Kessel besessen, in dem Schweine gegart wurden. Doch es war kein gewöhnlicher Kessel, und es waren auch keine gewöhnlichen Schweine. Immer war ein Schwein gar und der Kessel niemals leer, egal, wie viele von ihm aßen. Und überdies inspirierte der Inhalt des Kessels Dichter und erweckte Tote zu neuem Leben. Das erzählte man sich.
Wie dem auch sei, eines Tages ging der Dagda zum Heerlager der Formorier, weil er um einen Waffenstillstand bitten wollte. Da er aber auch schlau war, spionierte er gleichzeitig ihr Lager aus. Die Formorier, von denen einige selbst Riesen waren, bereiteten ihm ein Porridge aus fast vierhundert Litern Milch, vierhundert Kilo Fleisch und Fett zu. Dazu gaben sie Schweine, Ziegen und Schafe, dann gossen sie alles in ein riesiges Loch im Boden.
»Iss alles auf«, sagten die Formorier, »oder du musst sterben.«
»Das werde ich tun«, antwortete der Dagda, nahm seine Schöpfkelle, die so groß war, dass ein Mann und eine Frau darin liegen konnten, und begann zu essen. Die Formorier sahen dabei zu, wie er alles bis auf den letzten Happen herunterschluckte und die letzten Krumen mit seiner großen Hand aus dem Dreck kratzte, wo die Kelle nicht hinkam. Dann legte er sich schlafen.
»Seht euch diesen Bauch an«, riefen die Formorier und zeigten auf den schlafenden Dagda, dessen Bauch sich wie ein Berg von der Stelle aus auftürmte, auf der er lag. »Er wird nicht mehr aufstehen können.«
Und was denkt ihr wohl, ist dann passiert? Der Dagda erwachte, grunzte, erhob seine enormen Massen und taumelte fort, zog seine Keule hinter sich her und schlug eine Furche von der Breite eines Grenzgrabens. Und selbst dann war er noch nicht erschöpft. Später am Tage lag er bei Morrigan, der Krähe, der Göttin des Krieges. Doch das ist eine ganz andere Geschichte.
Ich war dabei, wisst ihr. Ja, das war ich. Wer sagt, dass ich es nicht war?
Kapitel 1 – Ich bin der Seegang
»Ich habe festgestellt, dass einer der wenigen Vorteile des Totseins darin besteht, dass man sagen kann, was einem gerade einfällt. Man muss nicht besonders höflich sein, kann sogar die verletzendsten Wahrheiten oder Sticheleien, die herzzerreißendsten Geständnisse und bissigsten letzten Worte äußern, ohne Proteste, Peinlichkeiten oder Racheandrohungen hinnehmen zu müssen, die eine solche Offenheit natürlich unausweichlich mit sich bringt.«
Ich glaube, Eamon Byrne muss so gedacht haben, doch seine Worte lösten ein Gezeter, eine so leidenschaftliche Wut und eine derartige Erbitterung aus, wie er wohl kaum vorausgeahnt hatte.
Natürlich hielt auch ich ihn für ungehobelt und unsensibel, als ich ihn so aus dem Grabe sprechen hörte, auch wenn er mit dem, was er sagte, vielleicht nicht ganz falsch lag. Das war jedoch, bevor ich die Leute, von denen er sprach, näher kennen lernte.
»Ihr werdet euch fragen, weshalb ich euch zusammengerufen habe«, begann Byrne mit einem Grinsen, das irgendwann zur Grimasse gefror, weil ihm schließlich die Luft wegblieb.
»Eamon hat schon immer gerne im Mittelpunkt gestanden«, flüsterte Alex Stewart mir so leise zu, dass die anderen ihn nicht hören konnten.
»Und Eamon konnte anscheinend auch gut mit Klischees umgehen«, flüsterte ich zurück.
»Vor allem«, fuhr der Mann nach ein paar mühsamen Atemzügen fort, »vor allem«, wiederholte er, »wenn man bedenkt, wie ich gestorben bin.«
»Ein echter Witzbold«, seufzte Alex.
Man sah, wie sich das Gesicht in dem Film zur Kamera vorbeugte, dann verschwamm und plötzlich mit einem Ruck wieder im Mittelpunkt stand, als wäre die Kamera von einer unsichtbaren Hand geführt worden. Das Gesicht bot keinen besonders schönen Anblick: Wangen und Augen waren eingefallen, ein Sauerstoffschlauch baumelte aus einem Nasenloch, und das graue Haar klebte am Kopf. Trotzdem erkannte ich, dass dies einmal ein sehr stolzer und gut aussehender Mann gewesen sein musste.
»Komisch, dass er sich in diesem Zustand hat filmen lassen«, flüsterte ich Alex zu.
Alex neigte wieder seinen Kopf zu mir. »Ich hatte nie den Eindruck, dass er sich viel daraus machte, was die Leute von ihm dachten, Lara. Im Gegenteil.« Während er sprach, kam eine etwa dreißig Zentimeter große Schildkröte über den Orientteppich angekrochen.
»Psssst«, fauchte eine verhärmt wirkende Frau in der Reihe vor uns über ihre Schulter. Zwei weitere, ähnlich aussehende Frauen, die in derselben Reihe saßen, drehten sich daraufhin zu uns um. Mutter und Töchter – sie glichen sich aufs Haar, so ausgeprägt war die Familienähnlichkeit. Ich widerstand der Versuchung, etwas Unfreundliches zu erwidern, und beschränkte mich darauf, zurückzustarren und mir ein paar gehässige Gedanken zu machen.
Ein unsympathisches Grüppchen, dachte ich mir, diese drei Frauen, zwischen denen, fast wie Puffer, zwei Männer saßen.
Die Männer hatten ihre Jacken abgelegt, die drückende Hitze und die abgestandene Luft im Raum machten jeden Versuch zunichte, eine feierliche Stimmung zur Würdigung des Augenblicks aufkommen zu lassen.
Die beiden Männer hingen mehr in ihren Stühlen, als dass sie saßen, zwei weiße Hemden, bleiche Hälse und darüber blondes Haar. Einen Augenblick musste ich an die Wattepads denken, die man während der Pediküre zwischen die Zehen gesteckt bekommt, womit verhindert wird, dass man sich mit Lack bekleckert.
Dieser Vergleich passte erstaunlich gut, wie ich später erfahren sollte, nicht nur, was die beiden Männer betraf, sondern auch, wie sie die Frauen der Familie spalteten.
Links von uns aus gesehen saß die große Zehe Mutter Margaret, groß, blond, von eleganter Schlankheit, in einem dem Anlass entsprechenden schwarzen Wollkostüm mit einem kastenförmigen Jäckchen, das an Chanel erinnerte. Sie war mit Recht stolz auf ihre Beine, die für ihr Alter gut aussahen und die sie in regelmäßigen Abständen immer wieder übereinander schlug. Neben ihr saß das erste Wattebäuschchen, Schwiegersohn Sean McHugh, daneben seine Frau Eithne, Margarets älteste Tochter, genauso groß, blond und schlank wie diese und etwas nervös wirkend, was darauf schließen ließ, dass sie wohl der Pessimist der Familie war. Neben ihr saß ein weiteres Wattebäuschchen, Conail O’Connor, neben seiner Frau Fionuala, Margarets zweiter Tochter. Sie sah den beiden anderen sehr ähnlich, war jedoch nicht so groß und wirkte etwas vulgär, was sie wohl zum Vamp der Familie machte. Alle drei Frauen wirkten steif und verbittert, vor allem die Mutter, die nach chronischen Magenbeschwerden aussah, für die ihre Töchter noch zu jung waren. Die Männer hingegen wirkten verweichlicht um Kinn und Bauch, was einer Tendenz zur Trägheit entsprach, die ich in der kurzen Zeit, die ich sie kannte, bemerken konnte.
Der nächste Zeh wäre Breeta, die jüngste Tochter gewesen, hätte sie sich neben die anderen gesetzt. Stattdessen hatte sie es sich in einem Lehnstuhl bequem gemacht, so weit von ihrer Familie entfernt, wie das in diesem überfüllten Raum nur möglich war. Sie schien jünger als ihre Schwestern zu sein, Mitte zwanzig, würde ich sagen. Während zwischen den beiden anderen Schwestern der übliche Altersunterschied von zwei oder drei Jahren bestand, mussten zwischen Breeta und der zweitjüngsten Schwester Fionuala mindestens sechs oder sieben Jahre liegen. Vielleicht war Breeta ja eine Nachzüglerin oder auch der letzte verzweifelte Versuch der Eltern, ihre Ehe zu retten, was wohl nicht gelungen ist, wage ich mal zu behaupten.
Sie war ein wenig übergewichtig und schmollte vor sich hin, war aber trotzdem hübsch und kam ganz nach dem Vater, überlegte ich, als ich mir das Gesicht auf dem Bildschirm genauer ansah. Sie hatte dunkles Haar und helle Augen und zeigte nur wenig Ähnlichkeit mit den anderen drei Frauen.
An ihrer Umwelt schien sie völlig desinteressiert, ein Verhalten, das ich auch bei anderen ihrer Altersgenossen schon beobachtet hatte. Ob dieses Desinteresse am Geschehen des Tages echt oder vorgetäuscht war, konnte ich nicht beurteilen.
Der Einzige, dem der Tod des Kranken nahe zu gehen schien, war ein junger Mann mit feuerrotem Haar und von der Sonne gerötetem und mit Sommersprossen übersätem Gesicht, der, wie ich fand, aufrichtig ernst dasaß. Er wirkte wie jemand, der körperlicher Arbeit im Freien nachging, seine Muskeln spannten die Nähte seines einfachen, jedoch sauberen Jacketts und seines verschlissenen Hemdkragens, der sich fest um seinen Hals schloss. Er hieß Michael Davis, wie ich später erfuhr, und war nicht nur einer der wenigen im Raum, der um Eamon Byrne trauerte, sondern neben Alex der Einzige, der abweisend behandelt wurde. Darum hatte man Michael, Alex und mich zusammen mit ein paar anderen Ausgestoßenen in die letzte Reihe verbannt, von denen einer ein Anwalt war, der eine bisher unbekannte Person vertrat, wie man mir sagte.
Dem Kreis gehörten noch zwei Anwälte an, die Eamons Nachlass verwalteten, ein Dienstmädchen mit Namen Deirdre – die ich aufgrund ihres griesgrämigen Ausdrucks »Deirdre of the Sorrows« taufte, obwohl ich nicht wusste, ob sie immer oder nur zu diesem Anlass so dreinsah und die als treue Angestellte der Byrnes offenbar bei ihrem Vornamen gerufen wurde – und ein weiterer Hausangestellter namens John, auch er nur bekannt unter seinem Vornamen, der nach Alkohol stank und dessen Hände zitterten, wenn er mit dem Finger auf die Personen in der Runde zeigte. Ab und zu verließ John den Raum, ging in den Flur und genehmigte sich dort ein Schlückchen, was ich zunächst gar nicht erst bemerkt hätte, hätten seine schwarzen Schnürschuhe nicht bei jedem Schritt gequietscht. Zu den Anwesenden gehörte auch, nicht zu vergessen, eine Schildkröte, das Haustier der Familie, das frei durch das Haus rannte – oder besser gesagt schlich. Darauf zu achten, nicht auf die Hausschildkröte zu treten, war eine völlig neue Erfahrung für mich, was mich veranlasste, für Diesel, die offizielle Wachkatze des Antiquitätengeschäfts, dessen Miteigentümerin ich bin, und ihre Art, allem und jedem auszuweichen, einige Hochachtung zu empfinden.
Was ich aber – abgesehen von der Schildkröte – noch interessant fand, war die Tatsache, dass ich einen ganz guten Eindruck davon bekam, wie die fünf Familienmitglieder vor uns über die Sache und die Anwesenden dachten, obwohl ich ihre Gesichter nur im Profil und bei den seltenen Gelegenheiten zu sehen bekam, in denen sie unsere Anwesenheit würdigten, indem sie uns anzischten.
Es war offensichtlich, dass sie sich zwar in ihrem Aussehen und Verhalten ähnelten, zu diesem Anlass auch zusammensaßen und gemeinsam offen ihre Feindschaft Alex gegenüber bekundeten, ansonsten aber nicht miteinander auskamen.
Alles deutete darauf hin, dass die Familienmitglieder auf Kriegsfuß miteinander standen. Nur selten sahen sie sich an, die Frauen saßen kerzengerade, die Köpfe entschlossen nach vorne gewandt, während die Männer gekrümmt auf ihren Stühlen hingen und abgesehen von ihrer jeweiligen Partnerin neben sich niemanden anblickten. Sie vermieden es auch entschieden, Breeta anzusehen, obwohl diese von Zeit zu Zeit zu ihnen herüberspähte, und sie ignorierten Michael und den geheimnisvollen Anwalt. Es musste sie eine große Willensanstrengung gekostet haben, sich nicht im Zimmer umzusehen oder sich bei jedem Türknall umzudrehen, doch eisernen Willen schienen sie im Überfluss zu haben.
Inzwischen scheint klar zu sein, dass ich diese Leute nicht ausstehen konnte. Wenn, abgesehen von Michael Davis, auch nur einer von ihnen eine nette Eigenschaft gehabt hätte, so hatte ich sie bis jetzt noch nicht entdeckt. Als ich die drei Frauen ansah, wünschte ich mir, erst gar nicht nach Irland gekommen zu sein, doch diesen Gedanken bereute ich sofort wieder.
Wenn Alex Stewart das Gefühl hatte, dass er meine Anwesenheit brauchte, sollte er sie haben.
Alex Stewart ist ein guter Freund, ein pensionierter Gentleman, der nur ein paar Häuser von mir entfernt wohnt und regelmäßig bei unserem Geschäft Greenhalgh & McClintoch vorbeischaut, um auszuhelfen. Wir haben ein Antiquitäten- und Designergeschäft in Yorkville, einem der angesagtesten Viertel von Toronto, so angesagt, dass wir es uns eigentlich nicht leisten könnten, dort ein Geschäft zu besitzen. Vor ein paar Monaten hatte Alex sich am Kopf verletzt und während der Zeit seiner Genesung einen leichten Gehirnschlag erlitten, wie die Ärzte es nannten. Ihm hatte das zwar kaum zu schaffen gemacht und bis auf ein paar Tage, in denen er auf einer Gesichtshälfte eine gewisse Taubheit verspürte, war nichts zurückgeblieben, doch ich hatte panische Angst bekommen.
Als also Ryan McGlynn, der Anwalt der namhaften Kanzlei MacCafferty & McGlynn, Alex aus Dublin anrief, um ihm mitzuteilen, dass seine Anwesenheit bei der Testamentseröffnung von Eamon Byrne notwendig sei, und Alex ein paar Bedenken geäußert hatte, hinzufahren, hatte ich darauf bestanden, mitzukommen. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen, also sagte ich ihm, dass auch ich Ferien brauchte, und zu meiner großen Verwunderung war der Gedanke, Urlaub zu machen, sogar noch ungewöhnlicher als eine Schildkröte zum Haustier zu haben. Ich machte also Ferien. Mir gelang es außerdem, Rob Luczka, einen weiteren Freund und Unteroffizier bei der Royal Canadian Mountain Police, und seine Tochter Jennifer davon zu überzeugen, uns zu begleiten. Wir planten, nach der Verlesung des Testaments zu viert Irland zu besichtigen.
Alex sagte, er wüsste nicht, weshalb er vorgeladen worden sei, ich hingegen hoffte, dass ein kleines Vermögen für ihn dabei herausspringen würde, damit er den Rest seines Lebens ein wenig dem Luxus frönen konnte.
Da ich wusste, was er für ein Mensch war, konnte ich mir denken, dass er trotzdem auch weiterhin in unser Geschäft kommen würde, um bei uns auszuhelfen, doch wenigstens müsste ich mir dann keine Gedanken mehr darüber machen, ob er von seiner Rente und dem kleinen Zubrot, das er bei uns verdiente, leben konnte.
Alex’ Flugkosten wurden offenbar aus dem Nachlass von Byrne bezahlt, während ich ein paar Flugmeilen investierte, von denen ich ungefähr eine Milliarde besaß, um für mich und Jennifer Luczka die Tickets zu besorgen. Ich hatte so viele Meilen gesammelt, weil Sarah Greenhalgh und ich die Ware für unser Geschäft weltweit einkaufen. Ich bin diejenige, die sich vorwiegend um den Einkauf kümmert, und unternehme mindestens vier große Reisen pro Jahr, weil Sarah das nicht so gerne tut.
Warum ich meine Meilen nicht öfter nutze, weiß ich auch nicht. Ich erzähle den Leuten immer, dass ich sie für eine Weltreise aufhebe, die ich vermutlich nie machen werde. Warum sollte ich auch? Schließlich habe ich eine Arbeit, die mir Spaß macht und bei der ich so viel reisen kann, wie ich will.
Die Wahrheit ist aber, dass ich abergläubisch bin und die Meilen für den Fall horte, dass Sarah und ich einmal so abgebrannt sind, dass unser Überleben von den Gratismeilen abhängt.
Meine beste Freundin Moira, die Besitzerin des eleganten Schönheitssalons Cum Spa am Ende der Straße, sagt immer, die Buchhalter oder Versicherungsstatistiker, die dafür bezahlt werden, sich über Leute, die Meilen horten, um Fluggesellschaften zu ruinieren, den Kopf zu zerbrechen, werden mir eines Tages einen Auftragskiller schicken.
Wir waren noch keine vierundzwanzig Stunden in Irland, schon bedauerte ich es, die Meilen verflogen zu haben.
Da saßen wir nun, in einem dunklen Zimmer von Eamon Byrnes Anwesen, das, nach einem unauffälligen Schild an der Straße zu schließen, Second Chance hieß. Das Haus war recht hübsch, mit hellgelben Stückarbeiten, einem schwarzen Dach und weißen Zierleisten, es gab eine beeindruckend lange und kurvige Auffahrt und viel Land darum, das sich bis zum Meer erstreckte. Die Auffahrt war von Hortensienbüschen gesäumt, an denen schwere, atemberaubend schöne rosa, blaue und lilafarbene Blüten hingen, die beinahe den Boden berührten. Hinter dem Haus befand sich ein Wintergarten mit chintzbezogenen Korbmöbeln und Blick auf einen wunderbaren Garten sowie auf eine Terrasse, von der eine mit Tonkrügen gesäumte Treppe zur Dingle Bay hinunterführte. Alles war außerordentlich luftig und licht angelegt, ganz im Gegensatz zu der Atmosphäre, die den Ort beherrschte.
Wie dem auch sei, wir jedenfalls saßen in der Bibliothek, die sich perfekt für den Anlass eignete. Der Raum lag auf der Rückseite des Hauses, nicht weit vom Wintergarten entfernt, war ziemlich groß und beeindruckend, mit dunkler Holztäfelung, übergroßen Ledersesseln und einem riesigen Schreibtisch, der aussah, als hätte man das Haus um ihn herum errichtet. Die Bibliothek hatte Eamon Byrne offensichtlich auch als Arbeitszimmer gedient. Um das Tageslicht und bedauerlicherweise damit auch die Luft und den Ausblick auszuschließen, hatte man zu diesem Anlass die bordellroten, deckenhohen Samtvorhänge vor den riesigen Fenstern zugezogen, damit wir der Vorführung noch besser folgen konnten.
Mein gelegentlich hypersensibler Geruchssinn vernahm eine Spur von Desinfektionsmittel in der Luft.
Im Gegensatz zur stillen Eleganz des Äußeren des Hauses, herrschte in diesem Raum eine Unordnung, die einem Chaos glich. Byrne musste offensichtlich ein leidenschaftlicher, wenn auch nicht allzu wählerischer Sammler gewesen sein. Damit ist nicht gemeint, dass die Dinge, die er sammelte, wertlos gewesen wären – ein kurzer Blick darauf verriet mir kurz nach unserer Ankunft, dass er sehr wohl wusste, was er da sammelte. Doch auf den ersten Blick schien es, dass er sich auf nichts spezialisiert hatte. Falls es dennoch einen allgemeinen Leitfaden gab, so war dieser für mich nicht gleich ersichtlich. In dem Raum hingen Gemälde und Drucke, unzählige Bücher, davon viele in Leder gebunden, lagen in Regalen, stapelten sich auf Möbeln oder am Boden, den drei wertvolle Orientteppiche zierten.
Die Ölgemälde an den Wänden waren in dunklen Farben gemalt und zeigten als Motiv vorwiegend große Segelschiffe, die entweder den Elementen trotzten oder gegen feindliche Schiffe auf See kämpften. An einer Wand stand ein Glaskasten, in dem ein paar sehr alte Waffen, größtenteils Schwerter und Speerspitzen, ausgestellt waren. Auf dem untersten Regalboden der Vitrine sah ich einige recht außergewöhnliche Eisentöpfe oder Schalen, manche mit fast dreißig Zentimeter Durchmesser oder größer. Ich vermutete, dass sie aus der Eisenzeit stammten. Alle Teile lehnten an einem Hintergrund aus rotem Samt, der perfekt auf die Vorhänge an den Fenstern abgestimmt war. Als ich mich umsah, dachte ich, dass wohl zig Tausend Dollar und knapp zwei Kilometer Samtstoff für die Raumausstattung benötigt worden waren. Ein Schwert, an dessen Schneide der Zahn der Zeit nagte, hing hinter dem Schreibtisch an der Wand, ein anderes, offensichtlich wertvolleres, war unter Glas auf dem Schreibtisch befestigt worden. Es war eine durchaus beachtliche Sammlung, die dem Ablauf des Ganzen jedoch etwas ziemlich Bedrohliches verlieh. Ich dachte mir, dass für Eamon Byrne das Leben ein Kampf gewesen sein musste, vorausgesetzt, er war der Sammler all der Bilder und Waffen.
Man hatte einen Fernseher und einen Videorecorder auf die Anrichte hinter dem massiven Schreibtisch gestellt, wobei der Fernseher noch zusätzlich auf einem Bücherstapel platziert worden war. Alles stand etwas schräg zum Schreibtischstuhl. Aus der Ecke, in der ich mit Alex in der letzten Reihe hinter den für Eamons Leben bedeutenderen Leuten gequetscht saß, sah es aus, als ob der sprechende Kopf sich da befände, wo Eamon gesprochen hätte, wäre er noch am Leben.
Wäre die Situation nicht so trostlos gewesen, hätte ich bei dem Anblick geschmunzelt.
Breeta hatte sich auf den großen Sessel fallen lassen und faltete unaufhörlich ihr Spitzentaschentuch auf und wieder zusammen. Alle anderen saßen auf ziemlich unbequemen Metallklappstühlen in zwei Halbkreisen um den Schreibtisch. Den Videorekorder bediente Charles McCafferty, einer der Partner von McCafferty & McGlynn.
Zumindest glaube ich, dass es McCafferty war. Er und sein Partner trugen fast identische, sehr teuer aussehende, gut sitzende und hübsche Anzüge mit passender Weste dazu, an der sich jeweils eine Tasche mit Taschenuhr befand, dazu ein weißes Hemd mit gestärktem hohem Kragen und Doppelmanschetten mit silbernen Manschettenknöpfen. Beide hatten zudem einen nahezu identischen Haarschnitt und ebenfalls teuer aussehende Lesebrillen, die so saßen, dass sie über ihre Nasen auf den Rest der Welt herabblicken konnten. Eines unterschied sie jedoch: die silbergrauen, aber unterschiedlich gemusterten Krawatten, von denen die eine kariert, die andere gestreift war, was ihnen meiner Meinung nach einen Hauch von Individualität verleihen sollte. Ich nannte sie heimlich einfach Dideldum und Dideldei. Oft, aber keinesfalls immer, wähle ich abschätzige Spitznamen für Leute und weiß natürlich, dass ich das nicht tun sollte. Doch zugegebenermaßen kann ich mir nur schwer Namen merken. Wie dem auch sei, jedenfalls schnitten McCafferty & McGlynn noch ganz gut dabei ab, wirklich. Obwohl sie keinesfalls originell waren, wirkten sie erfolgreich, jedenfalls was ihre Kleidung betraf.
Der Gedanke, dass ich mit dem, was die beiden für ihre Kleidung ausgaben, meine gesamte Hypothek hätte abzahlen könne, ernüchterte mich.
»Mister McCafferty oder Mister McGlynn – für mich sehen beide nahezu gleich aus – werden Ihnen nun meinen letzten Willen und die daran geknüpften Bedingungen eröffnen«, fuhr Eamon nach einer weiteren Atempause fort. Dideldum fühlte sich sichtlich unwohl bei dem Gedanken, dass er und Dideldei für Byrne anscheinend identisch waren, was ich nur bestätigen konnte. Die drei Hexen, so hatte ich sie inzwischen genannt, wandten nun ihre Aufmerksamkeit von uns ab und wieder dem Fernseher zu.
»Ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, denn wie ihr selbst erfahren werdet, habe ich die Byrne Enterprise meinen Töchtern Eithne und Fionuala oder, wie ich sie in ihrer Kindheit zu nennen pflegte, Eriu und Fotla und somit auch ihren Ehemännern Sean und Conail hinterlassen. Während meiner Krankheit haben Sean und Conail die Geschäfte geführt, aber vielleicht sollte ich eher sagen, das Unternehmen heruntergewirtschaftet, wenn man bedenkt, dass sie, wie in Conails Fall, lieber die Stühle ihrer Lieblingskneipen gewärmt haben, statt sich um eine anständige Arbeit zu kümmern, oder, wie in Seans Fall, sich wie englische Großgrundbesitzer aufgeführt haben.« Die beiden Männer rutschten unruhig auf ihren Sitzen hin und her, während das vor Anstrengung angespannte Gesicht von Byrne weitersprach. »Ich gehe davon aus, dass die Erbschaft schon bald an Wert verloren haben wird, wenn meine Töchter sich nicht dazu entschließen sollten, die beiden Nichtsnutze vor die Tür zu setzen.
Meiner Frau hinterlasse ich Second Chance, die Ländereien und das Haus samt Inhalt, bis auf zwei Ausnahmen, Rose Cottage, auf das ich später noch zurückkommen werde, sowie meine Sammlung alter Waffen, Landkarten und Manuskripte, die ich nach vorheriger Rücksprache dem Trinity College in Dublin vermachen werde. Ich habe zudem eine Summe für sie vorgesehen, die viele als sehr großzügig, sie aber zweifellos als knauserig empfinden wird. Alleine für Haus und Ländereien verantwortlich zu sein, wird sehr lehrreich für Margaret sein, und sie wird erfahren, was es bedeutet, den Lebensstil zu halten, den sie für sich als angemessen empfindet. Es sei denn, sie findet einen neuen, vermögenden Mann. Sollte dem so sein, wird sie wohl bald alles verkaufen.«
So wie Margaret ihren Kiefer anspannte und heftig einatmete, schien ihr das gar nicht zu passen.
»Meiner jüngsten Tochter Breeta, die bis vor zwei Jahren, als sie Hals über Kopf das Haus verließ, noch mein Liebling, meine kleine Banba war – aber das ist für meine beiden anderen Töchter ja nichts Neues –, hinterlasse ich nichts. Sie hat mein Geld immer verachtet, darum bekommt sie auch keins.« Breeta sagte nichts, sie beugte sich zur Schildkröte, die unter ihrem Stuhl krabbelte, und hob sie auf, vielleicht tat sie das aber auch, um ihr Gesicht zu verbergen. Sie streichelte ihren kleinen Kopf, als wäre dies das Einzige auf der Welt, was zu tun war.
»Für die Bediensteten von Second Chance habe ich eine wie ich hoffe großzügige Summe festgesetzt, außerdem soll Michael Davis ein monatliches Stipendium erhalten, falls er sich aufraffen und seine Schule beenden sollte. Ich hoffe sehr, dass er mein Angebot annehmen und etwas aus sich machen wird. Er hat mir in den letzten Wochen viel Last abgenommen.« Alle Blicke richteten sich auf Michael, doch keiner davon schien mir freundlich zu sein. Michael konnte sein Glück offenbar kaum fassen, doch die tiefen Falten auf seiner Stirn zeigten, dass er sich fragte, wie er wohl Eamon Last abgenommen hatte.
»Rose Cottage, all sein Mobiliar und der Grund, auf dem es steht, hinterlasse ich Alex Stewart aus Toronto, der hoffentlich heute anwesend sein wird. Alex war es, durch den ich eine zweite Chance erhalten habe, für die ich ihm trotz allem dankbar bin, ganz egal, was ich damals zu ihm gesagt habe. Obwohl er mein Angebot einer Belohnung zu Lebzeiten ausschlug, hoffe ich, dass er sie diesmal annehmen wird. Für mich war Rose Cottage immer ein wunderbarer Ort, also hoffe ich, dass auch Alex ihn genießen wird.«
Rose Cottage dachte ich bei mir. Das war vielleicht nicht unbedingt das kleine Vermögen, an das ich für Alex gedacht hatte. Er schien bei der Vorstellung ein wenig aus der Fassung zu geraten.
Mir kamen plötzlich Bilder eines Steinhäuschens in den Sinn, an dessen Fassade Blumen blühten, ein Second Chance in Miniatur. Überall Rosen, immerhin hieß das Häuschen ja Rose Cottage. Bestimmt war es weiß und rosa angestrichen, überlegte ich, an den Wänden Spaliere, an denen sich Rosen emporrankten und über dem Eingang wölbten. Und natürlich war das Dach mit Stroh gedeckt. Innen gab es weiße Wände, dunkles, offenes Gebälk, eine große, steinerne Feuerstelle mit brennenden Holzscheiten darin und einen von Hand geschnitzten Holzschwan auf dem Kaminsims. Vielleicht war es auch mit breiten, bequemen und prall gefüllten Sofas mit Chintzüberzug ausgestattet. Die sogar in einem milden Grünton waren? Etwa Seladongrün? Nein, sie mussten in verstaubtem Altrosa sein. Ja, Altrosa. Aber breit, weich und nachgiebig, die Art Sofa, in das man gerne mit einem guten Buch und einem Glas Sherry in der Hand versinkt. Alex müsste wahrscheinlich Küche und Leitungen modernisieren lassen, doch das wäre schon in Ordnung. Ich würde ihm dabei helfen. Vermutlich gab es auch zu wenig Schränke, aber da würde ich ihm als Geschenk schon ein paar antike aus meinem Geschäft herüberschiffen lassen, kein Problem. Kurzum, die Sache schien perfekt. Vermutlich musste man die breiten, dunkel gebeizten Fußbodendielen restaurieren lassen, ein paar Teppiche, am besten indische Dhurries, in denen auch das Altrosa, das Seladongrün und der Cremeton enthalten wären …
Das Knistern in der Luft riss mich jäh aus meinen Träumen. Als ich zu mir kam, sah ich, dass Margaret so angespannt war, dass ihre Nackenmuskulatur verkrampfte und ich selbst von hinten zu erkennen glaubte, wie sie die Zähne aufeinander biss.
Breeta seufzte nur einmal hörbar auf. Ihre älteren Schwestern hatten die Köpfe eingezogen. Während Eamon über Alex sprach, drohte ihr Zorn, den sie bislang in Schach gehalten hatten, außer Kontrolle zu geraten. Sie freuten sich nicht über Michaels Glück, aber das von Alex störte sie aus irgendeinem Grund gewaltig.
Das gleichmütige Gesicht hörte einen Augenblick auf, Flüssigkeit durch einen Strohhalm zu saugen, und fuhr fort. »Es gibt noch eine weitere Person, die anwesend sein sollte, aus Angst vor dem Zorn meiner Familie aber wohl einen Vertreter geschickt haben wird.« Die Hexen drehten sich zu dem Anwalt um, der rechts von uns saß. Er nickte und lächelte nicht unbedingt freundlich in ihre Richtung.
»Bedauerlicherweise bin ich den Wünschen meiner Familie nachgekommen und habe Padraig Gilhooly nichts von meinen Besitztümern hinterlassen.« Der Anwalt, der scheinbar diesen Gilhooly vertrat, wer immer das sein mochte, runzelte die Stirn, während Margarets Nackenmuskulatur sich ein wenig entspannte. Das Gesicht fuhr fort. »Ich möchte, dass Padraig weiß, dass ich überglücklich gewesen wäre, wenn er in unserer Hausgemeinschaft aufgenommen worden wäre, er wird also vermutlich seinen Anteil an meinem Besitz einklagen. Einer der Vorteile davon, tot zu sein, ist, dass ich mit diesen Familienstreitigkeiten und allen anderen, die ich zu Lebzeiten habe erdulden müssen, nun nichts mehr zu tun haben werde.
Es erfüllt mich mit Schmerz, dass Unfriede in dieser Familie herrscht. Es kostet mich Anstrengung, dies selbst im Angesicht des Todes aussprechen zu müssen, darum habe ich mir etwas ausgedacht, das eure Zusammenarbeit fördern soll.« Anspannung war überall im Raum zu spüren.
»So ungewöhnlich dies auch erscheinen mag, so setze ich doch meine Hoffnung darauf. Wenn ihr so wollt, ist es der törichte Optimismus eines sterbenden Mannes. Ich habe McCafferty & McGlynn gebeten, euch nach der Testamentseröffnung jeweils einen Umschlag zu überreichen. Diese beiden Rechtsvertreter haben natürlich ihre Einwände gehabt. Ihre recht schwachen Einwände hatten aber zweifellos nur das Ziel, ihre Ärsche zu retten, falls etwas schief gehen sollte, denn auf das Zusatzhonorar, das sie für ihre Bemühungen einstreichen, wollten sie auch nicht verzichten, aber so sind sie nun eben. Sie sind zu sehr an den ausschweifenden Lebensstil in St. Stephen’s Green gewöhnt, um meine Bitte auszuschlagen zu können, vor allem, als ich ihnen androhte, dass ich sonst andere Testamentsvollstrecker beauftragen würde.
In jedem Umschlag befindet sich ein Hinweis, der mit den anderen zu einem äußerst wertvollen Gegenstand führt. Ein einzelner Hinweis wird keinen von euch weiterbringen. Einige Hinweise sagen etwas über diesen Gegenstand, andere wiederum weisen auf den Ort hin, an dem er sich befindet. Mit anderen Worten, wenn ihr ihn finden wollt, müsst ihr Zusammenarbeiten. Jede Spitzfindigkeit in dieser Angelegenheit liegt mir jedoch fern. Wenn ihr einen Grund braucht, um mitzumachen, dann lasst mich euch daran erinnern, was ich bereits gesagt habe. Einigen von euch bringt mein Tod nichts, anderen wiederum weniger, als sie sich erhofft haben. Diejenigen, die etwas Wertvolles von mir erhalten haben, werden meinen, dass das, was ich euch hinterlassen habe, wertlos ist. Dieser Gegenstand ist so wertvoll, dass er euch allen helfen kann, falls ihr ihn finden solltet. Ich möchte euch dazu ermahnen, zu lernen, in Eintracht miteinander zu leben. Ich bezweifle zwar, dass ihr dazu imstande seid, doch ich hoffe sehr, dass ihr mich eines Besseren belehren werdet. Falls dem nicht so sein sollte, wird etwas Außergewöhnliches und unschätzbar Wertvolles vielleicht für immer verborgen bleiben. Mehr habe ich nicht zu sagen.«
Dann hob das Gesicht die Hand und machte eine Geste, die man als eine Entlassung des Kameramannes und uns allen werten konnte. Die Kamera entfernte sich etwas von dem Gesicht, wodurch noch mehr Schläuche und Krankenhausutensilien wie zahllose Pillenfläschchen auf dem Beistelltischchen sichtbar wurden. Byrne zeigte keinerlei Gefühl der Zuneigung, nicht einmal ein Abschiedswort war zu hören. Er hinterließ lediglich das Bild eines sterbenden Mannes, der mit schmerzverzerrtem Gesicht dalag und langsam im Dunklen verschwand.
Ein paar Minuten lang saßen wir alle da und starrten auf den dunklen Bildschirm, als würden wir über Eamon Byrnes letzte Worte nachdenken. Kein Mucks war zu hören, nur das undeutliche Rauschen des Fernsehers, das Ticken einer Uhr in der Halle, ein gedämpftes Zwitschern der Vögel, das Rascheln von Palmwedeln und irgendwo weit in der Ferne das schwache Brausen der vom Wind aufgepeitschten See.
Breeta war die Erste, die sich wieder gefangen hatte. »Verdammt clev, Dad«, seufzte sie, hievte sich aus dem Sessel und rannte zur Tür. »Echt verdammt clev.« »Was bedeutet ›verdammt clev‹?«, flüsterte mir Alex erstaunt zu, als wir Breeta nachsahen, wie sie hinauseilte.
»Vermutlich soll das zweite Wort ›clever‹ heißen«, flüsterte ich zurück.
Alex sah dem ziemlich breiten Hinterteil nach, das da verschwand, und schüttelte missbilligend den Kopf. Ich musste mir ein Lächeln verkneifen. Alex war jahrelang Zahlmeister bei der Handelsmarine gewesen, trotzdem habe ich niemals irgendeine Obszönität oder einen Fluch über seine Lippen kommen hören. Ich hingegen … Nun gut, so viel zu Klischees.
Dideldei räusperte sich nervös, zum Zeichen, dass der förmlichere Teil der Veranstaltung nun beginnen konnte. »Äußerst ungewöhnlich«, begann er. »Wäre es nicht besser für Miss Breeta Byrne, wenn sie noch warten würde?«, fragte er und sah Dideldum an.
»Sehr ungewöhnlich. Sie sollte lieber hier bleiben«, antwortete Dideldum. Dideldei blätterte irritiert einen Moment in den Unterlagen, während Deirdre die Vorhänge aufzog. Ich sah Breeta durch den Garten hinunter zum Meer laufen.
»Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause«, sagte Dideldum. »Deirdre«, sagte er und wandte sich dem Dienstmädchen zu, »vielleicht können Sie und Mr Davis frischen Tee servieren«, überlegte dann aber, dass es wohl besser war, John nicht um eine so anstrengende Tätigkeit zu bitten, nachdem er gesehen hatte, wie er einige Male während der Testamentseröffnung den Raum verlassen hatte. »Vielleicht können Sie aber auch Miss Byrne ausrichten, dass wir ihre Anwesenheit benötigen.«
Die fabelhaften Fünf vor uns standen alle gleichzeitig auf und verließen im Gänsemarsch den Raum. Und natürlich forderte uns niemand auf, ihnen zu folgen oder das Haus zu besichtigen, sie ließen Alex, mich und Padraig Gilhoolys Anwalt einfach stehen. Wir sollten alleine zurechtkommen, während Dideldum und Dideldei mit den Unterlagen und Briefumschlägen hantierten. Nachdem wir begriffen hatten, dass wir lieber bleiben sollten, wo wir waren, erhob ich mich von meinem unbequemen Stuhl. Da ich nun nicht mehr gezwungen war, auf die Schildkröte auf dem Boden zu achten, weil Breeta das arme Geschöpf mitgenommen hatte, streckte ich mich, blickte mich um und sah Michael Davis durch die Verandatür auf der Terrasse in die Richtung gehen, in die wir zuletzt Byrnes jüngste Tochter hatten laufen sehen.
Ich muss wohl nicht erst betonen, dass ich mit Antiquitäten handle, weil ich Antiquitäten liebe, und nachdem ich mich ein wenig in dem Chaos in Byrnes Zimmer zurechtgefunden hatte und nicht mehr die ärgerlichen Blicke der Familie auf mir fühlte, entpuppte sich das Zimmer als wahrer Genuss für Augen und Seele, besonders für jemanden wie mich.
An der Art, wie Menschen sammeln, kann man viel über sie erfahren, und während ich mir noch überlegte, dass das Leben für Byrne ein Kampf gewesen sein musste, begann ich, eine gewisse Logik in dem, was er sammelte, zu erkennen. Nach ein paar Minuten stand für mich fest, dass nur die Bilder eine Ausnahme waren.
Vermutlich gehörten sie schon lange zum Familienbesitz, ob seinem oder ihrem, war mir nicht klar, jedenfalls waren sie so aufgehängt, dass Byrne sie von seinem Schreibtisch aus kaum sehen konnte.
Was Byrne hingegen gerne angeschaut haben musste, waren seine Waffensammlung und die Landkarten. Die Waffen schienen sehr alt zu sein und natürlich einer bestimmten Epoche zu entstammen, obwohl ich mir nicht sicher war, um welche es sich handelte.
Das bedeutete, dass Byrne nicht irgendwelche Waffen sammelte, sondern die einer ganz bestimmten Epoche. Es befanden sich beispielsweise weder Flinten noch Pistolen noch preußische Helme oder Kriegsmedaillen darunter, sondern nur sehr alte Schwerter und Speerspitzen.
Überall im Raum befanden sich Landkarten, an den Wänden, auf den Arbeitstischen oder in Form von großen Atlanten im Zimmer verstreut. Zudem standen ein paar Rollen in der Zimmerecke, bei denen es sich auch um Landkarten handeln musste, darauf hätte ich gewettet. Zudem gab es einen Schrank mit langen, flachen Schubläden, in denen vermutlich noch mehr davon aufbewahrt wurden.
Ab und an hatte auch ich schon alte Landkarten in meinem Geschäft gehabt, und zu der Zeit suchte ich gerade wieder welche, denn ich hatte einen neuen Kunden, der ein begeisterter Landkartensammler war. Man findet an den Wänden heute hauptsächlich Kopien alter Atlanten, von denen die meisten aus der Mitte und dem späten neunzehnten Jahrhundert stammen. Botanische Drucke liegen in letzter Zeit sehr im Trend, weshalb die Preise dafür in die Höhe geschossen sind, ich habe aber herausgefunden, dass Landkarten sich allgemein immer gut verkaufen. Viele Leute kaufen sie, weil sie sich gut an den getäfelten Zimmerwänden machen, ich nenne das Raumausstattungskunst. Es gibt aber auch ernsthafte Sammler, die nach seltenen und ungewöhnlichen Karten suchen und bereit sind, einiges dafür zu bezahlen. Diese Leute begeistern sich vor allem für Blattdiagramme, das sind Karten, die nicht aus Atlanten herausgeschnitten, sondern gedruckt oder in seltenen Fällen auf einzelne Blätter oder Stoff gezeichnet wurden.
Mein Kunde, ein liebenswerter Zeitgenosse namens Matthew Wright, der alte Karten von den britischen Inseln sammelt, hätte für ein paar von Byrnes Landkarten jemanden ermordet oder zumindest ernsthaft verstümmelt. Matthew hatte mir erzählt, dass Großbritannien und Irland infolge des blühenden Handels mit den Inseln in der Antike bekannt waren und dass eine so ehrwürdige Persönlichkeit wie der alexandrinische Astronom Ptolemäus diese Gegend im zweiten Jahrhundert nach Christus gezeichnet hatte. Byrnes Landkarten waren alle von Irland, und immerhin erkannte ich ein paar von ihnen. Eine Karte war von Speed. John Speed war Kartograf im frühen siebzehnten Jahrhundert gewesen, und obwohl diese Karte im Überblick über Irland nicht ganz detailgetreu gezeichnet worden war, so war sie doch zweifellos die beste ihrer Zeit. Byrnes Karte stammte aus dem Jahre 1610.
Obwohl es sich bei der Landkarte nicht unbedingt um eine Erstausgabe handeln musste, denn Speeds Karten wurden für gewöhnlich mit Datum versehen und dann noch lange Zeit später kopiert, war ich mir ziemlich sicher, dass es sich um ein Original handeln musste.
Eine weitere Karte war, nach dem Schild auf dem Rahmen zu urteilen, William Petty zuzuordnen, der, wenn mich nicht alles täuscht, im siebzehnten Jahrhundert die erste Karte von Irland gezeichnet hat. Es gab noch eine dritte Karte hinter Glas oben auf dem Kartenschrank, die recht hübsch war und auf der der Sonnenauf- und -untergang über Irland zu verschiedenen Jahreszeiten eingezeichnet war, sowie die Abbildungen verschiedener Monstren, die um Irlands Küsten aus der See aufstiegen. Alle anderen gerahmten Karten waren auch nicht schlecht, wenn auch nicht so einmalig wie die von Speed und Petty. Dennoch handelte es sich um eine beeindruckende Sammlung. Ich verstand, warum Byrne es für richtig gehalten hatte, sie dem Trinity College zu vermachen, und vermutete, dass es sich überglücklich schätzen würde, sie zu bekommen.
Interessant war außerdem, sofern man geneigt war, Byrne anhand seiner Sammlung zu beurteilen, dass es neben den gerahmten Karten noch unzählige andere gab, die, nach meinem ungeübten Blick zu urteilen, weder Wert hatten noch reizvoll, alt oder irgendwie besonders beachtenswert gewesen wären. Es gab moderne Militärkarten, Straßenkarten von Michelin, schlicht Karten aller Art und Größe. Daran erkannte ich, dass Byrne seine Waffen wegen ihres Alters sammelte, die Karten hingegen aus einem ganz anderen Grund, von dem ich zur damaligen Zeit nicht glaubte, ihn jemals zu erfahren.
Nach ein paar Minuten Pause, in der wohl die Familie bedient wurde, rollte Deirdre das Teeservice auf einem kleinen Wägelchen herein und reichte Tassen herum. Ich überlegte, dass ein paar Schlucke des legendären irischen Whiskeys wohl eine beachtliche Verbesserung gewesen wären, verstand aber, dass die Umstände eine feierliche Nüchternheit erforderten.
»Genau da ist er gestorben«, sagte Deirdre als sie mir die Tasse mit Tee reichte. »Genau da, wo Sie jetzt stehen.« Unwillkürlich machte ich einen Satz zur Seite und hätte beinahe meinen Tee auf den Orientteppich gekippt. »Wir haben sein Bett hier drinnen aufgestellt«, fuhr sie fort, ohne meine Bedrängnis zu bemerken. »Am Schluss konnte er nicht mehr Treppen steigen. Lungenkrebs«, fügte sie hinzu. »Kam ganz plötzlich, und war sehr schlimm. Trotzdem war er gerne hier, bei all seinen Büchern und Karten und dem Blick über den Garten auf das Meer. Wir haben das Bett so gestellt, dass er hinaussehen konnte. Er war ganz alleine. Echt traurig. Die Nachtschwester hatte noch nicht angefangen und die anderen waren auch nicht da«, sagte sie, schüttelte den Kopf und sah in die Richtung, in der wir zuletzt die Familie gesehen hatten. »Die waren beim Abendessen. Breeta war auch schon lange fort.« Deirdre sah noch griesgrämiger aus, falls das überhaupt möglich war. »Er war im besten Mannesalter, noch gar nicht alt. Ich habe gehofft, er würde es bis Weihnachten schaffen, wissen Sie. Ich meine, viele Leute schaffen es bis Weihnachten.«
»Lass uns einen Blick nach draußen werfen«, sagte Alex und nahm mich am Arm.
»Gute Idee«, antwortete ich dankbar. Alex und ich schlugen alle Vorsicht in den Wind, riskierten, den Zorn der Byrne-Familie auf uns zu ziehen, öffneten die Flügeltüren und gingen hinaus auf die Terrasse hinter dem Haus. Während wir warteten, genossen wir die Sonne und nippten vorsichtig an unserem Tee, der so stark und heiß war, dass man förmlich spüren konnte, wie er die Kehle hinunterbrannte.
»Welch ein Ort!«, rief ich, als wir an der frischen Luft waren. Alex nickte.
»Was meinte Byrne, als er sagte, du hättest ihm eine zweite Chance gegeben?«, fragte ich. Alex hatte mir nur erzählt, dass er Byrne vor vielen Jahren kennen gelernt hatte, das war alles. Ehrlich gesagt, hatte ich das Gefühl, dass er mir immer ein wenig auswich, wenn ich ihn auf das Thema ansprach, doch wie ich später erfuhr, hatte das mit einem Versprechen zu tun, das er Byrne vor langer Zeit gegeben hatte.
Alex bedeutete mir, dass wir uns etwas vom Haus entfernen sollten. »Ich weiß nicht, was seine Familie darüber weiß«, sagte er ruhig. »Deshalb möchte ich sichergehen, dass uns niemand hört.« Wir gingen in den Garten und blieben kurz vor den Rosenbüschen stehen, um ihren Duft zu genießen. »Ich bin Eamon Byrne zum ersten Mal in Singapur in einer heruntergekommenen Kneipe begegnet, in der er jeden Tag an der Bar rumhing«, fing Alex an. »Mein Schiff lag wegen Reparaturarbeiten auf dem Trockendock, darum hatten die Burschen und ich ein wenig Landgang. Eamon war natürlich betrunken, der sprichwörtliche betrunkene Ire, und noch dazu recht missmutig. Er war kein glücklicher Betrunkener, dafür aber sehr gesprächig. Du weißt ja, wie diese Leute sind, die reden wollen, es ist ihnen egal, ob man ihnen zuhören will oder nicht. Er erzählte unentwegt von Irland und wie schön das Land sei, dass es aber nicht so schön wie die Frau sei, die er liebte, aber verloren hätte. Solche Geschichten eben. Gesabber, dachte ich damals. Ehrlich gesagt, langweilte er mich schrecklich. Am nächsten Tag kehrte ich jedoch wieder in das Lokal zurück, denn dort gab es billigen Schnaps, den man nicht mit allzu viel Wasser gestreckt hatte. Eamon saß wieder da und war wieder genauso betrunken.
Doch diesmal war er nicht ganz so gesprächig. Er stand einfach nur an der Bar, schüttete einen billigen irischen Whiskey nach dem anderen hinunter und weinte in sein Glas. Schwer zu sagen, was schlimmer ist, ein missmutiger Betrunkener oder ein gesprächiger. Er erzählte mir nur, dass er seine Familie, vor allem seine Mutter sehr enttäuscht hatte. Er hatte Schande über sie gebracht. Eamon stank, und nicht nur vom Alkohol. Er hatte sich seit Tagen nicht mehr gewaschen, und ich wollte ihn einfach nur loswerden.
Plötzlich legte er seinen Kopf auf den Tresen, dann setzte er sich wieder auf, als hätte er irgendeine Lösung, ein Ergebnis gefunden, taumelte vom Barhocker und auf die Straße hinaus. Obwohl er ein so unangenehmer Typ war, folgte ich ihm. Ich weiß bis heute nicht, warum, vielleicht war es Eingebung. Er ging zum Wasser hinunter und stand ewig am Landungssteg, grübelte und starrte ins Wasser. Ich wollte bereits gehen, als er sich plötzlich ins Wasser stürzte. Selbst im dämmrigen Licht am Ende der Landungsbrücke konnte ich erkennen, dass er nicht schwimmen konnte. Er versuchte es noch nicht einmal, sondern ließ sich einfach wie ein Stein sinken. Nun, was hätte ich tun sollen? Ihm zusehen, wie er untergeht? Ich sprang ihm hinterher.«
»Willst du damit sagen, dass er nicht schwimmen konnte oder dass er es nicht wollte?«, unterbrach ich Alex.
»Er konnte vermutlich nicht schwimmen. Viele Seeleute wollen nicht schwimmen lernen. Stell dir einmal vor, sie gehen im Nordatlantik oder so über Bord, dann ist es besser, wenn sie gleich ertrinken, als sich hoffnungslos abzukämpfen.«
»Du hast aber gesagt, dass er versucht hat, sich das Leben zu nehmen, dass es kein Unfall war.«
»Es war kein Unfall, da bin ich mir sicher. Ich konnte ihn nur mühsam in der Dunkelheit finden, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer er war. Irgendwie habe ich es aber dann doch geschafft, ihn herauszuziehen. Der arme Kerl hat versucht, mich abzuschütteln, doch dafür war er zu betrunken. Ich schleppte ihn zu einem kleinen dreckigen Hotel, während er mich die ganze Zeit über beschimpfte – seine Tochter kommt sprachlich wohl ganz nach dem Vater –, dann legte ich ihn ins Bett und passte auf ihn auf, während er schlief. Am nächsten Tag sorgte ich dafür, dass er sich wusch, und dabei unterhielten wir uns über das Leben. Solche Gespräche führte ich ab und an auch mit den Burschen an Bord, wenn sie irgendwie vom Weg abgekommen waren, wie man so schön sagt. Ehrlich gesagt, hatten wir eine furchtbare Auseinandersetzung. Alles in allem hatte die Situation eine gewisse Komik, wäre sie nicht so hoffnungslos gewesen. Ich versuchte, Gründe dafür zu finden, weshalb das Leben lebenswert war, und er stritt mit mir.
Schließlich sagte ich ihm, wie schrecklich es sei, sein Leben wegzuwerfen, woraufhin er antwortete, dass seines es nicht wert sei, gerettet zu werden. Dann sagte ich ihm, dass er feige gehandelt habe, egal, was ihm widerfahren sei, doch er gab zurück, dass es sein Leben sei und es nur ihn etwas anginge, was er damit mache. Ich machte keine sonderlichen Fortschritte, bis mir auffiel, dass er ein kleines Kreuz um den Hals trug. Ich sagte ihm, dass er in der Hölle schmoren würde, wenn er selbst Hand an sich legen würde, worauf er mich ansah und sagte, dass er noch für viel schlimmere Dinge in der Hölle schmoren würde. Doch der Trick schien funktioniert zu haben. Immerhin riss er sich jetzt zusammen. Irgendwann verzieh er mir, glaube ich, dass ich ihn gerettet hatte. Er sagte so etwas wie: dass es nicht meine Schuld gewesen sei und dass ein Mensch im Grunde erst dann gehen könne, wenn er abberufen werde, was an jenem Tag in Singapur nicht der Fall gewesen wäre. Eine recht fatalistische Einstellung, zu glauben, dass die Todesstunde vorherbestimmt ist. Aber Iren sind in vielerlei Hinsicht abergläubisch.«
»Hattest du denn keinerlei Hinweis darauf, was er Schreckliches angestellt hatte?«, fragte ich.
»Er hat nur gesagt, dass er etwas zerbrochen hätte. Doch was es war, weiß ich nicht mehr.« »Moment mal«, sagte ich. »Willst du mir etwa erzählen, dass er sich umbringen wollte, weil er ein Porzellanfigürchen von Royal Doulton oder so zertrümmert hat?«
»Hier in Irland wäre es wohl eher ein Kristallgegenstand von Waterford gewesen, meinst du nicht auch?«, lächelte Alex. »Nein, ich denke, dass er wohl eher ein Tabu gebrochen hat. Er benutzte damals ein Wort, das ich nicht kannte, es war jedenfalls kein englisches. Wenn es mir wieder einfallen würde, könnte mir hier vielleicht irgendjemand sagen, was es bedeutet. Aber vielleicht fällt es mir ja wieder ein. Leider ist mein Gedächtnis auch nicht mehr das, was es einmal war. Das wird das Alter sein.«
»Deins ist immer noch besser als meins«, antwortete ich. »Jedenfalls scheinst du ihm erfolgreich seinen Selbstmord ausgeredet zu haben.«
»Ich habe ihm einen Job als Deckhelfer besorgt, also fuhren wir in den folgenden Monaten gemeinsam zur See. Auf diesen Schiffen ist das Knochenarbeit, weißt du, aber für ihn war es genau das Richtige, glaube ich. Er war ein guter Arbeiter. Als wir nach Europa zurückgekehrt waren, ließ er sich seinen Lohn ausbezahlen, den er nicht versoffen hatte, und verließ das Schiff. Ich musste ihm versprechen, dass ich mit niemandem über seinen schwachen Moment, wie er ihn bezeichnete, sprechen würde, und das habe ich bis jetzt auch nie getan.
Ehrlich gesagt, denke ich auch nicht, dass ich es seiner Familie erzählen werde, wobei das vermutlich nun, da er tot ist, auch keine Rolle mehr spielen würde.
Ich kann nicht sagen, dass ich ihn gut kannte, wir waren nie eng miteinander befreundet, und kurz nachdem er von Bord gegangen war, verloren wir uns aus den Augen. Ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Sofern man das Video als Sehen bezeichnen kann. Dort und auf einem Foto, das vor ungefähr fünf Jahren in einem Wirtschaftsmagazin veröffentlicht worden ist, in dem er auf einer dieser internationalen Ranglisten, oder wie man das nennt, erwähnt und als sehr erfolgreich bezeichnet wurde. Obwohl er sehr verändert aussah, habe ich ihn gleich erkannt. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, weshalb er mich in seinem Testament erwähnt hat. Schließlich habe ich sehr wenig für ihn getan und wirklich nicht damit gerechnet, irgendetwas bei seinem Tod zu erhalten.«
»Er hat doch gesagt, dass du vorher auf eine Belohnung von ihm verzichtet hast«, sagte ich.
»Zehn Jahre nach unserem Abschied hat er mir einen Scheck über zehntausend irische Pfund geschickt – offensichtlich war er im Laufe der Zeit sehr reich geworden –, ohne einen Absender anzugeben. Ich habe den Scheck nie eingelöst. Er hatte keinen Grund, ihn mir zu schicken.«
»Das ist einleuchtend«, sagte ich. »Er hat gesagt, dass du ihm eine zweite Chance gegeben hast und sogar sein Anwesen nach dir genannt. Es muss also ein wichtiger Moment, irgendein Wendepunkt in seinem Leben gewesen sein.« Alex zuckte die Achseln. »Ich frage mich, wo dieses Rose Cottage ist, das du geerbt hast«, fügte ich hinzu. »Ich hoffe, dass es hübsch ist.«
In dem Moment tauchte Michael Davis auf. »Ich konnte Breeta nicht finden«, sagte er. »Ich habe überall nach ihr gesucht. Was machen wir jetzt?«