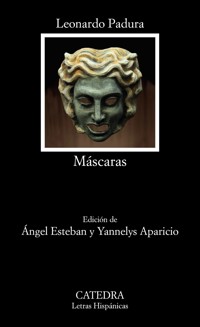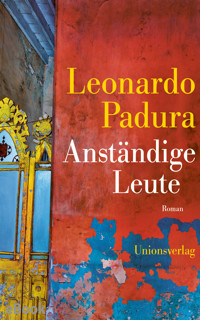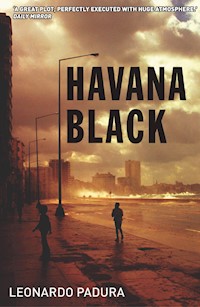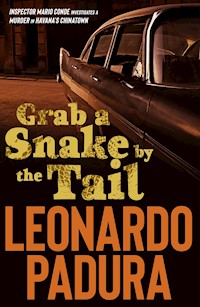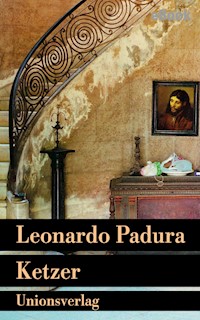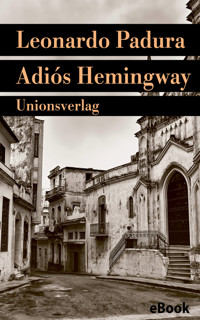9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Teniente Mario Conde hat noch einen furchtbaren Kater von der Silvesterfeier. Doch als er trotz seines freien Wochenendes von seinem Chef den Auftrag erhält, ein verschwundenes hohes Tier aus der kubanischen Nomenklatura zu suchen, merkt er bald, dass es sich bei dem Verschwundenen um Rafael Morín handelt, einen Schulkollegen. Schlagartig kommen die Erinnerungen zurück: Der Mann mit der blütenweißen Weste, der zuverlässige Genosse, war schon damals ein Musterschüler, der immer das bekam, was er wollte – auch Mario Condes Freundin Tamara. Aber in Rafael Moríns perfektem Leben gibt es ein paar verdächtige Momente, die genauer zu untersuchen sich lohnt. Dabei muss sich Mario Conde der verlorenen Liebe zu Tamara stellen – und gleichzeitig den Träumen und Illusionen seiner eigenen Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Teniente Mario Conde soll einen Verschwundenen finden, Rafael Morín, der mit Conde zur Schule gegangen ist. Der Mann mit der scheinbar blütenweißen Weste war schon damals ein Musterschüler, der immer das bekam, was er wollte – auch Condes Freundin Tamara. Der Teniente muss sich den Träumen und Illusionen seiner eigenen Generation stellen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. International bekannt wurde er mit seinem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Ein perfektes Leben
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
Havanna-Quartett »Winter«
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel Pasado perfecto bei Tusquets Editores, Barcelona.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: Pasado perfecto (2000)
Die erste Ausgabe dieses Werks im Unionsverlag erschien am 8.7.2003
© Leonardo Padura Fuentes 2000
© by Unionsverlag, Zürich 2019
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Robert Polidori
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30486-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 22.01.2019, 18:47h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
EIN PERFEKTES LEBEN
1 – Noch bevor er darüber nachdenken konnte, wusste er …
2 – Mario Conde wurde in einem lärmenden und staubigen …
3 – Das Wecken war jeden Morgen eine Katastrophe …
4 – Er hebt den Deckel der Kaffeekanne an und …
Mehr über dieses Buch
Noemí Madero: Kriminalroman, Sozialroman: Das Havanna-Quartett
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Karibik
Für Lucía, mit Liebe und Untergründigkeit
Die Ereignisse, von denen in diesem Roman berichtet wird, sind nicht real,
auch wenn sie es sein könnten, wie die Realität selbst gezeigt hat.
Jede Ähnlichkeit mit realen Ereignissen und Personen ist demnach
nichts als bloße Ähnlichkeit und ein beharrliches Streben der Realität.
Niemand darf sich deshalb von dem Roman gemeint fühlen. Niemand
auch darf sich von ihm ausgeschlossen fühlen, falls er auf ihn anspielt.
Leonardo Padura
Winter 1989
Er drehte sich um.
»Seid still!«, schrie er.
»Wir haben nichts gesagt«, sagten die Berge.
»Wir haben nichts gesagt«, sagten die Himmel.
»Wir haben nichts gesagt«, sagten die Überreste des Schiffes.
»Dann ist es ja gut«, sagte er. »Verhaltet euch weiter still!«
Alles war wieder normal.
Ray Bradbury, Träumen vielleicht
nichts mehr besitzenzwischen Himmel und Erde alsmein Gedächtnis, als diese Zeit …Eliseo Diego, Testamento
1
Noch bevor er darüber nachdenken konnte, wusste er, dass es das Schwierigste sein würde, die Augen zu öffnen. In den Pupillen die Helligkeit des Morgens auszuhalten, die in den Fensterscheiben funkelte und das ganze Zimmer mit ihrem blendenden Licht überzog. Und sodann zu erleben, wie man durch den unumgänglichen Akt des Augenaufschlagens zulässt, dass sich im Schädel eine schwammige Masse bildet, bereit, bei der kleinsten Körperbewegung einen schmerzhaften Tanz aufzuführen. Schlafen, vielleicht träumen, sagte er zu sich, dieselben einschläfernden Worte, die er schon fünf Stunden zuvor gemurmelt hatte, als er, eingehüllt in den düsteren Geruch seiner absoluten Einsamkeit, aufs Bett gefallen war. Verschwommen sah er sein Bild im Halbdunkel vor sich, das Bild eines reuigen Sünders, der vor der Kloschüssel kniete und nicht enden wollende Sturzbäche von bernsteinfarbenem, bitterem Erbrochenen von sich gab. Doch das Klingeln des Telefons durchbohrte wie Maschinengewehrsalven seine Ohren und marterte sein Hirn, das durch diese ausgefeilte, beharrliche, wirklich brutale Foltermethode weich geklopft wurde. Er ging das Wagnis ein. Hob kurz die Augenlider und musste sie wieder schließen. Schmerz drang durch die Pupillen, und er hatte nur den einen Wunsch: zu sterben. Und die furchtbare Gewissheit, dass sein Wunsch nicht in Erfüllung gehen würde. Er fühlte sich sehr schwach, zu kraftlos, um die Arme zu heben und sie eng um seine Stirn zu legen und so die bei jedem bösartigen Klingeln drohende Explosion abzuschwächen; aber er beschloss den Schmerz zu bezwingen und hob einen Arm, öffnete die Hand und schaffte es, sie um den Telefonhörer zu schließen, ihn anzuheben und auf die Gabel fallen zu lassen und auf diese Weise den segensreichen Zustand der Stille wieder herzustellen.
Er hätte gerne über seinen Sieg gelacht, doch auch das gelang ihm nicht. Er wollte sich davon überzeugen, dass er wach war, konnte sich dessen aber nicht sicher sein. Sein Arm hing wie ein abgebrochener Ast auf einer Seite des Bettes herunter. Er wusste, dass aus dem Dynamit, das in seinem Kopf lagerte, Bläschen sprudelten und jeden Moment eine Explosion drohte. Er hatte Angst, eine nur allzu bekannte und immer wieder vergessene Angst. Er hätte gerne gejammert, aber seine Zunge hatte sich in den Tiefen der Mundhöhle aufgelöst. In diesem Augenblick startete das Telefon die zweite Offensive. Nein, nein, verdammte Scheiße, nein, warum? Ja, ja, stöhnte er und hob die Hand zum Hörer. Mit den Bewegungen eines eingerosteten Lastkrans brachte er ihn an sein Ohr und ließ ihn dort liegen.
Zuerst Stille. Stille ist ein Segen. Dann die Stimme, eine harte, herrische und, wie er meinte, Furcht einflößende Stimme.
»Hallo, hörst du mich?«, glaubte er zu hören. »Mario, hallo, Mario, hörst du mich?« Und er hatte nicht den Mut zu sagen, nein, nein, ich höre nichts und will auch nichts hören, oder einfach nur: falsch verbunden.
»Ja, Chef«, murmelte er schließlich, doch vorher musste er tief einatmen, um seine Lungen mit Luft voll zu pumpen, musste seine beiden Arme dazu zwingen, sich in Richtung Kopf zu bewegen, und seine Hände, gegen die Schläfen zu drücken, damit sich die Schwindel erregende Karussellfahrt in seinem Hirn verlangsamte.
»Hör mal, was ist los, he? Was ist mit dir los?« Das war keine Stimme mehr, das war ein unbarmherziges Gebrüll. Erneut atmete er tief ein, wollte ausspucken. Seine Zunge fühlte sich an, als wäre sie dicker geworden, oder aber es war gar nicht seine Zunge.
»Nichts, Chef, ich habe Migräne. Oder erhöhten Blutdruck, was weiß ich …«
»Hör mal, Mario, nicht schon wieder! Wer hier erhöhten Blutdruck hat, das bin ich, und hör auf, mich Chef zu nennen! Was hast du?«
»Wie gesagt, Chef, Kopfschmerzen.«
»Kleiner Schelm heute Morgen, was? Also, hör mir mal gut zu: Mit deiner Morgenruhe ists vorbei.«
Ohne an die Konsequenzen denken zu wollen, öffnete er die Augen. Wie er vermutet hatte, schien die Sonne in die Fenster, und alles um ihn herum war leuchtend hell und warm. Draußen hatte die Kälte vielleicht nachgelassen, und möglicherweise war es sogar ein schöner Morgen; ihm jedoch war nach Weinen zu Mute oder nach etwas, das dem ziemlich nahe kam.
»Nein, Alter, bitte nicht, tu mir das nicht an. Das ist mein freies Wochenende. Hast du selbst gesagt. Erinnerst du dich nicht?«
»Es war dein freies Wochenende, mein Lieber, war. Wer hat dich gezwungen, zur Polizei zu gehen?«
»Aber warum ich, Alter? Dir steht doch ’n Haufen Leute zur Verfügung«, hielt er dagegen und versuchte sich aufzurichten. Die schwammige Hirnmasse stieß gegen seine Stirn, und er musste die Augen schließen. Restübelkeit stieg aus seinem Magen auf, und ein stechender Schmerz zeigte ihm das dringende Bedürfnis zu urinieren an. Er biss die Zähne zusammen und tastete nach den Zigaretten auf dem Nachttisch.
»Hör mal, Mario, ich hab nicht die Absicht, darüber abstimmen zu lassen. Weißt du, warum du dran glauben musst? Nun, weil ich es so will, darum. Also, reiß dich zusammen und steh auf!«
»Du machst nur Spaß, oder?«
»Hör auf, Mario … Ich bin schon mitten in der Arbeit, verstehst du?«, warnte die Stimme, und Mario verstand, dass er mitten in der Arbeit war. »Pass auf: Donnerstag, also am Ersten, wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben, einer der Chefs aus dem Industrieministerium ist verschwunden, verstehst du?«
»Ich bemühe mich ja zu verstehen, ich schwörs dir.«
»Dann bemüh dich weiter und schwör nicht leichtfertig. Die Ehefrau hat um neun Uhr abends Anzeige erstattet, wir haben eine landesweite Suche gestartet, aber der Mann bleibt verschwunden. An der Sache ist was faul. Du weißt, auf Kuba gehen Chefs im Range eines Vizeministers nicht einfach so spurlos verloren«, fügte der Alte in besorgtem Ton hinzu. Der andere, Mario, der es endlich geschafft hatte, sich auf die Bettkante zu setzen, versuchte die Situation aufzulockern: »In meiner Tasche ist er nicht, wirklich nicht.«
»Mario, jetzt reichts!« Die Stimme war wieder die alte. »Der Fall liegt inzwischen bei uns, in einer Stunde erwarte ich dich hier. Wenn du erhöhten Blutdruck hast, gib dir ’ne Spritze und mach dich auf die Socken.«
Er entdeckte das Zigarettenpäckchen auf dem Boden. Das erste freudige Ereignis an diesem Morgen. Das Päckchen war platt getreten und bot einen traurigen Anblick, doch er sah es voller Optimismus an. Er ließ sich von der Bettkante gleiten und setzte sich auf den Boden. Die jämmerliche Zigarette, die er mit zwei Fingern aus dem Päckchen fischte, kam ihm wie eine Belohnung für seine ungeheure Anstrengung vor.
»Hast du Streichhölzer, Chef?«, fragte er ins Telefon.
»Was soll das denn jetzt, Mario?«
»Ach, nichts. Was rauchst du heute?«
»Das errätst du nie!« Nun klang die Stimme zufrieden, genüsslich. »Eine Davidoff, Geschenk von meinem Schwiegersohn zum Jahreswechsel.«
Den Rest konnte er sich ausmalen: Der Alte betrachtete das rippenlose Deckblatt seiner Havanna, atmete den feinen Rauch ein und passte auf, dass die eineinhalb Zentimeter, die den vollkommenen Rauchgenuss garantierten, nicht abfielen. Gott sei Dank, dachte Mario.
»Heb eine für mich auf, ja?«
»Ich denke, du rauchst keine Zigarren. Kauf dir an der Ecke ein Päckchen Populares und komm her.«
»Ja, ja, schon gut … Übrigens, wie heißt der Mann?«
»Warte … Ah ja, Rafael Morín Rodríguez, Leiter der Import-Export-Abteilung im Industrieministerium.«
»Moment mal«, sagte Mario und sah auf die unappetitliche Zigarette, die zwischen seinen Fingern zitterte, was nicht unbedingt nur auf den Alkohol zurückzuführen war. »Ich glaub, ich hab dich nicht richtig verstanden. Rafael, und wie weiter?«
»Rafael Morín Rodríguez. Hast dus notiert? Gut! Dir bleiben jetzt noch genau fünfundfünfzig Minuten, dann bist du in der Zentrale«, sagte der Alte und legte auf.
Hinterhältig wie zuvor die Übelkeit stieg ein Rülpser auf und ließ einen säuerlichen Rumgeschmack im Mund des Ermittlungsbeamten Teniente Mario Conde zurück. Auf dem Boden, neben der Unterhose, sah er sein Hemd liegen. Langsam kniete er sich hin und kroch auf allen Vieren zu der Stelle, bis er einen Ärmel zu fassen kriegte. Er grinste. In der Brusttasche fand er Streichhölzer. Endlich konnte er die Zigarette, die zwischen seinen Lippen feucht geworden war, anzünden. Er inhalierte den Rauch, und nach der rettenden Entdeckung der zerdrückten Zigarette war dies das zweite Glücksgefühl des Tages, der mit Maschinengewehrfeuer, mit der Stimme des Alten und einem fast vergessenen Namen begonnen hatte. Rafael Morín Rodríguez, dachte er. Er stützte sich mit beiden Händen auf die Bettkante und stellte sich auf die Beine. Dabei wanderten seine Augen zum Regal, auf dem Rufino, der Kampffisch, mit morgendlicher Energie seine endlosen Runden in dem runden Aquarium drehte. »Was ist passiert, Rufo?«, murmelte er und besah sich die Bescherung seines jüngsten Schiffbruchs. Er überlegte, ob er die Unterhose wegräumen, das Hemd auf den Bügel hängen, seine alte Jeans glatt streichen und die Ärmel seines Jacketts auf rechts ziehen sollte. Später. Er versetzte der Hose einen Tritt und ging ins Bad, wo er sich daran erinnerte, dass er schon seit einer Ewigkeit pinkeln musste. Im Stehen beobachtete er, wie der kräftige Strahl in der Kloschüssel schäumte wie frisch gezapftes Bier. War es aber nicht, denn der beißende Uringestank stach sogar ihm in die unempfindliche Nase. Als die letzten erleichternden Tropfen ins Wasser fielen, fühlte er sich so schlapp in Armen und Beinen wie ein ausgeleierter Hampelmann, der sich nach einem ruhigen Plätzchen sehnt. Schlafen, vielleicht träumen, dachte er, wenn ich das doch nur könnte.
Er öffnete das Toilettenschränkchen und suchte die Schachtel mit den Duralginas. In der vergangenen Nacht war er nicht in der Lage gewesen, eine zu nehmen, und nun bereute er dieses unverzeihliche Versäumnis. Er legte drei Tabletten auf die Handfläche und ließ Wasser in ein Glas laufen. Dann warf er die Tabletten in seinen durch die Kotzerei geschundenen Rachen und trank Wasser hinterher. Er schloss das Schränkchen, und im Spiegel zeigte sich ihm das Bild eines Gesichtes, das ihm entfernt bekannt und zugleich unverwechselbar vorkam. Der Teufel, dachte er und stützte sich mit beiden Händen aufs Waschbecken. Rafael Morín Rodríguez, murmelte er, und nun fiel ihm auch wieder ein, dass er eine große Tasse Kaffee brauchte, um nachdenken zu können, und dazu eine Zigarette, die er nicht hatte. Er beschloss, all seine bekannten Sünden unter der stechend kalten Dusche zu büßen.
»Verdammte Scheiße, so ein Mist«, seufzte er, als er sich aufs Bett setzte, um sich die Stirn mit der wärmenden chinesischen Heilsalbe einzureiben, die ihm das Leben stets erträglicher machte.
Mit Wehmut, die ihm schon etwas zu vertraut zu werden begann, betrachtete El Conde die Hauptstraße seines Viertels, die überquellenden Mülltonnen, die Pizza-Pappen, die der Wind mit sich forttrug, das unbebaute Grundstück, auf dem er Baseball spielen gelernt hatte und das jetzt der Autowerkstatt an der Ecke als Müllhalde diente. Wo lernen die Jungen heutzutage Baseball spielen? Der Morgen war wunderbar mild, so wie er es vorausgefühlt hatte, und er genoss es, mit dem Kaffeegeschmack im Mund durch die Straßen zu wandern; doch da sah er den überfahrenen Hund mit dem zerquetschten Kopf, der neben dem Bordstein vor sich hin faulte, und er dachte, dass ihm immer die schlimmsten Dinge auffallen mussten, sogar an einem Morgen wie diesem. Er beklagte das Schicksal des unglücklichen Tieres, das ihn schmerzte wie eine Ungerechtigkeit, die zu beseitigen ihm nicht möglich war. Schon seit ewigen Zeiten, seit dem langen Todeskampf des alten Robin, hatte er keinen Hund mehr. Er hatte das Versprechen, sein Herz nie wieder an ein Tier zu hängen, gehalten, bis er sich für die schweigsame Gesellschaft eines Kampffisches entschied, den er immer wieder Rufino nannte – nach seinem Großvater, dem Züchter von Kampfhähnen –, Fische ohne Ticks und ausgeprägte Persönlichkeit, die er, wenn einer starb, durch ein gleichartiges Exemplar ersetzen konnte, das wiederum Rufino getauft und in dasselbe Aquarium gesperrt wurde, wo es stolz mit seinen verschwommen blauen Kampftierflossen umherschwamm. Er hätte es gerne gesehen, wenn die Frauen ebenso problemlos gekommen und gegangen wären wie diese Fische ohne Vergangenheit. Doch Frauen und Hunde waren so furchtbar anders als Fische, selbst Kampffische, und zu allem Übel konnte er bei Frauen kein Abstinenzgelübde ablegen, wie er es hinsichtlich der Hunde so standhaft erfüllte. Am Ende, so ahnte er, würde er sich noch einem Schutzverein für streunende Hunde und Männer mit fatalem Hang zu Frauen anschließen.
Er setzte sich die dunkle Brille auf und ging zur Bushaltestelle. Ihm fiel auf, dass das Aussehen des Viertels wohl seinem eigenen glich: eine Landschaft nach einer verheerenden Schlacht. Und er spürte, dass die empfindsamste Stelle seines Gedächtnisses Risse bekam. Die sichtbare Realität der Straße unterschied sich allzu sehr von dem rosaroten Bild seiner Erinnerung, einem Bild, von dem er sich inzwischen fragte, ob es wirklich real war oder er es möglicherweise den nostalgischen Erzählungen seines Großvaters verdankte. Oder ob er selbst es ganz einfach erfunden hatte, um die Vergangenheit zu ertragen. Man darf nicht sein ganzes verdammtes Leben lang grübeln, sagte er sich, und er bemerkte, dass die milde Morgenwärme die Tabletten dabei unterstützte, dem, was in seinem Kopf war, wieder Gewicht, Stabilität und ein paar elementare Funktionen zu verleihen. Er nahm sich vor, derartige Alkoholexzesse in Zukunft zu vermeiden. Seine Augen brannten vor Schlafmangel. Er kaufte sich Zigaretten, und dann spürte er, wie der Rauch den Kaffeegeschmack ergänzte und er wieder zu einem Menschen wurde, der in der Lage war zu denken und sogar sich zu erinnern. Da bereute er seinen Wunsch, sterben zu wollen, und um sich das Gegenteil zu beweisen, lief er zum Bus, der unbegreiflicherweise fast leer war. Das ließ ihn ahnen, dass das neue Jahr absurd begann. Doch das Absurde besitzt nicht immer die Freundlichkeit, sich im Gewande eines am Morgen fast leeren Busses zu präsentieren.
September 1972
Es war erst zwanzig nach eins, doch alle waren bereits vollzählig versammelt, nicht einer fehlte. Sie hatten sich in Grüppchen aufgeteilt, rund zweihundert Schüler, die man an ihrem Äußeren erkennen konnte. An dem Gitterzaun unter den riesigen Hibiskusbäumen standen die aus dem Varona-Viertel, seit langem Herren dieser beliebtesten Ecke, der mit dem meisten Schatten. Für sie bedeutete der Wechsel in die Oberstufe nichts weiter, als von ihrer Sekundarschule die Straße zu überqueren, und schon waren sie da. Sie redeten laut, lachten, hörten Elton John aus einem voll aufgedrehten Transistorradio Marke »Meridian«, das den Sender WQAM aus Miami tadellos empfing. Bei ihnen standen die hübschesten Mädchen. Keine Frage.
Die aus Párraga, großspurig und unverschämt, standen in der prallen Septembersonne mitten auf dem Roten Platz, und ich wette, dass sie nervös waren. Ihre Angeberei machte sie misstrauisch, sie gehörten zu jenen Typen, die Unterhosen mit Beinansatz tragen, für alle Fälle. Ein Mann ist ein Mann, alles andere ist Schwuchtelkram, sagten sie und hielten sich ein weißes Taschentuch vor den Mund. Sie sprachen so gut wie nie, und die meisten von ihnen trugen Kleidung und Haarschnitt nach der letzten Mode und benahmen sich großkotzig. Aber ihre Mädchen waren wirklich nicht schlecht, wahrscheinlich gute Salsa-Tänzerinnen, die leise miteinander tuschelten, so als wäre es ihnen etwas unheimlich, zum ersten Mal in ihrem Leben so viele Leute zu sehen. Die aus Santos Suárez waren anders, machten einen vornehmeren Eindruck, fleißiger, hellhäutiger, sauberer und ordentlicher als alle andern, was weiß ich. Sie sahen aus wie Streber, Kinder von einflussreichen Papas und Mamas. Die aus Lawton dagegen glichen denen aus Párraga. Sie waren fast genauso arrogant und blickten auf alles verächtlich herab, und sie hielten sich ebenfalls ein weißes Taschentuch vor den Mund. Sogleich kam mir der Gedanke, dass sich die beiden Gruppen in Sachen Großspurigkeit Konkurrenz machen würden.
Wir anderen, die aus den Vorstadtvierteln, waren am schwersten einzuordnen. Die Clique um den verrückten Loquillo, Potaje, Ñáñara und diese Leute sahen aus wie die aus Párraga, wegen des Haarschnitts und der modischen Klamotten; andere glichen denen aus Santos Suárez: Pello, Mandrake, Ernestico und Andrés, vielleicht auch wegen der Kleidung; andere wiederum denen aus dem Varona, auf Grund ihrer Selbstsicherheit und der Selbstverständlichkeit, mit der sie redeten und rauchten. Und ich, ich sah neben Andrés und dem Hasenzahn wie ein richtiger Blödmann aus, war bemüht, alles mitzukriegen, und suchte in der fremden, mir unbekannten Menge das Mädchen, das ich mir als Freundin vorstellte. Brünett sollte sie sein, mit langem Haar, schönen Beinen, möglichst peppig, aber nicht zu peppig, denn sie sollte mir im Landschulheim die Wäsche waschen und so. Und natürlich kein feines Dämchen durfte sie sein, klar, damit sie mir nicht mit Ficken-ist-nicht und so kommen würde. Kurz und gut, ich wollte sie nicht gleich heiraten. Hoffentlich eine aus La Víbora oder Santos Suárez, die ließen immer tolle Partys steigen, und bis nach Párraga oder Lawton wollte ich dafür nicht pilgern. Und was in unserem Viertel so rumlief, interessierte mich nicht, das waren keine peppigen Mädchen, nicht mal kleine Schlampen; zu den Festen nahmen die sogar ihre Mütter mit. Am besten, wenn meine Zukünftige mit mir in derselben Gruppe war, auf der Liste standen mehr Mädchen als Jungen. Fast doppelt so viele, habs kurz überschlagen, auf jeden Jungen kommen 1,8 Mädchen, eine komplette und die andere ohne Kopf oder mit nur einer Brust, sagte der Hasenzahn zu mir, vielleicht die da mit den Schlitzaugen, aber die ist aus dem Varona, die haben alle ihren festen Stecher. Und da schrillte die Klingel, und es öffneten sich an jenem 1. September 1972 die Tore der Oberstufenschule von La Víbora, wo ich so viel erleben sollte.
Wir brannten buchstäblich darauf, in den Käfig zu kommen, wie das am ersten Schultag eben so ist. Als würde der Platz nicht für alle reichen, rannten einige sogar – die Mädchen, klar – auf den Schulhof, wo sich die verschiedenen Gruppen hinter nummerierten Holzpfählen aufstellen mussten. Ich gehörte zur Gruppe 5, in der sich aus unserem Viertel nur noch der Hasenzahn befand, ein Junge, mit dem ich seit der fünften Klasse zusammen war. Der Schulhof füllte sich. Noch nie hatte ich in einer einzigen Schule so viele Menschen gesehen, wirklich nicht, und ich fing an, mir die Mädchen in unserer Gruppe anzuschauen, um eine Vorauswahl zu treffen. Die Sonne brannte ganz schön, was ich aber nicht merkte, weil ich ja mit der Auswahl beschäftigt war. Dann sangen wir die Nationalhymne, und der Direktor stieg auf das Podium, das im überdachten Eingang aufgebaut war, im Schatten, und begann ins Mikrofon zu sprechen. Als Erstes schärfte er uns ein: Mädchen, der Rock bis über die Knie, mit dem vorgeschriebenen Saum, steht alles auf dem Zettel, den man Ihnen bei der Anmeldung gegeben hat; Jungs, Haare kurz geschnitten, Ohren frei, keine Koteletten, kein Schnäuzer; Mädchen, die Bluse in den Rock gesteckt, mit Kragen, ohne Verzierungen, steht alles auf dem Zettel …; Jungs, normale Hosen, keine Röhrenhosen, keine mit weitem Schlag, das hier ist eine Schule und keine Modenschau; Mädchen, die Kniestrümpfe hochgezogen, nicht auf die Knöchel runtergerollt – wo es ihnen doch so gut stand, sogar die mit dünnen Beinen sahen damit besser aus –; Jungs, beim ersten Verstoß gegen die Schulordnung, schon bei einem einfachen Vergehen, ab vors Comité Militar, das hier ist eine Schule und nicht die Besserungsanstalt von Torrens; Mädchen und Jungs, Rauchen auf den Toiletten verboten, sowohl in den Pausen als auch zu allen übrigen Zeiten. Und dann noch einmal: Mädchen und Jungs … Die Sonne brannte mir jetzt überall auf den Körper, er stand ja im Schatten und sprach, und dann kündigte er den Vorsitzenden der Schülervertretung an.
Er stieg aufs Podium und zeigte sein strahlendstes Lächeln. Colgate, hatte der Dünne wohl gedacht, aber da kannte ich den Dünnen, der hinter mir in der Reihe stand, noch nicht. Als Vorsitzender der Schülervertretung musste der auf dem Podium in der 12 oder 13 sein, später erfuhr ich, dass er in die 13 ging. Er war groß, fast blond, hatte sehr helle Augen – ein treuherziges, leicht verschwommenes Hellblau – und sah wie frisch gebadet, gekämmt, rasiert, parfümiert aus. Trotz der Entfernung und der Hitze machte er einen wachen und sehr selbstsicheren Eindruck, als er seine Rede begann, sich als »Rafael Morín Rodríguez« vorstellte, »Vorsitzender der Schülervertretung an der Oberstufe des Gymnasiums René O. Reiné und Mitglied des Comité Municipal de la Juventud. Ich erinnere mich noch genau an ihn, an die Sonne, von der ich Kopfschmerzen bekam, und an die Gewissheit, dass der Junge auf dem Podium zum Führer geboren war. Er redete sehr lange.
Die Aufzugtüren öffneten sich mit der Langsamkeit eines Vorhangs in einem kleinen Theater. Erst jetzt fiel dem Teniente auf, dass er für diese Szene keine Sonnenbrille benötigte. Seine Kopfschmerzen waren so gut wie weg, doch das vertraute Bild von Rafael Morín wühlte Erinnerungen in ihm auf, die er in den hintersten Winkeln seines Gedächtnisses verschüttet geglaubt hatte. El Conde liebte es, sich zu erinnern. Einen »Erinnerungsfetischisten« nannte ihn der Dünne. In diesem Fall wäre ihm allerdings ein erfreulicherer Anlass zum Erinnern lieber gewesen. Er ging den Korridor entlang. Er hätte lieber geschlafen als gearbeitet. Vor dem Büro des Alten rückte er seine Pistole zurecht, die jeden Augenblick aus dem Hosenbund zu rutschen drohte.
Maruchi, die Sekretärin des Alten, hatte ihren Platz verlassen. Sie frühstückte wohl, wie er aufgrund der Uhrzeit vermutete. Er klopfte an die Glasscheibe der Tür, öffnete und sah Mayor Antonio Rangel hinter seinem Schreibtisch sitzen. Der Alte hörte sich aufmerksam an, was ihm jemand durchs Telefon zu sagen hatte, und ließ seine Zigarre nervös von einem Mundwinkel in den anderen wandern. Mit den Augen deutete er auf die Akte, die offen vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Der Teniente schloss die Tür, setzte sich seinem Chef gegenüber und wartete auf das Ende des Telefongesprächs. Der Mayor hob die Augenbrauen, stieß ein knappes »Verstanden, ja, heute Nachmittag« hervor und legte auf.
Dann betrachtete er verstört das malträtierte Ende seiner Davidoff. Er hatte die Zigarre übel zugerichtet. Zigarren sind nachtragend, pflegte er zu sagen, und bestimmt würde diese hier nicht mehr so gut schmecken. Rauchen und jünger aussehen waren seine erklärten Leidenschaften, denen er sich mit fachmännischer Gründlichkeit widmete. Stolz verkündete er sein Alter, achtundfünfzig, wobei er mit seinem faltenlosen Gesicht lächelte und über seinen Fakir-Bauch strich. Seine Uniform war knapp geschnitten, die grauen Schläfen schienen eine jugendliche Laune zu sein. Seine freien Abende verbrachte er zwischen Swimmingpool und Squash-Halle, auch hier mit der Zigarre im Mund. Mario Conde beneidete ihn sehr. Er wusste, dass er selbst mit sechzig Jahren – falls ich überhaupt so alt werde! – ein arthritischer, wunderlicher Greis sein würde, und deswegen beneidete er den Mayor um seine offensichtliche Fitness. Nicht mal husten musste er vom Zigarrenrauchen. Obendrein beherrschte er alle Tricks, die ein guter Chef beherrschen muss: sehr liebenswürdig oder sehr autoritär, je nach Belieben. Das Furchterregendste an ihm war zweifellos seine Stimme. Die Stimme ist der Spiegel der Seele, dachte Mario Conde immer, wenn er auf die Nuancen in Tonfall und Strenge achtete, derer sich der Mayor im Gespräch bediente. Jetzt aber hatte er eine malträtierte Davidoff zwischen den Fingern und ein Hühnchen mit einem Untergebenen zu rupfen, und so griff er auf eine seiner schlimmsten Kombinationen von Stimme und Tonfall zurück.
»Ich will mich mit dir nicht über das von heute Morgen streiten, aber eins sag ich dir, so was lass ich mir nicht noch einmal bieten! Bevor ich dich kannte, war mein Blutdruck normal, und du wirst es nicht schaffen, dass ich an einem Infarkt sterbe. Nicht umsonst schwimme ich regelmäßig und schwitze beim Squash wie ein Affe. Ich bin dein Vorgesetzter, und du bist Polizist, häng dir das übers Bett, damit dus auch im Schlaf nicht vergisst. Beim nächsten Mal gibts was auf die Eier, klar? Schau auf die Uhr, fünf nach zehn! Okay?«
Mario Conde senkte den Blick. Ihm fielen ein paar gute Witze ein, doch er wusste, dass dies nicht der richtige Moment dafür war. Überhaupt war beim Alten nie der richtige Moment, was er sowieso schon oft genug ignorierte.
»Die Davidoff ist ein Geschenk von deinem Schwiegersohn, hast du gesagt, ja?«
»Ja, eine 25er-Kiste zu Neujahr. Aber komm nicht vom Thema ab, ich kenn dich«, und wieder betrachtete er verständnislos das rauchende Etwas, das in den letzten Zügen lag. »Die ist hin … Also, soeben hab ich mit unserem Industrieminister gesprochen, er macht sich große Sorgen wegen dieser Angelegenheit. Ich glaub, er ist ganz außer sich. Sagt, Rafael Morín sei ein wichtiger Kader in der Ministeriumsspitze und habe mit zahlreichen Unternehmern aus dem Ausland zu tun, und deswegen will er einen Skandal vermeiden.« Der Alte machte eine Pause und zog an seiner Zigarre. »Hier ist alles, was wir bisher zusammengetragen haben«, fügte er hinzu und schob die Akte seinem Untergebenen zu.
Mario Conde nahm die geschlossene Akte in die Hand. Ihm schwante, dass sie eine Art Büchse der Pandora sein könnte, und er verspürte keinerlei Lust, die Dämonen der Vergangenheit aus ihr zu befreien.
»Warum hast du ausgerechnet mich für den Fall ausgesucht?«, fragte er.
Der Alte zog wieder an seiner Zigarre. Er schien auf eine überraschende Erholung der Havanna zu hoffen. Tatsächlich bildete sich eine gleichmäßige, gesunde fahle Asche an der Spitze, und er zog behutsam, gerade so viel, um die Glut nicht ausgehen zu lassen und die empfindliche Einlage nicht zu schädigen.
»Ich werde jetzt nicht wiederholen, was ich dir vor einiger Zeit mal gesagt habe, nämlich dass du der Beste bist oder einen Riesendusel hast und dir alles gelingt. Bilde dir das bloß nicht ein, das ist vorbei, okay? Was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass ich dich ausgewählt habe, weil ich es so wollte oder weil ich finde, dass du besser hier aufgehoben bist als zu Hause, wo du immer nur von Romanen träumst, die du nie schreiben wirst, oder weil diesen Scheiß-Fall jeder Blödmann lösen kann. Such dir die Antwort aus und kreuze sie an.«
»Ich entscheide mich für das, was du mir nicht mehr sagen willst.«
»Das ist dein Problem, ja? Und jetzt hör zu: In jeder Provinz wurde ein Beamter mit der Suche nach Rafael Morín beauftragt. Dort hast du die Vermisstenanzeige, die seit gestern erteilten Anordnungen und die Liste der Leute, die dir zur Verfügung stehen. Ich hab dir auch wieder Manolo zugeteilt … Außerdem die Personenbeschreibung des Vermissten, sein Foto und eine Kurzbiografie, die uns seine Frau gegeben hat.«
»In der es heißt, dass es sich um einen untadeligen Menschen handelt.«
»Ich weiß, untadelige Menschen magst du nicht, aber damit musst du leben. Ja, allem Anschein nach ist er ein untadeliger Mann und zuverlässiger Genosse. Niemand hat einen blassen Schimmer, wo er da reingeraten oder was ihm passiert sein könnte. Ich jedenfalls rechne mit dem Schlimmsten … Aber dich interessiert das wohl überhaupt nicht, was?«, schrie er in plötzlich verändertem Tonfall.
»Hat er vielleicht das Land verlassen?«
»Sehr unwahrscheinlich. Außerdem gab es lediglich zwei Versuche, beide gescheitert. Der Nordwind bläst wie verrückt.«
»Krankenhäuser?«
»Natürlich nichts, Mario.«
»Hotels?«
Der Alte schüttelte den Kopf und stützte sich mit beiden Ellbogen auf den Schreibtisch. Es sah so aus, als langweilte er sich.
»Politisches Asyl in irgendwelchen Pensionen, Stundenhotels, illegalen Kneipen?«
Der Alte lächelte. Ein kaum wahrnehmbares Zucken der Lippe über der Zigarre. »Mach, dass du wegkommst, Mario, aber vergiss nicht, was ich dir gesagt habe: Beim nächsten Mal mach ich dich fertig! Du kriegst ein Disziplinarverfahren an den Hals, wegen ungebührlichen Benehmens gegenüber einem Vorgesetzten.«
Teniente Conde stand auf. Er nahm die Akte in die linke Hand, rückte mit der rechten die Pistole zurecht und deutete einen militärischen Gruß an. Als er sich umdrehen wollte, um das Büro zu verlassen, ließ Mayor Rangel eine weitere Version seiner Kombinationen von Stimme und Tonfall hören, bemüht, ein Gleichgewicht zwischen Überredungskunst und Neugier herzustellen.
»Mario, darf ich dir zwei Fragen stellen?« Er stützte das Gesicht in beide Hände. »Junge, warum bist du zur Polizei gegangen? Verrat mir das endlich, los!«
Mario Conde sah den Alten an, als hätte er nicht richtig verstanden. Er wusste, dass er ihn mit seiner Mischung aus Gleichgültigkeit und Effizienz immer wieder aus der Fassung bringen konnte, und diesen kurzen Moment der Überlegenheit genoss er.
»Ich weiß es nicht, Chef. Seit zwölf Jahren denke ich darüber nach, aber ich weiß es immer noch nicht. Und die zweite Frage?«
Der Mayor stand auf und kam um den Schreibtisch herum. Er strich sich das Uniformhemd glatt, eine Art kurzärmelige Jacke mit Achselstücken und Rangabzeichen, die frisch aus der Wäscherei zu kommen schien. Dann musterte er die Schuhe, die Hose, das Hemd und das Gesicht des Teniente.
»Wo du nun schon mal Polizist bist«, begann er, »wann wirst du dich wie ein Polizist kleiden, he? Und warum rasierst du dich nicht anständig? Schau dich doch mal an, du siehst aus, als wärst du krank.«
»Das waren drei Fragen, Mayor. Willst du darauf drei Antworten?«
Der Alte lächelte und schüttelte den Kopf. »Nein, ich will, dass du Rafael Morín findest. Im Grunde interessiert es mich doch gar nicht, warum du zur Polizei gegangen bist. Und noch weniger, warum du nicht endlich diese verwaschene Hose ausziehst. Was mich interessiert, sind schnelle Resultate. Ich habe es nicht gerne, wenn Minister mir Druck machen«, fügte er hinzu, dann gab er den militärischen Gruß lustlos zurück und setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch, von wo aus er den Teniente hinausgehen sah.
Gegenstand der Anzeige: Verschwinden einer PersonAnzeigenerstatter: Tamara Valdemira MéndezPrivatanschrift: Santa Catalina N° 1187, Santos Suárez, Havanna StadtPers.-Ausweis Nr. 56071000623Beruf: Zahnärztin
Angaben zum Fall: Am Donnerstag, dem 1. Januar 1989, um 21.35 Uhr erscheint auf der hiesigen Dienststelle die Anzeigenerstatterin (= AE), um das Verschwinden des kubanischen Staatsangehörigen Rafael Morín Rodríguez anzuzeigen, Ehemann der AE, wohnhaft o.g. Adresse, Pers.-Ausweis-Nr. 52112300565, Hautfarbe: weiß, Haarfarbe: dunkelblond, Augenfarbe: blau, Größe: ca. 180 cm. Die AE erklärt: Nach einer gemeinsamen Neujahrsfeier mit Arbeitskollegen und Freunden kehrten die AE und ihr Ehemann Rafael Morín Rodríguez nach Mitternacht in ihr gemeinsames Haus zurück. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass der gemeinsame Sohn in seinem Zimmer schlief, zusammen mit der Mutter der AE, gingen sie in ihr Schlafzimmer und legten sich zu Bett. Am darauf folgenden Morgen, als die AE aufwachte, hielt sich Rafael Morín Rodríguez nicht mehr im Haus auf, worüber sich die AE zunächst jedoch keinerlei Gedanken machte, da er in der Vergangenheit häufiger das Haus verlassen hatte, ohne sie zu informieren. Gegen Mittag, jetzt bereits etwas beunruhigt, rief die AE verschiedene Freunde und Arbeitskollegen sowie das Unternehmen, in dem ihr Mann arbeitet, an, erhielt aber keinerlei Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Zu diesem Zeitpunkt machte sie sich bereits Sorgen, da ihr Ehemann weder das Privatauto (Lada, amtl. Kz: HA 11934) noch das des Unternehmens (z. Zt. in der Werkstatt) benutzt hatte. Im Laufe des Nachmittags riefen die AE und René Maciques Alba, ein Arbeitskollege des Vermissten, in verschiedenen Krankenhäusern an, ohne Ergebnis, und fuhren dann zu weiteren Krankenhäusern, die sie telefonisch nicht erreichen konnten, jedoch ebenfalls ohne Ergebnis. Um 21.35 Uhr erschienen auf hiesiger Dienststelle die AE und René Maciques Alba, um das Verschwinden von Rafael Morín Rodríguez anzuzeigen.
Wachhabender Beamter: Lincoln Capote, Sargento
Anzeige Nr. 16-0101-89
Leiter der Dienststelle: Jorge Samper, Primer Teniente
Anlage 1: Foto des Vermissten
Anlage 2: Persönliche und berufliche Daten des Vermissten
Weitergeleitet zur Bearbeitung. Dringlichkeitsstufe 1
Polizeidirektion Havanna Stadt
Er sah Tamara vor sich, wie sie Anzeige erstattete, und schaute sich wieder das Foto des Vermissten an. Es war wie ein Köder, der ferne Erinnerungen aufwühlte, Tage, die er vergessen wollte, nostalgische Gräber. Das Foto glänzte, es war wohl erst vor kurzem aufgenommen worden. Doch auch wenn der Mann auf dem Foto zwanzig Jahre alt gewesen wäre, wäre er heute immer noch dieselbe Person. Sicher? Sicher. Er schien immun gegen die Wechselfälle des Lebens, liebenswürdig auch auf Passbildern, frei von Schweiß, Akne und Fett, von der dunklen Bedrohung des Bartwuchses, ausgestattet mit dem gewissen Etwas eines makellosen, vollkommenen Engels. Zurzeit allerdings galt er als vermisst, ein alltäglicher Fall für die Polizei, eine Arbeit für Mario Conde, die dieser lieber nicht hätte erledigen wollen. Was war da los, verdammt noch mal?, fragte er sich beim Verlassen des Büros. Er verspürte keinerlei Verlangen, den Bericht mit den persönlichen und beruflichen Daten des untadeligen Rafael Morín Rodríguez durchzulesen. Vom Fenster seines eigenen kleinen Büros konnte er einen Ausblick genießen, der ihm wie ein impressionistisches Gemälde vorkam: die von uralten Lorbeerbäumen gesäumte Straße, diffuse grüne Flecken im Sonnenlicht, die im Stande waren, das Brennen in seinen Augen zu lindern; eine bedeutungslose kleine Welt, deren Geheimnisse er allesamt kannte und an der ihm jede Veränderung auffiel: ein neues Spatzennest, ein absterbender Ast, die Erneuerung des Laubes, die durch die dunkle Färbung der immergrünen Blätter angekündigt wurde. Hinter den Bäumen eine Kirche mit hohen Gittern und glatten Außenmauern sowie einige nur undeutlich zu erkennende Gebäude. Und schließlich, ganz hinten, das Meer, das man nur als Lichtfleck und als Geruch wahrnehmen konnte. Die Straße war leer und warm und sein Kopf so gut wie leer und ein wenig benebelt. Wie gerne, dachte er, säße er unter diesen Lorbeerbäumen und wäre noch einmal sechzehn Jahre alt, einen Hund an seiner Seite, den er streicheln, und eine Freundin, auf die er warten könnte. Dann, einfach so dasitzend, wäre er rundum glücklich, jede Wette, so glücklich, wie man nur sein kann, was er schon beinahe vergessen hatte. Und vielleicht würde es ihm sogar gelingen, seine Vergangenheit, die ja seine Zukunft wäre, in Ordnung zu bringen und sich auszumalen, wie sein Leben verlaufen werde. Der Gedanke faszinierte ihn, denn dann würde er versuchen, es anders zu gestalten. Jene lange Kette von Irrtümern und Zufällen, die seine Existenz bestimmt hatte, würde sich nicht wiederholen; es müsste eine Möglichkeit geben, sie zu unterbrechen oder wenigstens zu korrigieren und einen anderen Weg, das heißt, ein anderes Leben auszuprobieren. Sein Magen hatte sich inzwischen so einigermaßen beruhigt. Er wünschte sich, den Kopf freizuhaben, um sich in diesen Fall zu stürzen, der ihn in die Vergangenheit führte und ihn aus der friedlichen Willenlosigkeit riss, die er sich fürs Wochenende erträumt hatte. Er drückte die rote Taste der Gegensprechanlage und verlangte, man solle Sargento Palacios zu ihm schicken. Vielleicht, so dachte er, konnte er von Manolo lernen. Zum Glück gab es Leute wie ihn, so dachte er weiter, denen es gelang, die tägliche Arbeitsroutine durch ihre bloße Anwesenheit und ihren Optimismus aufzulockern. Manolo war ein guter Freund, erwiesenermaßen verschwiegen und fleißig, aber ohne Hektik. Mario Conde zog ihn allen anderen Sargentos und den übrigen Ermittlern der Kripo vor.
Er sah den größer werdenden Schatten hinter der Glasscheibe, und dann trat Sargento Manuel Palacios ohne anzuklopfen ein.
»Ich dachte, du wärst noch nicht da«, sagte Manolo und setzte sich in einen der Sessel vor Condes Schreibtisch. »Was für ein Leben, Bruder. Scheiße, du hast heute aber dein verschlafenes Gesicht aufgesetzt!«
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie hackevoll ich gestern war. Furchtbar!« Beim bloßen Gedanken daran zog sich Mario der Magen zusammen. »Die alte Josefina hatte Geburtstag, wir haben mit Bier angefangen, ich hatte welches besorgt, danach gabs zum Essen Rotwein, so ’n scheiß-rumänischen, kam aber gut, und hinterher hat der Dünne ’ne Flasche Añejo geköpft, die er eigentlich seiner Mutter geschenkt hatte. Als der Alte mich heute Morgen anrief, wär ich fast gestorben.«
»Maruchi sagt, der Alte ist sauer auf dich gewesen, weil du einfach aufgelegt hast.« Manolo grinste und rutschte tiefer in den Sessel zurück. Er war gerade mal fünfundzwanzig und hatte Probleme mit der Wirbelsäule. Keine Sitzgelegenheit war für seinen knochigen Hintern geeignet, und er konnte nicht lange stehen, ohne ein paar Schritte zu gehen. Mit seinen langen Armen und dem hageren Körper bewegte er sich wie ein wirbelloses Tier. Von den Leuten, die der Teniente kannte, war er der Einzige, der sich in den Ellbogen beißen und über die Nase lecken konnte. Sein Gang war wie ein Schweben, und wenn man ihn so sah, hielt man ihn für schwächlich, sogar zerbrechlich, und bestimmt für jünger, als er war.
»Der Alte ist nervös«, sagte der Teniente, »er kriegt nämlich auch Anrufe, von oben.«
»Wohl ein schwieriger Fall, was? Mich hat er auch angerufen, höchstpersönlich.«
»Nicht nur schwierig, sondern vor allem heikel. Hier, nimm das mit«, sagte Mario Conde und ordnete die Aktenblätter, »lies das durch, in einer halben Stunde fahren wir los. Ich muss noch darüber nachdenken, wie wirs am besten anpacken.«
»Du kannst schon wieder denken?«, fragte der Sargento und verließ mit seinem federnd leichten Gang das Büro.
El Conde blickte auf die Straße hinunter und lächelte. Ja, er konnte schon wieder denken, und er dachte, dass der Fall eine Bombe war. Er ging zum Telefon und wählte. Das metallische Klingeln am anderen Ende erinnerte ihn an sein furchtbares Erwachen.
»Hallo«, hörte er eine Frauenstimme sagen.
»Jose, ich bins.«
»Sag mal, mein Kleiner, wie geht es dir heute Morgen?«, fragte die Frauenstimme. Sie hörte sich fröhlich an.
»Frag mich besser nicht! Aber es war doch ein schöner Geburtstag, oder? Was macht der Bär?«
»Ist noch nicht aufgewacht.«
»Manche Leute haben ein Glück …«
»Sag mal, was ist los? Von wo rufst du an?«
Er seufzte und sah wieder auf die Straße, bevor er antwortete. Die wärmende Sonne stand nach wie vor am blanken Himmel. Ein Samstag, wie er ihn selbst nicht hätte besser machen können. Zwei Tage zuvor hatte er einen Fall abgeschlossen, ein Devisenvergehen, das ihn mit endlosen Fragezeichen zur Verzweiflung gebracht hatte. Eigentlich wollte er am Wochenende bis in die Puppen schlafen. Und jetzt verschwand dieser Kerl!
»Aus dem Brutofen, Jose«, jammerte er. Damit meinte er sein kleines Büro. »Bin in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett geklingelt worden. Es gibt keine Gerechtigkeit für uns Gerechte, meine Liebe, ich sags dir.«
»Dann kommst du also nicht zum Mittagessen?«
»Sieht ganz so aus. Sag mal, was muss ich da durchs Telefon riechen?«
Die Frau lachte. Sie kann immer lachen, diese wunderbare Frau!
»Das, was du dir entgehen lässt, mein Junge.«
»Something special?«
»Nein, nothing special, aber sehr lecker. Hör zu: die malangas, die du mitgebracht hast, gekocht, in Knoblauchsoße, mit viel Knoblauch und bitteren Apfelsinen; die Schweineschnitzel, die gestern übrig geblieben sind, stell dir vor, ich hab sie eingelegt, sie sind so gut wie fertig, und es reicht für zwei pro Kopf; dazu schwarze Bohnen, schön sämig, wie ihr sie am liebsten mögt, wegen des intensiven Geschmacks, und jetzt gebe ich noch einen Schuss argentinisches Olivenöl dazu, hab ich in der Bodega gekriegt. Beim Reis hab ich schon die Flamme klein gestellt, auch den hab ich mit Knoblauch angemacht, so wie dir dein Freund aus Nicaragua gesagt hat. Und dann der Salat: Kopfsalat, Tomaten und Radieschen. Ach ja, das Dessert: geraspelte Kokosnuss mit Käse … Bist du noch dran, Condesito?«
»Ich beiß mich in den Arsch, Jose«, sagte El Conde, und er spürte, wie sich sein angegriffener Magen endgültig erholte. Er schwärmte für reich gedeckte Tische und hätte sein Leben hergegeben für ein solches Menü. Er wusste, dass Josefina das Essen eigens für ihn und den Dünnen zubereitete, und jetzt musste er darauf verzichten. »Hör schon auf, ich hab keine Lust mehr, mit dir zu reden. Weck den Dünnen auf und gib ihn mir. Der alte Säufer soll endlich aufstehen …«
»Sag mir, mit wem du umgehst …«, lachte Josefina und legte den Hörer neben die Gabel.
Er kannte sie nun schon seit zwanzig Jahren, aber auch in den schlimmsten Augenblicken hatte er sie niemals fatalistisch oder am Boden zerstört erlebt. Mario Conde bewunderte und liebte sie, manchmal mehr als seine eigene Mutter, mit der ihn keine so innige und vertraute Beziehung verband wie mit der Mutter von Carlos, dem Dünnen, der nicht mehr dünn war.
»Was ist?«, brummte der Dünne. Seine Stimme klang tief und belegt. Genauso schrecklich, wie die seines Freundes wohl geklungen haben musste, als der Alte ihn geweckt hatte.
»Ich werd dir den Rausch austreiben«, versprach Mario grinsend.
»Scheiße, das hab ich auch nötig, ich bin fix und fertig. Ich sags dir, du Wildsau: Nie wieder so ’ne Sause wie gestern Nacht, das schwör ich dir bei deiner Mutter!«
»Tut dir der Kopf weh?«
»Das ist das Einzige, was mir nicht wehtut«, erwiderte der Dünne.
Er hatte niemals Kopfschmerzen, und Mario wusste das. Carlos konnte Unmengen Alkohol trinken, zu jeder Tages- und Nachtzeit, süßen Wein, Rum, Bier, alles durcheinander, er konnte sternhagelvoll sein, aber niemals tat ihm der Kopf weh.
»Also, weshalb ich anrufe … Heute Morgen hat man mich aus dem Bett geklingelt …«
»Aus der Zentrale?«
»Aus der Zentrale, ja, wegen eines dringenden Falls. Eine Vermisstenanzeige.«
»Erzähl keinen Scheiß! Ist Baby Jane etwa wieder abgehauen?«
»Red nur so weiter, mein Freund, und ich mach dich fertig. Der Vermisste ist kein anderer als ein Unternehmensleiter im Range eines Vizeministers, und außerdem ist er ein Freund von dir. Er heißt Rafael Morín Rodríguez.« Eisernes Schweigen. Ich hab ihn voll erwischt, dachte Mario. Hat nicht mal »Leck mich am Arsch, du« gesagt. »Dünner?«
»Leck mich am Arsch, du! Was ist passiert?«
»Eben das, vermisst wird er, von der Bildfläche verschwunden ist er, entschwunden wie Matías Pérez mit seinem Heißluftballon. Niemand weiß, wo er ist. Tamara hat am Abend des Ersten Anzeige erstattet, und der Kerl taucht nicht wieder auf.«
»Und man weiß nichts?« Die Ratlosigkeit des Dünnen wuchs mit jeder Frage. Mario stellte sich das Gesicht des Freundes vor. Zwischendurch gelang es ihm, ihn über die Einzelheiten des Falles Rafael Morín zu informieren, soweit sie ihm bekannt waren.
»Und was wirst du jetzt tun?«, fragte der Dünne, als er die Nachricht verdaut hatte.
»Routinearbeit. Hab noch keine Idee. Leute befragen und so, das Übliche eben, ich weiß noch nicht.«
»Sag mal, kommst du wegen Rafael nicht zum Essen?«
»Wo du gerade davon sprichst, sag Jose, sie soll mir meinen Teil aufbewahren, anstatt ihn irgendeinem hergelaufenen Blödmann in den hungrigen Rachen zu werfen. Sobald ich hier fertig bin, komm ich vorbei.«
»Und erzählst mir alles, ja?«
»Und erzähl dir alles. Wie du dir denken kannst, werd ich Tamara besuchen. Soll ich ihr Grüße von dir ausrichten?«
»Neujahrsgrüße, ja, denn heute beginnt ein neues Jahr und damit ein neues Leben. Hör mal, Kleiner, du musst mir auch erzählen, ob sie immer noch so gut aussieht. Du, ich erwarte dich heute Abend.«
»Moment, Moment«, beeilte sich Mario, »wenn du wieder nüchtern bist, denk mal ein wenig über die Sache nach. Später reden wir darüber.«
»Was meinst du, was ich tun werde? Woran werd ich wohl denken? Bis später.«
»Guten Appetit, Bruder.«
»Ich grüß Mama von dir, Bruder«, sagte der Dünne und legte auf. Mario Conde dachte: Das Leben ist beschissen.
Der dünne Carlos ist nicht mehr dünn, er wiegt mehr als zweihundert Pfund und riecht säuerlich wie alle Dicken. Das Schicksal hat seine Wut an ihm ausgelassen. Aber als ich ihn kennen lernte, war er so dünn, dass er jeden Augenblick durchzubrechen drohte. Er setzte sich an das Pult vor mir, neben den Hasenzahn, ohne zu ahnen, dass wir auf diesen Plätzen am Fenster während der gesamten Oberstufenzeit sitzen würden. Er besaß ein furchtbar scharfes Messer, ein Skalpell, mit dem er die Stifte anspitzte. Einmal sagte ich zu ihm: »He, Dünner, leih mir mal das Messer da«, und von dem Tag an nannte ich ihn »Dünner«. Ich konnte ja nicht wissen, dass er mein bester Freund werden und eines Tages nicht mehr dünn sein würde.
Tamara setzte sich zwei Reihen vor den Hasenzahn. Niemand wusste, warum man ihre Zwillingsschwester in eine andere Klasse gesteckt hatte, wo sie doch vorher in dieselbe Schule gegangen waren, denselben Familiennamen und sogar das gleiche bildhübsche Gesicht hatten, nicht wahr? Aber dann waren wir auch wieder froh, denn Aymara und Tamara sahen sich so ähnlich, dass wir vielleicht nie gewusst hätten, wer die eine und wer die andere war. Als der Dünne und ich uns gleichzeitig in Tamara verliebten, hörten wir um ein Haar für immer auf, Freunde zu sein, und es war Rafael, ausgerechnet, der das Problem löste: weder der Dünne noch ich! Er gestand Tamara seine Liebe, und zwei Monate nach Schulbeginn waren die beiden bereits ein Paar, eins von denen, die wie Kletten aneinander hängen, die in den Pausen unzertrennlich sind und die zwanzig Minuten damit zubringen, miteinander zu reden und sich in die Augen zu schauen, Hand in Hand, so weit weg von dem weltlichen Treiben, dass sie sich überall abknutschen. Ich hätte die beiden umbringen können.
Der Dünne und ich aber blieben Freunde und waren nach wie vor in Tamara verliebt. Wir konnten unseren Frust gemeinsam abreagieren, indem wir uns Katastrophen für Rafael ausdachten, ein gebrochenes Bein oder Schlimmeres. Und wenn wir besonders schlecht drauf waren, stellten wir uns vor, wie wir mit Tamara und Aymara »gehen« würden (wer mit wem, war uns damals egal, obwohl wir beide immer nur in Tamara verliebt waren, keine Ahnung, warum, wo sie doch beide gleich hübsch waren). Wir heirateten und wohnten in vollkommen identischen, direkt nebeneinander liegenden Häusern, die sich so glichen wie die Zwillinge. Zerstreut, wie wir waren, verwechselten wir manchmal die Häuser und die Schwestern, und Aymaras Mann landete bei Tamara und umgekehrt, und wir amüsierten uns prächtig, und später bekamen wir Zwillinge, die am selben Tag geboren wurden – vier Jungen auf einmal –, und die Ärzte, die ebenso zerstreut waren wie wir, verwechselten die Mütter und die Kinder und sagten: Zwei hierhin, zwei dorthin, und die Jungen wuchsen gemeinsam auf und saugten an den vier Mutterbrüsten, und später dann verwechselten auch sie ständig die Häuser, und wir verbrachten Stunden damit, dummes Zeug zu reden, bis die Jungen groß waren und Vierlinge heirateten, die sich ebenfalls aufs Haar glichen, und da wurde das Ganze unübersichtlich. Wenn Josefina von der Arbeit nach Hause kam, drehte sie das Radio leiser. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Gedudel den lieben langen Tag ertragen könnt, sagte sie kopfschüttelnd, ihr werdet noch taub davon, verdammt, sagte sie und mixte uns einen Shake – manchmal einen Mango- oder einen Mamey-Shake und sonst einen Schoko-Shake.
Als wir zum letzten Mal davon faselten, die Zwillingsschwestern zu heiraten, war der Dünne noch dünn. Wir besuchten die letzte Oberstufenklasse, er ging mit der Dulcita, und die Cuqui hatte sich bereits mit mir verkracht, als Tamara vor der ganzen Klasse verkündete, dass sie und Rafael heirateten und uns alle einluden. Das Fest sollte bei Tamara zu Hause stattfinden. Obwohl die Partys dort immer erstklassig waren, schworen wir uns, nicht hinzugehen. An jenem Abend soffen wir uns zum ersten Mal so richtig die Hucke voll. Damals war schon ein Liter Rum zu viel für uns beide, und Josefina musste uns waschen, uns einen Löffel Belladonna gegen die Kotzerei verabreichen und uns sogar einen Eisbeutel auf die Eier legen.