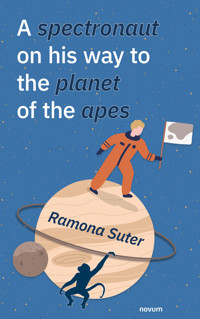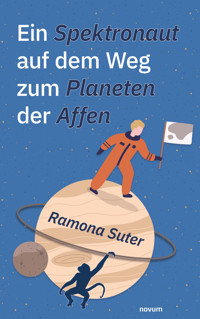
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das ist ein spezieller BH!" Diesen Satz möchte wohl keine Frau hören, wenn ihr Freund sie das erste Mal in Unterwäsche sieht. Wenn man mit jemandem liiert ist, der eine Autismus-Spektrum-Störung hat, sollte man gesellschaftliche Normen ohnehin lieber hinterfragen, als sie ernst zu nehmen. Apropos "Normen", ganz normal bin ich übrigens auch nicht, denn: Spinnen kann man auch ohne Diagnose! Wie ist es also, eine Beziehung mit einem Mann zu führen, der in vielerlei Hinsicht anders tickt? Und das, während man selbst eigentlich genug damit zu tun hat, seine eigenen Affen im Kopf zu bändigen? Ganz ehrlich: Es ist erfrischend, bereichernd und wertvoll, aber auch unglaublich herausfordernd und anstrengend. Kreativität und Geduld sind ebenso gefragt wie Humor und ein gesundes Selbstwertgefühl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-467-9
ISBN e-book: 978-3-99146-468-6
Lektorat: Maria Hentschel
Umschlagabbildungen: Ernest Akayeu, ArtistMiki | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Ich widme das Buch in erster Linie natürlich meinem Mann, der dem Wort „Liebe“ eine neue Bedeutung verliehen hat und ohne den es diese Geschichte nicht geben würde. Ich widme es meinem jüngeren Ich, dem es schon immer Freude bereitet hat, Erlebtes in Worte zu fassen. Ich widme es meinen beiden Engeln im Himmel, die meinen Texten stets mit Wertschätzung begegnet sind. Ich widme es meiner lieben Sara, ohne die mein Segelboot niemals den richtigen Tiefgang hätte erreichen können. Ich widme es Nathalie, zu deren Hobbys die Selbstoptimierung genauso zählt wie zu den meinen. Ich widme es Behare, welche meine Affen von Kindesbeinen an kennt. Ich widme das Buch auch Alessandra, die meiner Beziehung von Anfang an unvoreingenommen begegnet ist. Ich möchte es meinen beiden Schwestern widmen, weil sie meinen Mann ohne Wenn und Aber in unsere Familie aufgenommen haben. Und zu guter Letzt widme ich das Buch Helen, Pädi und meiner kleinen Nichte, weil sie unverzichtbar sind, um diesen wertvollen Kreis zu schließen.
Der Pinguin im Eisbärenkostüm
Immer wenn mich jemand fragt, ob ich zuerst die guten oder die schlechten Nachrichten hören möchte, entscheide ich mich für Zweiteres. Deshalb hatte ich ursprünglich auch vor, mein Buch zuerst mit allerlei ungekämmt haarigen Angelegenheiten zu beginnen. Ich wollte euch gleich am Anfang durch Jammertäler wandern lassen, damit ihr anschließend die Aussicht vom Jubelhorn etwas mehr genießen könnt. Allerdings habe ich meinen Mitmenschen früher freudige Nachrichten sehr lange vorenthalten um den perfekten Moment zu erwischen – oft so lange, dass einige davon noch heute nicht wissen, dass ich mittlerweile keine Windeln mehr trage. Das wollen wir nicht, denn wir wissen bekanntlich nie, wann unser allerletztes Stündchen geschlagen hat. Somit beginne ich an dieser Stelle ausnahmsweise mit einem kleinen Highlight. Etwas, das mir verdeutlicht hat, wie aus einem „Worst Case“ ein „Best Case“ wachsen kann und dass ich allein es bin, die darüber entscheidet, wie viel Wert ich meinen Stärken zuschreibe.
Am Anfang der Beziehung hätte ich mir niemals vorstellen können, gemeinsam mit meinem Mann zu verreisen, geschweige denn ins Ausland und geschweige denn noch mehr, mit dem Flugzeug. Dies hat mich allerdings nicht großartig gestört, da ich zu diesem Zeitpunkt selbst nicht sonderlich reisefreudig war. Mir langten meine täglichen Ausflüge nach Sofahausen. Es gab unterschiedliche Gründe dafür, weshalb ich gemeinsame Ferien ohnehin noch als utopisch erachtete. Zuallererst hätte dies seine labile psychische Verfassung nicht zugelassen und das Suchtmonster wäre stets im Köfferchen mitgereist. Des Weiteren stellte ich es mir äußerst schwierig vor, ein Projekt zu planen, das bei ihm Unbehagen auslöst, weil er dafür seine Komfortzone hätte verlassen müssen. Und als wäre dies nicht genug, leidet mein Mann zudem an Flugangst. Damit ist er definitiv nicht allein. Interessanterweise ängstigt sich der eine Teil der Menschheit eher vor denjenigen Dingen, die nicht oder nur bedingt kontrolliert werden können. Dazu gehören beispielsweise das erwähnte Fliegen oder das Wetter oder der Krieg oder der Tod oder die Existenz von Aliens. Warum? Womöglich aufgrund des Gefühls einer gewissen Machtlosigkeit, dem man sich ausgesetzt sieht. Den anderen Teil ängstigt hingegen eher das Kontrollierbare. Warum? Womöglich aufgrund von eigenen Versagensängsten, denen man wiederum ebenfalls ausgesetzt ist, wenn man Mist baut. Ich persönlich gehöre zum zweiten Teil. Ich schiebe lieber den Aliens die Schuld in die Schuhe oder in was auch immer sie tragen mögen. Natürlich überkommt auch mich ein mulmiges Gefühl, wenn es im Flugzeug ruckelt. Erstens ergibt es aber für mich persönlich tendenziell keinen Sinn, wenn ich mich vor Dingen ängstige, für die ich mich freiwillig entscheide, die ich jedoch nicht kontrollieren kann. Zweitens sterbe ich lieber auf einer Reise nach Florida als so, wie der chinesische Dichter und Höfling Lia Bai, der beim berauschten Versuch starb, das Spiegelbild des Mondes im Wasser zu umarmen. Ich besitze jedoch genug Empathie, damit ich die Gegenseite verstehen kann. Auch eine meiner Schwestern leidet an Flugangst, vor allem dann, wenn es sich um längere Strecken handelt. Dabei hat sie es auch einmal geschafft, eine Beruhigungstablette mit Imodium zu verwechseln. Der Placebo-Effekt trat zuverlässig ein, die Obstipation allerdings auch. Bei meinem Mann hätte seinerzeit wohl weder die eine noch die andere Tablette Wunder bewirkt.
Blöderweise begann ich kurz nach unserem Anbändeln doch noch damit, eine Vorliebe für das Entdecken der Welt außerhalb der Couchzone zu entwickeln. Bis anno dato war ich zwar noch nicht sonderlich viel herumgekommen, wenn ich mich mit Gleichaltrigen verglich, jedoch hatte ich immerhin einmal für drei Monate die Vereinigten Staaten von Amerika bereist. Diese Zeit ist für mich bis heute mit schönen Erinnerungen verknüpft, die ich nicht missen möchte und die meine Begeisterung für dieses oft etwas verpönte Land entfacht hat. Dazumal hatte ich Vorfreude und Organisation allerdings weitgehend meinem Partner überlassen. Ich konnte aus verschiedenen Gründen nur schwer mit seiner Euphorie mithalten. Nun musste ich überraschenderweise feststellen, dass ich es im Grunde liebte, zu organisieren und zu planen, nicht unbedingt die Reinigung der Kloschüssel, aber beispielsweise einen Ausflug ins Blaue. Ich merkte, dass ich ein Händchen dafür hatte, etwas unter erschwerten Bedingungen realisierbar zu machen, und diese Ressource konnte ich in unserer Beziehung gut gebrauchen.
Ich habe schon immer etwas anders getickt als meine Mitmenschen, auch wenn mein Verhalten abgesehen von ein paar Ticks nie so auffällig gewesen ist, dass ich mit dem schulpsychologischen Dienst hätte vorliebnehmen müssen. Ich denke, ich konnte meine vermeintlichen Schwächen meist relativ gut kompensieren und hatte zudem von Kindesbeinen an gelernt, mich anzupassen. Noch heute ist jedoch meine Batterie häufig etwas schneller leer als diejenige von anderen und noch heute bin ich sehr sensibel, neige zum Grübeln, benötige hie und da etwas mehr Zeit als meine Mitmenschen und habe Mühe damit, mich auf Dinge zu konzentrieren, die mich nicht interessieren. In Konfrontation mit unserer Norm-Gesellschaft erzeugte dies in mir lange Zeit den Glaubenssatz: Du bist zu faul, du bist zu dumm. Meine Stärken gingen in diesem selbstentwertenden Denken verloren. Paradoxerweise fand ich sie genau dort wieder, wo viele andere im Gegenzug untergehen würden. Es fällt nach wie vor schwer, zu verstehen, wie ich in einer Beziehung glücklich sein kann, die mit so vielen Herausforderungen gespickt ist. Manche können oder wollen sich kaum vorstellen, dass es mir auch nur ansatzweise gut darin gehen könnte. Wir sind wie das achte Weltwunder. Wenn ich mir allerdings meine Stärken vor Augen führe, fällt es mir zumindest nicht schwer, mich selbst zu verstehen: Ich bin gut darin, Selbstfürsorge walten zu lassen, klar zu kommunizieren, Begebenheiten zu reflektieren, Dinge zu analysieren und Pläne zu schmieden. Ich liebe es, mir auf kreative Art und Weise Gedanken darüber zu machen, wie auch aus etwas unmöglich Erscheinendem Mögliches gemacht werden kann. Und genau diese Stärken kann ich aktiv in die Beziehung mit meinem Mann einfließen lassen. Es ist nicht so, dass ich andauernd Brände löschen müsste, sondern dass es durch den Einsatz von seinen und meinen Stärken immer weniger Feuer werden. Meine Seelenschwester Sara hat mir vor einiger Zeit davon erzählt, wie ihr Vater einst zu ihr gesagt hat, sie erinnere ihn an einen Pinguin, der ein Eisbär sein wolle. Und tatsächlich hat Sara die nötige Selbstsicherheit entwickelt, immer wieder aufs Neue nicht nur ein Eisbär sein zu wollen, sondern auch, einer sein zu können. Ich empfinde dies als eine wirklich zauberhafte Imagination.
Da ich meiner neu entdeckten Reiselust nicht allein frönen wollte, war es taktisch tatsächlich sinnvoll, möglichst klug vorzugehen, als ich das erste Mal mit dem Wunsch um die Ecke rauschte, Urlaub auf Ibiza machen zu wollen. Wie konnte ich meinen Mann, der psychisch mittlerweile zwar gefestigter war, jedoch immer noch unter Flugangst litt und wenig Begeisterung zeigte, wenn es ums Reisen ging, davon überzeugen, mit mir abzuheben? Als Erstes setzte ich ihm den Floh ins Ohr, wie gut das Hippie-Flair der Insel doch zu uns passen würde. Ich fügte an, dass der Flug in etwa meiner Aufmerksamkeitsspanne entsprechen würde und somit eher kurz ausfalle. Anschließend zeigte ich ihm ein vielversprechendes Video, in welchem die Insel von ihrer besten Seite dargestellt wurde, und zu guter Letzt erstellte ich eine hochprofessionelle Power-Point-Präsentation, die keine Fragen mehr offenließ. Und siehe da, mein Mann ließ sich davon überzeugen, dass eine Reise nach Ibiza genau das war, was wir brauchten. Und ich? Ich hatte nicht nur mein Ziel erreicht, sondern auch einen Heidenspaß daran gehabt, die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Ich hatte darauf geachtet, alles möglichst „aspergergerecht“ zu gestalten: Das Gepäck wurde von der Bahngesellschaft abgeholt und eingecheckt, wodurch wir davor verschont blieben, am Flughafen erstmal in einer langen Schlange zu stehen. Dies hätte lediglich seine Unruhe und Nervosität verstärkt. Gebucht hatte ich in der Business Class. Das war zwar kein Schnäppchen, aber bedeutete mehr Komfort. Auch das Taxi, das uns vom Flughafen zum Hotel bringen sollte, buchte ich bereits im Vorfeld. Hätte ich gekonnt, hätte ich das passende Wetter und den Fahrer oder die Fahrerin gleich mit dazu bestellt. Interessanterweise merkte ich, dass ich das Unterfangen nicht nur möglichst „aspergerfreundlich“ gestaltet hatte, sondern auch äußerst „Ramona-freundlich“. Im Grunde war ich lediglich auf eine Art und Weise vorgegangen, die mir meine eigenen Ängste nahm. So kam es, dass wir kurz nach der Hochzeit unseren ersten gemeinsamen Urlaub auf Ibiza verbrachten. Es war großartig und erfüllte mich mit einer tiefen Dankbarkeit. Ich war dankbar dafür, dass ich mit ihm an meiner Seite Strände entlanglaufen, Hügel bezwingen, eine Altstadt entdecken und die frivolen Zimmernachbarn über uns stöhnen hören durfte. Mir wurde klar: Alles ist möglich, wenn man die Realisierung seiner Vorstellungen und Wünsche nicht mit jener abgleicht, die andere vollziehen. Wir mussten nicht so reisen, wie dies Hinz und Kunz womöglich getan hätten, weil wir uns dann noch immer in der erwähnten Couchzone befinden würden und niemals in unserem Ferienappartement mit selbst gepflücktem Rosmarin ein leckeres Abendessen zubereitet hätten. Mir war allerdings schon vorher klar, dass uns Vergleiche nicht weit bringen würden und wir stets unseren eigenen Weg finden mussten. Dennoch hätte ich mir nicht träumen lassen, einmal mit ihm über den Ozean zu fliegen. Ich war mir auch noch nicht dessen bewusst, dass in mir mehr steckte, als ich glaubte. Ich wusste noch nicht, dass meine Stärken stark genug waren, um im Leben vorwärtszukommen. Ich durfte nicht nur langsam und stetig lernen, an meine Ressourcen zu glauben, sondern fing auch allmählich damit an, diese als festen Bestandteil in mein Leben zu integrieren. Auch ich war mehr als nur ein süßer, tollpatschiger Pinguin. Ich musste lediglich Situationen kreieren, in denen ich mehr sein konnte. Meine Beziehung entspricht einer solchen Situation. Einer, die aufzeigt, dass es mir deshalb viel besser geht, als man erahnen könnte, weil darin auch ich ein Eisbär sein kann.
Die nackte Wahrheit
Was soll der schriftliche Affenzirkus eigentlich? Ursprünglich wollte ich mich in meinem Buch ausschließlich verschiedenen Themen und Situationen widmen, welche in Zusammenhang mit der Autismus-Spektrum-Störung meines Mannes stehen. Ich wollte jene Aspekte erläutern, die unseren Beziehungsalltag mal mehr, mal weniger herausfordernd gestalten. Während des Schreibens musste ich mir allerdings eingestehen, dass dies nur der halben Wahrheit entsprach und dass ich wohl auch jene Dinge zu Papier bringen sollte, die ich lieber verharmlost oder verschwiegen hätte. Letztendlich handelt es sich dabei nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit um genau das, was viele Menschen interessiert und im Gegenzug auch mich interessieren würde.
Zudem war und ist es mir wichtig, das große Ganze sichtbar zu machen. Es geht mir darum, die Komplexität unserer Beziehung aufzuzeigen, und darin ist der Autismus zwar ein relevanter, jedoch nicht der einzige Bestandteil. Somit wäre dies auch der passende Zeitpunkt, auf den Zungenbrecher „Komorbidität“ hinzuweisen. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können: Grob gesagt handelt es sich dabei um die Kombination und das Vorhandensein verschiedener Diagnosen gleichzeitig. Oftmals existiert eine Grunderkrankung mit einer oder mehreren Nebenerkrankungen. Häufig ist allerdings nicht so klar zu differenzieren, welche Diagnose als primär und welche als sekundär erachtet werden kann.
Die Diagnose „Hochfunktionaler Autismus“ hat mein Mann erst mit Ende zwanzig erhalten. Ich sage „erst“, weil er davon ausgeht, dass sein Leben einen anderen, vielleicht sogar etwas weniger belasteten Verlauf hätte nehmen können, hätte dieser Befund schon als Kind vorgelegen und hätte man entsprechend darauf reagieren können. Letzteres ist natürlich ausschlaggebender für die weitere Entwicklung eines Menschen als der Befund selbst.
Die erste Diagnose, die Applejack erhielt, war jedoch nicht Autismus, sondern die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS und früher bekannt als POS (Psychoorganisches Syndrom). Gemäß den Aussagen einer Fachperson, von der er einst betreut worden ist, ist ADHS früher automatisch ein Ausschlusskriterium für Autismus gewesen. Ob sie damit recht hatte, weiß ich nicht. Stand heutiger Dinge ist es jedenfalls so, dass beide Entwicklungsstörungen durchaus Parallelen aufweisen, sich in manchem allerdings auch deutlich voneinander unterscheiden. So, wie es im Grunde fast immer ist, wenn man etwas miteinander vergleicht.
Aus dem hyperaktiven Kind, das Mühe mit der Impulskontrolle hatte und sich nicht so gut konzentrieren konnte, wurde im Jugendalter schließlich das, was die Gesellschaft oft als Problemfall betitelt: Ein junger Mann, der eine Diagnose nach der anderen erhält (dazu mehr in einem späteren Kapitel) und dennoch durch sämtliche Raster zu fallen scheint. Ein Mann, der im Teenageralter anfängt, Verschiedenes zu konsumieren, und sich nebst Cannabis und Alkohol rund ein Jahrzehnt lang fast alles reinpfeift, was nicht niet- und nagelfest ist. Auch vor dem Missbrauch von Medikamenten machte er nicht Halt. Applejack hat in seiner Laufbahn mehr als nur eine Klinik von innen gesehen, mehr als nur eine Fachperson getäuscht und in mehr als nur einem betreuten Wohnhaus für Zähneknirschen im Team gesorgt. Erst, als er auch aus dem letzten Setting flog, in welchem wir uns – Obacht – als Bewohner (er) und Fachperson (ich) kennengelernt hatten, fing er glücklicherweise langsam, aber stetig an, aufzuwachen und sich einer Realität zu stellen, die über Jahre hinweg völlig vernebelt von Sucht, Frust und schlechten Erinnerungen gewesen ist.
Im erwähnten Wohnhaus, in welchem sowohl er als auch ich uns aufhielten, waren vor allem seine Sucht und eine Borderline-Störung Bestandteil von Diskussionen in Teamsitzungen. Es schien fast so, als würden diese beiden Diagnosen – obwohl die Sucht dazumal noch nicht offiziell als solche diagnostiziert worden war – eine Art Konkurrenzkampf anzetteln. Die einen im Team ordneten seine Probleme und sein Verhalten mehr in der Rubrik „Sucht“ ein, die anderen in der Rubrik „Borderline“. Manche waren der Ansicht, dass seine starken Stimmungsschwankungen auf sein Konsumverhalten zurückzuführen sind, andere wiederum machten dafür psychische Probleme wie erlebte Traumata verantwortlich. Irgendwie hatten wohl alle recht, aber die einen zu jenem Zeitpunkt etwas mehr als die anderen. Auch dazu werde ich mich in einem Folgekapitel noch etwas differenzierter äußern.
Was während seiner Aufenthaltszeit allerdings noch kein Thema gewesen ist, war der Autismus. Meiner Meinung nach fristete er dazumal sein Dasein im Schatten der Sucht, denn diese war dermaßen alltagsbestimmend, dass alles andere in den Hintergrund rückte. Weder hätte der Autismus also entdeckt noch sinnvoll in die Betreuung miteinbezogen werden können. Es ist rückblickend schwierig, zu beurteilen, wann sich der Autismus zeitweise vielleicht doch gezeigt hat und wann man hätte merken können, dass da etwas grundsätzlich anders ablief in seinem Oberstübchen. Jede Form von Andersartigkeit und Auffälligkeit wurde automatisch der Sucht und seiner emotionalen Instabilität zugeordnet. Erst jetzt, wo Applejack zumindest in Bezug auf sein dazumal prägnantestes Suchtproblem – nämlich den Missbrauch von Medikamenten – clean ist, wird sichtbar, was übrigbleibt. Je stabiler er in seiner psychischen Verfassung wird, desto besser lässt sich differenzieren, was welcher Diagnose zugeordnet werden könnte und welche Diagnosen einst möglicherweise sogar falsch gestellt worden sind. Es ist wie das Schälen einer Zwiebel. Mit jeder losgelösten Schicht nähert man sich der Knospe im Inneren, während man die eine oder andere Träne dabei vergießt.
Gerade zu Beginn unserer Liebesbeziehung traten bei ihm immer wieder komatöse, psychotische Zustände und starke Stimmungsschwankungen auf. Ich konnte ihn oft nicht richtig spüren und erfassen, weil er dazu selbst nicht in der Lage war. Ich wusste, worauf ich mich einließ, zumal ich es im Wohnhaus ja hautnah miterlebt hatte, und doch konnte ich nicht erahnen, in welchen Gefühlslagen ich mich wiederfinden würde. Ich wusste es und wusste es gleichzeitig nicht.
Die ganze Wahrheit wäre demnach die folgende: Die Diagnose ADHS hat vor allem seine Kindheit geprägt, da sie dazumal Thema unzähliger Therapien gewesen ist. Wirklich davon profitieren konnte er allerdings nie, weil auch diese Diagnose – wie wir heute wissen – nur einer Teilwahrheit entsprochen hat. So schreibt beispielsweise das Hamburger Autismus Institut, dass rund die Hälfte aller Kinder, bei denen Hochfunktionaler Autismus diagnostiziert wird, zusätzlich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, häufig mit Hyperaktivität (ADHS) aufweisen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre dies bei ihm nicht anders gewesen und das eine hätte entsprechend das andere nicht ausgeschlossen.
So präsent seine erste Diagnose in seiner Kindheit gewesen ist, so einnehmend war die Sucht im jungen Erwachsenenalter. Es ist bekannt, dass Menschen mit ADHS tendenziell suchtgefährdeter sind. Ich würde es allerdings nicht als richtig erachten, im Sinne der Komorbidität an dieser Stelle zu behaupten, dass es sich beim ADHS um die Grunderkrankung (da zuerst gestellt) und bei der Sucht – salopp gesagt – um deren Ausgeburt handelt. Wenn überhaupt, dann müsste man korrekterweise sagen, dass Halbwahrheiten möglicherweise wichtige und auf ihn angepasste Lernschritte verhindert haben und eine gesunde Resilienz somit nicht erreicht werden konnte. Dies wiederum hat eventuell ein Abrutschen in die Sucht begünstigt.
Erst in seiner jüngsten Diagnose „Hochfunktionaler Autismus“ hat mein Mann nun so etwas wie ein Zuhause gefunden. Keinesfalls eines, in dem er sich ausruht und sich die Erlaubnis erteilt, tun und lassen zu können, was er will, da nun ja vermeintlich bewiesen ist, dass er es nicht anders kann. Es ist als ein Zuhause in dem Sinne zu verstehen, dass er nach langer Suche einen Ort entdeckt hat, der ein wesentliches Stück zu seiner Identifikation beigetragen hat. Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn man nach langer Zeit an seinen Heimatort zurückkehrt und einem dieser gleichermaßen fremd und vertraut vorkommt. Wenn ich heute Situationen mit ihm erlebe, die mir etwas spanisch vorkommen, und dabei merke, dass sich im betreuten Wohnhaus früher Vergleichbares ereignet hat, so weiß ich nun, dass es durchaus Verhaltensweisen gibt, die schon dazumal in keinem direkten Zusammenhang mit seiner Sucht gestanden haben. War er beispielsweise der festen Überzeugung, in sein Zimmer sei eingebrochen worden, weil sich Utensilien, die er sehr wahrscheinlich selbst verlegt hatte, nicht mehr am selben Platz befanden, so hatte dies mit psychotischen Zuständen als Folge seines Konsumverhaltens zu tun. Ein Zustand, in dem man unter anderem an einer starken Wahrnehmungsverzerrung und mitunter auch an Verfolgungswahn leiden kann. Konnte er hingegen gewisse Aussagen, die von uns beispielsweise als unangebracht erachtet wurden, nicht begründen oder unser Missfallen darüber nicht verstehen, so lässt sich dies im Nachhinein eher auf den Autismus zurückführen. Der Konsum kann die Wahrnehmung verändern. Der große Unterschied zum Autismus besteht darin, dass die andersartige Wahrnehmung in mancherlei Hinsicht schon von Beginn an besteht. Neurotypische Menschen hingegen, sehen die Welt erst durch den Konsum mit anderen Augen.
Unzählige der schwierigen Situationen, die im Verlaufe unserer Beziehung entstanden sind, zeigten sich als unschönes Produkt von Sucht und Konsum. Die Herausforderungen, mit welchen die anschließende Bearbeitung solcher Ereignisse gespickt war, ließen sich wiederum meist auf den Autismus zurückführen. Beispielsweise musste ich meine Art und Weise, mit ihm zu kommunizieren, anpassen, da vieles von dem, was ich für selbstverständlich hielt, es für ihn nicht war und noch heute nicht ist. So konnte er anfangs beispielsweise nicht verstehen, dass wenn es ihm schlecht ging, dies auch Einfluss auf meine eigene Befindlichkeit hatte. „Es ist doch mein und nicht dein Problem!“, pflegte er manchmal zu sagen. Ebenso wenig konnte er begreifen, dass man wütend aufgrund einer Aneinanderreihung von nervenaufreibenden Ereignissen sein konnte und nicht ausschließlich wegen einer gegenwärtig auftretenden Einzelsituation. Das sogenannte Fass, das überlaufen kann, war ihm nicht bekannt. Ebenso fremd war es für ihn auch, dass jemand Zeit braucht, nachdem ihn etwas emotional erschüttert hat, und dass sich diese Zeit oftmals nicht nur auf den Tag des Ereignisses beschränkt. Ein etwas begrenztes Empathievermögen kann durchaus ein Merkmal von Autismus sein, wohingegen die Annahme, autistische Menschen hätten keine Gefühle, völliger Blödsinn ist.
Was ist denn nun aber von seiner als Kind erhaltenen ADHS-Diagnose übriggeblieben? Von außen betrachtet würden wohl viele vermuten, es sei seine körperliche Unruhe, welche sich dahingehend zeigt, dass er ständig von einem Fuß auf den anderen tritt oder wippende Bewegungen macht, wenn er am Tisch sitzt. Dieses Verhalten könnte jedoch ebenso gut unter die Sparte „Autismus“ fallen, in der bei betroffenen Menschen nicht selten stereotypische Bewegungen zu Tage treten. Mein Mann und ich vermuten sogar, dass es keines von beidem ist, sondern eher einer Tic-Störung (noch) unbekannten Ursprunges gleicht. Schließlich wäre da auch noch die Sache mit dem Konzentrationsproblem und seiner etwas kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Es kommt nicht selten vor, dass er sich nicht an Inhalte von unseren Gesprächen erinnern kann. Je nach Situation kann dies sowohl dem ADHS als auch dem Autismus zugeordnet werden. Menschen mit ADHS fällt es beispielsweise tendenziell schwer, sich auf Dinge zu konzentrieren, die sie nicht sonderlich interessieren oder sie gegebenenfalls thematisch überfordern. Da es sich bei unseren Gesprächen meist um emotionale Inhalte handelt und Applejack es nicht so mit Emotionen hat, kann es natürlich gut sein, dass seine Merkfähigkeit diesbezüglich tatsächlich etwas geringer ist, als wenn ich ihm beispielsweise Fakten zum Thema „Weltall“ erläutern würde. Sich mit dem Verstehen und Einordnen von Emotionen etwas schwer zu tun, ist allerdings auch ein für Autismus typisches Merkmal. Wir wären somit bei der Frage angelangt, was zuerst existiert hat, das Huhn oder das Ei, beziehungsweise, zu welchem Huhn wohl welches Ei gehört. Und wenn er im Übrigen zeitweise auch depressiv ist, liegt dies dann daran, dass der Substanzmissbrauch sein Gehirn an jener Stelle vergiftet hat, die für die Ausschüttung von Glückshormonen zuständig ist – oder ist vielleicht doch eher die Borderline-Störung dafür verantwortlich? Wenn er nicht von seiner Meinung abweichen kann oder möchte, ist es dann Narzissmus oder Autismus und wo zeigen sich möglicherweise noch Manie, Hysterie und Schizophrenie?
Häufig hat man bestimmte Bilder und Vorstellungen im Kopf, wenn man von Diagnosen hört, und oft entsprechen diese nicht der (ganzen) Wahrheit. Dies liegt daran, dass fast jede Diagnose ein riesiges Spektrum umgibt. Auch ich befinde mich irgendwo zwischen zoologischem Garten und normalem Wahnsinn.
Es liegt letztendlich an einem selbst und den zuständigen Fachpersonen, Diagnosen zu stellen, die passend sind. Mit passend meine ich Befunde, mit denen man sich identifiziert, ohne sich gleichzeitig nur noch darüber zu identifizieren. Befunde, die Orientierung und Worte in und für etwas kreieren, das zuvor chaotisch und namenlos oder sogar falsch beschildert worden ist. Es kann wichtig sein, ein „Ich bin zu dumm“ in ein „Mein Gehirn funktioniert anders“ zu transformieren. Dies kann unglaublich entlastend für die Betroffenen sein und einen Grundstein legen, auf dem künftig aufgebaut werden kann.
Die ganze Wahrheit ist jedoch auch, dass nicht immer alles so einfach und eindeutig zuordenbar ist, wie wir es alle manchmal gerne hätten, und diese Tatsache gilt es auszuhalten. Wo die einen als Ursache eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, befinden andere einen Pickel am Rücken für schuldig. Menschen mit einer psychischen Erkrankung können täuschen (wie solche ohne im Übrigen auch), indem sie beispielsweise nicht die ganze Wahrheit erzählen oder nur das, wovon sie denken, dass es das Gegenüber gerne hören möchte. Fachpersonal kann auf der Gegenseite ebenfalls Fehler machen, indem es Verhaltensweisen beispielsweise nicht korrekt einschätzt. Manchmal existiert tatsächlich keine Regel ohne Ausnahme. Es ist mir jedoch wichtig, aufzuzeigen, dass man trotzdem keine Angst zu haben braucht. Abweichungen und Unklarheiten bedeuten nicht nur Orientierungslosigkeit, sondern bieten einem auch die Chance, neue Wege einzuschlagen, seinen ganz eigenen nämlich.
Ich maße es mir nicht an, stets richtig einschätzen zu können, von welchem Huhn das gelegte Ei stammt. Was ich mir allerdings anmaße, ist, Thesen aufzustellen, und die sind ja bekanntlich nicht in Stein gemeißelt. Der Autismus mag – genauso wie es andere Diagnosen auch tun – schlussendlich wertvolle Erklärungen für bestimmte Verhaltensweisen liefern, erklärt jedoch nicht den Menschen als Ganzen. Man kann einem passend erscheinende Schubladen öffnen, diese sollten jedoch erst dann wieder verschlossen werden, wenn die ganze Wahrheit herausgefunden wurde, und dieser Prozess dauert meist ein Leben lang.