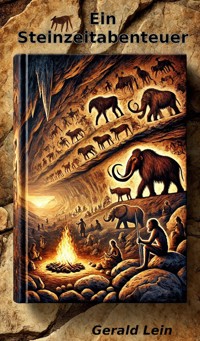
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Svante Pääbo und sein Team 2010 ihre bahnbrechende Studie veröffentlichten, enthüllten sie ein Geheimnis. Das Genom der Neandertaler zeigt eine signifikant größere Ähnlichkeit mit dem Erbgut der Europäer und Asiaten als mit dem der Afrikaner. Diese wissenschaftliche Erkenntnis war mehr als nur eine Fußnote in der Evolutionsgeschichte – sie war der Schlüssel zu einem längst vergessenen Kapitel unserer Vergangenheit. Sie erzählte von Begegnungen in den nebligen Tälern Europas, die unsere Spezies für immer prägen sollten. Inspiriert von dieser außergewöhnlichen Entdeckung begann ich mir vorzustellen, wie diese ersten Kontakte zwischen den modernen Menschen und den Neandertalern, ausgesehen haben könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum/Copyright
Autor: Gerald Lein
Erscheinungsjahr: 2025
Copyright: © 2025 Gerald Lein.
Alle Rechte vorbehalten.
-
Die Inhalte dieses E-Books wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Der Autor übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Dieses Buch stellt keine [rechtliche/medizinische/finanzielle] Beratung dar und ersetzt nicht die Konsultation eines qualifizierten [Anwalts/Arztes/Finanzberaters]. Der Autor haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der in diesem Buch enthaltenen Informationen entstehen könnten.
-
Urheberrecht und Nutzungsrechte
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar.
Erlaubt ist:
Das Lesen des E-Books auf persönlichen Geräten
Das Erstellen einer Sicherungskopie für den eigenen Gebrauch
Nicht Erlaubt ist:
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung
Die Weitergabe oder der Verkauf an Dritte
Die öffentliche Zugänglichmachung
Die Verwendung für gewerbliche Zwecke ohne Genehmigung
Das Erstellen von Bearbeitungen oder Übersetzungen
Kontakt
Bei Fragen zu diesem E-Book können Sie den Autor unter folgender Adresse erreichen:
[email protected]
Vorwort
Als Svante Pääbo und sein Team 2010 ihre bahnbrechende Studie veröffentlichten, enthüllten sie ein Geheimnis. Das Genom der Neandertaler zeigt eine signifikant größere Ähnlichkeit mit dem Erbgut der Europäer und Asiaten als mit dem der Afrikaner. Diese wissenschaftliche Erkenntnis war mehr als nur eine Fußnote in der Evolutionsgeschichte – sie war der Schlüssel zu einem längst vergessenen Kapitel unserer Vergangenheit. Sie erzählte von Begegnungen in den nebligen Tälern Europas, die unsere Spezies für immer prägen sollten.
Inspiriert von dieser außergewöhnlichen Entdeckung begann ich mir vorzustellen, wie diese ersten Kontakte zwischen den modernen Menschen und den Neandertalern, ausgesehen haben könnten. Was geschah als sie sich auf den Weg nach Europa machten und dort auf eine andere Menschenart trafen? Welche Geschichten verbergen sich hinter den genetischen Spuren, die wir heute noch in uns tragen? Die Antworten führten mich in die Steinzeit – in eine Welt voller Gefahren und Wunder. Eine Welt in der Menschenarten verschwanden und die Grundlagen für unsere heutige genetische Vielfalt gelegt wurde. Dieses Buch ist eine Reise zurück in diese faszinierende Epoche. Eine Expedition zu den Wurzeln. Es ist die Geschichte von Begegnungen und damit auch ein Weg zu uns selbst.
Begeben Sie sich mit mir auf dieses Steinzeit-Abenteuer und entdecken Sie die verborgenen Geschichten.
Ein Neanderthalerclan
Naias Verlust
Der Rauch stieg langsam aus der Höhle. Grau gegen das blasse Morgenlicht.
Naia saß am Rand des Felsvorsprungs und beobachtete die Sonne, wie sie sich mühsam über die Berge schob. In der Ferne glitzerte das Meer. Wind brachte den salzigen Geruch von Algen, trockenem Gras – und etwas, das sie nicht benennen konnte.
„Naia“, rief eine Stimme. Alt. Rau. „Zurück ans Feuer, Kind. Die Luft beißt noch.“
Sie drehte sich nicht um. „Ich friere nicht, Großmutter.“
Ein paar Schritte. Dann die Hände der Alten auf ihren Schultern – knochig, warm, vertraut.
„Du beobachtest. Das ist gut“, sagte sie. „Aber der Tag hat begonnen.“
Naia stand auf. Sechzehn Winter zählte sie, aber in ihren Bewegungen lag noch die Unsicherheit eines Kindes. Ihr Gewand aus Hirschleder war verschlissen an den Knien. Die Muscheln, die ihre Mutter aufgenäht hatte, klirrten leise.
Sie zeigte auf eine Pflanze in der Felsspalte. „Die Blüten sind neu.“
Die Großmutter beugte sich, nickte. „Bergweidenröschen. Fieber. Bauchschmerz. Merken.“
Naia nickte. Ihre Finger glitten über die Blätter. Flaumig, weich. Erinnerung speichern. Mit Händen, nicht mit Worten.
Sie stiegen später ins Tal. Ihr Bruder hatte sie zum Beerensammeln geschickt. Die Großmutter bestand darauf, sie zu begleiten. „Ein letzter Gang“, hatte sie gesagt. Und dann geschwiegen.
Der Weg war vertraut. Bäume, Steine, Duft nach Harz. Vögel riefen. Naias Blick wanderte zu jedem Blatt, jedem Busch. Ihre Welt bestand aus Formen, Farben, Gerüchen.
Ein fremder Strauch. Dunkelblaue Beeren. Rund, glänzend, wie jene, die ihnen letzten Winter geholfen hatten. Süß.
„Nicht dieselben“, sagte die Großmutter. „Blätter anders. Glanz zu stark.“
Naia roch. Sie roch nichts Giftiges. Sie roch nur... Leben. Ich erkenne das. Ich weiß es.
Sie probierte.
Der Geschmack war süß.
Dann kam der Schmerz.
Das Erwachen war wie aus Wasser steigen. Schwer, schleppend.
Feuer. Felle. Höhlendecke.
„Großmutter?“ Stille.
Nur die Mutter, die ihre Hand hielt.
„Du warst zwei Tage fort, Naia. Wir haben dich fast verloren.“
Naia sah ihre Augen. Und wusste.
„Wie?“, flüsterte sie.
Die Stimme der Mutter brach. „Sie trug dich. Der Hang... Sie stürzte. Der Knochen... das Fieber...“ Ein Schluchzen. „Sie wollte dich retten.“
Naia schloss die Augen. Ihre Brust zog sich zusammen, wie von innen eingeklemmt.
„Ich war schuld“, sagte sie.
„Sie hat dir vergeben, bevor du dich selbst verurteilen konntest“, antwortete die Mutter. „Sie hat gesprochen. Klar.“
Naia drehte den Kopf.
„Sie sagte, du sollst gehen. Nicht fliehen. Finden. Lernen. Für andere.“
Ein Beutel wurde ihr gereicht. Leder. Dünn. Leicht. Der Geruch von Kräutern, Rauch, Berührung.
„Ihre besten Samen“, sagte die Mutter. „Sie vertraute dir.“
Naia nahm ihn.
Sie sprach in den nächsten Tagen kaum noch. Aß wenig. Hörte, wie die Sippe flüsterte. Kael sagte: „Sie kennt nicht einmal die Gifte. Wie soll sie uns führen?“
Die Worte trafen sie. Aber sie fühlte keinen Zorn. Nur Leere. Und einen schmalen, dünnen Faden – etwas, das sich fast wie Richtung anfühlte.
In der Morgendämmerung ging sie. Leise. Ohne Abschied.
Sie nahm nur das Nötigste. Feuerstein. Messer. Umhang. Den Beutel.
Am Höhleneingang blieb sie kurz stehen.
„Ich werde lernen“, flüsterte sie. „Nicht, weil ich stark bin. Weil ich es muss.“
Dann trat sie in den Wind.
Ein Menschenclan
Rans Kampf
Der Ruf kam mit dem ersten Licht. Kurz, tief, wie aus der Erde geholt.
Ran fuhr hoch, der Speer schon in der Hand. Um ihn herum bewegten sich die anderen Jäger – lautlos, wach, bereit.
Theron trat an ihn heran, legte ihm die Hand auf die Schulter. „Nordtal. Eine kleine Herde. Du führst.“
Ran blinzelte, nickte. „Ich bin bereit.“
Baraks Blick bohrte sich in seinen Rücken. Ran spürte ihn wie Kälte. Therons Neffe, älter, schwerer – voller Groll. Immer schon.
„Bist du das wirklich?“, murmelte Barak. Doch Theron hörte nicht zu. Oder wollte nicht.
Sie bewegten sich schnell. Zwölf Männer. Lautlos wie Schatten. Der Wind war ihnen günstig, der Himmel wolkenverhangen. Der Winter schlich bereits durch die Bäume.
Ran kannte den Plan. Trennung, Einkesselung, Lärm. Druck. Dann der Stoß.
Er wählte das kleinste Weibchen. Stark genug für Vorräte, aber leichter zu isolieren. Jorik links. Theron rechts. Er in der Mitte.
Ran ging voran.
Er zählte seine Schritte. Zwanzig. Zehn. Der Boden vibrierte. Die Tiere rochen sie.
Zu spät.
„Jetzt!“, rief Ran.
Die Herde tobte. Erde, Dampf, Schreie. Ran lief, sprang, stieß zu. Der Speer drang tief.
Das Mammut brüllte, schlug nach ihm.
Er wich aus – fast.
Der Rüssel traf ihn seitlich. Schmerz. Luft weg. Boden hart.
Er lag. Bewegte den linken Arm – nichts.
Das Mammut kam zurück. Auf ihn zu. Die Stoßzähne wie Speere. Zu nah.
Ein zweiter Speer durchbrach die Luft. Traf das Tier am Hals.
Theron.
„Ran! Aufstehen!“
Er gehorchte. Keuchend. Der Arm taub. Blut an der Stirn. Sein zweiter Speer. Noch da. Er warf. Traf. Aber das Tier blieb.
Theron war zu nah.
Ran sah es. Sah, wie sein Vater zögerte – zu spät.
Ein Stoßzahn durchbrach Fleisch.
Theron fiel.
Das Mammut wankte, stürzte. Tot. Aber zu spät.
Ran kroch zu ihm. Blut. Augen halb offen. Worte kaum mehr als Atem.
„Du bist stark“, sagte Theron. „Aber… zu schnell.“
Dann: Stille.
Die Rückkehr war leise. Die Männer trugen Fleisch. Und einen Toten.
Rans Mutter schrie nicht. Sie fiel nur auf die Knie. Sein Bruder starrte ihn an, wortlos. Barak trat vor.
„Erzähl.“
Ran sprach wenig. Nur das Nötigste. Barak nickte. „Du hast geführt. Dein Vater ist gefallen.“
Ein Murmeln ging durch die Sippe.
„Es braucht einen Anführer, der weiß, wann man steht“, sagte Barak. „Und wann man wartet.“
Die Ältesten hörten. Und stimmten zu.
Ran schwieg. Was hätte er sagen sollen?
Die nächsten Tage waren kalt.
Barak führte. Ran gehorchte. Er bekam die schwersten Aufgaben. Die stumpfeste Klinge. Lob gab es nicht. Fehler schon.
„Dein Vater hätte das Tier erlegt“, sagte Barak. Oder: „Du bist kein Schüler. Du bist eine Warnung.“
Andere sahen weg. Aus Furcht. Aus Unsicherheit. Nur Jorik sagte eines Nachts: „Wehr dich. Oder du gehst daran zugrunde.“
Ran fragte: „Wie?“
„Beweise es. Jage allein.“
Barak hörte es. Und machte ein Spiel daraus.
„Drei Tage“, sagte er. „Allein. Wenn du genug bringst – Respekt. Wenn nicht – suche dir einen anderen Platz.“
Es war keine Wahl.
Ran sagte: „Ich gehe.“
Er ging.
Mit Speer, Messer, Wasser. Nichts weiter.
Die Kälte war scharf. Der Himmel leer. Der Wald fremd.
Aber schlimmer als die Wildnis war der Gedanke: Vielleicht hatte Barak recht.
Die Geschichte beginnt
Kapitel 1 - Der Weg der Schatten
Der Wind strich über das Hochplateau und fuhr Naia wie ein kalter Atem durch das Haar. Die Sonne stand tief, ihr Licht brach sich an den Schneeresten zwischen den Steinen. Unten glitzerte das Meer wie ein ferner Traum, aber hier oben war nichts als Fels, Kälte – und Einsamkeit.
Naia ging langsam, vorsichtig, tastete sich Schritt für Schritt über den schmalen Grat. Die Rinde ihrer Stiefel war vom langen Marsch aufgerissen, ihre Finger taub vor Kälte. Seit Tagen hatte sie keine Feuerstelle mehr, keinen wärmenden Blick, keine Stimme außer ihrer eigenen.
Drei Sonnenaufgänge war sie nun fort von ihrer Sippe. Keine Spur hatte sie zurückgelassen, keine Worte, nur einen leeren Schlafplatz und den Beutel ihrer Großmutter. In ihm: getrocknete Wurzeln, Samen, zwei kleine Lederbeutel mit bitterem Pulver. Wissen, weitergegeben in einer Welt, die sie verstoßen hatte – oder die sie selbst verlassen hatte. Vielleicht beides.
Der Schmerz in ihrer Brust war still geworden. Kein Weinen mehr. Nur noch das schwere, leere Ziehen, das bei jedem Schritt mitging wie ein Schatten.
Sie hatte geglaubt, sich vorbereitet zu haben. Ihre Füße kannten die Pfade, ihr Blick kannte die Kräuter, ihre Hände wussten, wie man Feuer machte. Aber sie hatte nicht gewusst, wie sehr der Wald schweigen konnte. Wie bedrohlich die Dunkelheit war, wenn keine vertraute Stimme darin klang. Und wie scharf Hunger sich anfühlen konnte.
Der erste Tag war einfach gewesen. Sie hatte Beeren gefunden, das trockene Fleisch aus ihrer Tasche gegessen, am Rand eines Bachlaufs geschlafen, eingerollt wie ein Tier. Am zweiten Tag war der Regen gekommen. Kalt, unbarmherzig. Ihr Umhang hatte durchnässt auf der Haut geklebt, das Feuer war nicht angesprungen, die Nacht endlos. Sie war weitergelaufen, nicht aus Ziel, sondern aus Angst.
Jetzt war sie hier. Und hier war nichts.
Ein Rascheln.
Naia erstarrte. Ihre Finger tasteten nach dem Feuersteinmesser an ihrem Gürtel. Die Geräusche kamen aus dem Unterholz. Vorsichtig ging sie in die Hocke, versuchte, ihren Atem zu beruhigen.
Dann sah sie sie – Schatten, lautlose Bewegung zwischen den Bäumen. Große Gestalten mit tiefhängenden Köpfen und leuchtenden Augen. Wölfe.
Mindestens drei.
Ihr Herz begann zu hämmern. Sie erinnerte sich an das, was ihr Vater gesagt hatte: "Wenn du einem Wolf begegnest, geh nicht weg. Schau ihn an. Zeig keine Angst." Aber ihr Vater war nicht hier, und sie war nicht mutig.
Sie griff nach einem Stein, hielt ihn fest. Die Wölfe beobachteten sie. Einer trat näher – schlank, grau, mit Narben an der Flanke. Ihre Blicke trafen sich.
"Ich bin kein Reh", flüsterte sie. "Ich bin kein Reh."
Ein Knurren. Dann drehte sich der Leitwolf ab. Die anderen folgten. Nur einer blieb zurück – kleiner, hinkend, mit gesträubtem Fell. Er sah Naia an, und in seinen Augen lag kein Hunger, sondern etwas anderes. Schmerz?
Ein weiteres Knacken. Der Welpe zuckte zusammen, keuchte, wollte aufspringen – und fiel. Er schleppte sich unter einen Strauch, zitternd.
Naia blieb noch lange reglos. Dann, vorsichtig, trat sie näher. Der kleine Wolf bleckte die Zähne, zuckte zurück, aber er hatte keine Kraft mehr. Seine Flanke blutete – eine frische Wunde, tief, vielleicht von einem Ast oder einem Biss. Vielleicht war er verstoßen worden. Oder gestürzt.
Sie kniete sich hin, legte langsam den Beutel ihrer Großmutter neben sich. Riss ein Stück ihres Umhangs ab. Rührte mit zitternden Fingern eine Paste aus zerdrückter Weidenrinde und einem Tropfen Wasser an. Instinkt. Erinnerung. Wissen, das in ihr lebte.
"Ich weiß nicht, ob du mich beißen wirst", murmelte sie. "Aber ich glaube, du willst leben."
Sie schob das Tuch vor, langsam. Der Welpe zitterte. Dann ließ er es geschehen.
Naia verband die Wunde so gut sie konnte. Dann setzte sie sich daneben, lehnte sich gegen einen Baum, zog den Beutel an ihre Brust. Ihr Herz schlug wild, aber nicht mehr vor Angst.
Sie war nicht mehr allein.
Kapitel 2 - Der zitternde Schatten
Der Wind hatte gedreht.
Naia spürte es an der feinen Bewegung der Gräser, am anderen Geruch, den er trug – nasser Stein, modriges Laub, vielleicht sogar Schnee. Der Herbst war alt geworden, und die Tage wurden kürzer, kälter, leiser.
Der Welpe schlief. Oder ruhte. Sein Atem ging flach, das zottige Fell hob und senkte sich kaum sichtbar. Sie hatte ihn nicht angerührt, seit sie die Wunde versorgt hatte – nur beobachtet, wie sich die blutige Paste langsam in seinem Pelz verlor. Er hatte ihr keine Zähne gezeigt seitdem, aber auch keinen Laut von sich gegeben.
Naia saß da, den Rücken an einen Baum gelehnt, und kaute auf einem trockenen Wurzelstück. Ihr Magen knurrte, doch das hier war kein Ort, um Beeren zu suchen oder zu jagen. Nicht mit einem kranken Tier, das sie nicht allein lassen konnte – und nicht mit diesem Körper, der von Schlafmangel und Kälte zitterte.
Sie hatte einen flachen Unterschlupf aus Ästen gebaut, nahe bei einem moosigen Felsen. Kaum Schutz gegen den Regen, aber besser als nichts. Dort lag auch ihr kleiner Beutel mit Kräutern – getrocknete Blätter, ein Rest Harz, ein halbes Stück Wurzelrinde gegen Fieber. Nichts davon würde ewig reichen.
Der Wolf hob den Kopf.
Nur ein wenig, nur ein Zittern im Nacken. Dann öffnete er die Augen – gelblich, trüb, aber wach. Seine Lefzen zuckten leicht. Naia hielt den Atem an.
"Du bist noch da", flüsterte sie. "Ich auch."
Sie griff nach einem flachen Holzstück, auf dem sie am Abend zuvor ein paar Insekten und Pilze gesammelt hatte – mageres Mahl, aber nahrhaft. Einen kleinen Happen legte sie in den Staub vor sich. Dann schob sie ihn mit einem Zweig näher zum Welpen.
Er roch daran. Langsam. Zögerlich. Dann schnappte er es sich und fraß, als hätte er seit Tagen nichts gehabt.
"Du wirst mir nicht danken", sagte sie. "Aber das ist auch nicht nötig."
Sie nannte ihn zunächst nichts. Kein Name, kein Wort, kein Befehl. Er war nur "er". Ein Schatten, ein verletzter Begleiter, vielleicht ein Zeichen. In den Geschichten ihrer Großmutter waren Tiere oft Boten gewesen. Zeichen des Schicksals, Prüfungen der Ahnen. Vielleicht war dieser Wolf beides.
Am dritten Tag konnte er stehen. Wacklig, mit schiefem Bein und aufgestelltem Nackenfell – aber er stand. Naia beobachtete, wie er vorsichtig einen Kreis um sie zog, immer auf Abstand, immer auf Flucht bereit. Doch er kehrte zurück. Das war alles, was zählte.
Sie fand ein paar Beeren, bitter, aber essbar. Konnte Feuer machen mit Harz und trockener Rinde. Sie sang leise beim Reiben des Feuersteins – alte Melodien, die sie von ihrer Großmutter gelernt hatte. Der Wolf legte sich in den Rauch, nicht nahe, aber in Hörweite.
Sie sprach nicht viel. Doch manchmal sagte sie ihm etwas.
"Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Vielleicht du auch nicht."
Oder: "Meine Sippe denkt, ich hätte meine Großmutter getötet. Aber sie haben nicht gehört, was sie mir sagte."
Oder: "Ich glaube, du warst der Kleinste deines Rudels. So wie ich in meiner Sippe."
Am vierten Tag jagte er selbst. Nur eine Eidechse, aber es war ein Anfang. Er fraß sie in drei Bissen, dann blickte er zu ihr, als wolle er wissen, ob sie das auch könne.
"Nein", sagte Naia. "Ich bevorzuge Pilze."
Er neigte den Kopf. Vielleicht hatte er den Tonfall erkannt. Vielleicht auch nicht.
Am Abend, als der Himmel in kaltem Rot brannte, schlief er nahe bei ihr. Nicht an ihrer Seite, aber nah genug, dass sie seinen Atem hören konnte. Sie fragte sich, wie es weitergehen sollte. Wie lange sie durchhalten würde. Und ob sie ihn mitnehmen durfte, wenn sie weiterzog.
"Ich werde dich nicht zähmen", sagte sie leise in die Nacht. "Aber vielleicht... werden wir einander folgen."
Er hob kurz den Kopf. Dann legte er ihn wieder ab.
In ihren Träumen lief sie nicht mehr allein durch den Wald. Ein Schatten neben ihr atmete im selben Takt. Und es war nicht mehr so kalt.
Kapitel 3 - Blut auf Schnee
Der Morgen war still. Kein Vogelruf, kein Rascheln. Nur der Wind, der durch das dürre Laub strich wie ein müder Atem.
Naia kniete am Bachlauf, ihre Hände im eiskalten Wasser. Sie wusch das grobe Tuch aus, das sie als Verband genutzt hatte – das Blut war längst eingetrocknet, aber sie schrubbte weiter, als könnte sie damit die Angst aus ihrem Herzen reiben.
Der Welpe lag unter einem Haselstrauch, das verletzte Bein ausgestreckt, die Augen halb geschlossen. Sein Fell war verklebt, der Blick matt, aber er atmete ruhig. Seit drei Tagen war er an ihrer Seite – drei Nächte voller Kälte, Hunger, Dunkelheit. Aber sie waren beide noch da.
Sie teilte jeden Bissen mit ihm. Manchmal mehr, als sie sich leisten konnte. Er fraß zögerlich, aber nicht mehr scheu. Und er folgte ihr. Nicht nah, nicht wie ein Hund – eher wie ein Schatten. Doch er wich ihr nicht mehr aus.
Sie sprach kaum noch. Die Welt war still, und sie wurde es auch. Nur ihre Gedanken waren laut. Erinnerungen, Zweifel, die Stimme ihrer Großmutter: „Geduld, Naia. Und Zuhören.“
Heute war sie tiefer in das Tal vorgedrungen. Die Bäume wichen offenerem Gelände, der Boden war feucht vom letzten Regen. Ein alter Wildwechsel führte durch niedrige Büsche – vielleicht würden hier Tiere kommen. Vielleicht ließ sich etwas jagen oder sammeln.
Der Welpe trottete hinter ihr her, das verletzte Bein nur noch leicht nachziehend. Naia blieb stehen, lauschte. Irgendetwas stimmte nicht. Die Vögel schwiegen. Die Luft war gespannt, wie vor einem Sturm.
Dann hörte sie es.
Ein Grunzen. Heiser, dumpf, nah.
Sie drehte sich, gerade rechtzeitig, um das Wildschwein zu sehen.
Es war riesig – ein ausgewachsenes Männchen, mit zotteligem Fell, klumpigen Schultern und leeren, schwarzen Augen. Die Hauer glänzten feucht. Es stand mitten auf dem Pfad, nur wenige Schritte entfernt, den Kopf gesenkt, die Nüstern bebend.
Naia fror. Ihre Hand glitt zu ihrem Messer. Zu klein. Zu schwach.
Sie wich einen Schritt zurück.
Das Schwein schnaubte, stampfte mit den Vorderhufen.
Dann rannte es los.
Ein Kreischen – nicht von ihr, sondern vom Welpen. Er sprang dazwischen, fletschte die Zähne, warf sich mit aller Kraft gegen das Tier. Es wich nicht – aber zögerte einen Sekundenbruchteil. Und das reichte.
Naia riss einen brennenden Ast aus ihrem Bündel, schwang ihn vor sich her, schrie. Nicht aus Mut – aus Angst, aus Verzweiflung, aus einer Kraft, die sie nicht kannte.
Der Schweinekörper zuckte zurück, riss den Welpen mit sich, dann verschwand er im Unterholz, brechend, grunzend, fluchend.
Stille.
Naia keuchte. Ihre Hände zitterten. Der Ast fiel zu Boden, glühend. Sie suchte den Welpen mit den Augen.
Er lag im Gestrüpp. Blut an der Flanke. Das Bein aufgerissen, das Auge halb geschlossen.
„Nein.“
Sie kniete sich zu ihm, presste den Stoff gegen die Wunde, murmelte Worte, die sie kaum verstand. Pflanzen… sie brauchte Pflanzen. Aber nicht jetzt. Nicht sofort.
Der Welpe zuckte, aber er winselte nicht. Seine Augen blickten sie an, klarer als je zuvor.
"Du Dummkopf", flüsterte sie. "Du hättest weglaufen sollen."
Sie säuberte die Wunde, verband sie, legte Moos darüber, schichtete Laub, baute ein Nest. Dann wachte sie die ganze Nacht. Fütterte ihn mit kleinen Tropfen Wasser, streichelte seinen Nacken, flüsterte, sang.
Als der Morgen kam, öffnete er die Augen.
Und leckte ihre Hand.
Etwas brach in ihr. Nicht wie Holz. Wie Eis.
Sie legte die Stirn an sein Fell.
„Du bist nicht mehr nur ein Schatten.“
Sie dachte nach.
Dann sagte sie: „Kiru.“
Der Welpe blinzelte.
Sie wiederholte es. „Kiru. Das bedeutet… nichts. Es klingt nur nach dir.“
Und in diesem Moment war es, als hätte er es verstanden. Vielleicht war es der Tonfall. Oder die Wärme ihrer Stimme. Vielleicht war es einfach das Leben, das sich seinen Weg bahnte, wie immer.
Naia lächelte zum ersten Mal seit vielen Tagen.
Kapitel 4 - Der Fels und die Feder
Ran war erschöpft.
Zwei Tage in der Wildnis hatten seinen Stolz gefressen wie Raubtiere. Der erste Tag war noch von Trotz getragen gewesen, von Wut auf Barak, auf die Sippe, auf sich selbst. Aber der Hunger kam schnell, und die Kälte noch schneller.
Er hatte Feuer gemacht. Ein kleines. Windschutz aus Ästen gebaut, den Mantel fest um den Körper geschlungen. In der ersten Nacht hatte er geschlafen – nur kurz, aber ruhig. In der zweiten war er wach geblieben. Jedes Knacken im Unterholz klang wie ein Feind, jedes Rascheln wie ein Vorwurf.
Jetzt irrte er durch ein steiniges Tal, seine Beine schwer, der Wasserschlauch leer. Die Sonne stand tief – ein fahles, graues Licht, das keinen Trost spendete. Er hielt die Hand an seinen Speer, aber seine Finger waren steif vor Kälte.
Er war ein Jäger. Das hatte er geglaubt.
Ein Kaninchen war ihm entwischt – zweimal. Ein Reh hatte ihn bemerkt, bevor er es auch nur anvisieren konnte. Sein letzter Speerwurf war in einen Baum gegangen.
Der Speer steckte dort immer noch.
Ran stand nun davor, den Kopf gesenkt, das Holz vor sich wie einen Spott. Er zog daran – es brach. Nicht der Baum. Der Speerschaft.
Ein trockener Laut entkam ihm. Kein Fluch. Kein Schrei. Etwas dazwischen.
"Verdammt..."
Er sackte auf die Knie, sah auf die gebrochene Waffe in seinen Händen. Sie war gut gewesen – sein bester Speer. Und jetzt war sie so nutzlos wie er selbst.
Er lachte bitter. Dann ließ er sich nach hinten fallen, den Blick in den Himmel gerichtet. Wolken zogen vorbei wie langsame Tiere.
Er erinnerte sich an seinen Vater. „Geduld ist stärker als Muskelkraft.“
Und an Baraks Stimme: „Vielleicht warst du nie bereit.“
Die Worte hallten in ihm, prallten gegen Wände aus Scham und Trotz.
Er lag lange so. Dann, irgendwann, drehte er den Kopf – und sah sie.
Eine Feder. Weiß, flauschig. Vom Wind bewegt. Sie tanzte durch das Gras, kam näher, blieb an einem Stein hängen. Winzig. Nutzlos. Und doch: Sie war noch da. Nicht zerbrochen.
Ran stand auf. Langsam.
Er hob die Feder auf, betrachtete sie.
"Ich bin kein Fels", murmelte er. "Nicht wie mein Vater. Vielleicht bin ich nur... das hier."
Er steckte die Feder in sein Haarband. Nicht aus Aberglauben – aus Trotz. Ein Jäger mit einer Feder. Warum nicht?
Dann machte er sich an den Bau eines neuen Speers. Nicht schön. Nicht perfekt. Aber er würde halten.
Er würde weitergehen.
Kapitel 5 - Die Gelegenheit
Der Tag war klar, aber kalt. Der Wind kam von Osten, roch nach Schnee, obwohl der Himmel noch blau war. Ran ging langsam, den improvisierten Speer in der Hand, das Gesicht vom Frost gezeichnet.
Er hatte in der Nacht kaum geschlafen. Immer wieder war er aufgewacht – nicht wegen Geräuschen oder Kälte, sondern wegen dem, was in ihm brodelte: ein dumpfes Gefühl, das er nicht benennen konnte.
Er nannte es Hunger. Oder Wut.
Aber vielleicht war es etwas anderes.
Er war jetzt am Rand eines Hanges angekommen, von dem aus er ins Tal blicken konnte. Unten zog sich ein schmaler Bach durch ein lichteres Wäldchen. Da – Bewegung. Ran duckte sich instinktiv, ging in die Hocke, hob den Speer.
Ein Tier.
Ein Riesenhirsch, wie man ihn nur selten sah. Breit, mächtig, mit gewaltigem Geweih. Doch dieses hier war verletzt – es hinkte, eine seiner Flanken war blutig. Vielleicht ein Kampf mit einem Artgenossen, vielleicht ein Sturz. Es war allein, schwach.
Ein leichtes Ziel.
Ran schlich näher. Jeder Schritt vorsichtig, jeder Atemzug kontrolliert. Er spannte die Muskeln, bereit zum Wurf.
Dann blieb er stehen.
Etwas hielt ihn zurück. Nicht Angst. Nicht Zweifel. Etwas anderes.
Er sah den Hirsch an – wie er zitterte, wie sein Atem dampfte. Die Augen des Tiers blickten nicht panisch. Sie blickten ihn an.
Nicht wie ein Feind.
Nicht wie Beute.
Ran senkte langsam den Speer.
Er wusste, dass das töricht war. Dass die Sippe – selbst Barak – ihn ausgelacht hätte. Aber irgendetwas in ihm weigerte sich, dieses Wesen zu töten. Es war nicht nur schwach – es war stolz. Noch lebendig.
Ein Moment verging.
Dann drehte der Hirsch sich um und humpelte davon, langsam, würdevoll, bis er zwischen den Bäumen verschwand.
Ran atmete aus.
Er wartete, bis das Geräusch seiner Schritte verklungen war. Dann ging er weiter, wortlos, den Speer in der Hand. Nicht als Sieger. Nicht als Jäger.
Er schlug erst kurz vor Sonnenuntergang ein Lager auf. Keine Beute. Kein Feuerholz. Nur ein kleines windgeschütztes Plateau mit Laub und Moos. Er kaute auf einem trockenen Stück Wurzel, seine Gedanken dunkler als der Wald um ihn.
„Du hattest die Gelegenheit“, hörte er Baraks Stimme in seinem Kopf. „Du hast sie verstreichen lassen.“
„Man hilft niemandem, der zu schwach ist zu leben“, hatte sein Vater einmal gesagt. Und Ran hatte das geglaubt. Lange.
Aber etwas an den Augen des Hirsches hatte ihm widersprochen.
Später, als die Dämmerung kam, hörte er in der Ferne ein Heulen. Kein Wolf. Etwas anderes. Menschen? Vielleicht.
Er spannte sich, griff nach seinem Speer – doch er war zu müde, um sich einzureden, dass es wichtig war. Noch nicht.
Kapitel 6 - Die Entscheidung
Der Wald war leise.
Ran bewegte sich mit vorsichtiger Routine durch das Unterholz. Noch ein Tag. Vielleicht zwei. Dann musste er zurück. Oder versuchen, es zumindest. Er hatte kaum Fleisch, keine Beute, aber genug geschnittene Kräuter und getrocknete Wurzeln, um nicht mit leeren Händen zurückzukehren. Barak würde ihn auslachen. Doch das war nicht mehr das, was ihm Sorgen machte.
Die Begegnung mit dem verletzten Hirsch ließ ihn nicht los. Du hattest die Gelegenheit. Du hast nichts getan.
Er hörte das Urteil in sich. Und noch schlimmer: die Stille, die darauf folgte.
Dann – ein Laut. Kein Tier.
Menschen.
Er erstarrte. Stimmen, undeutlich. Kein Lachen, kein Singen. Zischende Worte, hektisches Knacken im Geäst. Ein heiserer Schrei. Gefolgt von Knurren. Ein tiefes, gefährliches Knurren, das ihm durch Mark und Bein ging.
Ran duckte sich, bewegte sich näher. Jede Faser in ihm war angespannt.
Dann sah er sie.
Drei Gestalten – jugendlich, aber bewaffnet mit Knüppeln und Speeren. Umringten etwas – oder jemanden.
Da – Bewegung im Zentrum. Eine junge Frau. Schlank, mit wildem Haar, das an Rindenstreifen erinnerte. Ihre Kleidung war zerschlissen, das Messer in ihrer Hand klein. Aber ihre Haltung war aufrecht.
Vor ihr stand ein Wolf.
Ein junger, vernarbter, mit einer frischen Narbe an der Flanke. Die Lefzen gefletscht. Er knurrte, ging dazwischen, schützte sie wie ein Bruder.
Ran erstarrte.
Ein Wolf?
Und doch... das Tier wich nicht zurück. Es war kein Angriff, es war Schutz. Kein Rudel war in der Nähe. Das hier war... Bindung.
Einer der Jungen warf einen Stein. Er traf den Wolf an der Schulter – das Tier jaulte kurz, stürzte aber nicht.
Naia stürzte vor, schrie etwas – unverständlich. Dann duckte sie sich unter einem Speer hinweg und stach zu. Nicht tödlich, aber wild. Sie war keine Kriegerin, aber voller Entschlossenheit.
Ran hätte sich umdrehen können.
Er kannte diese Sippe nicht. Die drei waren nicht seine Feinde. Das Mädchen war nicht seine Verantwortung. Und doch...
Wieder sah er den Hirsch vor sich.
Wieder diese Augen.
Diesmal wollte er es nicht falsch machen.
Er trat aus dem Schatten. Rief laut: „He!“
Die Jungen drehten sich um, überrascht. Der Älteste hob den Speer – Abwehrhaltung.
„Lass sie gehen“, sagte Ran, fest. „Sie gehört nicht zu euch.“
„Und zu dir?“, fragte der Jüngste. „Bist du ihr Jäger?“
„Nein“, sagte Ran. Er trat näher. „Ich bin nur jemand, der nicht wegsieht.“
Einen Moment lang war alles still. Nur das Knurren des Wolfs und das Keuchen des Mädchens füllten die Luft.
Der Anführer der drei musterte Ran, sah seinen Speer, seine Haltung – er war größer, älter, eindeutig stärker.
Schließlich spuckte er auf den Boden.
„Nicht wert, Blut zu vergießen“, sagte er. „Die Wildnis wird sie holen.“
Dann drehte er sich um und verschwand zwischen den Bäumen. Die anderen folgten zögernd.
Ran blieb stehen. Er wartete, bis der Lärm verklungen war. Dann sah er sie an.
Sie sagte nichts.
Der Wolf stellte sich vor sie, seine Lefzen noch immer halb geöffnet. Ein Knurren – aber leiser. Warnend, nicht drohend.
Ran senkte den Speer langsam. Hob dann beide Hände, leere Handflächen nach vorne.
„Ich“, sagte er ruhig, zeigte auf seine Brust. „Ran.“
Das Mädchen antwortete nicht. Ihre dunklen Augen fixierten ihn, aufmerksam, wachsam. Dann deutete sie auf ihn. Ihre Stirn runzelte sich. „Rrr...an?“
Er nickte.
Sie überlegte. Dann schlug sie sich leicht gegen die Brust. „Naia.“
Der Wolf knurrte, fast wie zur Bestätigung.
Ran wiederholte: „Naia.“
Sie nickte.
Dann Stille.
Er versuchte es mit einem Satz, eine Geste, ein Zeichen. „Ich – helfen“, sagte er langsam und zeigte erst auf sich, dann auf sie, dann machte er eine Schutzgeste mit beiden Armen. „Helfen.“
Naia sah ihn an. Ihre Stirn blieb gerunzelt. Kein Verständnis.
Sie machte eine kreisende Handbewegung, verwirrte ihn. Dann hob sie eine Wurzel vom Boden auf, zeigte darauf. „Tarrak“, sagte sie. Dann auf einen Baum: „Sheelu.“
Ran verstand: Sie sprach eine andere Sprache. Ganz anders. Keine gemeinsamen Wörter. Keine vertrauten Klänge.
Aber sie hatten ihre Namen. Ihre Hände. Ihre Augen.
Und das Knurren des Wolfs war verklungen.
Ran hockte sich hin. Er zeigte auf den Boden, dann auf sich, dann auf sie. „Hier. Ich. Du. Keine Gefahr.“
Naia sagte nichts. Aber sie setzte sich hin.
Mit Abstand. Mit wachem Blick.
Aber sie blieb.
Und Ran wusste: das war ein Anfang.
Kapitel 7 - Zwischen Pfote und Hand
Der Morgen war blass und feucht. Raureif lag auf den Zweigen, die Luft roch nach nasser Erde. Ran erwachte mit einem Ziehen in der Schulter. Die alte Verletzung. Das kalte Lager hatte sie zurückgebracht.
Er richtete sich auf, tastete nach dem Speer, überprüfte die Klinge seines Messers. Noch da. Noch scharf. Wenigstens das.
Ein leises Geräusch ließ ihn aufblicken. Schritte. Leicht, vorsichtig. Kein Wild. Mensch.
Naia trat aus dem Halbdunkel, mit etwas in der Hand. Etwas Eingewickeltes.
Ran spannte sich an, doch sie hob sofort die Hände – eine Geste, die er mittlerweile verstand. Keine Gefahr.
Langsam hockte sie sich hin, legte das Bündel zwischen ihnen ab. Dann machte sie einen Schritt zurück.
Ran betrachtete es: ein Tuch aus Leder, darin zerdrückte Wurzelmasse, feucht, duftend, bitter.
Er verstand. Für seine Schulter.
Er sah sie an, vorsichtig. „Danke“, murmelte er. Unsicher, ob sie das Wort kannte.
Naia sagte nichts. Sie beobachtete nur, wie er die Paste zögerlich auf die wunde Stelle rieb. Es brannte. Aber das Brennen fühlte sich lebendig an.
Dann, wortlos, griff Ran in seine Tasche. Ein Stück Trockenfleisch. Nicht viel. Aber nahrhaft.
Er legte es zwischen sie.
Naia wartete. Sah ihn an. Nahm es nicht.
Ran nickte. „Für dich.“
Zögerlich nahm sie es an. Teilte es mit den Fingern. Ein Stück blieb bei ihr, das andere legte sie Kiru hin.
Ran zuckte unwillkürlich zurück.
Der Wolf – nicht mehr Welpe, aber auch kein Jäger – knurrte nicht. Aber er sah Ran direkt an. Wachsam. Prüfend.
Naia sagte etwas. Ein Laut. Kurz. Beruhigend. Der Wolf ließ den Blick sinken. Dann fraß er.
Ran staunte. „Er... hört auf dich.“
Naia verstand nicht. Aber sie lächelte schwach. Dann wiederholte: „Kiru.“
Ran zeigte auf den Wolf. „Kiru.“
Sie nickte.
Dann zeigte sie auf sich. „Naia.“
Er tippte sich an die Brust. „Ran.“
Sie verstand. Schon zum zweiten Mal. Es war wenig. Aber es war mehr als Stille.
Im Laufe des Tages zogen sie gemeinsam weiter. Nicht nebeneinander. Aber in Rufweite. Kein Plan, keine Abmachung. Nur ein instinktives Wissen: Zu zweit ist es leichter.
Ran sammelte trockene Zweige, Naia zeigte ihm, welche Rinde besser brannte. Er deutete auf Spuren im Boden – Hirsch, sagte seine Geste. Sie nickte. Dann zeigte auf Kräuter – Medizin, zeigte sie mit einer drehenden Bewegung. Er verstand nicht alles. Aber genug.
Kiru hielt Abstand zu Ran. Nahm nur Futter aus Naias Hand. Wenn Ran zu nah kam, stellte sich das Tier schräg vor sie – nie aggressiv. Nur erinnernd.
Ran respektierte es. Mehr als das. Er begann zu begreifen.
Er hatte allein gejagt, allein gedacht. Das hier war anders. Zwei Wesen. Drei Körper. Ein Rhythmus.
Am Abend fanden sie eine kleine Mulde im Hang, geschützt von Fels und Gebüsch. Naia richtete sich dort ein. Ran legte sich einige Schritte entfernt, spürte das Ziehen in der Schulter, die Müdigkeit in den Beinen.
Ein Laut.
Naia reichte ihm ein gefaltetes Stück Leder. Darin: etwas Wurzel, ein Stück getrocknetes Fleisch.
Er nahm es. Nickte.
Dann tippte er sich auf die Brust. „Freund.“
Naia blinzelte. Überlegte. Dann wiederholte das Wort. „Fro... end.“
Ran lächelte.
Kiru hob kurz den Kopf, prüfte die Luft – und legte sich dann wieder zu Naia, die Hände unter dem Kopf, den Blick zum Himmel.
Der Rauch ihres Feuers stieg still in die Nacht.
Kapitel 8 - Die Zuflucht
Der Wind war umgeschlagen.
Was am Morgen nur ein kühles Flüstern gewesen war, peitschte nun durch das Geäst wie eine wütende Hand. Die Bäume knarrten. Der Himmel war dicht und grau, voller Schnee, der noch nicht fiel, aber jederzeit brechen konnte.
Ran zog den Umhang fester um die Schultern. Seine Schulter schmerzte wieder, aber schlimmer war die Nässe in seinen Stiefeln. Er drehte sich um.
Naia kam hinter ihm her, Schritt für Schritt. Kiru war zwischen ihnen, näher bei ihr. Der Wolf hob ständig die Nase, schnüffelte, prüfte den Wind.
„Schnee“, sagte Ran, mehr zu sich als zu ihnen. „Bald.“
Naia verstand das Wort nicht. Aber sie sah zum Himmel – und nickte.
Sie zogen weiter. Dicht am Hang, durch Gestrüpp und schmale Pfade. Der Wald veränderte sich, wurde offener. Raureif glitzerte auf den Zweigen. Die Tiere waren verschwunden – die Natur hielt den Atem an.
Dann sah Kiru etwas.
Er blieb stehen. Rute hoch. Ein Laut, tief aus der Kehle.
Naia folgte seinem Blick – ein dunkler Einschnitt im Fels, nur wenige Schritte entfernt. Halb verdeckt von Tannenwuchs. Ein Schatten.
Eine Höhle.
Ran trat vor. Prüfte die Öffnung. Niedrig, eng, aber trocken. Die Decke war rußgeschwärzt – andere waren schon hier gewesen, vor langer Zeit.





























