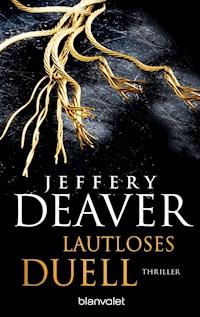7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Als die junge Anwaltsassistentin Taylor Lockwood von ihrem Vorgesetzten Mitchell Reese gebeten wird, eine verdeckte interne Ermittlung für ihn durchzuführen, willigt sie sofort ein. Es geht um das rätselhafte Verschwinden eines Dokuments. Doch bei ihren Ermittlungen stößt Taylor auf ein Geheimnis, das den Fall in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Plötzlich geht es um Mord. Und Taylor selbst schwebt in tödlicher Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Ähnliche
Jeffery Deaver
Ein tödlicher Plan
Thriller
Deutsch von Helmut Splinter
Buch
Als die junge Anwaltsassistentin Taylor Lockwood von ihrem Vorgesetzten Mitchell Reese gebeten wird, eine verdeckte interne Ermittlung für ihn durchzuführen, willigt sie sofort ein. Es geht um das rätselhafte Verschwinden eines Dokuments. Doch bei ihren Ermittlungen stößt Taylor auf ein Geheimnis, das den Fall in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Plötzlich geht es um Mord. Und Taylor selbst schwebt in tödlicher Gefahr …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Mistress of Justice« bei Doubleday, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Die Wall Street-Anwälte« beim Knaur Verlag.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
E-Book-Ausgabe 2016 Copyright der Originalausgabe © 1992 by Jeffery Deaver Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1996 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Copyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: © www.buerosued.deUmschlagmotiv: © Arcangel Images/Helene Havard
ISBN 978-3-641-19622-6V001
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
In der Nacht schläft die Anwaltskanzlei.
Voller Schatten, aber nicht wirklich dunkel, ruhig, aber nicht still, gleicht die Kanzlei nicht anderen Büros wie zum Beispiel denen von Banken oder Aktiengesellschaften, Museen, Konzerthallen oder den dumpf brütenden Apartments ohne Namen, die groß und klein die Insel Manhattan füllen. Die Kanzlei unterscheidet sich von ihnen, weil ihre Seele bleibt, auch wenn keine Mitarbeiter mehr da sind. Ähnlich einem viktorianischen Landhaus besitzen ihre Hallen und Flure eigene Charakterzüge – vererbt wie geprägt von Willenskraft, Ehrgeiz und Intrigen. Hier hängt am Ende eines breiten, mit edlen Tapeten beklebten Ganges das Porträt eines würdigen Herrn mit mächtigem Schnauzer und Backenbart – eines Mannes, der die Sozietät verließ, um Gouverneur des Staates New York zu werden.
Im kleinen Foyer mit frischem Blumenschmuck fällt der Blick auf einen erlesenen Fragonard, der weder von dickem Glas noch von einer Alarmanlage geschützt wird.
Und drüben, im großen Konferenzraum, stapeln sich Berge von Papieren mit den magischen Worten, die das Gesetz verlangt, um eine Klage über hundertsechzig Millionen Dollar anzustrengen. In einem ähnlichen Raum etwas weiter den Flur hinunter findet sich eine vergleichbare Menge von Papieren, die man in dunkelblauen Aktenordnern abgeheftet hat, darunter die Satzung einer gemeinnützigen Stiftung, die privater AIDS-Forschung eine finanzielle Grundlage verschafft.
Schließlich ist da ein fest verschlossener Aktensafe, in dem das Testament mit den letztwilligen Verfügungen des zehntreichsten Mannes der Welt verwahrt wird.
Heute schläft die Kanzlei wie ein Wesen, das auf sich gestellt ist, und sein sonorer Atem klingt wie das weiße Rauschen nach Macht, Geld und Bedeutung. Man kann diese Laute selbst jetzt, mitten in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, hören.
Doch plötzlich eine Störung. Ein hartes Geräusch pflanzt sich durch die trockene Luft fort. Ein widerhallendes Einschnappen von Metall, ein unpassender Laut wie ein unwillkürliches Aufstöhnen im Traum. Dann das leise Zischen einer Tür, die geschlossen wird, und dem folgt das Wispern von Schritten, die sich rasch über den Teppich zurückziehen. Jemand flieht durch die düsteren Gänge, die solch dringliche Hast nicht gewöhnt sind. Als eine weitere Tür ins Schloss gezogen wird, kehrt erneut Frieden ein. Der Traum – oder Albtraum – ist vergangen, und die Kanzlei findet wieder zu ihrem vornehmen, satten, doch wachsamen Schlaf.
… Eins
Als ihr Telefon klingelte, dachte Taylor Lockwood gerade darüber nach, warum man die fünfzehnte Etage Halsted Street nannte.
Irgendwann in den Siebzigerjahren hatte die Kanzlei heftig einen jungen Juristen umworben. Der hatte sein Staatsexamen an der juristischen Fakultät der University of Chicago und seinen Doktor »magna cum laude« gemacht, war Schreiber der Verbindung »Der Siebente Kreis« und besaß auch sonst alles, was zum Geschäft gehört. In ihrem Bestreben, den jungen Mann unbedingt für die Kanzlei zu gewinnen, führten die Senioranwälte ihn durch die Büros. Er stieg die Marmortreppe zum fünfzehnten Stockwerk hinunter, wo die nichtjuristischen Mitarbeiter und Anwaltsassistenten tätig waren. Als er dort die vierzig Arbeitsbereiche mit den brusthohen Raumteilern erblickte, die Verschlägen glichen, sagte er: »Ha, das sieht wie die Halsted Street aus!« Er grinste. Die ihn begleitenden Anwälte lächelten ebenfalls, doch keiner von ihnen besaß genug Geistesgegenwart oder den Mut, den jungen Mann zu fragen, was er damit meine.
Als er wenige Tage später die Stelle ablehnte, die ihm von der Kanzlei angeboten worden war, hatte sich seine Bezeichnung für das Großraumbüro wie ein Lauffeuer durch die ganze Kanzlei verbreitet. Und seitdem hatte sich Halsted Street als Synonym für den Arbeitsbereich der Gehilfen, Schreibkräfte und Assistenten im Hause etabliert.
Taylor folgte der vorherrschenden Meinung, wonach der junge Mann mit dem Straßennamen auf die Viehstallungen bei den Schlachthöfen auf der South Side von Chicago angespielt hatte. Als sie heute Morgen in ihrem winzigen Büro saß, kam sie zu dem Schluss, dass es sich bei dieser Theorie um die einzig richtige handeln musste. Es war der Dienstagmorgen nach Thanksgiving, und die Uhr zeigte halb neun. Seit drei Uhr früh war sie damit beschäftigt gewesen, zwischen dem Kopierraum und einem Konferenzsaal hin und her zu laufen, und hatte einige hundert Schriftstücke für einen Vertragsabschluss, der für heute Nachmittag angesetzt war, herausgesucht, geordnet und gestapelt. Als der Anwalt, dem sie zugeteilt war, gesagt hatte, sie solle eine Pause einlegen, war sie hierher geflüchtet. Sie lehnte sich nun auf ihrem bequemen roten Drehstuhl zurück, leerte ihren fünften Becher schwarzen Kaffee, saugte an dem Finger, in den sie sich mit einer Papierkante geschnitten hatte, und versuchte intensiv, das Bild von der Viehherde, die in die Stallungen getrieben und dann zu den Schlachthöfen geführt wurde, aus ihrem Bewusstsein zu verbannen.
Das Telefon läutete.
Müde hob Taylor ab. Eine halbe Stunde. Er hat gesagt, ich könne eine halbe Stunde Pause machen. Und davon sind gerade erst zehn Minuten vergangen. Zehn Minuten sind nie und nimmer eine halbe Stunde …
Doch aus dem Hörer kam nicht die Stimme ihres Anwalts, sondern die der Oberaufseherin des Viehhofs. Die Supervisorin der Assistenten und Anwaltsgehilfen, eine dreißigjährige Frau mit dem umständlichen Gehabe einer Bibliothekarin und dem Feingefühl eines Bestattungsunternehmers, sagte: »Taylor, ich frage ja nur ungern, aber würde es Ihnen etwas ausmachen, ich meine, wären Sie sehr enttäuscht, wenn man Sie vom SBI-Projekt abzieht?«
»Wie bitte?«
»Könnten Sie sich damit abfinden? Ich meine, kein SBI mehr?«
Taylor entgegnete verwundert: »Aber die Verhandlungen sollen doch heute um vierzehn Uhr abgeschlossen werden. Ich arbeite jetzt seit drei Wochen an der Sache.«
»Wäre es denn so schlimm, damit aufzuhören?« Die Supervisorin klang, als bereitete ihr schon die Frage physische Schmerzen.
»Wie sieht denn die Alternative aus?«
»Eigentlich«, das Wort kam langsam und unendlich zerdehnt heraus, »gibt es keine Alternative. Ich habe Mr. Bradshaw bereits Ersatz geschickt.«
Taylor drehte sich mit ihrem Stuhl erst weit nach links und dann nach rechts. Die Schnittwunde fing wieder an zu bluten, und sie wickelte eine Papierserviette um ihren Finger, die mit einem fröhlichen Truthahn verziert war – ein Überbleibsel von der Cocktailparty, die vergangene Woche in der Kanzlei stattgefunden hatte. »Habe ich irgendetwas falsch gemacht?«
»Mitchell Reece hat Sie angefordert, um ihm bei einem Projekt zu assistieren.«
»Reece? Aber ich habe noch nie für ihn gearbeitet.«
»Offenbar eilt Ihnen ein ganz besonderer Ruf voraus.« Die Supervisorin klang vorsichtig, als wäre es ihr neu, dass Taylor schon so etwas wie eine Reputation besaß. »Er sagte, er wolle nur Sie und keine andere.«
»Äh … Sie erinnern sich bestimmt, dass ich nächste Woche in den Skiurlaub wollte.«
»Darüber sollten Sie mit Mr. Reece sprechen, er wird sicher Verständnis dafür haben. Ich habe ihn aber bereits davon in Kenntnis gesetzt.«
»Und wie hat er reagiert?«
»Es schien ihm nicht allzu viel auszumachen.«
»Warum sollte es auch? Er ist schließlich nicht derjenige, der Ski fahren will.« Blut drang durch die Serviette auf das grinsende Gesicht des Truthahns.
»Melden Sie sich in einer Stunde in seinem Büro.«
»Soll ich Mr. Bradshaw Bescheid geben?«
»Darum habe ich mich schon gekümmert. Finden Sie sich in einer Stunde …«
»… in Mr. Reeces Büro ein.« Taylor legte auf.
Sie ging zwischen den mit Teppich ausgelegten Arbeitsverschlägen hindurch zum einzigen Fenster von Halsted Street.
Draußen wurde das Finanzviertel in das Licht des frühmorgendlichen bedeckten Himmels getaucht. Heute konnte der Anblick Taylor jedoch nicht begeistern. Für ihren Geschmack war da zu viel schmutziger alter Stein; wie Berge, die eine starke Hand abrupt zusammengeschoben und dann liegen gelassen hatte, auf dass sie verwitterten und ein immer unheimlicheres Aussehen annähmen. Im Fenster eines der gegenüberliegenden Gebäude war ein Hausmeister zu erkennen, der sich damit abmühte, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. In der kalten Marmorhalle erschien das Grün wie ein Fremdkörper. Taylor kam es eigenartig vor, dass nicht das Grau der Fassaden, sondern die Farbe des Baums sie störte. Sie war viel zu dunkel und wirkte gegenüber normalem Grün wie getrocknetes Blut zu Rot.
Taylor konzentrierte ihren Blick auf das Fenster vor ihr und bemerkte, dass sie ihr eigenes Spiegelbild anstarrte.
Taylor Lockwood litt nicht eigentlich an Übergewicht, aber sie besaß auch nicht die knochige Figur eines Models. Erdverbunden, so empfand sie ihren Körper. Wenn jemand sie nach ihrer Größe fragte, antwortete sie: ein Meter dreiundsiebzig. Dabei waren es gerade mal einssiebzig. Aber sie hatte dichtes schwarzes Haar, und wenn sie das toupierte, kam sie leicht auf die angegebene Größe. Früher hatte ein Freund ihr einmal gesagt, mit ihrem gekräuselten und lose herabhängenden Haar passe sie in ein Gemälde der Präraffaeliten.
So sah sich Taylor allerdings überhaupt nicht. An guten Tagen glaubte sie eine Ähnlichkeit mit der jungen Mary Pickford zu haben. An den anderen Tagen kam sie sich wie ein dreißigjähriges kleines Mädchen vor, das mit nach innen gestellten Füßen dastand und ungeduldig darauf wartete, dass Reife, Entschlusskraft und Autorität endlich auch den Weg zu ihr fänden. (Es geschah sogar heute noch, dass sie Ich bin erwachsen! Ich bin erwachsen! zu sich sagte und dabei richtige Tränen vergoss.) Taylor mochte ihr Spiegelbild am liebsten in Behelfsspiegeln wie zum Beispiel schwarzen Schaufensterscheiben.
Oder in den Fenstern von Anwaltskanzleien in der Wall Street. Sie wandte sich ab und kehrte zu ihrem Drehstuhl zurück. Es war jetzt kurz vor neun Uhr, und die Kanzlei erwachte überall zum Leben. Die anderen Mitarbeiter trafen ein. Grüße – oder Warnungen vor anstehenden Krisen – wurden kreuz und quer durch die Halsted Street gerufen, Erlebnisse in der U-Bahn oder im Verkehrsstau ausgetauscht. Taylor saß an ihrem Schreibtisch und dachte darüber nach, wie abrupt sich der Verlauf eines Lebens verändern konnte – und das aus der Laune eines anderen heraus. Doch diese gewichtigen Betrachtungen vergingen ebenso rasch, wie sie gekommen waren, und Taylor stand auf, um sich ein Pflaster für den Finger zu besorgen.
An einem warmen Aprilmorgen des Jahres 1887 betrat ein zweiunddreißigjähriger Anwalt namens Frederick Phyle Hubbard, dessen mächtige Koteletten in auffälligem Kontrast zur Lichtung seines Haupthaars standen, ein kleines Büro auf dem Lower Broadway, hängte seinen Seidenhut und Prinz-Albert-Mantel an den Garderobenhaken und sagte zu seinem Partner: »Guten Morgen, Mr. White. Haben Sie schon irgendwelche Klienten?«
So begann das Leben einer Anwaltskanzlei.
Sowohl Hubbard als auch C. T. White hatten an der juristischen Fakultät der University of Columbia ihr Examen gemacht und waren sofort dem wachsamen Auge des ehrenwerten Walter Carter, Esquire, einem der Seniorpartner von Carter, Hughes & Cravath, aufgefallen. Er nahm die beiden für ein Jahr auf Probe in die Kanzlei auf, und in dieser Zeit erhielten sie, wie damals üblich, keinen Cent Lohn. Nach Ablauf der Frist stellte Carter Hubbard und White fest ein und zahlte ihnen ein laufendes Gehalt von nicht unbeträchtlichen zwanzig Dollar im Monat.
Sechs Jahre später liehen sich die beiden – sie waren jetzt so ambitioniert, wie Carter sie in weiser Voraussicht geformt hatte – von Whites Vater dreitausend Dollar, stellten einen Assistenten und einen Sekretär (zu jener Zeit üblicherweise ein Mann) ein und eröffneten ihre eigene Kanzlei.
Obwohl Hubbard und White von Büroräumen im Equitable Building am Broadway Nr. 120 träumten, gaben sie sich am Anfang mit weniger zufrieden. Die Miete in dem alten Gebäude nahe der Trinity Church, für das sie sich schließlich entschieden, betrug vierundsechzig Dollar im Monat, und dafür erhielten die beiden aufstrebenden Anwälte zwei dunkle Räume. Allerdings verfügte ihr Büro über eine Zentralheizung (auch wenn sie im Januar und Februar die beiden darin befindlichen Öfen zu benutzen pflegten) und einen Fahrstuhl, der mittels eines Stricks bedient wurde, welcher mitten durch die Kabine verlief. Auf den Böden lagen gobelinartige Teppiche, die Hubbards Frau zurechtgeschnitten und bestickt hatte. Die bereits vorhandenen Filzbeläge waren für Hubbards Geschmack nicht elegant genug, und er fürchtete, sie könnten »mögliche Klienten eher abschrecken«.
Und das Büro besaß noch weitere Vorzüge. Beim Mittagessen im Delmonico’s auf der Fifth Avenue, wo Hubbard und White den Großteil ihrer ersten Einnahmen ließen, um bereits existierende wie mögliche Klienten mit einem Mahl bei Laune zu halten, konnten die beiden mit der neuen Druckpresse ihrer Firma prahlen; dieses Gerät stellte vermittels eines feuchten Tuchs Kopien von der Geschäftskorrespondenz her. Die Anwälte hatten sich auch einen Telefonapparat vorführen lassen, sich dann aber gegen einen Erwerb desselben entschieden. Die Mietgebühr betrug zehn Dollar im Monat, doch davon abgesehen, gab es bis auf Gerichtsbedienstete oder ein paar Regierungsbeamte niemanden, den man hätte anrufen können. Die Kanzlei war außerdem mit einer Schreibmaschine ausgestattet, aber man erledigte den überwiegenden Teil der Geschäftspost immer noch mit Stahlfeder und Tintenfass. Hubbard und White legten großen Wert darauf, dass ihr Sekretär die Streusanddosen zum Tintenlöschen nur mit dem schwarzen Sand vom Champlain-See füllte.
In den Vorlesungen hatten beide Männer davon geträumt, bewährte Prozessanwälte zu werden, und während ihrer Wochen und Monate der Knechtschaft bei Carter, Hughes & Cravath hatten sie tatsächlich viele Stunden in den verschiedenen Gerichtssälen mit der Beobachtung verbracht, wie bekanntere Prozessanwälte schmeichelten, plädierten, Winkelzüge machten und Zeugen wie Jurymitglieder gleichermaßen verschreckten.
Aber was sie selbst betraf, mussten sie bald feststellen, dass es auch nötig war, sich mit anderem abzugeben, um Geld in die Kasse zu bekommen, und so wurde das lukrative Feld des Handels- und Gesellschafts- beziehungsweise Körperschaftsrechts bald zur Haupteinnahmequelle ihrer noch jungen Kanzlei. Für jede Arbeitsstunde stellten sie ihren Klienten zweiundfünfzig Cent in Rechnung, gewährten aber für gewisse Treuhandtätigkeiten willkürliche und großzügige Bonusse. Es waren eben noch die guten alten Zeiten vor Einführung der Einkommenssteuer, der Antitrustgesetze oder des Kartellamts. Handelsgesellschaften aller Arten rasten damals wie eine Hunnenhorde über die Landschaft des amerikanischen freien Unternehmertums. Hubbard und White waren der Generalstab dieser Armeen, und in dem Maße, in dem ihre Klienten ungeheuren Reichtum erwarben, gelangten auch sie zu Wohlstand. Ein dritter Seniorpartner, Colonel Benjamin Willis, trat 1920 in die Kanzlei ein. Er starb einige Jahre später an einer Lungenentzündung, die auf einen Senfgasangriff im Ersten Weltkrieg zurückzuführen war. Als sein Vermächtnis hinterließ er der Kanzlei als Klienten eine Eisenbahnlinie, eine Bank und einige andere größere Versorgungsbetriebe. Hubbard und Willis erbten auch die Frage, was sie mit seinem Namen tun sollten. Dessen Nennung im Firmentitel war der Preis gewesen, den sie sowohl für den Eintritt des Colonels in die Kanzlei als auch für die betuchten Klienten, die er mitbrachte, hatten bezahlen müssen. Sie hatten das damals per Handschlag besiegelt und nichts schriftlich fixiert. Doch nach seinem Tod hielten die beiden ihr Wort.
Die Anwaltskanzlei war seitdem als Triumvirat bekannt und würde es immer bleiben. Als gegen Ende der Zwanzigerjahre die Ära der Glühstrumpflampen ihrem Ende zuging, war die Sozietät Hubbard, White & Willis auf achtunddreißig Anwälte gewachsen. Der lang ersehnte Wunsch der Gründer hatte sich erfüllt, und man war ins Equitable Building umgezogen. Bankgeschäfte, Kreditsicherheiten und Zivilprozesse bildeten den Schwerpunkt der Kanzleitätigkeiten, und die Arbeit wurde auch weiterhin so wie im 19. Jahrhundert angegangen – das heißt, von Gentlemen, und zwar nur von denen einer bestimmten Art. Anwälte, die zu einem Einstellungsgespräch kamen und aussahen wie Juden, Italiener oder Iren oder es sogar waren, wurden zwar freundlich empfangen, und man hörte sie auch mit Interesse an, aber in die Firma aufgenommen wurden sie nie.
Weibliche Arbeitskräfte wurden gerne eingestellt; gute Stenografinnen fand man schließlich nicht wie Sand am Meer.
Die Kanzlei wurde immer größer, und aus ihr erwuchsen gelegentlich Filialbetriebe oder politische Karrieren. Es verwundert sicher nicht zu erfahren, dass ausschließlich Mitglieder der republikanischen Partei gefördert wurden. Hubbard, White & Willis brachte einige Generalbundesanwälte hervor, des Weiteren einen Comissioner der Börsen- und Bankenaufsicht, einen Senator und zwei Gouverneure. Doch im Gegensatz zu anderen Kanzleien von gleicher Größe und ähnlichem Prestige hatte Hubbard, White & Willis nie ein besonderes Interesse daran, sich zu einer Politiker-Kaderschmiede zu entwickeln. In dieser Kanzlei pflegte man den Grundsatz, dass Politik zwar Macht, aber kein Geld einbrachte, und die Seniorpartner sahen nicht ein, warum sie um einer politischen Karriere willen die Praxis in der Wall Street aufgeben sollten, wo sie doch beides, Macht und Geld, hatten.
Derzeit beschäftigte Hubbard, White & Willis über zweihundert Anwälte sowie dreihundert Assistenten, Anwaltsgehilfen und andere Angestellte; damit rangierte man größenmäßig im Mittelfeld der Anwaltskanzleien von Manhattan. Unter den vierundachtzig Partnern fanden sich elf Frauen, zehn Juden (fünf von ihnen weiblichen Geschlechts), eine Amerikanerin ostasiatischer Herkunft und drei Schwarze (darunter zur großen Freude der Geschäftsleitung einer von gleichzeitig iberoamerikanischer Herkunft). Wenn die Kanzlei von den Medien oder von den Anwälten aus Bevölkerungsminderheiten darauf angesprochen – gelegentlich eher hart angegangen – wurde, wie sie es mit den Minderheiten hielte, erklärte ihre Sprecherin gewöhnlich: »Hubbard, White & Willis macht keine Unterschiede hinsichtlich Rasse, Geschlecht, sexuellen Vorlieben, nationaler oder Stammesherkunft. Unsere Geschäftspolitik besteht einzig und allein darin, nur die besten juristischen Köpfe dieses Landes für unsere Kanzlei zu gewinnen.« Des Weiteren verwies die Sprecherin dann darauf, dass Hubbard, White & Willis nicht nur eines der aktivsten und effektivsten Minderheitenschutzprogramme in der ganzen Stadt verfolge, sondern auch bereitwillig Anwälte für Klienten stelle, die unter das Armenrecht fielen.
Hubbard, White & Willis machte nun das große Geld. Allein die Betriebskosten beliefen sich mittlerweile auf über zwei Millionen Dollar im Monat, und die Partner der Kanzlei verlangten heute erheblich höhere Gebühren als Frederick Hubbard zu seiner Zeit. Eine Stunde bei einem ihrer Anwälte kostete bis zu vierhundertfünfzig Dollar, und bei wirklich großen Transaktionen wurde dem betreffenden Klienten zusätzlich eine Prämie (die von den Assistenten und Anwaltsgehilfen als »Granitgebühr« bezeichnet wurde, weil keiner der Anwälte in diesem Punkt nachgab) von bis zu zweihundertfünfzigtausend Dollar auf die Rechnung gesetzt. Junge Assistenten, gerade fünfundzwanzig Jahre alt und frisch von der Uni, verdienten im Jahr fünfundneunzigtausend Dollar.
Die gegenwärtigen Partner konnten nicht verleugnen, Nachfahren von Hubbard und White zu sein. Es handelte sich bei ihnen durchweg um brillante, gebildete Geister mit gefestigter Persönlichkeit, die verantwortungsbewusst handelten und Risiken mieden. Sie ähnelten eher Ratgebern und Gelehrten als knallharten Geschäftsleuten und waren Mitglieder in Clubs wie King of Meadowbrook oder Creek Club. Bei den Juniorpartnern konnte man eine eigenartige Mischung aus Gegenwart und vergangenen Jahrzehnten feststellen. Sie trugen unter ihren Hart-Schaffner-&-Marx-Anzügen Hosenträger, liebten die hölzerne College-Atmosphäre des Yale Club, und ihre Handflächen wurden noch feucht, wenn sie Finanzierungen von Stadtverwaltungen planten oder Firmenaufkäufe in die Wege leiteten. Zur gleichen Zeit schworen sie alle auf HD-Lipoproteine und Diätpläne und joggten pro Woche rund neunhundert Meilen. Und mehr als ein männlicher Partner hatte Unterschriftsleistungen von Salomon Brothers oder Merrill Lynch so terminiert, dass seine Frau diesen Vorgang überwachen konnte, während er selbst dafür sorgte, dass Paul junior oder der kleine Atkins in die Dalton School kam.
Hubbard, White & Willis war aus dem Kalksteingebäude in einen Palast aus Glas und Stahl gezogen. Die Kanzlei belegte nun drei Etagen in einem Wolkenkratzer nahe dem World Trade Center. Ein Innenarchitekt hatte eine Dreiviertelmillion dafür erhalten, die Klienten mit unübersehbarem Understatement in Ehrfurcht zu versetzen. Im Gesamteindruck überwogen Lavendel, Burgunderrot und Meeresblau, dazu Rauchglas, gebürstete Metallflächen und dunkles Holz mit Seidenglanzoberfläche. Marmorne Wendeltreppen verbanden die einzelnen Etagen miteinander, und die Bibliothek war in einem drei Stockwerke hohen Atrium mit fünfzehn Meter hohen Fenstern untergebracht, von denen man einen atemberaubenden Ausblick auf den Hafen von New York City hatte. Die zahlreichen Stahl- und Bronzeskulpturen (darunter einige wenige mit dezent erotischen Darstellungen), die Textiltapeten und die seidenen Kozo-Trennwände prägten sich zwar nicht so sehr ins Gedächtnis des Besuchers ein wie die Gemälde von Calder, Pollack, Monet und Matisse, verstärkten aber dennoch die Wertschätzung der Kunstsammlung der Kanzlei, die auf gut und gerne acht Millionen Dollar geschätzt wurde.
In dieser Kombination von Modelleinrichtungen, wie man sie in den Zeitschriften MOMA und Interieur Design vorgestellt bekam, war der Konferenzraum 16-2 als Einziger groß genug, um alle Partner der Kanzlei aufzunehmen. Doch am heutigen Dienstagmorgen saßen dort nur zwei Männer am Ende des hufeisenförmigen Konferenztisches, der aus in Rosenholz gefasstem dunkelrotem Marmor bestand. Inmitten des Dunstes von Fußbodenheizung und frisch aufgebrühtem Kaffee beschäftigten sie sich mit einem einzigen Blatt Papier.
Donald Burdick präsidierte seit zwölf Jahren dem Vorstand. Er war siebenundsechzig Jahre alt, schlank und hatte kurzes, glattes graues Haar. Alle vierzehn Tage fand sich in seinem Büro ein Friseur ein, ein alter Italiener, der im firmeneigenen Rolls-Royce Silver Cloud zur Kanzlei gebracht wurde – herbeizitiert wurde, wie Burdick es auszudrücken beliebte. (Wenn man zu ihm ins Büro kommen sollte, beschlich einen des Öfteren das Gefühl, er habe einen zu sich zitiert.) Es gab nicht wenige, die ihn einen »flotten Oldie« nannten. Auf den ersten Blick wirkte diese Bezeichnung durchaus zutreffend, und doch wurde sie nur von denen gebraucht, die ihn nicht besonders gut kannten. Denn »flott« oder »Oldie« vermittelte nichts von der Macht und der Autorität, die dieser Mann besaß. Donald Burdick war ein überaus mächtiger Mann, viel mächtiger, als seine große Ähnlichkeit mit Sir Laurence Olivier und seine guten Manieren eines Kavaliers alter Schule vermuten ließen.
Seine Macht war jedoch nicht in Zahlen oder anderen Größen auszudrücken. Sie war eher ein Konglomerat aus altem Geld, alten Freunden an wichtigen Stellen und Gefälligkeitsschulden. Ein Aspekt seiner Macht ließ sich allerdings rechnerisch schätzen – die komplizierte Formel der Gesellschafter- und Partnergewinnverteilung bei Hubbard, White & Willis. Bei Licht besehen war diese Formel jedoch gar nicht so kompliziert. Man musste sich nur vor Augen halten, dass die Stimmen, die man in den Versammlungen bekam, und das Gehalt, das man nach Hause trug, in direkter Linie davon abhingen, wie viele Klienten man der Kanzlei einbrachte und wie viel Geld diese daließen.
Donald Burdick verdiente im Jahr knapp zwei Millionen Dollar.
Burdick zog seine Hand zurück und überließ das Papier dem festen Zugriff von William Winston Stanley. Stanley war fünfundsechzig, stämmig, rotgesichtig und blickte ständig grimmig drein. Man konnte ihn sich leicht als einen der Pilgerväter vorstellen, wie er an einem kalten Morgen in Neuengland Dampfwolken ausatmete. Und man konnte ihn als denjenigen vor sich sehen, der die Anklageschrift gegen eine Hexe verlas.
Burdick war auf den besten Universitäten wie Dartmouth und Harvard gewesen. Stanley hatte in Abendkursen die Fordham Law School besucht und tagsüber in der Poststelle von Hubbard, White & Willis gearbeitet. Mit einer gesunden Mischung aus Charme, Sturheit und einer natürlichen Begabung für das Metier hatte er sich in der Kanzlei bis nach oben durchgeboxt, vorbei an Männern, deren vornehme Wohnorte (Locust Valley und Westport) ihm so fremd waren wie der seine (Williamsburg in Brooklyn) ihnen. Das Einzige, was für ihn sprach und ihn in wortwörtlichem Sinn für höhere Weihen qualifizierte, war seine Zugehörigkeit zur Episkopalkirche.
Seit über einem Jahrzehnt gedieh Hubbard, White & Willis unter der Ägide dieser beiden Männer. Vor einigen Jahren hatten die Gebildeten unter den Angestellten Burdick und Stanley »die Raben« genannt und damit auf die Vögel angespielt, deren Anwesenheit die Standfestigkeit des Tower of London gewährleistete. Für neuere Assistenten und Anwaltsgehilfen waren Burdick und Stanley, wenn überhaupt über die beiden gesprochen wurde, nur »die alten Männer«.
»Ist das zuverlässig?«, fragte Burdick jetzt.
Stanley betrachtete das Blatt. »Meine Jungs haben nur eine informelle Liste über das vermutliche Wahlverhalten der einzelnen Partner zusammengestellt. Aber wer weiß schon, wie jeder im Ernstfall wirklich abstimmen wird?«
»Ich muss gestehen, ich bin von ihm überrascht. Wie hat er das geschafft? Wie ist es ihm gelungen, so viele Partner in sein Lager zu ziehen, ohne dass wir etwas davon mitbekommen haben?«
Stanley lachte heiser. »Wir haben doch jetzt davon erfahren.«
»Der Scheißkerl!« Burdick griff nach dem Blatt. Für einen Moment sah es so aus, als wollte er das Papier zerknüllen, doch dann faltete er es sorgfältig zusammen und schob es in die Innentasche seines maßgeschneiderten Anzugs.
… Zwei
»Ich habe in einer halben Stunde ein Arbeitsfrühstück, und danach erwartet mich die Partnerversammlung, die den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen wird«, sagte Wendall Clayton. »Kümmern Sie sich darum.«
»Sie können sich auf mich verlassen, Wendall.« Der Assistent nickte mehrmals, um dahinter die pure Angst zu verbergen, die in ihm aufgestiegen war.
»Und wenn Sie die Herrschaften dann zurückrufen, aristokratisieren Sie die Blödmänner!«
»Selbstverständlich.« Der junge Mitarbeiter nickte noch heftiger, eilte aus dem Büro und grübelte darüber nach, was genau von ihm verlangt wurde.
»Die Blödmänner aristokratisieren«, das schrieb Clayton manchmal an den Rand eines Memos, das jemand aus seiner Truppe aufgesetzt hatte. Wenn der oder die Betreffende das Papier dann wieder in Händen hielt, konnte man zusehen, wie die Lippen angestrengt versuchten, das Wort auszusprechen – aris-to-krati-sie-ren. Clayton hatte das Wort selbst erfunden, und es hatte vornehmlich mit Benehmen, Haltung und Auftreten zu tun, natürlich auch mit überlegenen Rechtskenntnissen, aber noch mehr mit dem Drumherum. Übersetzt hieß es so viel wie »Mach sie zur Ratte«. Clayton praktizierte diese Kunst meisterhaft.
Die Sonne schien an diesem Dienstagmorgen in sein Büro, das Eckbüro, auf das er in zweifacher Hinsicht stolz war. Zum einen genoss er die Atmosphäre, welche dieser Raum ausstrahlte, für die seine Frau, eine Amateurinnenarchitektin, verantwortlich war. Zum anderen gefielen ihm die Lage und die Größe seines Büros. Es befand sich auf der Vorstandsetage, dem siebzehnten Stockwerk, und maß neun mal sieben Meter. Ein Büro von solchen Dimensionen gebührte von Rechts wegen eher einem Partner, der in der Firmenhierarchie deutlich über Clayton stand. Doch als dieser Raum frei geworden war, hatte man ihn ihm zugewiesen. Niemand wusste so recht den Grund dafür.
Die Sonne. Er mochte es, wie ihr Licht tief und golden auf die Teppiche, die Chippendale-Stühle, den Sheraton-Schrank, die beiden Apothekergläser aus Padua, die Delfter Kachel, das schwedische Astrolabium aus dem 19. Jahrhundert, die massiven Messingurnen und den Steuben-Aschenbecher fiel.
Clayton sah ausgesprochen gut aus. Er war nicht besonders groß, unter einsachtzig, besaß aber einen sportlichen, durchtrainierten Körper, den er mit Laufen (er joggte nicht, er praktizierte Langstreckenlauf), Tennis und der Sechsunddreißig-Fuß-Yacht Ginnie May in Form hielt, die er von April bis September an jedem zweiten Wochenende um Newport herumsteuerte. Er hatte den dichten Haarschopf eines Harvard-Professors und trug europäische Anzüge (ohne Schlitz am Rücken und manchmal sogar Zweireiher), weil ihm die dunklen und konservativen Nadelstreifenanzüge nicht zusagten, die den meisten Männern in der Kanzlei wie Säcke von den Schultern ihrer birnenförmigen Körper hingen. Die weiblichen Angestellten tuschelten einander zu, dass sie bei einem wie ihm durchaus schwach werden könnten. Ein paar Zentimeter mehr, und jede Modelagentur hätte Clayton mit Kusshand genommen. Er arbeitete hart an seinem Image. Ein Duke musste gut aussehen. Ein Duke mochte es, wenn man für seine Anzüge Bürsten aus Naturborsten benutzte und seine teuren dunkelroten Schuhe von Bally auf Hochglanz poliert waren. Clayton genoss die kleinen Rituale anspruchsvoller Persönlichkeiten mit Wonne.
Er warf einen Blick auf die Schiffsuhr, die auf seinem Schreibtisch stand, und lehnte sich in seinem Sessel zurück – seinem Thron, einem mächtigen Gebilde aus Eiche und rotem Leder, das er für zweitausend Pfund in England erstanden hatte.
Aristokratisieren.
Wendall Clayton schaute zum Fenster hinaus. Die Sonne stand tief über Brooklyn und ließ all den Dreck in der Luft feurig und dramatisch erscheinen. Das rote Licht fiel auf sein Gesicht. Er glaubte Wärme zu spüren, obwohl das bei dieser Novembersonne kaum möglich war. Clayton rieb sich die Haut unter den Augen. Er war ziemlich erschöpft. Am vergangenen Freitagabend hatte er um achtzehn Uhr mit einigen jungen Assistenten im Murphy’s gesessen, ihnen ein paar Drinks ausgegeben, über ihre eher harmlosen schmutzigen Witze gelacht, selbst einige seiner weniger harmlosen erzählt und gerade über Football gefachsimpelt, als sein Piepser sich gemeldet hatte. Einer seiner Klienten stand kurz vor einer Panik. Seiner Firma war eine einstweilige Verfügung zugestellt worden. Clayton war Wirtschaftsanwalt, genauer Anwalt für Körperschaftsrecht, aber nicht bei Gericht zugelassen, und hatte daher nur vage Vorstellungen, wie man eine solche Verfügung außer Kraft setzen konnte. Doch der Mann gehörte zu seinem Klientenstamm, und binnen drei Stunden hatte er einen bei Gericht zugelassenen Partner der Kanzlei telefonisch von seinem Dinner vor dem Theaterbesuch weggeholt und ihm zwei ausgeschlafene Assistenten besorgt. Sie hatten sich sofort darangemacht, das Nötige für den Fall zusammenzustellen, um die einstweilige Verfügung zu kippen. In der Nacht von Montag auf Dienstag waren sie fertig geworden, und vor einer halben Stunde hatte der Prozessbevollmächtigte den Fall vor einem gefälligen Richter im Southern District vorgebracht. Der Richter hatte zugunsten von Claytons Klient entschieden und die einstweilige Verfügung aufgehoben.
Clayton hatte dem Klienten gerade die gute Nachricht übermittelt, der ehrlich überrascht gewesen war, dass Hubbard, White & Willis die Geschichte schon vor Geschäftsbeginn am kommenden Dienstag aus der Welt geschafft hatte. Clayton hatte sich die Lobpreisungen gern angehört und ihn nicht mit solchen Banalitäten unterbrochen wie, dass die Rechnung für ein Wochenende voller Arbeit sich in einer Höhe von sechzigtausend Dollar bewegen werde.
Während er jetzt zum Fenster hinausblickte und das goldene Sonnenlicht und den Erfolg genoss, fühlte er sich entspannt und mehr oder weniger zufrieden.
Das Gefühl hielt auch dann noch an, als er sich, was er in der letzten Zeit häufiger tat, fragte, ob er wirklich seinen Job, der ihm im Jahr vierhundertfünfzehntausend Dollar einbrachte, kündigen und Hubbard, White & Willis den Abschiedskuss geben sollte. Selbstredend zog ein Duke niemals den Schwanz ein. Die erste und vornehmste Verantwortung eines Duke gehörte seinen Klienten. Besser gesagt, seinen Untertanen. Aber ein Duke, der seine fünf Sinne beisammenhatte, wartete nicht so lange, bis der König sich so weit verschlissen hatte, dass es den Feinden ein Leichtes war, das Reich zu überrennen. Nein, ein Duke wusste genau, was er wollte. Die Metapher vom Schwanzeinziehen wurde etwas kompliziert, und Clayton stellte fest, dass es ihm angenehmer war, weniger an Könige und Dukes und dafür mehr an Burdick, die Kanzlei und sich selbst zu denken.
Dieser gottverdammte Burdick; dieser aufgeblasene alte Pfau! Zur Hölle mit ihm! Clayton ballte vor Ärger die Faust so fest, dass sein muskulöser Arm zitterte.
Das Telefon läutete. Seine Limousine war unten vorgefahren. Clayton stand auf, zog sich Jacke und Mantel an und schritt durch die unheilvoll stillen Gänge. Er hatte in Uptown eine Verabredung, die für ihn mindestens so wichtig war wie die Partnerversammlung später am Vormittag. Doch zuvor musste er noch etwas erledigen, das für ihn entscheidender war als die beiden Zusammenkünfte. Wendall Clayton wollte sich persönlich bei den beiden jungen Kollegen bedanken, die für seinen Klienten und damit auch für ihn ihr Wochenende geopfert hatten.
»Sind Sie schon einmal hier gewesen, Wendall?«, fragte ihn der Mann am polierten Kupfertisch.
Als Clayton sprach, wandte er sich jedoch nicht an ihn, sondern an den Oberkellner des Carleton Hotel. »Gibt es das Nova Spezial?«
»Nein, Mr. Clayton«, antwortete der Oberkellner, den Kopf schüttelnd, »heute nicht.«
»Danke, Henri, dann nehme ich zwei Rühreier mit Speck und ein Croissant.«
»Sehr wohl, Mr. Clayton.«
»Ha!«, platzte es aus John Perelli heraus, bevor er das Gleiche und dazu noch einen Früchtebecher bestellte. Perelli war untersetzt und hatte dunkles Haar und ein langes Gesicht. Er trug einen marineblauen dreiteiligen Anzug mit Nadelstreifen.
Clayton zog seine Manschetten gerade, wobei seine achtzehnkarätigen Wedgwood-Manschettenknöpfe sichtbar wurden, und erklärte: »Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich fühle mich hier wie zu Hause.«
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Clayton gehörte zu den Reichen, die keinen Wert auf protzige Zurschaustellung legten. Er besaß ein Apartment mit acht Zimmern in der oberen Fifth Avenue, ein Sommerhaus in Redding, Connecticut, und ein Blockhaus mit zehn Zimmern in Newport. Außerdem lag in seinem Safe ein Aktienpaket, das an guten Tagen seine drei Millionen Dollar wert war. An den holzgetäfelten Wänden seiner Wohnung in der Upper East Side hingen zwei Picassos, drei Klees, ein Mondrian und ein Magritte. Er hatte seinen Jaguar gegen einen Mercedes-Kombi eingetauscht, weil ihm das Laufgeräusch der britischen Reifen nicht gefiel. Sein Reichtum stammte von der stillen, der viktorianischen Art: Ein Drittel war ererbt, ein Drittel war im Beruf erworben (inklusive der vorsichtigen Investments, zu denen Klienten ihm geraten hatten), und ein Drittel hatte seine Frau mit in die Ehe gebracht.
Wendall Clayton stand nicht allein mit seinem dreisäuligen Vermögen, aber in Midtown war er von einer anderen Art von Besitz umgeben. Hier herrschte das laute Geld, Vermögen, das man mit neuen Dingen aller Art gemacht hatte. Doch es war nicht etwa so, dass die Männer und Frauen, die auf solche Weise zu Reichtum gekommen waren, über gar keinen oder einen schlechteren Geschmack als Clayton verfügten – nein, der Unterschied bestand in den Quellen, aus denen ihr Geld stammte. Sie hatten ihre Vermögen in den Medien, in der Werbebranche, im Showbusiness, mit Warentermingeschäften, windigen Firmenfusionen, aggressiven Firmenübernahmen oder Börsengeschäften gemacht. Ihr Geld kam von anderem Geld, von Verkäufen und Übernahmen, von Immobilien, von Italienern, von Juden, von Japanern.
Claytons Geld hatte Spinnweben, und daher war er, so merkwürdig es klingt, diesen Neureichen suspekt. Je mehr einer respektiert wird, desto weniger wird er akzeptiert, pflegte er in Gedanken sein eigenes Klischee zu zitieren und dabei das Gesicht zu verziehen.
Clayton war in Cornell und in Harvard gewesen, hatte in einem Staatsanwaltsbüro gearbeitet, wie es sich für einen angehenden Anwalt gehörte, war schließlich bei Hubbard, White & Willis aufgestiegen und hatte Geld in eine Geldheirat eingebracht. Er war genauso gut und mächtig wie jeder andere hier im Saal.
Doch obwohl er in einem Restaurant saß, in dem die Bedienung ihn mit Namen anredete, fühlte er sich an diesem Ort keineswegs wie zu Hause. Perelli war der beste Beleg dafür mit seiner Frage, ob Clayton schon einmal hier gewesen sei. Clayton kam sich im Carleton vor wie ein ärmlicher Einwanderer, wie jemand ohne Pass. Das verdross ihn sehr und ließ ihn Zurückhaltung üben.
»Sie möchten also eine Anwaltskanzlei, oder, John?«, fragte er jetzt.
»Ich … wir hätten unter Umständen Interesse daran. Zuerst müssen wir natürlich Ihre Zahlen überprüfen, aber, großer Gott, was möchten Sie denn von mir hören? Gerüchten zufolge sind Ihre Einnahmen niedrig. Sie haben zu viele unnütze Köpfe als Partner. Ihr Prämiensystem ist aufgebläht und zu ausgeklügelt, und die Kanzlei als Ganzes hat zu viel überflüssiges Fett.«
»Darüber hinaus haben wir den treuesten Klientenstamm von allen Kanzleien in der Stadt, unsere Mietverträge laufen noch bis nächstes Jahr, sodass man uns nicht unvermittelt auf die Straße setzen kann, und die Absolventen der besten juristischen Fakultäten streben zu uns. Vier unserer Partner haben bedeutende Handbücher oder Abhandlungen verfasst, und fünf weitere sind für einige Semester beurlaubt, um als außerordentliche Professoren Vorlesungen in Fordham, Columbia und der University of New York zu halten.«
»Sie arbeiten mit einem Computerschreibsystem, das Sie langfristig geleast haben …«
»John!«
»… und das schon seit zwei Jahren veraltet ist.«
»John!«
»Ich höre ja schon zu.«
Clayton übte sich in Geduld. »Wir würden nicht hier sitzen und das Brot miteinander brechen, wenn wir nicht vorhätten, gemeinsame Sache zu machen. Ich meine, die wichtigste Frage ist doch: Wie viel wird die Geschichte Sie kosten und wie viel mich?« Der Kellner brachte ihre Bestellungen. Clayton beugte sich über den Rühreiberg, schnitt alles in kleine, mundgerechte Portionen und aß hungrig.
Perelli wartete, bis der Kellner sich zurückgezogen hatte, und meinte dann: »Sie wollen also sagen, wir sollen uns nicht lange mit Höflichkeitsfloskeln aufhalten? Okay, auf diese Weise betreibt auch meiner Mutter Sohn seine Geschäfte am liebsten. Wir sind ernsthaft interessiert, Wendall. Wir haben Klienten, die aufgrund ihrer Gewinne Ärger mit der Bankenaufsicht erwarten dürfen. Und wir haben außerdem Klienten mit Produkthaftungsproblemen, die sich für uns als wahre Goldgruben erweisen dürften. Sie verfügen über erstklassige Leute für Wirtschaftsrecht und Prozessanwälte, die unserem Team wie gerufen kämen. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir wollen Ihre Bankrechtleute, und Sie wollen unsere Immobilienexperten. Theoretisch sind wir ein perfektes Paar.«
»Und praktisch?«
»Praktisch geht es um überschüssige Ressourcen, schlicht um Ballast. Eine unserer beiden Firmen wird nach einer Zusammenlegung etwas abnehmen müssen. Ich hoffe, es schockiert Sie nicht zu sehr, wenn ich Ihnen sage, dass wir nur ungern einige von unseren Leuten vor die Tür setzen möchten.«
Clayton gab dem Kellner zu verstehen, ihm noch etwas von dem frisch gemahlenen Pfeffer zu bringen. Die beiden Männer warteten, während dieser die große Pfeffermühle drehte und ein angenehm scharfer Geruch von Claytons Teller aufstieg. »Dann schmeißen Sie doch einfach ein paar von unseren raus.«
Perelli lachte, bis ihm aufging, dass sein Gegenüber keinen Scherz gemacht hatte. »Einfach so?«
»Nein, nicht einfach so«, antwortete Clayton. »Ich habe Ihnen die Arbeit bereits abgenommen.« Er reichte Perelli einen Zettel. Dieser las die Liste und sah Clayton dann fragend an.
»Das sind diejenigen«, erklärte der Anwalt und tippte zur Bekräftigung mit dem Zeigefinger auf das Blatt, »die gehen müssen.«
»Aber hier stehen, wie viel … nun, gut und gerne fünfzig Namen.« Perelli las einige vor: »Donald Burdick, Bill Stanley, Woody Crenshaw, Lamar Fredericks, Ralph Dudley … Wendall, diese Männer sind Hubbard, White & Willis. Was Sie mir hier vorlegen, erinnert stark an eine Abschussliste.«
»Stimmt genau.«
»Diese Leute wissen doch sicher, dass sie in Gefahr schweben. Glauben Sie denn, die Partnerversammlung wird sich auf Ihre Seite schlagen? Wie viele Stimmen brauchen Sie, zwei Drittel? Schaffen Sie es denn, eine Mehrheit für die Fusion zusammenzubekommen?«
»Wenn Sie mir garantieren, dass die Personen, die auf dieser Liste stehen, gehen müssen, verschaffe ich Ihnen die Mehrheit. Ich habe …« Er hielt inne und überlegte, wie sehr er sein Gegenüber ins Vertrauen ziehen durfte. »Ich habe einige Vorbereitungen getroffen, um die nötigen Stimmen zu bekommen. Aber ich verlange noch ein paar weitere Zusagen, und zwar einen Sitz in Ihrem Vorstand sowie die Garantie, dass zehn Assistenten meiner Wahl von Hubbard, White & Willis binnen zwei Jahren die Partnerschaft angeboten wird.«
»Zehn? Wendall, wenn wir darauf eingehen, bringt uns das fast zwei Millionen Dollar Verbindlichkeiten!«
»Hören Sie, das sind meine Jungs, und sie haben sich seit acht Jahren für meine Klienten den Arsch aufgerissen. Wenn ein Klient von ihnen verlangt, jemanden fertig zu machen, stellen sie nur zwei Fragen: Erstens, wen? Zweitens, bis wann soll er im Loch sitzen?«
Perelli lachte und warf einen hungrigen Blick auf den klein geschnittenen Speck auf Claytons Teller. Der Anwalt forderte ihn mit einer lässigen Handbewegung auf, sich zu bedienen. Perelli nahm sich mit zwei Fingern ein Stück, schob es sich in den Mund und sagte: »Burdick ist ein Name von einigem Gewicht. Er repräsentiert ein großes Stück von Ihrem Klientenkuchen.«
»Sehen Sie sich seine Klienten und das, was sie der Kanzlei einbringen, doch einmal genauer an. Da ist eine Bank, gut, aber beim Rest handelt es sich um alte Fabriken und ein paar reiche alte Säcke, die zwar einiges auf dem Konto haben, uns aber nur mit Kleinkram beauftragen.«
»Und was ist mit MacMillan Holdings?«
»Was soll mit denen sein?«
»Die bringen tüchtig Geld in die Kasse«, sagte Perelli. »Mehrere Millionen im Jahr, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin …« Er sah Clayton forschend an, um aus seiner Miene eine Bestätigung für diese Information herauszulesen, die eigentlich unter Verschluss gehalten wurde. Als Clayton ihm den Gefallen nicht tat, fuhr er fort: »Und Burdick gehört bei MacMillan doch praktisch zur Familie, oder?«
»Auch Familienmitglieder können sich untereinander entfremden. Kommt sogar ziemlich häufig vor. Außerdem weiß MacMillan, dass Burdick nicht mehr der Jüngste ist. Vermutlich geht man dort schon längst davon aus, dass er sich bald aufs Altenteil zurückziehen wird. Natürlich steckt für uns ein Risiko dahinter, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.«
Perellis Miene verriet, dass ihm jetzt nicht zum Lachen zumute war. »MacMillan … verdammt, ich würde diesen Klienten nur ungern verlieren.«
Während sie ihren Kaffee tranken, erzählten sie sich gegenseitig von den Fällen, an denen sie gerade arbeiteten. Sie umschrieben viel und gebrauchten beschönigende Bezeichnungen, das übliche Gebaren von Anwälten, die sich des Umstands bewusst sind, dass sie das besondere Vertrauensverhältnis zwischen sich und den Klienten schützen müssten. Als sie beide ihre zweite Tasse geleert hatten, wischte Clayton sich Croissantkrümel von der Hose und winkte nach der Rechnung. »Nur einmal so ins Blaue gefragt«, sagte Perelli. »Wenn ich darauf bestehen würde, Burdick zu behalten, wäre die Geschichte dann für Sie gelaufen, oder würden Sie trotzdem weitermachen?«
Clayton unterschrieb die Rechnung, legte aber nicht seine Kreditkarte daneben. Der Kellner eilte herbei, nahm das Papier und verschwand rasch wieder.
»Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen, John. 1971 wurde Burdick von Nixon gebeten, einem neu gegründeten Sonderermittlungsausschuss vorzusitzen, der Missstände in der Stahlindustrie untersuchen sollte.«
»Ein Ausschuss vom Justizministerium?«
»Richtig. Man entschied sich damals für Burdick, weil er sowohl in Washington als auch in der New Yorker Landeshauptstadt Albany bekannt war und sein Wort dort etwas galt. Der damalige Vorstand von Hubbard, White & Willis – das Gremium hieß zu jener Zeit noch schlicht Geschäftsführung – war vor Begeisterung darüber ganz aus dem Häuschen. Jede Menge Publicity für die Kanzlei war zu erwarten, und Burdick würde die Chance erhalten, sich bei einflussreichen Regierungsmitgliedern bekannt und beliebt zu machen. Und nachdem der Ausschuss seine Arbeit beendet hätte, würde Burdick im Triumphzug in die Firma zurückkehren, was neue Publicity und noch mehr Klienten bedeutete. Aber Burdick erklärte dem Vorstand von Hubbard, White & Willis, dass er den Vorsitz beim Sonderausschuss nur unter einer Bedingung antreten würde. Bei seiner Rückkehr sollten er und ein Mann seiner Wahl Sitz und Stimme im Vorstand erhalten. Dafür müssten dann drei andere Partner, deren Namen er auch nannte, ihren Hut nehmen. Nun, John, das war Anfang der Siebziger. Damals haben Kanzleien einen Partner nicht einfach vor die Tür gesetzt. So was galt als zutiefst unanständig, das gehörte sich nicht.«
»Und weiter?«
»Drei Monate später ging ein Rundschreiben durch die Firma, in dem drei bestimmten Teilhabern zu ihrer eigenen Kanzlei gratuliert wurde. Sie hatten sich entschlossen, Hubbard, White & Willis zu verlassen, um sich selbstständig zu machen – zumindest hieß es offiziell so.« Clayton schob seinen Stuhl zurück. »Die Antwort auf Ihre Frage lautet: Unser kleines Abkommen funktioniert nur ohne Burdick und jeden anderen Namen auf der Liste. Das ist Quidproquo. Was sagen Sie jetzt?«
Perelli zog eine Zigarre aus einer Hülse, reichte sie Clayton und nahm sich dann auch eine. Er klappte ein kleines Silbermesser auf und fing an, das Mundstück zu beschneiden. »Ich sage, lassen Sie uns die Bilanzen und anderen Zahlen austauschen und endlich diese verdammte Fusion ins Rollen bringen.«
… Drei
»Es geht um Folgendes: Man hat mich beraubt«, erklärte Mitchell Reece und lehnte sich bequem in seinem schwarzen Ledersessel zurück. Der Mechanismus schnappte mit einem leisen Pling ein.
»Hat man Sie in der U-Bahn überfallen«, fragte Taylor Lockwood, »oder sprechen wir hier über das Finanzamt?«
»Ich spreche von Einbruchdiebstahl«, antwortete Reece mit einem bitteren Lächeln.
Er erhob sich langsam, so als hätte er viel zu lange in derselben Position gesessen, und ging zur Tür, um sie zu schließen. Taylor verschluckte zum x-ten Mal ein Gähnen, das schon seit fünf Minuten hinauswollte, und rieb sich die brennenden Augen. Es war zehn Uhr morgens, und sie wartete darauf, ihren toten Punkt zu überwinden. Vermutlich war er schon längst vergangen, und sie befand sich bereits im nächsten, ohne etwas davon bemerkt zu haben.
Sie wusste über Reece nur, dass er Prozessanwalt war und sein glattes schwarzes Haar für den Geschmack der konservativeren Kanzleipartner eine Idee zu lang trug. Reece war Mitte dreißig und hatte sich auf Wirtschaftsverfahren spezialisiert. Die Klienten liebten ihn, weil er in der Regel seine Fälle gewann. Die Kanzlei liebte ihn, weil seine Erfolge dem Haus fette Schecks einbrachten. »Das einzige Heilmittel für Gesetze sind noch mehr Gesetze«, lautete sein Motto, ein Zitat von Professor Karl Llewellyn, und er arbeitete täglich zwischen fünfzehn und achtzehn Stunden. (Taylor hatte von Kollegen gehört, dass er einmal für einen Arbeitstag sechsundzwanzig Stunden in Rechnung gestellt hatte. Der betreffende Fall hatte ihn nach Los Angeles geführt, und dabei hatte er den Tageszeitgewinn durch die Zeitzonendifferenz genutzt.) Die jüngeren Assistenten bewunderten ihn und taten alles, um für ihn zu arbeiten. Die älteren Partner verspürten oft ein Unbehagen, wenn er ihnen zugeteilt war. Die Notizen und Anträge, die er in ihrem Namen verfasste, gingen oftmals über ihren Horizont. Reece meldete sich auch regelmäßig als Armenanwalt der Kanzlei und vertrat freiwillig Klienten, die sich keinen Anwalt leisten konnten, als Strafverteidiger.
Für die zahlreichen weiblichen Gehilfen war aber viel wesentlicher, dass Reece ein Bild von einem Mann war, bei dem so gut wie jede Frau schwach wurde. Und als wäre das noch nicht genug, war er obendrein unverheiratet – und nicht schwul. Dafür gab es zwar nur einen einzigen mageren Beleg, seine Scheidung, aber die Frauen in der Kanzlei waren durchaus gewillt, das als hinreichenden Beweis anzuerkennen. Man sagte Reece nach, mit mindestens zwei weiblichen Angestellten der Kanzlei eine Affäre gehabt zu haben.
Reece kehrte zu seinem Sessel zurück. Es war ziemlich warm in seinem Büro, und Taylor zog ihr Marinejackett aus. Dann fuhr sie sich mit einer Hand durch die Locken und spürte, wie Reece ihre Figur taxierte, wie sein Blick über ihre weiße Bluse und die Rüschen an ihrem Hals wanderte.
In seinem Büro sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mindestens hundert Aktenmappen, die von Dokumenten überquollen, bedeckten den Boden, die Regalbretter des Schranks und den Schreibtisch. Fachzeitschriften, die darauf warteten, gelesen zu werden, füllten einzeln oder in Stapeln jede freie Fläche zwischen den Aktenbergen aus. Essensgeruch drang in Taylors Nase, und sie entdeckte neben der Tür eine fettige Tüte von einem Schnelldienst, der chinesische Spezialitäten ins Haus lieferte.
Reece goss sich eine Tasse Kaffee ein und drehte sich zu Taylor um. Er trug ein dunkelblaues Hemd mit weißen Ärmeln und weißem Kragen, eine dunkelblaue Hose und schwarze, spitz zulaufende Schuhe. Aber er sah nicht gerade aus wie aus dem Ei gepellt. Unter seinen Augen waren dunkle Schatten, als hätte jemand dort Bleistiftstriche verschmiert, und rote Äderchen zeigten sich auf dem Weiß der Augen. Sein Haar war ungekämmt, und seine Haut war derart blass, dass Taylor sich fragte, ob er überhaupt braun wurde. Plötzlich gähnte er so ausgiebig, dass ihm Tränen in die Augen schossen. Taylor unterdrückte das gleiche Verlangen, das sich wieder bei ihr meldete.
»Was wissen Sie über das Bankenrecht?«, fragte Reece sie.
»Nun, die Bank verlangt für geplatzte Schecks eine Rückscheckgebühr von zehn Dollar.«
»Ist das alles?«
»Ich fürchte, ja.« Sie schwieg einen Moment und fügte dann hinzu: »Aber ich lerne schnell.«
»Das hoffe ich«, entgegnete Reece ernst. »Gut, dann will ich Ihnen Nachhilfe geben. Einer unserer Klienten ist die US-Niederlassung der Banque Industrielle de Genève. Haben Sie mal für die gearbeitet?«
»Nein.« Taylor zog den Stenoblock aus ihrer Handtasche, nahm die Kappe von einem Stift und machte sich zum Mitschreiben bereit.
»Letztes Jahr hat diese Bank einen Kredit über fünfundzwanzig Millionen …«
»Schweizer Franken?«
»Nein, Dollar«, antwortete Reece und fuhr fort, »… an eine hiesige Firma in Midtown, die Hanover & Stiver, Inc. … Was schreiben Sie denn da?«
»Ich mache mir Notizen. Das tue ich immer.«
»Lassen Sie das«, befahl er.
Taylor zögerte einen Moment und legte dann den Block neben sich auf den Boden.
»Hanover & Stiver betreibt Abfallbeseitigung im großen Stil, Giftstoffe werden entfernt und entsorgt. Nun, anscheinend hat die Bank die Firma vor der Kreditvergabe nicht sorgfältig genug überprüft, denn mittlerweile hat sich herausgestellt, dass in der Geschäftsleitung von Hanover & Stiver der reinste Schlendrian herrscht. Von Anfang an haben sie die Raten nur unregelmäßig gezahlt und ständig neue Entschuldigungen vorgebracht. Ihre Kunden und Lieferanten würden ihre Rechnungen nicht begleichen und ähnliches Blabla. Und am Ende haben sie der Banque Genève erklärt: ›Es tut uns furchtbar Leid, aber wir haben nicht das Geld, um den Kredit zurückzuzahlen.‹ Und schon wird der Wechsel fällig.«
»Sie wollen die Bank wechseln?«
Reece bedachte sie mit einem zweifelnden Blick. »Sie haben wirklich keine Ahnung vom Bankenrecht, nicht wahr? Wenn eine Bank Geld verleiht, muss der Kreditnehmer einen Wechsel unterschreiben. Und dieses Papier ist so ähnlich wie ein Scheck.«
»Verstehe. Ein Scheck über fünfundzwanzig Millionen Dollar.«
»Die Banque Genève hat nun beschlossen, Hanover & Stiver zu verklagen, und mir den Fall übertragen. Wenn man jemanden auf Zahlung verklagen will, muss man dem Gericht den Wechsel vorlegen. Und so hat ihn mir die Bank per Boten zugestellt, aber der Gerichtstermin musste um zwei Wochen vertagt werden, weil …«
»… er nicht mehr da war?«, fragte Taylor und war ehrlich schockiert.
»Ja«, antwortete Reece leise. »Man hat ihn mir gestohlen. Jemand ist einfach hier hereinspaziert und hat ihn aus meinem verdammten Aktenschrank genommen.«
»Brauchen Sie denn unbedingt das Original? Reicht es nicht, dem Gericht eine Kopie vorzulegen?«
»Das könnte man natürlich tun, aber dafür steht mir nicht mehr genug Zeit zur Verfügung. Die Finanzen von Hanover & Stiver befinden sich in einem erschreckenden Zustand – deshalb hat die Bank es ja auch so eilig –, und bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich eine Kopie habe beglaubigen lassen und vorlegen kann, haben die Brüder wahrscheinlich keinen Cent mehr.« Seine Stimme klang bitter. Er rieb sich die Augen. »Die Banque Genève ist einer von Donald Burdicks größten Klienten. Wenn sie durch meine Schuld ihr Geld verliert, verlässt sie uns, ohne Auf Wiedersehen zu sagen.«
»Aber es ist doch nicht Ihre Schuld. Wie hätten Sie auch auf den Gedanken kommen sollen, dass jemand in Ihr Büro eindringt und den Wechsel stiehlt?«
»Es ist sehr wohl meine Schuld. Schließlich bin ich nach Hause gefahren, um zu schlafen …« Er schlug mit der Handfläche auf die polierte Tischplatte und lächelte dann verlegen, um Taylor zu zeigen, dass sein Zorn nicht gegen ihr Mitgefühl gerichtet war. »Als ich in die Kanzlei zurückkehrte, war der Wechsel fort.«
»Vielleicht ist er nur verlegt worden«, sagte Taylor und bereute im selben Moment ihre dumme Bemerkung.
Reece deutete kopfschüttelnd auf die tiefe Delle am Schloss seines aufgebrochenen Aktenschranks.
»Haben Sie denn nicht die Polizei gerufen?«
»Nein, natürlich nicht. Die Presse würde auf die Geschichte aufmerksam, Burdick würde mitbekommen, dass der Wechsel fort ist, und der Bank würde das auch nicht lange verborgen bleiben …« Er sah sie direkt an. »Ich denke, Sie ahnen bereits, warum ich Sie hergebeten habe.«
Vage Vermutungen schossen ihr durch den Kopf. »Sie möchten, dass ich herausfinde, wer das Papier gestohlen hat?«
»Um ganz ehrlich zu sein, es wäre mir noch lieber, Sie würden es finden. Im Moment ist es mir egal, wer es entwendet hat.«
»Aber wieso gerade ich?«, fragte sie, um Zeit zu gewinnen. »Ich meine, warum stellen Sie nicht selbst Nachforschungen an?«
Reece lehnte sich in seinem Sessel zurück, und wieder war ein leises Pling zu hören. Er wirkte erleichtert, so als hätte Taylor bereits zugesagt. »Wer immer den Wechsel aus meinem Schrank genommen hat, wird wissen, dass ich mich nicht an die Polizei wenden kann. Und er wird damit rechnen, dass ich nach ihm suche. Also muss ich jemand anderen damit betrauen. Und zwar Sie.«
»Es ist nur so, dass ich …«
»Ich weiß, Sie wollten eigentlich in den Skiurlaub. Tut mir wirklich Leid, aber den werden Sie wohl verschieben müssen.«
»Mitchell, ich weiß nicht so recht. Es schmeichelt mir natürlich sehr, dass Sie ausgerechnet mich angefordert haben, aber ich fürchte, ich bin auf diesem Gebiet nicht gerade die Erfahrenste.«
»Nun, dann will ich Ihnen eines sagen: Ich habe schon mit einer Menge Privatdetektiven gearbeitet, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Aber klar, mit Sam Spade und so weiter.«
»Nein, ein Sam Spade war nie darunter. Doch ich habe bei der Zusammenarbeit mit diesen Leuten eine wertvolle Erfahrung gemacht, und zwar die, dass die besten Detektive Frauen sind. Sie sind unauffälliger, attraktiv und klug. Sie wollen nicht bei jedem Gespräch das große Wort führen, sondern lassen ihr Gegenüber ausreden, während sie selbst sich aufs Zuhören beschränken. Und sie sind sexy … darf ich das sagen?«
»Ich habe nicht vor, Sie aufzuhalten.« Das Erröten geschah von einer Sekunde auf die andere. Sie kam sich wie eine Idiotin vor, so auf eine Bemerkung zu reagieren, die gar nicht als Flirtversuch oder Kompliment gemeint war.
»Eine sexy Frau lenkt Männer ab«, fuhr Reece fort. »Und wenn Sie noch einen Grund hören wollen: Ich vertraue Ihnen.«
»In der ganzen Kanzlei vertrauen Sie niemandem außer mir? Hören Sie, ich habe noch nie für Sie gearbeitet. Und wer sagt Ihnen, dass nicht ich diejenige war, die den Wechsel entwendet hat …« Sie unterbrach ihren Redefluss und fragte dann leise: »Wann ist er denn gestohlen worden?«
Reece grinste. »Am Samstag. Und da haben Sie ein Alibi. Sie waren zu der Zeit nämlich gar nicht in der Stadt.«
»Aber ich bin doch nur eine Anwaltsgehilfin. Ich kopiere Unterlagen, hefte Akten ab und tippe Texte.«
»Und den hausinternen Gerüchten zufolge …«, er legte eine Kunstpause ein, und Taylor sah ihn fragend an, »… sind Sie nicht auf den Kopf gefallen.«
»So, sagt man das über mich?«, entgegnete Taylor, legte die Stirn in Falten und fühlte sich zutiefst geschmeichelt.
»Werden Sie mir helfen?«
Taylor sah zum Fenster hinaus und spürte, wie seine Augen von ihrem Gesicht zu den Brüsten und den Beinen wanderten. Aber diesmal empfand sie nicht wie üblich Widerwillen, sondern eine kurze, angenehme Verkrampfung im Unterleib. Die Sonne verschwand hinter einer dicken Wolke, und der Himmel wurde so dunkel wie sein Spiegelbild auf dem unruhigen Hafenwasser.
»Ich liebe schöne Aussichten«, sagte Taylor. »Von meiner Wohnung aus hat man einen wundervollen Blick auf das Empire State Building. Man muss sich dazu nur ungefähr einen Meter weit aus dem Badezimmerfenster lehnen.«
»Und ich halte Sie jetzt davon ab, den Blick auf die Berggipfel zu genießen.«
»Meistens stehe ich auf dem Gipfel und verfolge, wie der Blue Shield sich aus den Wolken hebt.«
Beide schwiegen einen Moment. Reece fuhr sich mit den Händen durchs Haar und rieb sich dann wieder die Augen. Taylor unterdrückte erneut das Bedürfnis zu gähnen. Die Uhr auf dem Schreibtisch tickte leise.
»Ich werde Ihnen helfen«, sagte Taylor schließlich. »Ich habe zwar keine Ahnung, was ich tun soll, aber ich will es wenigstens versuchen.«
Er beugte sich abrupt vor und hielt mitten in der Bewegung inne. In Kanzleien gibt es ein Keuschheitsgebot. Was auch immer sich in Hotelzimmern oder Apartments abspielte, innerhalb der Kanzleiwände war nicht einmal ein Küsschen auf die Wange gestattet. So beschränkte sich Reece darauf, seine Dankbarkeit dadurch auszudrücken, dass er Taylors Hände in die seinen nahm. Sie spürte eine besondere Spannung oder Hitze zwischen seinen Händen und den ihren.
»Ich schätze, die erste Frage muss lauten: Haben Sie irgendeine Vorstellung, was sich hier abgespielt hat?«, sagte sie und zog ihre Hände unter den seinen hervor.
»Nun, die Bank hat den Boten mit dem Wechsel am Freitag um fünfzehn Uhr losgeschickt …«
Zu der Zeit habe ich mir eine Soap-Opera angeschaut und dabei ein dickes Sandwich mit Truthahnfleisch und Salat verdrückt, dachte sie.
»Gegen sechzehn Uhr habe ich das Papier in meinem Aktenschrank eingeschlossen. Ich habe den ganzen Freitag und Samstag hier gearbeitet. Als ich um zwanzig Uhr Schluss gemacht habe, war es noch an seinem Platz. Doch als ich am Sonntag um neun Uhr morgens wieder hierher kam, war der Wechsel fort.«
»Ist Ihnen am Samstag irgendjemand aufgefallen?«
»Ich habe die ganze Zeit Abschriften studiert. Natürlich waren außer mir noch andere in der Kanzlei, aber ich kann mich nicht mehr an sie erinnern. Und gesprochen habe ich an dem Tag mit niemandem.«
»Wer in der Bank weiß davon, dass das Papier sich in Ihren Händen befindet?«
»Nur der Vizepräsident, der den Kredit bearbeitet und genehmigt hat.«
»Könnte er es gestohlen haben?«
»Das ist mehr als unwahrscheinlich. Wenn die Bank nicht mittels des Wechsels an ihr Geld kommt, ist seine Karriere beendet.«
»Und wie steht es mit Ihrer Sekretärin?«
»Sie ist schon seit zwei Monaten im Mutterschaftsurlaub. Ich lasse alle meine Arbeiten vom Schreibbüro erledigen, bis sie wieder zurück ist.«
»Und wer im Haus ist darüber informiert, dass Sie diesen Fall bearbeiten?«
Reece lachte nur und schob ihr ein Blatt zu.
VON: M. A. Reece
AN: Alle Anwälte von Hubbard, White & Willis
Betr.: INTERESSENKONFLIKT
Ich vertrete unseren Klienten, die Banque Industrielle de Genève, in einer Klage gegen Hanover & Stiver, Inc. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie jemals Hanover & Stiver vertreten oder mit anderen Fällen zu tun haben, in die eine dieser Gesellschaften involviert ist, was zu einem Interessenkonflikt führen und die Interessen unserer Kanzlei berühren könnte.
»Bei diesem Schreiben handelt es sich um unser Standard-Konflikt-Memo. Wir verteilen es im ganzen Haus, um alle Anwälte wissen zu lassen, welche Firmen wir vertreten oder verklagen. Wenn irgendjemand bei Hubbard, White & Willis jemals Hanover & Stiver vertreten hat, muss ich die Sache fallen lassen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, jeder hier im Haus dürfte also Bescheid wissen, dass ich diesen Fall bearbeite. Und man braucht nur im Aktenraum die Kopien meines Schriftverkehrs durchzusehen, um sich ausrechnen zu können, wann der Wechsel in meine Hände gelangt sein dürfte.«
Taylor hielt das Memo mit zwei Fingern. Es ging um fünfundzwanzig Millionen. Sie bemühte sich, auf intelligente und wichtige Fragen zu kommen. »Warum stiehlt jemand ein solches Papier? Kann man es wie einen Scheck einlösen oder seinem Konto gutschreiben?«
»Ich glaube, Hanover & Stiver hat hier im Haus jemanden bestochen, den Wechsel für eine Weile verschwinden zu lassen. Vermutlich so lange, bis die Firma ihren Direktoren und Abteilungsleitern eine hübsche Abfindungssumme überwiesen hat. Und wenn dann die Kasse leer ist, taucht das Papier wie durch ein Wunder wieder auf, und wir dürfen nach Herzenslust klagen. Nur ist dann kein Geld mehr vorhanden, mit dem die Forderungen meines Klienten befriedigt werden können.«
»Das alles hört sich für mich ungeheuerlich an. Ich meine, wann ist in einer Anwaltskanzlei in der Wall Street schon einmal ein so dreister Diebstahl begangen worden?«
»Der Präsident von Hanover & Stiver, Lloyd Hanover, ist ein ausgemachter Dreckskerl, und er glaubt, er sei mit allen Wassern gewaschen. Sie kennen die Sorte bestimmt – Ende fünfzig, Bürstenhaarschnitt und dreimal in der Woche auf die Sonnenbank. Er hat drei Mätressen gleichzeitig und trägt so viele Ringe und Ketten aus purem Gold, dass jeder Metalldetektor einen Kurzschluss bekäme.«
»Das an sich ist aber noch kein Verbrechen«, bemerkte Taylor.
»Nein, das nicht, doch drei nachgewiesene Verstöße gegen Gesetze des Umweltschutzes und zwei rechtskräftige Verurteilungen schon«, entgegnete Reece barsch.
»Oh.«
Reece zog einen Ordner aus seinem Schrank.
»Warum wenden Sie sich nicht direkt an Hanover und nehmen ihn in die Mangel?«, fragte Taylor.
Die Mundwinkel des Anwalts verzogen sich.
Taylor versuchte seiner Antwort zuvorzukommen. »Natürlich würde er alles abstreiten.« Reece nickte, und sie fuhr fort: »Ich habe mir nur gerade überlegt, ob man ihn auf diese Weise nicht dazu bringen könnte, eine Falschaussage zu machen.«
»Taylor, der Staatsanwalt legt bei einer Klage wegen Falschaussage keinen allzu großen Eifer an den Tag, vor allem dann nicht, wenn es um den Bankrott einer Firma geht.«
»Nein, sicher nicht.«
Mädchen, wenn dir nur dumme Fragen einfallen, dann halt lieber den Mund, dachte Reece.