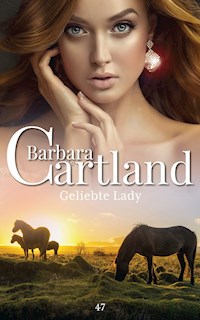Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die zeitlose Romansammlung von Barbara Cartland
- Sprache: Deutsch
Doreen Wallis, Tochter englischer Eltern, wächst in Kairo unter fragwürdigen Umständen auf, da ihre Eltern sich sozusagen - nachdem ihr trunksüchtiger Vater seinen Offiziersdienst beenden musste - durch das Leben durchschummeln müssen und auf die finanzielle Unterstützung anderer angewiesen sind. Doreen lebt von einem Tag in den Tag, und erwirbt sich einen zweifelhaften Ruf bezüglich ihres Umganges mit Männern. Nach gescheiterten Beziehungen - auch einer Ehe von der sie glaubte, dass sie rechtsgültig war, und erst nach dem Ableben ihres reichen Mannes erfuhr, dass er verheiratet war, nach dem Tod der Eltern, und einer sehr schweren Krankheit, will Doreen Ägypten verlassen. Sie will nach England zu ihrer Großmutter Alice Wickham zurückkehren, die sie nur einmal im Leben besucht hatte. Doreen versucht, ihre Cousine Anne Marston, die auf der Durchreise in Kairo ist, dazu zu bewegen, sie nach England und zu der Familie mitzunehmen, da sie die Begegnung mit der Familie fürchtet. Anne und Doreens Mütter waren Zwillingsschwestern – aus diesem Grund sehen sich auch die beiden jungen Damen sehr ähnlich. Während Mary den lebenslustigen Harry Wallis heiratete und in Kairo lebte, heiratete Martha einen angehenden Missionar, mit dem sie in den Sudan zog, um dort eine Mission aufzubauen. Wird Doreen es schaffen, nach England und zurückzukommen und dort von ihrer Familie mit offenen Armen aufgenommen werden? Wird sie dort ihr Glück, Liebe und Zufriedenheit finden, die sie so lange gesucht hat?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
©1981
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
XII
XIII
XVII
XVIII
XXII
XXIII
Hörbücher
Zur Autorin
Weitere Bücher der Reihe
Ein verhängnisvoller Schritt
Barbara Cartland
Barbara Cartland E-Books Ltd.
Vorliegende Ausgabe ©2025
Copyright Cartland Promotions 1981
Gestaltung M-Y Books
www.m-ybooks.co.uk
Ein verhängnisvoller Schritt
©1981
I
Durch die schadhaften Jalousien drang gleißend hell die Sonne und warf bizarre Schattenmuster auf die Wände des Zimmers.
Von der Straße herauf zog der scharfe Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee, in den sich der unverkennbare, für das Eingeborenenviertel von Kairo typische Gestank von Kameldung mischte. Frauen stritten sich keifend. Kinderlachen ertönte, das zornige Geschrei eines Eseltreibers.
Die junge Frau auf dem Bett schien von all dem nichts wahrzunehmen. An die Gerüche und den Lärm der Stadt hatte sie sich gewöhnt. Sie fühlte sich davon weniger belästigt als vom Summen eines Moskitos oder vom Knarren der rostigen Bettfedern, das entstand, sobald sie sich unruhig von einer Seite auf die andere wälzte.
Ihr dünnes Nachthemd klebte in dunklen, feuchten Flecken an ihrem Körper, und mit dem Handrücken wischte sie sich unaufhörlich dicke Schweißperlen von der Stirn.
Nach einer Weile öffnete sie die Augen und starrte zur Zimmerdecke, bis ihr Blick wieder von dem Brief angezogen wurde, der neben ihr auf dem Bett lag. Ihre Hand tastete danach, und sie begann aufs Neue zu lesen, obwohl sie die Sätze längst Wort für Wort auswendig kannte.
Es war ein kurzer Brief, doch sie brauchte lange, bis sie ihn zu Ende gelesen hatte und mit einem Seufzer fallen ließ.
»Was soll ich tun?« murmelte sie. »Was, zum Teufel, soll ich jetzt nur tun?«
Langsam, gegen ihren Willen, füllten sich ihre Augen mit Tränen, die ihr die bleichen Wangen hinunterrannen.
Eine Zeitlang lag sie regungslos, bis sie plötzlich mit einer heftigen Bewegung die Füße aus dem Bett schwang. Sie erhob sich und trat vor den Spiegel über der zerkratzten Kommode.
Zunächst betrachtete sie sich völlig geistesabwesend darin, dann mit wachsender Aufmerksamkeit, die Ellbogen auf die Platte der Kommode gestützt, das Gesicht in beide Hände geschmiegt.
»Was wirst du jetzt anfangen?« fragte sie sich wieder, wobei sich ihre ausgetrockneten Lippen kaum bewegten.
Sie sah die Verzweiflung in ihren Augen und brach in ein freudloses Lachen aus, das in der beklemmenden Dumpfheit der Zimmerluft schnell wieder erstickte.
Ihr Blick wanderte zum Bett zurück. Neben dem Briefblatt lag der Umschlag, in dem ein Bündel Banknoten steckte. Sie nahm die Scheine - zehn an der Zahl - aus dem Kuvert, ließ sie in einer roten Handtasche verschwinden, warf die Tasche aufs Bett und setzte sich daneben.
»Wenn ich mich nur nicht so krank fühlte!« murmelte sie.
Dicke Schweißperlen bildeten sich erneut auf ihrer Stirn. Das Umhergehen im Zimmer hatte sie erschöpft.
Diesmal fuhr sie sich mit dem Ärmel des Nachthemdes übers Gesicht. Dann überkam sie ein jäher Schwächeanfall, und sie ließ sich in die Kissen zurücksinken.
In Kairo grassierte in diesem Sommer das Denguefieber, dessen Nachwehen in starken Depressionen und großer körperlicher Abgeschlagenheit bestanden. Doreen Wallis hatte sich zunächst gegen das Fieber, die Übelkeit und das Schwindelgefühl, wovon sie mit jäher Gewalt erfasst worden war, zur Wehr gesetzt.
Doch schließlich musste sie den Kampf aufgeben. Die Krankheit hatte sie besiegt wie alle anderen. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, zu schwach, um dagegen zu protestieren.
Zehn Tage später entließ man sie wieder. Geheilt zwar, doch mit der strengen Anweisung der Ärzte, so viel wie möglich zu ruhen und vor allem in der ersten Zeit das Bett nicht zu verlassen.
Sie hatte nur zu gerne gehorcht, obwohl die strenge Bettruhe lange Stunden der Einsamkeit in billigen Unterkünften und den Verzicht auf geregelte Mahlzeiten bedeutete, denn oft vergaß das Personal, ihr das Essen, das sie bestellt hatte, aufs Zimmer zu bringen.
Erst vier oder fünf Tage nach ihrer Entlassung aus dem Hospital fand sie die Kraft, Tony zu schreiben.
Sie hatte so viel von ihm erwartet wieviel, wagte sie jetzt nicht einmal sich selbst einzugestehen.
Abend für Abend hatte er sie zum Dinner ausgeführt und mit ihr in den elegantesten und teuersten Lokalen von Kairo getanzt; sie hatte ihm beim Polospiel im Gezira Club zugeschaut, hatte seinen Wagen benützt, als wäre es ihr eigener.
Sie war sicher gewesen, dass er sie liebte. Sicher auch, dass das, was sie für ihn empfand, ein sehr tiefes Gefühl war, wenn auch nicht direkt Liebe. Tony zu mögen war nicht schwierig, denn er war jung, unkompliziert, reich und zudem sehr unterhaltsam.
Sie hatte einen Mann mit diesen Eigenschaften gebraucht und war in ihrem tiefsten Inneren von einer fast unterwürfigen Dankbarkeit ihm gegenüber gewesen.
Jeden Tag hatte sie damit gerechnet, dass Tony ihr einen Heiratsantrag machen würde.
Oft genug glaubte sie zu wissen, dass die Worte ihm bereits auf der Zunge lagen, und sie spürte, wie alles in ihr sich spannte, bereit, seinen Antrag anzunehmen. Gleichzeitig jedoch war sie entschlossen, sich einen letzten Rest von Stolz zu bewahren und ihre Einwilligung nichts zu hastig und übereilt zu geben.
Es war nicht leicht gewesen, ihre Erregung und Ungeduld zu zügeln, denn sie wollte die Heirat unter allen Umständen wollte sie mehr, als sie Tony wollte.
Nur eine Heirat konnte ihr Sicherheit bringen Schutz und Sicherheit vor der Vergangenheit, die sie auf Schritt und Tritt bedrohte.
Sie hatte in ständiger Angst gelebt, Tonys Freunde könnten mehr über sie wissen als er. Es war nicht einfach, in Kairo der Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu entgehen, wenn jemand so bekannt war wie sie.
»Das ist Doreen Wallis!«
Wie oft hatte sie diese Worte schon gehört, wenn sie ein Restaurant betrat oder zwischen den zum Tee gedeckten Tischen auf der Marmorterrasse des Gezira Clubs einherging.
Sie wusste, was man sich hinter vorgehaltener Hand über sie zuflüsterte, wusste, wie man hinter ihr herstarrte, den Blick voller Neugier, Ressentiment oder Missbilligung.
Sie hatte versucht, sich den Anschein zu geben, als machte es ihr nichts aus, was man von ihr dachte. Hocherhobenen Hauptes, das Kinn gereckt, war sie mitten durch die Menschenmenge geschritten. Mit ungeschickten Fingern hatte sie sich geschminkt, Lippenstift und Wimperntusche benutzt, als wären es Waffen, mit denen sie sich gegen eine Welt verteidigen konnte, von der sie verurteilt und abgelehnt wurde.
Oft genug hatten die leisen Stimmen und forschenden Blicke sie in einen Trotz reagieren ließ hineingetrieben.
Es kam vor, dass sie mit einem einfachen, anständigen Mann einen netten Abend verbrachte und sich plötzlich mitten auf der Tanzfläche wie eine Kurtisane in seine Arme drängte, nur weil sie die Bemerkungen, die andere Paare vermeintlich über sie gemacht hatten, nicht mehr ertragen zu können glaubte.
Ich werde ihnen den gewünschten Gesprächsstoff über mich liefern, dachte sie bei solchen Gelegenheiten voller Zorn. Doch wenn sie nachher allein war, hatte sie sich geschämt und erkannt, wie töricht sie sich wieder einmal genommen hatte.
Töricht, weil sie im Grunde stets die Verliererin war. Die anderen, die Achtbaren, Ehrenwerten, die alles besaßen, was sie nie besessen hatte und auch niemals besitzen würde, waren wie üblich die Gewinner gewesen.
Auch diesmal hatte sie verloren.
Die Klatschmäuler die Lauscher und Schnüffler von Kairo hatten ihr Tony weggenommen.
Sie konnte sich vorstellen, wie sie sich auf ihn gestürzt hatten, nachdem sie krank und ihr Einfluss auf ihn schwächer geworden war. Erbarmungslos hatten sie dafür gesorgt, dass er reumütig in die Arme der Gesellschaft zurückkehrte, aus denen er sich unter ihrem Einfluss befreit hatte.
Sie würden ihn vor ihr gewarnt, ihm all die Dinge erzählt haben, die er nie hatte erfahren sollen. Dinge, auf die er nie geachtet hätte, wäre sie bei ihm gewesen.
Stöhnend rollte sich Doreen auf die Seite, presste das Gesicht in die Kissen, während sie hemmungslos zu schluchzen begann.
»Er liebt mich, er liebt mich«, flüsterte sie.
Und sie selbst war so nahe daran gewesen, ihn ebenfalls zu lieben.
Wie wundervoll war es gewesen, einen netten jungen Engländer kennenzulernen nach all den Fremden, mit denen sie in den letzten Jahren in Verbindung gekommen war.
Er war ihr erschienen wie ein Mensch von einem anderen Stern mit seiner hellen Haut, seinen blauen Augen und dem gepflegten Äußeren.
Er war so nett, so liebenswürdig. Doch nun war er fort.
Sie würde ihn nie wiedersehen. Nie wieder den Klang seiner jungen Stimme hören, die ihren Namen rief. Nie mehr seinen Arm um ihre Schulter spüren oder die Berührung seiner Lippen auf den ihren.
»Du bist wundervoll«, hatte er an dem Abend, als er sie das erste Mal küsste, zu ihr gesagt.
Nichtssagende Worte, doch die Heiserkeit in seiner Stimme hatte Bände gesprochen. Und sie hatte gewusst, dass sie ihn wollte. Um seiner selbst willen ebenso wie um der Dinge willen, die er ihr bieten konnte.
Sie hatte Angst verspürt bei dem Gedanken, wie schlecht ihre Chancen standen.
Er war drei Jahre jünger als sie, doch das war nicht so tragisch. Schließlich war neunundzwanzig kein Alter in einer Zeit, wo Frauen von vierzig und fünfzig gefeierte Schönheiten wären.
Aber sie war Jahre, wenn nicht Jahrhunderte älter als er, was ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen betraf. Sohn reicher Eltern, verwöhnt und verhätschelt von seiner Mutter, war er nach Kairo gekommen, um dort seine Ferien zu verleben.
»Ich möchte die Welt sehen«, hatte er voller Naivität zu Doreen gesagt und war erstaunt, als sie ihm antwortete: »Hoffentlich bist du nicht enttäuscht von dem Ausschnitt, der sich dir hier bietet!«
Aber es kam zu keiner Enttäuschung für ihn. Die Schattenseiten des Lebens in der Stadt blieben ihm erspart. Für ihn gab es nur Sonne die Atmosphäre unberührter Heiterkeit, die Gastfreundschaft der englischen Kolonie, Vergnügungen und Amüsements vom Morgen bis zum Abend.
Das Kairo der Armut, des Elends und der Hoffnungslosigkeit bekam er nicht zu sehen. Und sie, Doreen, tat alles, um ihn davon fernzuhalten.
Im Gegenteil, sie hielt sich eng an Tony, ergriff mit beiden Händen alles, was die Götter ihr schickten, tat alles, um Tonys Erlebnisreise zu einem Erfolg zu machen.
Sie wusste, wenn ihr das gelänge, war das von Vorteil, für sie. Wenn es allerdings ein Fehlschlag wurde, würde sie alles verlieren.
Zusammen sahen sie die Pyramiden, die Moscheen und die erst jüngst freigelegten Königsgräber. Zusammen tanzten sie in den glitzernden Ballsälen der großen Hotels oder im Mondschein unter freiem Himmel in den überfüllten Tanzgärten.
Gemeinsam erforschten sie den Basar, entdeckten im Labyrinth seiner Gassen die herrlichsten Geschäfte, wo sie nicht nur Geschenke für Tonys Familie in England fanden, sondern auch für Doreen. Ein persisches Armband, eine Halskette aus geschnitztem Elfenbein, einen Gürtel, den ungeschliffene Türkise verzierten.
Nun waren dies die einzigen Dinge, die ihr von Tony blieben. Sie und die ägyptischen Pfundnoten, die neben ihr auf dem Bett lagen.
Damit du dir etwas kaufen kannst, das dich an die schöne Zeit erinnert, die wir zusammen hatten.
So stand es in seinem Brief, und er hätte keine Worte finden können, die verletzender gewesen wären.
Zehn Pfund, um eine Hoffnung zu beenden, an die sie sich so verzweifelt geklammert hatte. Zehn Pfund, um ein Kapitel abzuschließen, das so vielversprechend begonnen hatte.
Wie gut konnte sie sich das Gerede derer vorstellen, die glaubten, ihn vor ihr gerettet zu haben.
»Wäre doch schade um den netten Kerl gewesen, wenn er sich hätte von ihr einfangen lassen.«
Oder:
»Ende gut, alles gut - es hätte schlimmer für ihn kommen können!«
Dabei war Doreen am letzten Tag vor ihrer Krankheit so sicher gewesen, dass alles gut werden würde.
Beim Abschied, lange nach Mitternacht, hatte er sie fest an sich gepresst und geflüstert:
»Wäre es nicht wundervoll, wenn du jetzt nicht zu gehen, mich nicht zu verlassen brauchtest?«
Ihr Herz hatte wild zu schlagen begonnen, und sie hatte ihm nicht zu antworten vermocht.
Schließlich hatte sie gesagt:
»Oh ja, Tony, das wäre es!«
Atemlos hatte sie darauf gewartet, dass er weitersprechen würde, aber er hatte sie nur noch einmal geküsst und ihr dann aus dem Wagen geholfen.
»Wie kann ich ihn nur dazu bringen, mich zu fragen?« hatte sie überlegt, während sie ruhelos in ihrem Zimmer auf und ab gewandert war. Erst eine Stunde später war sie zu Bett gegangen, ohne Schlaf zu finden und ohne dass ihre Gedanken zur Ruhe kamen.
Morgen ist auch noch ein Tag, hatte sie sich schließlich getröstet und war erst in der Frühdämmerung in einen unruhigen Schlaf gefallen.
Es war ein Irrtum gewesen. Das Schicksal hatte erneut zugeschlagen, und ihr blieb keine andere Wahl, als sich in das Unvermeidliche zu fügen.
Das Geld, das Tony ihr geschickt hatte, musste sie nehmen, obwohl sie nichts lieber getan hätte, als es ihm zurückzuschicken.
Sie brauchte dieses Geld dringend, und überdies befand sich Tony nicht mehr in Kairo. Er war schon auf dem Weg nach England. Zurück in den Schoß seiner Familie, zurück zu den netten, wohlerzogenen Mädchen, die keine Ahnung hatten von der Härte des Daseins, von dem, was Armut, Einsamkeit und Verzweiflung aus einem Menschen machen konnten.
Auch sie konnte sich kaum noch daran erinnern, obwohl erst ein knapper Monat vergangen war, seit Tony in ihr Leben trat und sie sich der trügerischen Hoffnung hingab, im letzten Augenblick vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt worden zu sein.
Ihr Leben war nie leicht, nie unkompliziert gewesen, aber mit Pepis Tod hatte sich die Katastrophe angekündigt.
Sein Verlust hatte sie hart getroffen, aber noch schmerzvoller waren die Entdeckungen, die sich damit verbanden.
Und die Hölle hatte sich vor ihr aufgetan, als sie feststellen musste, dass diese Entdeckungen anderen Leuten schon lange bekannt gewesen waren.
Ihr erster Impuls nach Pepis Tod war gewesen, mit niemandem über die Dinge zu sprechen, die sich ihr plötzlich enthüllten, die Welt weiter einer gnädigen Unwissenheit zu überlassen.
Aber irgendjemand, sie wusste nicht mehr, wer hatte die Geschichte genauso rasch erfahren wie sie, und die Kunde hatte sich in Kairo ausgebreitet mit der Geschwindigkeit eines Waldbrandes.
Bereits bei ihrem ersten Auftreten in der Öffentlichkeit nach Pepis Tod hatte sie die Feststellung gemacht, dass das Geheimnis, das sie so sorgfältig zu hüten versuchte, gar keins mehr war.
Verstohlene Seitenblicke, Tuscheln hinter ihrem Rücken und die demütigende Erfahrung, von Leuten geschnitten zu werden, die noch vor wenigen Wochen über eine Einladung von ihr entzückt gewesen waren, hatten ihr die Augen geöffnet.
Niemand wollte mehr etwas von ihr wissen. Und die Erkenntnis war niederschmetternd, dass es ihr in den vier Jahren, die sie mit Pepi verheiratet gewesen war, nicht gelungen war, auch nur einen zuverlässigen Freund zu finden, an den sie sich nun wenden konnte, damit er ihr mit Rat und Tat zur Seite stand.
Wenn sie die Reihe ihrer Bekannten durchging, auf der Suche nach jemandem, dem sie vertrauen oder den sie um Hilfe bitten konnte, musste sie zugeben, dass sie die wahre Lage der Dinge längst hätte voraussehen müssen.
Alle schienen es gewusst zu haben.
Sie war die Einzige, die von dem Betrug keine Ahnung gehabt hatte.
Wie naiv und blind sie gewesen war!
Aber sie hatte sich eben um nichts gekümmert, alle Dinge Pepi überlassen. Es hatte ihr genügt endlich in Sicherheit zu sein, nach all den Jahren der Heimatlosigkeit. Pepi war der rettende Hafen für sie gewesen, ihr Schutz und ihr Halt. Obwohl er dem Alter nach ihr Vater hätte sein können, hatte sie sich nie unglücklich gefühlt als seine Frau.
»Wie hätte ich das auch wissen sollen?« fragte sie sich nach seinem Tod immer wieder verbittert und zornig zugleich.
Und während sie Pepi innerlich Vorwürfe machte, verachtete sie sich selbst wegen ihrer eigenen Leichtgläubigkeit.
Auch das Verhalten ihrer Eltern wurde ihr im Nachhinein immer unverständlicher. Hatten sie wirklich an Pepis Glaubwürdigkeit niemals Zweifel gehabt?
Vermutlich nicht. Sie waren einfach zu erleichtert über die Heirat ihrer Tochter mit ihm gewesen. Sowie er am Horizont auftauchte, hatten sie alles getan, damit diese Heirat zustande kam.
Und sie, Doreen, war mit den Bemühungen der Eltern einverstanden gewesen. Nie hatte es eine bereitwilligere Braut gegeben.
Der Altersunterschied von fünfunddreißig Jahren war zur Bedeutungslosigkeit zusammengeschrumpft angesichts der Tatsache, dass Pepi Geld hatte und heiratswillig war.
Nur das war es, was zählte, nach all den Jahren des ruhelosen Umherziehens, des Wohnens in drittklassigen Hotels, des Umgangs mit Menschen ohne Klasse und des Zusammenlebens mit einer ewig missmutigen, jammernden Mutter und einem ewig betrunkenen, nur im Rausch gutgelaunten Vater.
Pepi war ihr erschienen wie ein Geschenk des Himmels, obwohl er nicht aus der Gesellschaftsschicht kam, der anzugehören sich ihre Mutter bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit brüstete.
Aber was. half ihnen ihre adlige Herkunft, wenn sie lebten wie die Habenichtse, wenn sie ständig die Hotelunterkunft wechselten, weil sie die Zimmermiete nicht zahlen konnten, wenn sie ihre Gläubiger mit faustdicken Lügen hinhalten mussten, wenn ihnen auch die schäbigste Gesellschaft recht war, weil sie sich davon eine kostenlose Mahlzeit versprachen?
Nein, rückblickend schien es keinen Zweifel daran zu geben, dass ihre Eltern Pepi gegenüber ohne Verdacht gewesen waren. Sie hatten geglaubt, dass er das war, was zu sein er behauptete.
Sie selbst dagegen hätte skeptisch sein müssen angesichts seiner ständigen Heimlichtuerei, die er damit erklärt hatte, dass ein älterer Mann, der ein junges Mädchen heiratete, stets eine beliebte Zielscheibe für den Spott der Öffentlichkeit und der Zeitungen sei.
Es hätte zum Beispiel ihren Verdacht erregen müssen, dass kein einziges Mitglied der griechischen Kolonie in Kairo jemals einen Besuch bei ihnen machte, nachdem sie in ihr neues Heim eingezogen waren.
Es hatte Hunderte von Hinweisen und Zeichen gegeben, die sie hätten misstrauisch machen müssen. Stattdessen verschloss sie die Augen vor der Wirklichkeit und lebte in paradiesischer Sorglosigkeit bis zum Tag der Testamentseröffnung, an dem sie erfuhr, dass sie in den Augen des Gesetzes keinen gesellschaftlichen Status besaß.
Pepi hatte in Bigamie mit ihr gelebt. Er besaß in Athen eine Frau und zwei erwachsene Söhne. Sie waren seine rechtmäßigen Erben sonst niemand.
II
Wenn Dorren ihr Leben überschaute, konnte sie es in bestimmte Zeitspannen einteilen, die stets von schockierenden Enthüllungen beendet wurden.
Mit einer Deutlichkeit, als wäre es gestern gewesen, erinnerte sie sich an jenen Zeitpunkt, da sie entdeckt hatte, dass ihr Vater trank, haltlos und ohne Maß.
Sie war noch ein Kind gewesen, aber sie konnte sich an den Ekel und das Entsetzen erinnern, das sie empfunden hatte beim Klang seiner lallenden Stimme, dem Geräusch seiner stolpernden Schritte und dem tränenreichen Lamento der Mutter.
Die Finger in den Ohren, war sie die Treppe hinauf in ihr Zimmer gerannt, hatte sich aufs Bett geworfen, das Gesicht in die Kissen gepresst, in dem sinnlosen Bemühen, einer Welt zu entfliehen, die sich jäh und unerwartet in eine Hölle verwandelt hatte.
Doch mit der Zeit hatte sie sich an das Laster ihres Vaters gewöhnt.
Sie wurde immun gegen die hässlichen Szenen, die sich täglich zu Hause abspielten. Ungerührt half sie beim Säubern seines Zimmers, nachdem die Dienerschaft sie verlassen hatte, und ungerührt ließ sie den ständigen Wohnungswechsel über sich ergehen.
Sie gewöhnte sich an die Armut, die Dauergast in ihrer Familie geworden war, an die erbärmlichen Lebensbedingungen, unter denen sie dahinvegetierten, Und an das ewige Jammern der Mutter.
Oft dachte Doreen, dass der Vater noch leichter zu ertragen wäre als die Mutter. Denn in neun von zehn Fällen war er trotz seiner Trunkenheit freundlich und gutmütig, während die Mutter ihre Umgebung unter ihrer Übellaunigkeit und Enttäuschung ständig leiden ließ.
Es kam allerdings auch immer wieder vor, dass ihr Vater reizbar und streitsüchtig wurde, und diese gelegentliche Neigung zu Jähzorn und Starrsinn war es, die sie alle so tief ins Unglück gestürzt hatte.
In einem Ausbruch unkontrollierter Wut hatte er seinen vorgesetzten Offizier geschlagen und war daraufhin unehrenhaft aus der Armee entlassen worden.
Bei seiner Heirat war Henry Wallis ein schmucker, hochgesinnter, junger Offizier gewesen, und es hatte niemanden verwundert, dass sich Mary Wickham unsterblich in ihn verliebte.
Schwierigkeiten gab es erst, als sie beschloss, den jungen Mann zu heiraten. Der Widerstand kam vor allem aus ihrer Familie, die sich für Mary eine standesgemäße Partie vorgestellt hatte oder zumindest eine mit größeren finanziellen Vorzügen. Aber Mary setzte ihren Willen durch. Die Trauung fand statt, bevor Henrys Regiment nach Indien eingeschifft wurde.
In ihrer Jugend war Mary Wickham eine wirkliche Schönheit gewesen. Als sie starb, war sie eine verwelkte, frühzeitig gealterte Frau, der die Unzufriedenheit und Verbitterung mit tiefen Linien ins Gesicht geschrieben stand.
Ihre Ehe war von Anfang an unglücklich gewesen eine große Enttäuschung, wie sie schon bald ernüchtert feststellte.
Sie hatte Indien gehasst. Das Leben dort war ihr vom ersten Augenblick an eine Qual gewesen. Der Zusammenbruch und das endgültige Desaster ihres Lebens jedoch waren erfolgt, während Henry seine letzten Dienstjahre im Ausland auf ägyptischem Boden absolvierte.
Ihr Mann trank bereits seit längerer Zeit.
Mary war nicht imstande gewesen, ihn davor zu bewahren. Denn immer, wenn sie es versuchte, ärgerlich oder tränenüberströmt, lachte er nur, gab ihr einen flüchtigen Kuss und verschwand zu seinen Kameraden, in deren Gesellschaft er sich am wohlsten fühlte.
Henry Wallis selbst war sehr zufrieden mit seinem Leben.
Er mochte das Gefühl der Kameradschaft, das er im Offizierschor seines Regimentes fand. Er mochte dieses Dasein, das weder an seine Verantwortung noch an seinen Unternehmungsgeist irgendwelche Ansprüche stellte. Geselligkeit bedeutete ihm alles, und hier bekam er sie zum Selbstkostenpreis sozusagen.
Er war ein charakterschwacher Mann und erstaunlich ungebildet. Er las niemals ein Buch und warf nur selten einen Blick in eine Zeitung.
Seine Offizierspflichten verrichtete er mechanisch, und Anstrengungen akzeptierte er nur während seiner Vergnügungen. Er mied jede Form der Verantwortung, ging allem, was nach Leistung aussah, aus dem Weg und engagierte sich nur bei den Zusammenkünften im Club oder Offizierskasino.
Sein Regiment galt nicht als besonders traditionsreich oder ruhmvoll. Die meisten seiner Offizierskameraden waren ohne Ehrgeiz wie er selbst.
Deshalb hatte es die Wirkung einer mittleren Katastrophe, als der Colonel aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in den Ruhestand trat und durch einen Mann ersetzt wurde, der es gewohnt war, an seine Offiziere und Soldaten hohe Anforderungen zu stellen.
Er hatte sich aus dem Mannschaftsstand hochgedient und wurde von Henry und seinen Kameraden sofort als Streber abgestempelt. Keiner von ihnen vermochte zu erkennen, dass der neue Kommandeur ein ungewöhnlicher Mann mit ungewöhnlichen Fähigkeiten war, wie es bald die Zeit zeigen sollte.
Er stieg auf der Karriereleiter Sprosse um Sprosse, und es war wie eine Ironie des Schicksals das selten einmal ein effektvolles Zusammentreffen auslässt -, dass genau in der Woche, in der Henry Wallis starb, die Zeitungen vom Aufstieg seines ehemaligen Regimentskommandeurs in eine der führenden Positionen der britischen Armee berichteten.
Henry und seine Freunde hätten ihm einen solch schwindelerregenden Aufstieg in der militärischen Hierarchie niemals zugetraut. Für sie war er stets nur ein Mann gewesen, der nicht einmal eine höhere Schule besucht hatte.
Es war jene gefährliche Mischung aus gesellschaftlichem Dünkel und persönlichem Unterlegenheitsgefühl, die Henry seinem neuen Vorgesetzten gegenüber genau die falsche Einstellung einnehmen ließ.
Die Konfrontation zwischen den beiden Männern war unausweichlich.
In der ersten Woche unternahm der Colonel nichts. Er beobachtete nur, was um ihn herum vorging, aus scharfen Augen, denen nicht die kleinste Kleinigkeit zu entgehen schien.
Dann, nachdem er sich über sein neues Wirkungsfeld Klarheit verschafft hatte, griff er durch.
Die Disziplin der Truppe wurde verschärft, die strikte Einhaltung aller militärischen Regeln zum obersten Grundsatz erhoben. Von einem Tag auf den anderen hörte der Schlendrian auf. Mit Dingen, die man jahrelang hatte schleifen lassen, wurde schlagartig aufgeräumt.
Die Wirkung auf das Regiment war verblüffend, die Wirkung auf viele der Offiziere katastrophal.
Doch am härtesten traf es Henry.
Bisher hatte er es verstanden, sich mehr oder weniger überall durchzuschummeln, nur das zu tun, was unbedingt von ihm verlangt wurde. Er hatte ein Schmarotzerdasein geführt und konsequent auf Kosten anderer gelebt.
Das war nun vorbei. Sich umstellen konnte er nicht. Er reagierte auf die völlig neue Situation mit Angst und Verärgerung. Er hasste den Colonel mit der Boshaftigkeit und Hinterhältigkeit eines Feiglings, der zu schwach ist, die offene Auseinandersetzung mit jemandem zu suchen, der stärker ist als er.
Er intrigierte gegen seinen Vorgesetzten, versuchte ihn lächerlich zu machen, erzählte alle möglichen Lügen über ihn. Er trank auf dessen Scheitern, so oft er ein Glas in den Händen hielt und das war oft genug.
Eines Tages kam es zum Eklat. Henry hatte einen seiner Freunde mit ins Kasino gebracht, einen Mann, dessen Ruf zu schlecht war, um ihn ignorieren zu können. Der Colonel schnitt ihn, und Henry nahm es ihm übel.
Doch seine Verärgerung zeigte sich zunächst nur darin, dass er noch mehr trank als gewöhnlich. Nach Beendigung des Dinners stand er schwankend auf und verlangte von seinem vorgesetzten Offizier eine Erklärung.
Mit einer Handbewegung bedeutete ihm der Colonel, der die Messe verlassen wollte, ihn vorbeizulassen. Henry schoss das Blut in den Kopf, und in einem Anfall von Unerschrockenheit, die er in seinen nüchternen Momenten noch nie gekannt hatte, stürzte er sich mit einem Wutschrei auf seinen Vorgesetzten.
Er schlug ihm die Faust ins Gesicht und drosch besinnungslos auf ihn ein. Bevor die umstehenden Offiziere sich von ihrem Schreck erholt hatten, lag der Colonel blutend am Boden.
Der Vorfall hatte natürlich ein Nachspiel vor dem Kriegsgericht. Henry wurde aus dem Dienst entlassen.
Zuerst konnte er das Geschehene nicht fassen. Doch dann ging ihm auf einmal auf, dass er ein freier Mann war, und es dauerte nicht lange, bis er sich gefangen hatte und wieder der alte war.
»Es wird schon weitergehen«, sagte er zu seiner Frau. Aber unglücklicherweise irrte er sich.
Ihre Hauptsorge war natürlich das Geld, und die sollte sie von dem Tag an, da seine militärische Laufbahn zu Ende gegangen war, nie wieder verlassen.
Henry verfügte über ein jährliches Einkommen von hundertfünfzig Pfund, das seine Mutter ihm hinterlassen hatte. Mary erhielt weitere hundert Pfund jährlich aus einer Art Treuhandvermögen, das ihr Großvater für sie angelegt hatte. Nach ihrem Tod allerdings sollten diese Zahlungen nicht an ihre Hinterbliebenen gehen, sondern an irgendeine obskure wohltätige Einrichtung im Osten Londons.
Zweihundertfünfzig Pfund im Jahr und ein kleines Kind, das zu versorgen war, große Sprünge konnten sie unter diesen Umständen nicht machen. Vor allem nicht, als sie beschlossen, in Kairo zu bleiben, einer Stadt, in der einem das Geld buchstäblich wie Sand durch die Finger rann.
Es war Marys Schuld, dass sie nicht nach England zurückkehrten.
Sie schämte sich zutiefst wegen des Vorfalls, machte mehr Aufhebens davon als nötig und übertrug die eigenen Gefühle und Ängste in einem derartigen Ausmaß auf ihren Mann, dass dieser die Schmach eines Wiedersehens mit seinen Freunden und Verwandten schließlich ebenso fürchtete wie sie.
»Du wirst hier etwas finden!« sagte Mary zu ihm. »Du glaubst nicht, wie froh manche Leute sind, einen Engländer einzustellen.«
Am Anfang unternahm Henry einige Versuche, Arbeit zu finden, doch als diese fehlschlugen, gab er bald auf. Er betätigte sieh als Tippgeber bei Rennwetten, wurde zum Stammgast der verschiedensten Bars und zum Dauerbesucher der Rennbahn.
In Kairo gab es stets Ausländer, die sich ausnehmen ließen, Touristen, die glücklich waren, einen netten Burschen zu finden, der sich in der Stadt auskannte und dem sie gern etwas für seine Dienste zusteckten.
Henry war hundertmal im Jahr abgebrannt, aber irgendwie blieben sie am Leben, auch in den schlimmsten Zeiten drei Menschen in der teuersten Stadt der Welt, ohne Halt, ohne festes zuhause und ohne jede Vorstellung, wie lange es so noch weitergehen sollte.
Henry fand das neue Leben zweifellos angenehm. Vor allem von dem Augenblick an, da er die weltmännische Atmosphäre der großen Bars kennenlernte.
Mary brauchte einige Zeit, bis sie so weit war, sich ihm anzuschließen. Doch es dauerte eigentlich nicht lange, und ihr wurde klar, dass sie nur zwei Möglichkeiten hatte. Entweder sie ging mit Henry aus, oder sie blieb mit ihrem Kind allein in der schäbigen Absteige, in der sie oft genüg die einzigen weißen Gäste waren.
Sie kam zu dem Entschluss, dass die unangenehmen Dinge nicht an ihr allein hängen bleiben sollten, und ging mit, wenn Henry loszog.
Da es bei diesen Exkursionen notwendig war, Wert auf ihr Äußeres zu legen, verschlangen die Ausgaben für Kleidung einen großen Teil ihrer festen Einkünfte. Der eigentliche Leidtragende in dieser trostlosen Situation war das Kind Doreen.
Henry und Mary dagegen verlebten eine ungewöhnlich vergnügliche Zeit, nachdem sie damit begonnen hatten, als Team loszuziehen. Schließlich waren sie noch verhältnismäßig jung, waren nicht dumm und hatten die nötigen Umgangsformen.
Es gab immer Leute, die bereit waren, für sie zu zahlen, weil sie in ihnen zwei recht angenehme Gesellschafter fanden, die für jeden Spaß zu haben waren.
So war das Leben für Henry und Mary eine Zeitlang ein einziges ausgelassenes Fest, bestehend aus Champagner-Partys, Picknicks, Besuchen auf dem Rennplatz, Ausflügen und Bällen. Doreen blieb in der Obhut eines Eingeborenenmädchens zurück, das kaum älter war als sie und das für die Handvoll lumpiger Piaster, die es bekam, so wenig wie möglich tat und oft genug sogar vergaß, dem Kind sein Essen zu geben.
Vielleicht hätte Doreen nie erfahren, wie sehr sich ihr Leben vom Leben eines gewöhnlichen Mädchens ihres Alters unterschied, hätte Henry nicht in einem Augenblick unerwarteten Reichtums beschlossen, sie für drei Monate zu ihrer Großmutter nach England zu schicken.
Doreen war damals zehn gewesen, und die Vorstellung eines Besuches im Heimatland ihrer Eltern hatte sie entsetzt. Sie hatte gebettelt und gefleht, sie in Kairo zu lassen. Aber vergeblich. Vater und Mutter hatten nicht nachgegeben. Es sei gut für sie, eines Tages werde sie das einsehen.
Ihr plötzliches Interesse am Wohlergehen ihrer Tochter war jedoch nicht selbstlos gewesen. Ein reicher Amerikaner hatte ihnen angeboten, sie in seinem Boot den Nil hinauf mitzunehmen - eine Reise, die mehrere Monate dauerte und sie hatten sich den Kopf zerbrochen, was sie in dieser Zeit mit Doreen machen sollten.
Mary hatte mit ihrer Familie stets einen losen Kontakt gehalten.
Als ihre Mutter sich in einem ihrer Briefe nach Doreen erkundigte und um eine Fotographie ihrer Enkelin bat, kamen sie auf die Idee, dass es nicht nur zum Vorteil des Mädchens wäre, wenn sie den Sommer in England verbrachte, sondern auch zu ihrem eigenen.
Also reiste Doreen in die Heimat ihrer Eltern, unglücklich bis zum letzten Augenblick. Ein viel zu schmales, nicht sonderlich reizvolles Kind, mit Augen, die viel zu groß waren für das kleine Gesicht, und blonden Haaren, die nicht die geringste Neigung zur Naturkrause hatten, jedoch so mit der Brennschere bearbeitet, dass die Kleine förmlich aufgedonnert wirkte. Der Hut, den sie trug, war riesig. Er hatte ihrer Mutter gehört, bevor diese ihn ausrangiert hatte, weil er völlig aus der Mode war.
Als Doreen zu ihren Eltern zurückkehrte, war sie eine andere geworden.
Sie sprach nur wenig über die Zeit, die hinter ihr lag. Und weil sie ihre Erlebnisse und Gedanken für sich behielt, hatten Henry und Mary nicht die kleinste Ahnung, wie oft ihre Tochter an die Monate in England dachte oder wie viel sie ihr bedeuteten.
Doch von diesem Augenblick an begann sie, ihr eigenes Leben zu führen.
Sie beklagte sich zunächst einmal, durchaus mit Recht, über die Behandlung des Hotelpersonals. Und auch wenn ihr Zimmer oft genug nur eine bessere Abstellkammer war, hielt sie es peinlich sauber. Sie fällte von nun an die Entscheidung über das, was sie anzog oder nicht anzog, und am Äußeren ihrer Mutter übte, sie oft genug scharfe Kritik.
Verantwortungsbewusste Eltern hätten über dieses völlig neue, ungewohnte Verhalten ihrer Tochter nachgedacht, sie hätten sich nach der Ursache dafür gefragt. Doch Henry und Mary besaßen weder die Zeit noch das Interesse, sich wegen Doreen den Kopf zu zerbrechen.
Doreen war eine Belastung für sie, ein Luxus, den sie sich nicht leisten konnten.
Außerdem hatten sie ihre Nilreise in vollen Zügen genossen und wurden nicht müde, davon zu sprechen, so dass sie vergaßen, ihre Tochter nach dem Aufenthalt in England zu fragen.
Einmal erkundigte sich Mary mit einem wehmütigen Ausdruck in den übernächtigten Augen nach ihrem Elternhaus. Doch das geschah, als Henry nicht da war.
»Das letzte, was ich mir wünsche, ist, noch einmal den Regen und den Morast da drüben zu erleben«, sagte sie dann heftig. »In Ägypten sind wir davon wenigstens verschont.«
Mit sechzehneinhalb, einem Alter, in dem andere Mädchen noch zur Schule gehen, durfte Doreen bereits Bars und Nachtclubs besuchen, wo sie die Zeit mit allen möglichen jungen Männern verbrachte. Niemand redete ihr mehr in die Gestaltung ihres Lebens hinein. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte, solange sie ihren Eltern nicht in die Quere kam.
Doch obwohl sie selbst es nicht bemerkte: ihr Älterwerden hatte auf Mary und Henry einen ganz bestimmten psychologischen Effekt.
Ohne es vor sich selbst einzugestehen, wurden die beiden sich der Tatsache bewusst, dass sie Versager waren.
Die wilde, heftige Art, wie Doreen ihre Jugend genoss, verunsicherte sie mehr, als sie es wahrhaben wollten.
Der Preis dieser ungebundenen, vergnügungssüchtigen Jahre war das Ausbleiben einer engeren Bindung. Es fand sich kein ernsthafter, respektabler Bewerber für die Hand ihrer Tochter.
Ein Wissen, das Henry im Alkohol zu ertränken versuchte und Mary von Tag zu Tag verdrießlicher und verbitterter werden ließ.
Ihr Zusammenleben wurde immer unerträglicher. Streitereien waren an der Tagesordnung.
Doreen kümmerte sie nicht darum.
Als sie zwanzig war, sprach man von ihr nur als von dem ‚wilden Wallis-Mädchen‘.
Dieser Beiname traf jedoch viel weniger zu, als die meisten es ahnen konnten. Die Lebensweise ihrer Eltern, ihre eigene, äußerst attraktive Erscheinung und die Tatsache, dass sie bereit war, mit jedem den Abend zu verbringen, der ihr ein Dinner und die anschließende Unterhaltung bezahlte, genügten, um ihr den Ruf eines Flittchens einzubringen.
In Wirklichkeit vergab sich Doreen nie etwas, denn sie hatte die Angewohnheit, unwillkommene Annäherungsversuche auf der Stelle zurückzuweisen und ihren Verehrern deutlich zu zeigen, wo die Grenzen lagen.
Sie tanzte gern, sie war gerne vergnügt und lachte gern wie jedes Mädchen ihres Alters. Aber das war auch schon alles. Dass sie unbehütet und ohne Schutz war, dafür konnte sie nichts.
Ihr Erscheinungsbild allerdings sprach gegen sie, denn sie übertrieb maßlos, was ihre Aufmachung betraf. Schuld daran trug die Beschränktheit ihrer Mutter, die ihr niemals das Gefühl gab, eine attraktive junge Frau zu sein, die es nicht nötig hatte, durch extravagante Kleidung oder ein auffälliges Make-up auf sich aufmerksam zu machen.
Mary ließ keine Gelegenheit verstreichen, Doreen klarzumachen, wie unansehnlich sie sei.
»Der Himmel mag wissen, wie wir für dich einen Mann finden sollen!« fügte sie dann mit einem Seufzer hinzu, ohne sich bewusst zu sein, wie sehr sich ihre Tochter diese Worte zu Herzen nahm.
Denn Doreen war überempfindlich, was ihr Aussehen betraf. Sie wünschte sich verzweifelt, beachtet zu werden. Vor nichts hatte sie mehr Angst, als zum Mauerblümchen abgestempelt und links liegen gelassen zu werden.
Naiv, wie sie im Grunde noch war, glaubte sie fest daran, der großzügige Gebrauch von Rouge, Lippenstift und Wimperntusche würde ihr nichtssagendes Äußeres, in das einer aufsehenerregenden Schönheit verwandeln.
Ihre kosmetischen Bemühungen verliehen ihr zwar etwas Aufsehenerregendes, aber nicht in der Weise, wie sie es gewünscht hätte, wäre sie imstande gewesen, ein wenig sachlicher an das Problem heranzugehen.
Unentwegt nörgelte Mary an ihr herum und warf ihr vor, sie sehe aus wie eine Kurtisane. Sie machte jedoch nie den ernsthaften Versuch, Doreen ein Gefühl für das, was guter Geschmack war, zu vermitteln. Sie selbst versuchte schon seit Jahren, mit Hilfe von Puder und Schminke die zerstörerischen Spuren zu überdecken, die das Leben in einem heißen Klima nun einmal mit sich bringt.
Vielleicht war es sogar eine Art uneingestandener Eifersucht, die sie daran hinderte, ihrer Tochter einmal ein aufmunterndes Wort oder einen bewundernden Blick zu schenken. Die Folge war, dass Doreen ihrer Mutter gegenüber mit Trotz und Verschlossenheit reagierte.
Und das Zeichen für diesen stummen Protest war, dass sie sich immer mehr aufdonnerte, womit sie zugleich ihre Unsicherheit und ihre Minderwertigkeitsgefühle zu überspielen vermochte.
Sie ahnte nicht, dass sie den Neid der Mädchen ihres Alters in Kairo hervorrief. Hätte sie es geahnt, es wäre ein großer Trost für sie gewesen.
Diese Mädchen wären mit einem Bruchteil der Freiheiten zufrieden gewesen, die Doreen genoss. Auch sie hätten sich gern amüsiert, wären gern fröhlich und ausgelassen gewesen in der Gesellschaft eines Mannes, den sie sympathisch fanden. Und wie gern wären sie der strengen Aufsicht ihrer Mütter und Anstandsdamen entflohen, die jeden, auch den kleinsten Schritt in Richtung Freizügigkeit und Zwanglosigkeit im Keim erstickten.
Den Debütantinnen, die die Saison auf herkömmliche Weise begingen, erschien Doreens Leben geradezu ideal. Voller Neid blickten sie auf das Mädchen, wenn es wie selbstverständlich. eine Einladung in ein flottes Lokal annahm oder durch die einladend geöffnete Tür eines schicken Automobils auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Sie mussten für alles und jedes um Erlaubnis fragen oder wurden erst gar nicht eingeladen, weil jeder junge Mann wusste, dass er sowieso mit einem Korb rechnen konnte.
Keins dieser Mädchen hätte auch nur im Traum daran gedacht, dass Doreen auf sie eifersüchtig sein könnte.
Doreen sehnte sich vor allem nach einer Mutter, die auch schon einmal nein sagte, auf die sie stolz sein konnte, und die ein ganz normales und weniger auffälliges Leben führte als Mary.
Es war nicht immer einfach für Doreen, einem neuen Bekannten zu erklären, dass der auffallend gekleidete Gentleman, der ganz offensichtlich üppig gespeist hatte und nun an der Bar oder auf dem Sattelplatz viel zu laut und viel zu emphatisch das große Wort führte, ihr Vater sei.
Oder dass die Frau mit dem schrillen Lachen und dem viel zu kurzen Rock, die soeben mit einem bleichgesichtigen jungen Mann tanzte, der ihr Sohn hätte sein können, ihre Mutter war.
Je älter Doreen wurde, um so öfter machte sie die Erfahrung, dass fast jeder junge Mann, der ihre Bekanntschaft suchte, mehr von ihr erwartete, als sie zu geben bereit war.
Sie hatten sich an dem Klatsch orientiert, der über Doreen in der Stadt im Umlauf war, und das Mädchen war sich darüber im Klaren, dass ein paar flüchtige Küsse im Wagen oder die Erlaubnis, im Schatten der Pyramiden ihre Hand zu halten, nicht das war, was die jungen Herren von ihr erwarteten. Ihr Ruf hatte ihnen mehr versprochen.
Doreen war zynisch genug, anzunehmen, dass sogar ihre Eltern überrascht gewesen wären, hätten sie gewusst, wie rückhaltlos und unbedingt ihre Tochter ihre Tugend verteidigte.
Aus tiefster Überzeugung, die in ihrer Stärke fast etwas Religiöses hatte, wusste sie, dass sie unweigerlich in den Strudel der Verderbtheit hineingezogen würde, wenn sie sich selbst aufgab.
Als sie dreiundzwanzig war und voller Angst dem nächsten Geburtstag entgegenblickte, an dem sie vierundzwanzig wurde, trat Pepi in ihr Leben.
Die erste Begegnung mit ihm würde sie nie vergessen.
Ihre Mutter hatte einen Schwächeanfall erlitten, eins der vielen Signale, die sie innerhalb eines Jahres auf die Tatsache vorbereiten sollten, dass Mary unheilbar an Krebs erkrankt war.
Sie befanden sich auf der Rennbahn, wo sie jeden Sonntagnachmittag anzutreffen waren.
Doreen begleitete Mary zur Toilette. Ein Blick in die Runde genügte, ihren Vater auszumachen. Sein Gesicht war so rot wie die Nelke, die er im Knopfloch trug, und er bildete den Mittelpunkt einer lärmenden Gruppe von Männern am anderen Ende des Restaurants.
Sie überlegte noch, ob sie ihn bitten sollte, der Mutter einen Brandy zu besorgen, oder ob sie diesen selbst an der Theke holen sollte, als neben ihr eine Stimme fragte:
»Kann ich Ihnen helfen?«
Sie wandte den Kopf und bemerkte einen kleinen, dunkelhäutigen Mann mit einem freundlichen Gesichtsausdruck.
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Cognac besorgen würden«, sagte Doreen ruhig. »Meiner Mutter ist schwindlig geworden.«
»Warten Sie, hier!« sagte er und bahnte sich mit den Ellbogen einen Weg zur Bar. Wenige Sekunden später kam er mit einem Glas in der Hand zurück.
»Besten Dank«, sagte Doreen und streckte die Hand nach dem Cognac aus.
Doch er schüttelte den Kopf.
»Wohin soll ich ihn bringen?«
»Zur Damentoilette«, antwortete Doreen und setzte sich in Bewegung.
Mary stand schon draußen vor der Tür. Sie war sehr blass und griff wortlos nach dem Glas.
»Solltest du dich nicht besser setzen?« fragte Doreen.
»Ich konnte die Hitze da drinnen nicht mehr ertragen«, antwortete Mary kurzangebunden.
Doreen nahm ihr das leere Glas ab und reichte es dem Fremden.
»Danke», sagte sie. »Was bin ich Ihnen schuldig ...«
»Bitte nicht«, wehrte er ab. »Es war mir ein Vergnügen. Und falls Ihre Mutter sich immer noch nicht wohl fühlt, würde es mir eine Ehre sein, sie nach Hause zu fahren.«
Doreen wollte schon ablehnen, doch er kam ihr zuvor:
»Ich wollte sowieso aufbrechen. Ich kam nur wegen eines ganz bestimmten Pferdes her. Es ist beim letzten Rennen gelaufen.«
Bevor sie antworten konnte, hatte Mary, ganz offensichtlich verärgert über das Zögern ihrer Tochter, das Angebot bereits angenommen.
Sie gingen zum Parkplatz, wo er zu einer riesigen, luxuriös ausgestatteten Limousine ging.
Er ließ die beiden Frauen im Fond Platz nehmen und setzte sich vorn neben den Chauffeur. Die Trennscheibe war heruntergelassen, und daher erkundigte sich Mary bei ihrer Tochter im Flüsterton:
»Wer ist der Mann?«
Doreen zuckte die Schultern.
Nach einem unwilligen Murmeln lehnte sich Mary in die Polster zurück und schloss die Augen.
Wie krank sie aussieht, dachte Doreen. Es ist das unsinnige, verrückte Leben, das sie führt! Niemand in ihrem Alter könnte das durchhalten.
Aber dann begann sie zu rechnen und stellte überrascht fest, dass Mary erst siebenundvierzig war, zu jung, um schon so erschöpft und verbraucht zu sein.
In einigen Jahren bist du genausoweit, sagte sie sich.
Ein Schauder überlief sie, und sie drehte ihr Gesicht zur Seite. Sie hatte Angst vor der Zukunft. So sehr, dass sie sich nur selten erlaubte, daran zu denken.
Es lag auf der Hand, was mit ihr passieren würde. Sie würde sitzenbleiben. Es hatte zwar zahlreiche Männer in ihrem Leben gegeben, Männer, die darauf aus waren, angenehme Stunden in ihrer Gesellschaft zu verbringen, die sie reizvoll und amüsant fanden. Aber keiner hatte ihr jemals etwas Greifbares in Bezug auf die Zukunft geboten.
Sobald sie die Sprache aufs Heiraten brachte, erschien jener misstrauische Ausdruck in ihren Augen, der Doreen an ein Tier erinnerte, das fürchtete, in eine Falle zu laufen.
Die Limousine hielt vor ihrem Hotel in einer der schmutzigen und heruntergekommenen Seitenstraßen, die an die eleganteren Viertel der Stadt anschlossen. Der kleine Mann stieg aus und half ihnen aus dem Wagen.
»Danke«, sagte Mary. »Sie waren sehr hilfsbereit. Ich hoffe, wir begegnen einander noch einmal.«
Er gab ihr die Hand und wandte sich Doreen zu.
»Es war mir ein großes Vergnügen«, sagte er. »Ich würde Sie gern wiedersehen, wenn ich darf.«
»Das wäre nett«, antwortete Doreen mehr aus Höflichkeit als aus einem inneren Bedürfnis heraus. Dann folgte sie ihrer Mutter in die Halle.
Während sie mühsam die Stufen hinaufstieg, fragte Mary:
»Wer ist er? Kennst du seinen Namen?«
»Ich habe keine Ahnung«, erwiderte ihre Tochter gleichgültig.
»Hat er sich dir denn nicht vorgestellt?«
Doreen schüttelte den Kopf.
»Nein.«
»Wie dumm von dir, dich nicht nach seinem Namen zu erkundigen!« stieß Mary heftig hervor. »Schließlich scheint er ganz schön reich zu sein. Die Limousine war ein Traum, und die Livree des Chauffeurs wirkte gediegen und teuer. Ich dachte, du hättest etwas mehr Verstand! Lässt den Mann einfach laufen, ohne eine Verabredung mit ihm getroffen zu haben! Leider fühlte ich mich nicht wohl genug, sonst hätte ich etwas unternommen. Bitte, gib mir drei von diesen Tabletten aus der Schublade meines Ankleidetisches. Sie liegen in der linken Ecke.«
Doreen fand die Tabletten und warf einen Blick auf den Aufkleber des Fläschchens.
»Drei?« fragte sie. »Ist die Dosis nicht zu stark?«
Die Tabletten waren ein Beruhigungsmittel, das in jeder Apotheke zu haben war, allerdings nur auf Rezept.
»Und ein Glas Wasser!«
Doreen holte ein Glas Wasser. Als sie sich über Mary beugte, fiel ihr erneut auf, wie erschreckend krank sie aussah.
Ein plötzliches Mitleid mit ihrer Mutter erfasste sie. Liebevoll schüttelte sie die Kissen auf. Dann begann sie das Zimmer aufzuräumen.
Sie hängte Marys Kleid in den Schrank, faltete die vielen verstreut herumliegenden Wäschestücke zusammen und legte sie in die Kommode zurück.
Als sie fertig war, wandte sie sich zur Tür. Hinter sich hörte sie Marys Stimme, die schon ein wenig benommen klang.
»Griechen haben Geld. Vergiss nicht, herauszufinden, wer er ist!«
III
Pepi Altini galt in seiner Branche als eiskalter Geschäftsmann. Er war dafür bekannt, dass er jeden Vorteil rücksichtslos wahrnahm und sich von niemandem an die Wand drücken ließ.
Privat dagegen war er eine Art Idealist und trotz seiner achtundfünfzig Jahre immer noch auf der Suche nach einem Glück, das ihm das Leben bislang vorenthalten hatte.
Er sehnte sich nach Jugend. In seinen Gedanken und Träumen war er jung und stark und unablässig nach der Suche nach einem schönen Mädchen, das er zu seiner Lebensgefährtin machen würde.
Wenn er allerdings in den Spiegel schaute und seinen alternden Körper, fett und schlaff von zu gutem und reichlichem Essen, sah, fühlte er sich deprimiert und unglücklich, kam sich jedoch in keiner Weise lächerlich vor.
Mit neunzehn war Pepi einmal an einem schwül-heißen Nachmittag durch Athen gegangen und hatte ein entzückendes dunkelhaariges Mädchen gesehen, das auf einer Mauer saß und reife Feigen aß.
Sie hatte ihm zugelächelt, und es hatte keiner weiteren Aufforderung bedurft, sie anzusprechen. Sie verabredeten sich dann für den nächsten Tag und sahen sich von da ab immer häufiger.
An ihrem siebzehnten Geburtstag verführte er sie.
Danach trennten sich ihre Wege, denn ihr Vater schickte sie aufs Land, und er sah sie nie wieder.
Doch er vergaß sie nie. Sein ganzes Leben nicht. Sie wurde für ihn die Verkörperung seiner unerfüllt gebliebenen Träume von Liebe, Jugend und romantischer Leidenschaft.
Später heiratete er die Tochter eines Geschäftsfreundes seines Vaters. Es war eine Zweckheirat. Seine Frau brachte eine beträchtliche Mitgift mit in die Ehe und schenkte ihm zwei Söhne, die beide, je älter sie wurden, ihrem Vater gegenüber ein immer stärker werdendes Gefühl mitleidiger Verachtung entwickelten.
Madame Altini wurde mit den Jahren immer korpulenter. Sie war eine bequeme Frau, die die ehelichen Pflichten als äußerst langweilig und lästig empfand, sie aber des Kinderkriegens wegen in Kauf nahm. Für sie waren Kinder das einzig Bedeutsame im Leben einer normalen Frau.
Mit vierzig war sie eine alte Frau, zufrieden damit, ihre beiden Söhne zu bemuttern und ihrer maßlosen Essgier zu frönen.
Als Pepi ihr verkündete, er werde nach Kairo fahren, um dort eine neue Geschäftsniederlassung zu gründen, hatte sie keinerlei Einwände gegen diesen Plan, und sie schien es für selbstverständlich zu halten, dass er auf ihre Gesellschaft in Kairo keinen Wert legte.
Mit einer Wehmut, die er nach außen hin selten zeigte, hatte er sie zuvor einmal gefragt, ob sie ihn eigentlich vermissen werde, wenn er nicht mehr da sei.
Ihre Antwort war charakteristisch für sie.
»Ich habe doch meine Kinder.«
Pepi war zweiundfünfzig, als er nach Kairo kam. Und zum ersten Mal seit seiner Jugend hatte er wieder das Gefühl, ein freier Mann zu sein.
Er genoss sein Junggesellendasein und das Bewusstsein, seiner Vergnügungssucht und seinem Hang zu jungen Frauen endlich einmal nachgeben zu können ohne die unausgesprochene und dennoch deutlich spürbare Missbilligung seiner Söhne.
Langsam und ohne dass es ihm recht bewusst wurde, begann er, von sich wie von einem Mann zu reden, der ohne Anhang ist.
Anfänglich lächelte er nur, wenn die Leute, mit denen er zusammentraf, auf sein Junggesellendasein anspielten. Er nahm es als einen netten Spaß und ließ sie in ihrem Glauben. Er tat nichts, um ihre Meinung von ihm zu revidieren.
Schließlich stellte er fest, dass es gewisse Vorteile brachte, in Kairo als Junggeselle zu gelten.
Es machte ihm auch Freude, bei jungen Damen den Eindruck zu erwecken, er wäre noch zu haben vom Standpunkt der Ehe aus gesehen. Und dies umso mehr, je sehnsüchtiger manche unverheiratete Blondine auf ein Wort von ihm wartete, das ihr auch bestimmte legale Macht- und Besitzansprüche über ihn Verleihen würde.
Was als eine Art Spiel begann, wurde mit der Zeit tödlicher Ernst.
Pepi lebte in ständiger Furcht, die kleine Welt, die er sich errichtet hatte, könnte plötzlich über ihm zusammenbrechen.
Bekannte und Geschäftspartner aus Griechenland, die ihn besuchten, brachte er nie mit seinem neuen Freundeskreis zusammen. Im Gegenteil, er vermied peinlich, dass es zu irgendeiner Verbindung zwischen ihnen kam.
Zum Glück erforderten die Geschäfte, die er machte, nur selten einen persönlichen Kontakt, und seine Ängste blieben auf zwei oder drei Wochen im Jahr beschränkt.
Es dauerte also nicht lange und er genoss in Kairo den Ruf eines roues. Er war bekannt für seine diskreten, aber höchst amüsanten Partys, auf denen sehr junge und reizvolle Ladys anzutreffen waren, die es mit der Tugend nicht allzu ernst nahmen.
Er besaß zahlreiche Rennpferde, die ihm einen angesehenen Platz in der Sportwelt sicherten, und er nahm erfreut zur Kenntnis, dass man ihn immer häufiger als einen prächtigen Burschen bezeichnete.
Doch unter der betriebsamen und vergnügungssüchtigen Oberfläche blieb er der romantische Träumer, der er immer gewesen war. Er sehnte sich nach wahrer Liebe und nach jener Leidenschaft, die ihn vor langer Zeit einmal in einer der staubigen Straßen Athens erfasst hatte.
Er war sich darüber im Klaren, dass die Frauen, die er sich kaufte, ihm ihren Körper mit der gleichen Gedankenlosigkeit anboten, wie ein Mann ihm einen Drink spendierte oder ihm Feuer für seine Zigarette gab.
Pepi war reich, das allein zählte für sie. Aber weil er ein Idealist war, war ihm eine gekaufte Frau zu wenig. Er wollte mehr. Er hungerte nach etwas, das er seit damals nie wieder gefunden hatte und von dem er gleichzeitig wusste, dass es ihm eines Tages die Erfüllung all seiner Träume bringen würde.
Als er Doreen begegnete, verliebte er sich auf der Stelle in sie.
Einen besonderen Grund dafür gab es nicht. Sie war nicht annähernd so schön, wie viele der Mädchen, die Abend für Abend an seiner Dinner Tafel saßen. Sie besaß weder die Reize noch den sprühenden Witz, über die manche Frauen in seiner Umgebung verfügten.
Doch er spürte wozu vielleicht sonst niemand in der Lage war Doreens jugendliche Unberührtheit, die selbst noch unter der Schminke, ihres Trotzes und ihrer Rebellion zu erkennen war.
Gleich in den ersten Sekunden ihrer Begegnung wusste Pepi mit untrüglicher Sicherheit, dass Doreens Verleumder die Unwahrheit sagten. Dieses Mädchen war nicht unmoralisch und auch nicht mannstoll.
Er erkannte ihre Unschuld und Unberührtheit. Er erkannte es an der Art, wie sie ging, wie sie den Kopf drehte oder die Hand bewegte. Sie erinnerte ihn an ein junges Pferd, das viel zu früh und viel zu hart eingeritten worden war, sich jedoch unter dem Zaumzeug seine Ungezähmtheit und Ungezügeltheit bewahrt hatte.
Er mochte sie, er hatte Mitleid mit ihr, und er liebte sie obwohl sie eigentlich gar nicht sein Typ war.
Es begann auf die gewohnte Weise. Fast täglich rief er sie an und lud sie ein zu dem üblichen Zug durch die Clubs. Doreen war nur zu froh, seine Einladungen annehmen zu können.
Sie mochte Pepi, er interessierte sie, und sie war klug genug, ihn wie einen Gleichaltrigen zu behandeln und nicht wie einen Mann, der älter war als ihr Vater.
Außerdem genoss sie den Luxus, mit jemandem zusammen zu sein, der wirklich reich, war. Die Subalternoffiziere, die kleinen Beamten und Bankangestellten, die bis dahin die Mehrzahl ihrer Bewunderer gestellt hatten, konnten ihr längst nicht das bieten, was Pepi ihr bot.
Sein Wagen und sein Chauffeur standen stets zu ihrer Verfügung. Sein riesiges, komfortables Haus mit seinem schattigen Garten am Ufer des Nils, mit der geschulten Dienerschaft und der ausgezeichneten Küche bildeten einen Hintergrund, den ihr bisher noch kein Mann hatte bieten können.
Pepi beging nicht den Fehler, ihr zu viele Dinge zu rasch hintereinander anzubieten. Blumen, Süßigkeiten, Magazine standen selbstverständlich zu ihrer Verfügung, und wenn sie früher Rosen und Nelken an ihrer Schulter befestigt hatte, waren es nun teure Orchideen.
Doch er beleidigte sie nicht mit Geschenken wie Schmuck, Pelze oder kostspielige Kleider, wie er das zuvor so oft bei anderen Frauen getan hatte.
Lange bevor es für Doreen feststand, dass Pepi es ernst meinte, hatte er bereits den Entschluss gefasst, dass sie die Seine werden sollte.
Die Frage war nur, wie.
Pepi war keinesfalls ein Narr. Er kannte die Geschichten, die über Doreens Eltern die Runde machten, über ihre Freizügigkeit, die Art und Weise, wie sie versuchten, sich durchs Leben zu schlagen.
Einige der Geschichten glaubte er, von anderen wusste er, dass sie unwahr und typisch für den Klatsch waren, der in einer Stadt wie Kairo die Runde machte. In seinem Innersten war er fest davon überzeugt, dass er mit keinem Antrag, außer einem rechtmäßigen, bei Doreen eine Chance haben würde.
Weil er sie wirklich liebte, fürchtete er nichts so sehr, als durch einen falschen Schritt ihr Vertrauen und ihre Freundschaft zu verlieren.
Der alternde, von seiner Ehe enttäuschte Pepi war ein Idealist. Der liebende Pepi war Romeo, Dante und Lancelot in einer Person.
Die unter der Asche seiner Enttäuschung glimmende Glut eines leidenschaftlichen Temperaments war zur hellen Flamme entfacht, und sein Verlangen nach Doreen wuchs in einem Maße, dass er schließlich glaubte, ohne sie nicht mehr leben zu können.
»Ich liebe dich mein Leben ist sinnlos ohne dich!« sagte er zu ihr schmachtend und er meinte es auch so.
Seine Familie in Athen hatte er buchstäblich vergessen. Zu lange war er nun schon nicht mehr dort gewesen.
Zu Weihnachten erhielt er zwar stets einen Brief von seiner Frau mit den neuesten Bildern seiner Söhne, und in einem ihrer letzten Schreiben hatte gestanden, dass der älteste von ihnen geheiratet hatte und inzwischen Vater eines gesunden Sohnes geworden war. Aber für Pepi waren diese Nachrichten ohne jedes Interesse.
Er las diese Briefe mechanisch und verbrannte sie anschließend im Kamin, da er befürchtete, sie könnten der Dienerschaft in die Hände fallen.
Er war ein Mann mit Methode, und so hatte, er sich nicht nur eine Position geschaffen, die ihn in Kairo unabkömmlich machte, sondern es gleichzeitig auch fertiggebracht, den gewaltigen Bluff seiner Unabhängigkeit siebzehn Jahre lang aufrechtzuerhalten.
Jedenfalls glaubte er das.
Er ahnte nichts von dem, was man sich flüsternd und hinter vorgehaltener Hand über ihn erzählte vor allem unter seinen Landsleuten.
Dieses Gerede war natürlich harmlos und vermochte seinem Ruf kaum zu schaden.
Bis er Doreen heiratete.
Die Hochzeit fand heimlich statt.
Erst vierzehn Tage später tauchte Pepi mit ihr wieder bei den Rennen auf und stellte sie als seine Frau vor.