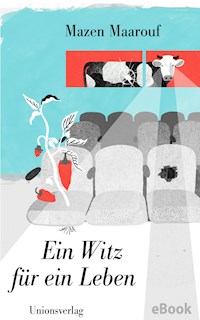
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kind, das einer einsamen Kuh durch die Trümmer folgt. Ein Onkel, der drei Mal stirbt. Ein Mann, der die Träume der anderen träumt, und einer, der immer flacher wird. Ein Junge, der seinen kleinen Bruder verkaufen will, und einer, der beschließt, nie wieder zu lächeln. Geschichten von fantastischen Matadoren, von reumütigen Voyeuren, von verlorenen Leben, von allmächtigen Milizen an jeder Ecke – und von der Notwendigkeit, trotz allem zu lachen. Wie überlebt man in einer Welt, die täglich zerstört wird? Wie findet man Worte für einen Schrecken, der so ganz anders ist, als wir ihn uns vorstellen? In seinen aufsehenerregenden Texten erzählt Mazen Maarouf überraschend und kühn, voller Humor und Fantasie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein Kind, das einer einsamen Kuh durch die Trümmer folgt. Ein Onkel, der drei Mal stirbt. Ein Mann, der die Träume der anderen träumt. Geschichten von fantastischen Matadoren, von reumütigen Voyeuren, von verlorenen Leben, von allmächtigen Milizen an jeder Ecke – und von der Notwendigkeit, trotz allem zu lachen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Mazen Maarouf (*1978) ist ein palästinensischer Autor, Übersetzer und Journalist. In seinem Schreiben spricht er sich dezidiert gegen repressive Regimes aus, seine Werke erschienen in zahlreichen Sprachen. Maarouf lebt in Reykjavík und Beirut.
Zur Webseite von Mazen Maarouf.
Larissa Bender (*1958) studierte u. a. Islamwissenschaft, Soziologie und Arabisch. Sie ist Übersetzerin, Journalistin, Dozentin für Arabisch, Moderatorin und berät Verlage und Kulturveranstalter. 2018 erhielt sie für ihr Engagement als Brückenbauerin in die arabische Welt das Bundesverdienstkreuz.
Zur Webseite von Larissa Bender.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Mazen Maarouf
Ein Witz für ein Leben
Aus dem Arabischen von Larissa Bender
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2015 bei Al-Kawkab Press Services S.A.R.L., Imprint of Riad El-Rayyes Books S.A.L.
Lektorat: Patricia Reimann
Originaltitel: Nukat li-l-musallaḥīn
© by Mazen Maarouf, 2015
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Inga Israel
Umschlaggestaltung:
ISBN 978-3-293-31043-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 01:42h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
EIN WITZ FÜR EIN LEBEN
Ein Witz für ein LebenDer MatadorDas GrammophonEin WitzKinoBiskuitDer TrägerAndrer-Leute-Träume-SyndromDas AquariumEine andere PersönlichkeitDer WeckerMarmeladenportionDer VorhangJuan und AusaMehr über dieses Buch
Über Mazen Maarouf
Neun Fragen an Mazen Maarouf
Mazen Maarouf: »Poesie ist der Schlüssel zur Freiheit.«
Über Larissa Bender
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Krieg
Zum Thema Großstadt
Zum Thema Kindheit
Zum Thema Palästina
Zum Thema Arabien
Ein Witz für ein Leben
Eine Paprikapflanze
Ich träumte, dass Vater ein Glasauge hatte. Als ich aufwachte, schlug mein Herz heftig – wie das einer verschreckten Kuh. Ich lächelte glücklich, denn endlich schien es Wirklichkeit geworden zu sein: Mein Vater hatte ein Glasauge. Als ich klein war, schenkte Vater mir einmal zum Geburtstag eine Paprikapflanze. Es war ein eigenartiges Geschenk, dessen tieferen Sinn ich damals nicht verstand. Von Zeit zu Zeit hörten wir Schüsse, aber wir hatten uns daran gewöhnt wie an das Hupen vorbeifahrender Autos. Und genauso wenig, wie ich verstand, was da draußen vor sich ging, verstand ich, warum Vater mir ausgerechnet eine Paprikapflanze geschenkt hatte. Sie hatte zwei kleine Paprikaknospen, und ich glaubte, sie würden mich und meinen Zwillingsbruder verkörpern.
Die Bewaffneten kämpften monatelang um unsere Straße, die zwischen dem Meer und der Innenstadt lag, doch Mutter schickte mich trotzdem zur Schule, mich und meinen tauben Zwillingsbruder, der sich auf dem Schulweg aus Angst hinter mir versteckte.
Ich mochte Vaters Geschenk damals nicht, ich fand es anormal und abscheulich und erzählte keinem meiner Mitschüler davon. Trotzdem kümmerte ich mich um die Pflanze, so wie Vater es von mir verlangt hatte. Vater, der eine Reinigung hatte, zeigte mir, wie man die kleinen Knospen mit einem Stück Baumwolle abreibt und mit einer Kerze beleuchtet, damit sie Vitamine bekommen und wachsen. Er machte das ganz vorsichtig. »Du musst die Pflanze gut pflegen, damit sie Knospen bekommt. Dieser Paprikabusch soll dein Freund werden«, sagte er. Durch Vaters Verhalten verstand ich, dass jede kleine Paprikaknospe eine Seele hat, und dass ich sie schützen musste, was immer es kostete. Das war meine kleine unbedeutende Aufgabe im Krieg. Manchmal, wenn die Gefechte heftiger wurden und die Bewaffneten schwere Waffen wie Mörser und RPGs einsetzten, legten sich meine verängstigte Mutter und mein Bruder im Flur zwischen Wohnzimmer, Küche und Badezimmer auf den Boden, während ich mich neben den Fernseher stellte – wo mich die Heckenschützen besonders gut sehen konnten. Ich beleuchtete die dort stehende Paprikapflanze mit einer Kerze, in dem Glauben, dass auch unsere Seelen, die von mir, meinem Bruder, von Vater und Mutter, in den kleinen Paprikaschoten steckten, und dass, wenn ich mich um sie kümmerte, niemand von uns in Gefahr war, getötet zu werden, insbesondere nicht Vater, der erst am Abend nach Hause kommen würde. Auf diese Weise vertiefte sich meine Beziehung zu der Paprikapflanze, und ich begann, sie zu mögen, auch wenn ich sie einmal eine Zeit lang nicht goss, sondern stattdessen anspuckte. Statt ihr Wasser zu geben, trank ich es selbst, denn Mutter sagte immer wieder, dass Wasser knapp sei und die Menschen verdursten würden. Ich bekam Angst und trank das Wasser selbst, denn ich stellte mir vor, dadurch in der Zukunft keinen Durst leiden zu müssen. Außerdem fand ich, dass das Gießen mit meinem Speichel die Paprikapflanze und mich einander noch näher brachte. Bis Mutter mich eines Tages dabei erwischte und es Vater erzählte, als er von der Arbeit kam.
Das war das erste Mal, dass Vater mich mit dem Gürtel schlug. Er war unfassbar wütend, und ich fragte mich: »Verdient das Bespucken der Paprikapflanze wirklich solche Wut?« Ich sah, wie mein tauber Bruder die Augen zukniff und jedes Mal, wenn der Gürtel auf meinen Körper schlug, zusammenzuckte. Als Vater von mir abließ, kroch ich heulend und tränenüberströmt auf die Paprikapflanze zu und versuchte herauszubekommen, in welcher der Schoten die Seele meines Vaters steckte. Es war ganz einfach. Ich wählte die größte Schote aus, riss sie eiskalt ab und zermalmte sie mit dem Fuß.
Grashüpfer
In der Schule prahlten die Kinder mit Geschichten, wie ihre Väter sie geschlagen hätten. Das Schlagen war Ausdruck der Autorität des Vaters in der Familie, denn Stärke war das Wichtigste für uns im Krieg. Mein Vater stand nicht an der Spitze der Hierarchie dieser Väter, er war kein Meister im Erfinden brutaler Strafen. Voller Stolz erzählte ich, dass er mich mit dem Gürtel verprügelt hatte, und als ich nach dem Grund dafür gefragt wurde, log ich und sagte nicht: »Ich habe die Paprikapflanze angespuckt«, sondern ich erfand stattdessen eine Geschichte, die zeigen sollte, dass ich, als wäre ich aus heroischem Holz geschnitzt, etwas äußerst Mutiges getan hatte: »Ich habe das Valium meiner Mutter geschluckt, eine ganze Schachtel. Da hat mein Vater so lange auf mich eingeprügelt, bis ich die Tabletten alle wieder ausgekotzt habe.«
Einige Tage nachdem ich mit meinem Heldenepos geprahlt hatte, erzählte mir ein Mitschüler, mit dem ich befreundet war, dass er beobachtet habe, wie mein Vater auf der Straße verprügelt worden sei. »Er hatte einen braunen Gürtel an«, sagte er, »aber er hat ihn nicht benutzt. Ist das nicht derselbe Gürtel, mit dem er dich verprügelt hat?« »Doch!«, nickte ich, denn Vater besaß nur einen einzigen braunen Gürtel. Der Freund, der das alles gesehen hatte, als hätte er durch einen Guckkasten geschaut, in den man den Kopf hineinstecken muss, beschrieb mir den Gürtel. Als Vater am Abend nach Hause kam, fiel mir auf, dass die Flecken in seinem Gesicht keine Verbrennungen durch Bügeldampf waren. Um herauszufinden, wie weh sie ihm taten, berührte ich den größten Fleck in seinem Gesicht mit dem Finger, während er schlief. Er zuckte vor Schmerz zusammen, drehte, ohne die Augen zu öffnen, sein Gesicht zur Seite und tat, als schliefe er einfach weiter.
In jenem Moment wurde mir bewusst, dass Vaters Seele endgültig aus der Paprikapflanze entwichen war. Ich schimpfte mit mir selbst. Hätte ich nicht die größte Schote abgerissen und mit dem Fuß zerquetscht, wäre Vater nicht so schwach geworden. Und feige. Und das schmerzte mich noch mehr. Danach hat Vater mich nie wieder geschlagen – trotz meiner Versuche, ihn zu provozieren. Mehrmals bespuckte ich in seiner Anwesenheit die Paprikapflanze, doch er reagierte nicht, wie kräftig und geräuschvoll ich auch spucken mochte.
Von da an sprach Vater nicht mehr viel. Die meiste Zeit verbrachte er im Badezimmer, wo er auf dem Badewannenrand saß. Ich spähte durchs Schlüsselloch: Er schien mir wie abwesend, ihm tropfte sogar der Speichel aus dem Mund, ohne dass er es zu bemerken schien. Durch die Tür hindurch flüsterte ich ihm mit zusammengepressten Zähnen zu, wie ein Freund, der ihm einen Rat gibt, während er mit ihm – auf dem Rand einer Badewanne hockend – am Meer sitzt und angelt: »Weine nicht. Nicht weinen …« Und Vater weinte nicht. Deshalb war ich davon überzeugt, dass er noch genügend Standhaftigkeit besaß.
Einige Zeit später waren auf seiner Kleidung Spuren von Fußtritten sichtbar, als er nach Hause kam. Er nahm den Fernseher und stellte ihn unter den Baum vor das Haus. Der Fernseher hatte zwar keinen Defekt, aber Vater wollte, dass alle sähen, dass er nichts mit Politik zu tun habe. Trotz allem ging Vater weiterhin täglich zur Arbeit, denn die Reinigung hatte die Kleidung der Gäste eines großen Hotels zu waschen und zu bügeln. Die meisten Hotelgäste waren ausländische Journalisten, die von weit her gekommen waren, um über den Krieg zu berichten, der in unserer und den benachbarten Straßen tobte.
Dass mein Vater geschlagen worden war, kursierte bald in der gesamten Schule. Ich wurde deshalb als Grashüpfer bezeichnet, weil auch mein Vater ein Grashüpfer sei. Denn Grashüpfer ergreifen stets die Flucht, statt anzugreifen. Um diesen Spottnamen wieder loszuwerden, erfand ich Geschichten, wie mein Vater mich brutal verdrosch. Zum Beispiel fügte ich mir auf dem Schulweg mit Zigaretten Brandwunden auf meinem Arm und meinem Bauch zu, oder ich zerriss meine Schuluniform oder zerkratzte meinen Hals und rieb mir die Augen. Ich ging also morgens vor der Schule eine verlassene Gasse entlang und fügte mir eine gehörige Portion Selbstverletzung zu. Manchmal tat es höllisch weh. Wenn ich in diesem Zustand in die Schule kam, scharten sich die Kinder um mich, und sofort platzte es aus mir heraus, während ich mich wie erschöpft auf das Tor stützte: »Das war mein Vater. Er hat mich wieder geschlagen. Er ist kein Grashüpfer, wie ihr sagt.« Doch bald wurde ich zur Direktorin gerufen. Nachdem sie mich untersucht hatte, sagte sie: »Ich habe das Gefühl, dass du dir das selbst angetan hast«, weil kein Vater seinen kleinen Sohn auf diese Weise am Hals kratzt, wenn er ihn schlägt, oder ihn mit Zigaretten verbrennt und ihn dann in die Schule schickt. Also bestellte sie Mutter ein, die auf der Stelle kam und, sobald wir die Schule verlassen hatten, auf mich einzuschlagen begann – noch in Sichtweite der Schüler, die sich in den Klassenzimmern an die Fenster drückten und hämisch lachten, wie Ratten.
Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl eines Misserfolgs. Ich war bereit, auf alles zu verzichten, etwa auf mein kleines Königreich aus Matchbox-Autos, nur damit Vater zu einer angsteinflößenden Persönlichkeit würde. Ich würde auch meine Spardose knacken, in deren Spalt ich stets meine Träume geflüstert hatte. Ich glaubte nämlich, dass das Hineinflüstern der Träume in den Geldspalt die Spardose in die Lage versetzen würde, alle Träume zu erfüllen. Wenn man der Spardose seine Träume anvertraute, vermehrte diese die Geldsumme, sodass sie dem Preis der Träume angemessen war. Und mein Traum war immer gewesen, so eine silberne 6-mm-Pistole kaufen zu können, wie sie mindestens drei Jungen in unserem Haus besaßen.
Jetzt aber bestand der Traum darin, ein Glasauge für meinen Vater zu bekommen.
Der Sahlab-Verkäufer
Die Idee mit dem Glasauge war zwar nicht meine Erfindung, sondern die des Sahlab-Verkäufers in der Schule, aber mir war von Anfang an klar, dass ich in Vaters Gesicht eine Veränderung herbeiführen müsste. Ein Teil seines Kopfes musste geopfert werden, um ihn als Ganzes zu retten. Aber ich wusste nicht, welchen Teil ich opfern sollte, und ich wusste nicht, wie. Wenn er nachts schlief, betrachtete ich ihn. Ich musterte seine Gesichtszüge und versuchte abzuschätzen, was ich entfernen oder verunstalten müsste, damit er angsteinflößend wirkte. Doch ich kam zu keinem Schluss, denn Vater hatte ein kleines Gesicht, und außerdem war sein unruhiger Schlaf nicht hilfreich für meine Überlegungen. Vater war jemand, der ganz unvermittelt seine Augen öffnete, einen erschrocken ansah und dann sagte: »Warum schläfst du noch nicht? Hast du Angst?« Und was sollte ich in so einem Fall tun? Es war dieselbe Frage, die mir durch den Kopf schoss, sobald ich sah, dass er plötzlich die Augen aufschlug: »Papa, hast du Angst?« Und um deutlich zu machen, dass wir auf einer Wellenlänge waren, sagte ich: »Nein, Papa. Wir haben keine Angst, nicht wahr?«
»Natürlich nicht«, sagte er zögerlich mit gedämpfter Stimme. Dann begleitete er mich in mein Zimmer, damit ich wieder schlafen ging, und setzte sich auf die Kante des Bettes, in dem ich und mein Bruder schliefen. Vollkommen in Gedanken versunken, blieb er dort sitzen, so wie er immer auf dem Badewannenrand saß. Sobald ihm der Speichel aus dem Mund zu fließen begann, drückte ich die Augen fest zu und tat, als schliefe ich. Dann stand er auf, ging in die Küche, trank etwas Wasser und kehrte in sein Bett zurück, neben meine Mutter, deren Schlaf so schwer war wie der eines Murmeltiers.
Der Sahlab-Verkäufer war ein Spitzel. Zweimal am Tag kam er zur Schule. Er war klein, glatzköpfig, hatte ein fliehendes Kinn und einen dünnen Schnurrbart. Er trug Müllmännerschuhe, weshalb viele Kinder in der Schule kein Sahlab bei ihm kauften. Doch das schien ihn nicht zu kümmern, denn er tauchte trotzdem zweimal täglich auf, ohne etwas zu sagen. Wir haben ihn niemals sprechen gehört. Wir haben ihn auch niemals erregt gesehen. Er hörte sich unsere Bestellung an, nahm das Geld entgegen und gab das Wechselgeld heraus, wenn es nötig war. Sein rechtes Auge fehlte, aber die Kinder, die Sahlab bei ihm kauften, ließen sich davon nicht schrecken. Was wirklich störte, waren eher die Müllmännerstiefel, die er trug. Jedenfalls mehr als sein fehlendes Auge. Vielleicht weil der Anblick von versehrten Körpern im Krieg so normal war wie die Werbung für importierten Käse, die einem vertraut ist, obwohl man weiß, dass man niemals auch nur in die Nähe eines solchen Käses kommen wird. Oder weil man im Fernsehen jeden Tag mindestens eine Leiche oder zwei sieht. Oder weil einer der Schüler einem im Detail erzählt, wie ein Verwandter durch eine Granate umgekommen ist. Aber eine Leiche zu sehen, die Müllmännerstiefel trägt, das war unmöglich! Und der Sahlab-Verkäufer war abstoßend wie eine Leiche! Doch niemals wurde er von den Bewaffneten geschlagen. Als ich einmal außerhalb des Hauptportals der Schule ein Glas Sahlab von ihm kaufte und ihn fragte: »Haben die Bewaffneten dich jemals geschlagen?«, antwortete er nicht. Da hob ich meine Stimme: »Sag mal, die Bewaffneten, die am Ende der Straße stehen, haben die dich jemals geschlagen?«, doch er schüttelte nur den Kopf, ohne mich anzusehen. Ich verspürte ein großes Glücksgefühl. »Danke«, sagte ich und erklärte mir diesen Umstand damit, dass es auf jeden Fall mit seinem fehlenden Auge zu tun haben müsse.
Eine Niederlage
Einige Zeit später stellte ich meine Schulbesuche ein, denn ich war zu einem öffentlichen Pissoir geworden. Alle leerten ihre beschissenen Witze über mir aus. Insbesondere nachdem Mutter mich vor meinen Mitschülern geohrfeigt hatte. Ich hatte keine Schuldgefühle, und ich dachte nicht über die Konsequenzen nach, sondern rechtfertigte mein Schuleschwänzen vor mir selbst damit, eine Auszeit zu benötigen und darüber nachdenken zu müssen, wie ich Vater helfen könne. Irgendwie müsste ich eine Beziehung zu den Bewaffneten knüpfen. Einer ihrer Verbündeten werden. Und dafür müsste ich ihre Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ein großes Ding drehen! Bummmm! Das sie veranlassen würde, mich einem Verhör zu unterziehen. Das sie glauben lassen würde, ich arbeitete für die Konkurrenz. Schon am nächsten Tag bot sich die Chance. Ich stahl einen Karton, den einer von ihnen auf einem Mauervorsprung hatte stehenlassen, in der Nähe des Gebäudes, das sie besetzt hielten. In dem Karton befanden sich eine Tüte Linsen, einige Medikamentenpackungen, medizinische Rezepte, der Spiegel eines Peugeots und ein Plastikteil, von dem ich nicht wusste, wozu es gut sein sollte. Die Medikamente waren für die Mutter eines rangniederen Bewaffneten. Ich schnappte mir den Karton und rannte los. Zwei Bewaffnete holten mich ein. Sie schossen nicht auf mich, denn sie konnten mich schon bei einem parkenden Auto stellen, bevor sie überhaupt darüber nachdachten, ob sie das Feuer eröffnen sollten. Nicht lange, und ich fand mich in einem Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes der Bewaffneten wieder. Als das »Verhör« begann (ich möchte es gerne so nennen), bat ich um einen Stuhl, um mich setzen zu können. Da ging eine Hand, so leicht oder so schwer wie eine oder anderthalb Tauben, auf meinen Hals nieder. Um keine Tränen zu vergießen, räusperte ich mich, als müsste ich meine Kehle reinigen. Ich hatte mich doch nicht hierherbringen lassen, um Schläge zu empfangen. Außerdem bedeutete ein Schlag auf den Hals, zumindest in der Schule, dass die geschlagene Person bedeutungslos war. Hätte sie Gewicht, würde man ihr ins Gesicht schlagen oder gegen den Kiefer, oder man würde ihr in den Bauch boxen. Das war eine Beleidigung. Aber ich richtete mich auf, kerzengrade, und versuchte, ihnen zu zeigen, wie viel ich aushalten konnte. Außerdem wollte ich, dass sie mich dafür bewunderten. Doch der Anführer der Bewaffneten fragte nur: »Sind die Schulen heute geschlossen?« Er musterte meine Schuluniform und meine Schultasche, und noch bevor ich antwortete, machte die Frage unter den Bewaffneten die Runde. Denn ein plötzliches Schließen der Schulen bedeutete, dass die Sicherheitslage sich verändert hatte und die Bewaffneten in Alarmbereitschaft sein müssten. Im Radio hatten sie aber nichts davon gehört. Und der Karton, den ich hatte mitgehen lassen, gehörte bloß einem bemitleidenswerten Bewaffneten, dessen Aufgabe es war, den anderen Kaffee, Tee und Sandwiches zu machen. Seine Mutter war schwer krank, und er musste eigentlich nach Hause, um ihr eine Linsensuppe zu kochen und die Medizin zu bringen. Doch wegen meines Verhörs war er gezwungen zu bleiben. Das ärgerte ihn, und deshalb war er es gewesen, der mich auf den Hals geschlagen hatte.
Sie jagten mich davon. Mein Plan war vereitelt. Sie hatten mich noch nicht einmal gefragt, warum ich den Karton gestohlen hatte. Doch ich ging nicht weg. Ich kehrte nicht nach Hause oder in die Schule zurück, sondern ich blieb dort. Ich stellte mich in die Nähe des Checkpoints und schaute ihnen zu, wobei ich fest entschlossen war, mich nicht einzumischen, wenn die Bewaffneten auf die Idee kamen, einen Passanten zu schlagen, und selbst wenn es Vater gewesen wäre. Ich war schließlich dort, um mit ihnen einen Handel abzuschließen: Ich wollte ihnen meinen Zwillingsbruder verkaufen. In der Schule hatte ich gehört, wie der Fahrer des Schulbusses mit der Lehrerin für Naturwissenschaften darüber gesprochen hatte, dass einige Bewaffnete mit Organen handelten, besonders mit denen von Kindern. Mein Problem war nun herauszubekommen, welche der Bewaffneten mit Organen handelten und welche nicht. Das hatte der Busfahrer gegenüber der Lehrerin nämlich nicht erwähnt. Und als ich zu ihm ging und danach fragte, spottete er – vielleicht um die Bewunderung der schönen Lehrerin zu gewinnen: »Um das zu wissen, frag sie, ob sie zu den Organliebhabern gehören!« Also musste ich sie selbst danach fragen.





























