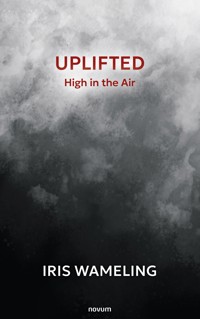19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein kühnes riskantes Spiel sei das Denken" - schreibt Michel de Montaigne in "Philosophieren heißt Sterben lernen": Mitten im Leben wird die Autorin mit einer tödlichen Diagnose und der ihr noch kurzen verbleibenden Lebenszeit konfrontiert. Sie blickt zurück auf ihr Leben, ihre große Liebe und ihre Familie und versucht, unser aller Welt im neuen Licht zu sehen, um Sterben zu lernen. Dabei erkennt sie, dass wahre Schönheit nur im Lichte der Vergänglichkeit sichtbar und das Leben in all seiner Tiefe nur angesichts des Todes erfahrbar wird. Sie versteht, dass in unserem Universum nicht nur alles mit allem verbunden, sondern auch alles Leben in all seinen Formen und Andersartigkeiten lebens- und liebenswert ist, voneinander abhängt und einander bedingt – im Leben und im Sterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-741-9
ISBN e-book: 978-3-99130-742-6
Lektorat: Dr. Angelika Moser
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Ein zweites Leben
„Wie lange?“
Die Frage aller Fragen.
„Ein paar Wochen, vielleicht noch ein paar Monate!“
„Rasch tritt der Tod den Menschen an, es ist ihm keine Frist gegeben.“ Friedrich Schiller in „Wilhelm Tell“1
Welche Frist?
Warum will ich das wissen?
Will ich das überhaupt wissen?
Will irgendjemand, jedefrau, jedermann das wissen?
Ohne Vorwarnung ist er da, der Tod. Irritiert und verstört bin ich allein, konfrontiert allein mit meiner eigenen Wahrnehmung.
Irgendwann in unserer Entwicklung zum Menschen haben wir mit dem Ichbewusstsein das Wissen um unsere Sterblichkeit erworben. Aber leben wir deshalb bewusster, verantwortungsvoller, trauriger, glücklicher?
Wir glauben, dass unsere Artgenossen, die wir als Tiere und damit als Objekte statt Subjekte bezeichnen, ohne Todesbewusstsein sind, weil sie so leben, als gäbe es den Tod nicht.
Was unterscheidet uns dann, wenn sie so leben, als gäbe es ihn nicht – genauso wie wir so leben, als gäbe es ihn nicht. Ist die Wahrheit über den Tod so furchtbar, dass wir so leben müssen, als gäbe es ihn nicht?
„Der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter.“ Bazon Brock2
„Wie wir wissen, ist der Tod unnötig.“ Georges Bataille³
Mit der Nachricht der Diagnose verliere ich die Kontrolle über den tiefen Schmerz, der schon so lange da ist. Warum wird er mir erst jetzt bewusst, obwohl er schon so lange tief in mir ist? Mit der Diagnose bekommt er einen Namen und überwältigt mich, so dass ich von meinem Stuhl in Schräglage rutsche. Wie konnte ich ihn so lange ignorieren? Wie konnte ich ihn überhaupt so lange kontrollieren?
„Sie bekommen ab sofort Opiate. Sie können sich auch gerne wieder hinlegen. Sie müssen nichts mehr aushalten.“
Ich erinnere mich, dass ich vor etwa zwei Jahren eine Treppe hinuntergestürzt bin und so lange bewegungslos liegen blieb, bis ich – nicht mehr betäubt vom Schmerz – mich langsam und vorsichtig aufrichten konnte. Seitdem ist dieser Schmerz mein Begleiter, aber irgendwie konnte ich ihn wohl beherrschen. Ich konnte mich beherrschen.
Von diesem Moment an beherrscht er mich.
Als ich keine Treppe mehr steigen und Tennis nur noch aus dem Stand spielen konnte, ließ ich mich von einem Orthopäden untersuchen, weil ich glaubte, dass ich mir beim Sturz die Hüften verletzt hatte.
„Sie haben vollkommen intakte Hüften, aber wohl ein gynäkologisches Problem.“
Seit unserem Umzug vor fünf Jahren nach Berlin hatte ich es versäumt, mir in der Stadt eine Gynäkologin zu suchen, fuhr deshalb für Vorsorgetermine weiterhin nach München. Aber dazu hatte ich seit zwei Jahren keine Zeit mehr. Meine Arbeit war wie immer wichtiger. Diesmal war mein aktuelles Bauprojekt noch enger eingetaktet, und natürlich haftete ich auch wie immer für die Einhaltung aller Kosten und Termine.
Die Gynäkologin, die ich schließlich nach Projektübergabe aufgesucht habe, untersucht mich gründlich, schließt umgehend ihre Praxis und nimmt mich wortwörtlich an die Hand, um ihre Diagnose mit dem neuen Chefarzt einer nahe gelegenen Klinik abzuklären.
Nun sitzen zwei sehr besonders empathische Menschen vor mir und schauen mich sorgenvoll an.
„Sie haben einen riesigen Tumor, Eierstockkrebs, zu groß, um noch operieren zu können.“
Ich kann es nicht glauben und denke an meine geliebte Tochter, die genau in diesem Krankenhaus vom Vorgänger des vor mir sitzenden Arztes operiert wurde. Sie hatte einen Dermoiden, eine aus Keimzellen gewachsene Zyste am rechten Eileiter. Diese drohte, nach einem Sturz zu platzen. Die Operation war lebensrettend.
Mein Einwand, dass es sich bei mir doch auch um solch einen Dermoiden handeln könnte, wird ruhig und geduldig beantwortet: „Dafür gibt es keine genetische Disposition. Sie haben auch keine Dermoid-Zyste oder Teratom, sondern einen soliden Tumor. Unreife Teratome können sich zwar durchaus zu soliden Tumoren entwickeln, die aber, wenn sie so groß werden, immer entartet sind. Ihrer ist so riesig, dass er den ganzen Bauchraum ausfüllt.“
Hoffnung und Verzweiflung in einem einzigen Herzschlag. Es gibt keinen Ausweg.
Im Bewusstsein, die bestmöglichen Ärzte gefunden zu haben, verliere ich jede Hoffnung. Ich habe keine Zukunft mehr, nur die Erinnerung an einen Augenblick, der mir vor vielen Jahren mit dem Wiedersehen eines Menschen ein ganzes Universum öffnete, was man Leben nennt. Damals begann unser gemeinsames Leben. Als er mich ansprach, genügten zwei Worte, um zu wissen, dass wir eine Welt miteinander bauen und bewohnen werden, wie es vielleicht nur wenigen Menschen gegeben ist. Dies ist nun der Augenblick, der dieses Universum schließt, weil das Leben stirbt, weil mein Leben stirbt.
„Es braucht sehr viele Jahre, dass ein Tumor so groß wird. Warum kommen sie erst jetzt?“
„Wir leben nur einen Wimpernschlag, dann verschwinden wir wieder, und in dieser kurzen Zeitspanne können wir noch nicht einmal das scheinbar Einfachste, die Wirklichkeit erkennen.“ Ferdinand von Schirach4
Ich könnte antworten, dass mein Münchner Gynäkologe ihn dann schon vor zwei Jahren hätte entdecken müssen.
Aber es ist sinnlos, daran noch irgendeinen Gedanken zu verschwenden.
Ich kann auch nicht mehr klar denken und stammle, dass ich einfach keine Zeit hatte, weil ich mein Projekt beenden musste und dieses gerade erst am letzten Wochenende zur Bilderhängung an die Museumsleitung übergeben konnte.
„Und in zwei Wochen habe ich Pressekonferenz, um das Museum der Öffentlichkeit zu übergeben.“
„Bis dahin können wir Sie fit halten. Und ich möchte mir gleich morgen per Bauchspiegelung einen Überblick verschaffen, welche umliegenden Organe betroffen sind. Und da Ihr Hormonspiegel wie bei einem Teenager stark erhöht ist, besteht vielleicht noch die Möglichkeit, den Tumor hormonell anzugreifen beziehungsweise dagegen zu arbeiten.“ Ich habe keinen Zweifel, mich in seine Hände zu begeben, mich ihm vollkommen anzuvertrauen, auch wenn er mir zu verstehen gibt, dass er nicht mehr viel für mich tun kann.
Welche Fügung und welche Tragik zugleich, dass dieser Arzt nicht nur kurz vorher per Headhunter als leitender Chefarzt für diese Klinik gesucht und gefunden wurde, sondern auch mit seinem Wechsel von Düsseldorf nach Berlin alle umliegenden Gynäkologen aufgesucht hat, um sich bei ihnen vorzustellen, damit sie ihm Patientinnen liefern. Meine neue Ärztin wusste sofort, dass sie mich zu diesem Mann mit seinem großen Ehrgeiz, außergewöhnlichen Fähigkeiten und internationalen Ruf für minimalinvasive Operationstechniken bringen musste. Meine persönliche Tragödie ist, dass es für mich zu spät ist.
„Was haben Sie noch vor, was möchten Sie noch tun?“
Es ist Montag und ich plane, am Donnerstag für vier Tage mit meinem Diplomvater, dem berühmten Kollegen, nach Riga zu fliegen. Organisiert vom deutschen Architekturzentrum will er mir, meinem Lebensmenschen und einer kleinen Gruppe von Kollegen seine Geburtsstadt zeigen.
Vor über 25 Jahren waren wir mit diesem Professor in Braunschweig um die Häuser gezogen.
„Wer ist dieser Kerl?“, raunte er mir damals auf dem Rücksitz der Limousine zu. Es klang respektvoll, aber auch eifersüchtig. Mein Freund saß am Steuer und wurde mein Lebensmensch, das größte Glück meines Lebens.
„Wir wussten voneinander. Alles Finden ist Wiederfinden.“ Ferdinand von Schirach5
Als ich ihn das erste Mal sah, fand ich ihn uninteressant. Nicht, dass er mir nicht gefiel.
Wir waren drei Paare an einem Tisch in einer Bar in meiner Heimatstadt, die nicht mehr meine Heimat war, da meine Eltern nach München gezogen waren. Ich hatte gerade erst mein Architekturstudium in Braunschweig begonnen und schlief – zu Besuch in meiner alten Heimatstadt – beim älteren Bruder meines Freundes. Sie alle waren wesentlich älter und gut miteinander bekannt. Es wurde ein interessanter und fröhlicher Abend. Aber seine Frau brachte es tatsächlich fertig, mich vollständig zu ignorieren. Wie konnte er nur mit dieser Frau verheiratet sein?
Daran dachte ich, als ich ihn vier Jahre später wiedersah. Er sprach mich an, und diesmal fühlte sich alles richtig an.
Ich wusste, dass er nicht mehr verheiratet war. Die ganze Welt wusste es. Wir waren vollkommen unbefangen, vertrauten einander und hatten wunderbare Gespräche.
Er hatte mich von diesem Augenblick an in dieser Bar, an einem Polterabend gemeinsamer Freunde, nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich bin in dieser Nacht nicht bei ihm geblieben, obwohl er gefragt hat, sondern fuhr am nächsten Tag zum Skilaufen in die Berge, wo mein damaliger Freund auf mich wartete, weil es so geplant war. Und ich musste erst schwer verunglücken, um in dem einen Augenblick, als ich glaubte, es sei mein letzter, verwundert festzustellen, dass ich ihn doch eigentlich noch wiedersehen wollte. Dann verlor ich mein Bewusstsein.
Er fand mich wieder, wir fanden uns wieder.
„Alles Finden ist Wiederfinden.“5