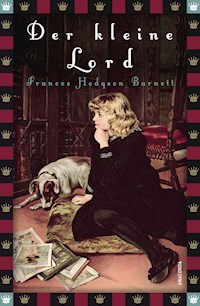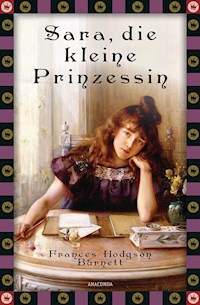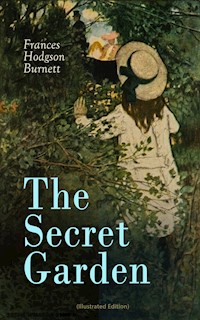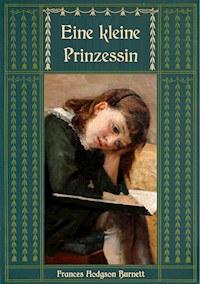
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nachdem Sara Crewe, Tochter eines in Indien lebenden wohlhabenden Vaters, mit sieben Jahren auf ein Mädchenpensionat in London geschickt wird, wird sie von ihren Mitschülerinnen wegen ihrer blühenden Phantasie und ihres Reichtums bald "Prinzessin Sara" genannt - von manchen liebevoll, von anderen spöttisch. Doch der Komfort und die bevorzugte Behandlung finden ein jähes Ende, als Saras Vater verarmt in Indien stirbt. Fortan wird sie in eine Dachkammer verbannt und muß für ihre Unterbringung hart arbeiten. Ihre Phantasie und wenige gute Freunde helfen ihr, nicht zu verzweifeln. Doch dann geschieht etwas Wunderbares ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach dem Text der englischen Erstausgabe:
„A Little Princess“, (1905)
übersetzt von Maria Weber
Inhalt
Kapitel 1: Sara
Kapitel 2: Eine Französischstunde
Kapitel 3: Ermengarde
Kapitel 4: Lottie
Kapitel 5: Becky
Kapitel 6: Die Diamantenminen
Kapitel 7: Wieder die Diamantenminen
Kapitel 8: In der Dachkammer
Kapitel 9: Melchisedek
Kapitel 10: Der indische Gentleman
Kapitel 11: Ram Dass
Kapitel 12: Die andere Seite der Mauer
Kapitel 13: Eine aus der Unterschicht
Kapitel 14: Was Melchisedek hörte und sah
Kapitel 15: Das Wunder
Kapitel 16: Der Besucher
Kapitel 17: „Es ist das Kind!“
Kapitel 18: „Ich habe versucht, nichts anderes zu sein“
Kapitel 19: „Anne“
Vorwort
—
Die ganze Geschichte
ICH weiß nicht, ob vielen Menschen klar ist, wie viel mehr in einer Geschichte wirklich steckt, als jemals geschrieben wurde – wie viele Teile davon nie erzählt werden –, wie viel mehr wirklich passiert ist, als in dem Buch steht, das man in der Hand hält und über das man nachdenkt. Geschichten sind wie Briefe. Wie oft erinnert man sich, nachdem man einen Brief geschrieben hat, an Dinge, die man ausgelassen hat, und sagt sich: „Ach, warum habe ich ihnen nicht davon geschrieben?“ Wenn man ein Buch schreibt, erzählt man alles, woran man sich zu der Zeit erinnert, und wenn man alles erzählen würde, was wirklich passiert ist, würde das Buch vielleicht niemals enden. Zwischen den Zeilen jeder Geschichte befindet sich eine andere Geschichte, die nie gehört wird und nur von den Menschen erraten werden kann, die gut im Raten sind. Die Person, die die Geschichte schreibt, weiß womöglich nicht alles davon, aber manchmal tut sie es doch und wünscht sich, sie hätte die Möglichkeit, noch einmal von vorne zu beginnen.
Als ich die Geschichte von „Sara Crewe“ schrieb, vermutete ich, daß bei Miß Minchin viel mehr passiert war, als ich zu diesem Zeitpunkt herausgefunden hatte. Ich wußte natürlich, daß zwischendurch ganze Kapitel voller Ereignisse vorgefallen sein mußten; und als ich anfing, ein Theaterstück aus dem Buch zu machen und es „A little Princess“ nannte, entdeckte ich drei Akte voller solcher Ereignisse. Was mich am meisten fesselte, war, als ich feststellte, daß es Mädchen an der Schule gab, deren Namen ich vorher nicht einmal gekannt hatte. Es gab ein kleines Mädchen, das Lottie hieß und das eine amüsante kleine Person war. Es gab ein ausgehungertes Küchenmädchen, das Saras ergebene Freundin war; Ermengarde war viel unterhaltsamer, als sie zuerst gewirkt hatte. Es geschahen Dinge in der Dachkammer, auf die in dem Buch niemals hingewiesen worden war; und ein gewisser Herr, der Melchisedek hieß, war ein vertrauter Freund von Sara, der niemals aus der Geschichte hätte herausgelassen werden dürfen, wenn er nur rechtzeitig hineingegangen wäre. Er, Becky und Lottie wohnten bei Miß Minchin, und ich kann nicht verstehen, warum sie sich mir gegenüber zuerst nicht bemerkbar gemacht haben. Sie waren so real wie Sara, und es war nachlässig von ihnen, nicht aus dem Schattenland der Geschichte herauszukommen und zu sagen: „Hier bin ich – erzähle von mir.“ Aber sie taten es nicht – was ihre Schuld war und nicht meine. Personen, die in der Geschichte leben, die jemand schreibt, sollten sich gleich zu Anfang melden und der schreibenden Person auf die Schulter klopfen und sagen: „Hallo, was ist mit mir?“ Wenn sie es nicht tun, kann niemandem als ihnen selbst und ihrer Untätigkeit die Schuld dafür gegeben werden.
Nachdem das Stück „A Little Princess“ in New York produziert worden war und so viele Kinder es besucht und gesehen hatten und Becky, Lottie und Melchisedek mochten, fragten mich meine Verleger, ob ich Saras Geschichte nicht noch einmal schreiben und alle Geschehnisse und Personen, die vorher ausgelassen worden waren, hineinstecken könnte, und so tat ich es; und als ich anfing, stellte ich fest, daß es tatsächlich Seiten über Seiten von Dingen gab, die passiert waren und die noch nicht einmal Eingang in das Stück gefunden hatten, und daher habe ich in diese neue „Kleine Prinzessin“ alles gesteckt, was ich entdecken konnte.
Frances Hodgson Burnett
Kapitel 1
—
Sara
AN einem dunklen Wintertag, als der gelbliche Nebel so dicht und schwer in den Straßen von London hing, daß die Lampen angezündet und die Schaufenster mit Gas erleuchtet werden mußten, wie man es des Nachts tut, saß ein seltsam aussehendes kleines Mädchen mit ihrem Vater in einer Droschke und wurde ziemlich langsam durch die großen Durchgangsstraßen gefahren.
Sie saß mit unter sich verschränkten Füßen da und lehnte sich an ihren Vater, der sie mit seinem Arm umfing, während sie, eine sonderbare, ernste Nachdenklichkeit in ihren großen Augen, aus dem Fenster auf die vorbeigehenden Menschen blickte.
Sie war ein so kleines Mädchen, daß man nicht erwartet hätte, einen solchen Ausdruck in ihrem kleinen Gesicht zu sehen. Es wäre ein zu erwachsener Ausdruck für ein zwölfjähriges Kind gewesen, und Sara Crewe war erst sieben Jahre alt. Tatsache war jedoch, daß sie immer von seltsamen Dingen träumte und darüber nachdachte und sich an keine Zeit erinnern konnte, in der sie nicht über erwachsene Menschen und die Welt, zu der sie gehörten, nachgedacht hatte. Sie hatte das Gefühl, schon seit einer langen Zeit auf der Welt zu sein.
Gerade jetzt war sie in der Erinnerung an die Reise versunken, die sie gerade mit ihrem Vater, Captain Crewe, von Bombay aus unternommen hatte. Sie dachte an das große Schiff, an die indischen Matrosen, die lautlos auf und ab gingen, an die Kinder, die auf dem heißen Deck herumspielten, und an die Frauen einiger junger Offiziere, die mit ihr zu reden versucht, und über die Dinge gelacht hatten, die sie sagte.
Hauptsächlich dachte sie daran, was für eine sonderbare Sache es war, daß man zuerst in Indien in der prallen Sonne und dann mitten im Ozean sein konnte und als nächstes in einem seltsamen Fahrzeug durch seltsame Straßen fuhr, wo der Tag so dunkel war wie die Nacht. Sie fand das so verwirrend, daß sie näher zu ihrem Vater rückte.
„Papa“, sagte sie beinahe flüsternd mit leiser Stimme, „Papa.“
„Was ist los, mein Liebling?“, antwortete Captain Crewe, hielt sie fester und sah ihr ins Gesicht. „Woran denkst du?“
„Ist das der Ort?“, flüsterte Sara und kuschelte sich noch näher an ihn. „Ist er das, Papa?“
„Ja, kleine Sara, das ist er. Wir haben ihn endlich erreicht.“
Und obwohl sie erst sieben Jahre alt war, wußte sie, daß er traurig war, als er es sagte.
Es schien ihr viele Jahre her zu sein, seit er begonnen hatte, ihre Gedanken auf „den Ort“ vorzubereiten, wie sie es immer nannte. Ihre Mutter war gestorben, als sie geboren wurde, darum hatte sie sie nie gekannt oder vermißt. Ihr junger, gutaussehender, reicher, liebevoller Vater schien die einzige Person zu sein, die sie auf der Welt hatte. Sie hatten immer miteinander gespielt und waren einander sehr zugetan. Sie wußte nur, daß er reich war, weil sie dies die Leute sagen gehört hatte, wenn sie dachten, daß sie nicht zuhörte, und sie hatte auch gehört, daß sie ebenfalls reich sein würde, wenn sie einmal erwachsen wäre. Sie wußte nicht, was es bedeutete, reich zu sein. Sie hatte immer in einem schönen Bungalow gelebt und war es gewohnt, viele Diener zu sehen, die sich vor ihr verbeugten und sie „Missee Sahib“ nannten, und sie in allem gewähren ließen, was sie wollte. Sie hatte Spielzeug und Haustiere und eine Ayah gehabt, die sie anbetete, und sie war allmählich zu der Erkenntnis gelangt, daß Leute, die reich waren, diese Dinge hatten. Das war jedoch alles, was sie darüber wußte.
Während ihres kurzen Lebens hatte sie nur eine Sache beunruhigt, und dies war „der Ort“, an den sie eines Tages gebracht werden sollte. Das Klima in Indien war sehr schlecht für Kinder, und sie wurden so bald wie möglich von dort weggeschickt – im allgemeinen nach England und zur Schule. Sie hatte gesehen, wie andere Kinder gegangen waren, und hatte ihre Väter und Mütter über die Briefe sprechen gehört, die sie von ihnen erhalten hatten. Sie hatte gewußt, daß auch sie gehen mußte, und obwohl die Geschichten ihres Vaters über die Reise und das neue Land sie manchmal neugierig gemacht hatten, hatte sie der Gedanke beunruhigt, daß er nicht bei ihr bleiben konnte.
„Könntest du nicht mit mir zu diesem Ort gehen, Papa?“, hatte sie gefragt, als sie fünf Jahre alt war. „Könntest du nicht auch zur Schule gehen? Ich würde dir bei deinen Aufgaben helfen.“
„Aber du wirst nicht sehr lange bleiben müssen, kleine Sara“, hatte er immer gesagt. „Du wirst in ein schönes Haus gehen, in dem es viele kleine Mädchen geben wird, und ihr werdet miteinander spielen, und ich werde dir reichlich Bücher schicken, und du wirst so schnell wachsen, daß es kaum ein Jahr dauert, bis du groß und klug genug bist, um zurückzukommen und dich um Papa zu kümmern.“
Sie mochte die Vorstellung. Den Haushalt für ihren Vater zu führen, mit ihm auszureiten und am Kopfende seines Tisches zu sitzen, wenn er Dinnerpartys gäbe, mit ihm zu reden und seine Bücher zu lesen – das würde ihr von allem in der Welt am liebsten gefallen, und wenn man, um dies zu erreichen, zu „dem Ort“ in England gehen mußte, mußte sie sich eben damit abfinden zu gehen. Sie interessierte sich nicht sehr für andere kleine Mädchen, aber wenn sie reichlich Bücher hätte, könnte sie sich damit trösten. Sie mochte Bücher mehr als alles andere und erfand tatsächlich immer Geschichten von schönen Dingen und erzählte sie sich selbst. Manchmal hatte sie sie ihrem Vater erzählt, und er hatte sie genauso gemocht wie sie.
„Nun, Papa“, sagte sie leise, „wo wir nun einmal hier sind, müssen wir uns wohl damit abfinden, schätze ich.“
Er lachte über ihre altkluge Rede und küßte sie. Er war in Wahrheit überhaupt nicht glücklich darüber, obwohl er wußte, daß er dies geheimhalten mußte. Seine drollige kleine Sara war eine großartige Begleiterin für ihn gewesen, und er glaubte, daß er einsam sein würde, wenn er nach seiner Rückkehr nach Indien in seinen Bungalow gehen und wissen würde, daß ihm keine kleine Gestalt in ihrem weißen Kleidchen entgegenkäme. Also hielt er sie sehr fest in seinem Arm, als die Droschke auf den großen, düsteren Platz rollte, auf dem das Haus stand, das ihr Ziel war.
Es war ein großes, tristes Backsteingebäude, genau wie alle anderen in seiner Reihe, außer daß an der Eingangstür eine glänzende Messingplatte hing, auf der in schwarzen Buchstaben eingraviert stand:
Miß Minchin,
Exklusives Pensionat für junge Damen
„Da sind wir, Sara“, sagte Captain Crewe und ließ seine Stimme so fröhlich wie möglich klingen. Dann hob er sie aus der Kabine, und sie stiegen die Stufen hinauf und läuteten. Sara dachte danach oft, daß das Haus irgendwie genau wie Miß Minchin war. Es war respektabel und gut eingerichtet, aber alles darin war häßlich; und selbst die Sessel waren hart und unbequem. In der Eingangshalle war alles lackiert und poliert – selbst die roten Wangen des Mondgesichtes auf der hohen Uhr in der Ecke hatten ein stark lackiertes Aussehen. Im Salon, in den sie geführt wurden, lag ein mit einem Quadratmuster versehener Teppich, die Stühle waren quadratisch, und auf dem schweren marmornen Kaminsims stand eine schwere Marmoruhr.
Als sie sich auf einen der steifen Mahagonistühle setzte, warf Sara einen ihrer schnellen Blicke umher.
„Ich mag es nicht, Papa“, sagte sie. „Aber andererseits wage ich zu sagen, daß auch Soldaten – selbst die mutigen – es nicht wirklich mögen, in die Schlacht zu ziehen.“
Captain Crewe lachte herzlich darüber. Er war jung und voller Spaß, und er wurde es nie müde, Saras wunderliche Reden zu hören.
„Oh, kleine Sara“, sagte er. „Was soll ich nur tun, wenn ich niemanden mehr habe, der ernste Dinge zu mir sagt? Niemand ist auch nur annähernd so ernst wie du.“
„Aber warum bringen dich ernste Dinge so zum Lachen?“, erkundigte sich Sara.
„Weil es so lustig ist, wenn du sie sagst“, antwortete er und lachte noch mehr. Und dann nahm er sie plötzlich in seine Arme und gab ihr einen Kuß, hörte auf zu lachen und sah fast so aus, als wären ihm Tränen in die Augen gestiegen.
In diesem Moment betrat Miß Minchin den Raum. Sie war ihrem Haus sehr ähnlich, dachte Sara: groß und glanzlos und respektabel und häßlich. Sie hatte große, kalte ausdruckslose Augen und ein breites, kaltes, ausdrucksloses Lächeln. Es vergrößerte sich zu einem sehr breiten Lächeln, als sie Sara und Captain Crewe sah. Sie hatte von der Dame, die ihm ihre Schule empfohlen hatte, sehr viele ansprechende Dinge über den jungen Soldaten gehört. Sie hatte unter anderem gehört, daß er ein reicher Vater wäre, der bereit wäre, viel Geld für seine kleine Tochter auszugeben.
„Es wird ein großes Privileg sein, ein so hübsches und vielversprechendes Kind zu unserem Schützling zu haben, Captain Crewe“, sagte sie, nahm Saras Hand und streichelte sie. „Lady Meredith hat mir von ihrer außergewöhnlichen Klugheit erzählt. Ein kluges Kind ist ein großer Schatz in einer Einrichtung wie der meinen.“
Sara stand ruhig da und hatte den Blick auf Miß Minchins Gesicht gerichtet. Sie dachte wie immer etwas Sonderbares.
„Warum sagt sie, ich sei ein hübsches Kind“, dachte sie. „Ich bin überhaupt nicht hübsch. Colonel Granges kleines Mädchen, Isobel, ist hübsch. Sie hat Grübchen und rosige Wangen und langes goldfarbenes Haar. Ich habe kurzes schwarzes Haar und grüne Augen; außerdem bin ich ein dünnes Kind und überhaupt nicht anmutig. Ich bin eines der häßlichsten Kinder, die ich je gesehen habe. Sie sagt von Anfang an nicht die Wahrheit.“
Sie täuschte sich jedoch, wenn sie dachte, sie sei ein häßliches Kind. Sie war nicht im geringsten wie Isobel Grange, die die Schönheit des Regiments gewesen war, aber sie hatte einen merkwürdigen eigenen Reiz. Sie war ein schlankes, geschmeidiges Ding, ziemlich groß für ihr Alter und hatte ein ausdrucksstarkes, interessantes Gesicht. Ihr Haar war schwer und ziemlich schwarz und nur an den Spitzen gekräuselt; ihre Augen waren zwar grüngrau, aber es waren große, wundervolle Augen mit langen, schwarzen Wimpern, und obwohl sie selbst die Farbe ihrer Augen nicht mochte, taten es viele andere Menschen. Trotzdem war sie fest davon überzeugt, daß sie ein häßliches kleines Mädchen war, und sie war überhaupt nicht entzückt von Miß Minchins Schmeichelei.
„Wenn ich sagen würde, daß sie schön ist“, dachte sie. „dann würde ich wissen, daß ich nicht die Wahrheit sage. Ich glaube, daß ich so häßlich bin, wie sie es ist – auf meine Weise. Warum hat sie es nur gesagt?“
Nachdem sie Miß Minchin länger kannte, erkannte sie, warum sie es gesagt hatte. Sie fand heraus, daß sie jedem Papa und jeder Mama, die ein Kind in ihre Schule brachten, dasselbe sagte.
Sara stand neben ihrem Vater und hörte zu, während er und Miß Minchin sich unterhielten. Sie war zum Pensionat gebracht worden, weil Lady Merediths zwei kleine Töchter dort erzogen worden waren, und Captain Crewe großen Respekt vor Lady Merediths Erfahrung hatte. Sara sollte eine sogenannte „bevorzugte Pensionsschülerin“ sein, und sie sollte noch größere Privilegien genießen als die bevorzugten Pensionsschülerinnen sie für gewöhnlich innehatten. Sie sollte ein hübsches Schlafzimmer und einen eigenen Salon haben; sie sollte ein Pony und eine Kutsche haben und eine Zofe, die an die Stelle der Ayah treten sollte, die in Indien ihr Kindermädchen gewesen war.
„Ich bin nicht im geringsten besorgt um ihre Ausbildung“, sagte Captain Crewe mit seinem fröhlichen Lachen, als er Saras Hand hielt und sie tätschelte. „Die Schwierigkeit wird darin bestehen, sie davon abzuhalten, zu schnell und zu viel zu lernen. Sie steckt ihre kleine Nase zuviel in Bücher. Sie liest sie nicht. Miß Minchin; sie verschlingt sie, als wäre sie ein kleiner Wolf anstatt eines kleinen Mädchens. Sie hungert immer danach, neue Bücher zu verschlingen, und sie möchte erwachsene Bücher – große und dicke in Französisch und Deutsch und Englisch –, Bücher über Geschichte, Biographien, Gedichte und alles Mögliche. Ziehen Sie sie von ihren Büchern weg, wenn sie zu viel liest. Lassen Sie sie auf ihrem Pony reiten oder ausgehen und eine neue Puppe kaufen. Sie sollte mehr mit Puppen spielen.”
„Papa“, sagte Sara. „Sieh doch, wenn ich alle paar Tage ausgehen und eine neue Puppe kaufen würde, hätte ich mehr, als ich liebhaben könnte. Puppen sollten vertraute Freundinnen sein. Emily wird meine vertraute Freundin sein.“
Captain Crewe sah Miß Minchin an und Miß Minchin sah Captain Crewe an.
„Wer ist Emily?“, fragte sie.
„Sag es ihr, Sara“, sagte Captain Crewe lächelnd.
Saras grüngraue Augen blickten sehr ernst und ruhig, als sie antwortete.
„Sie ist eine Puppe, die ich noch nicht habe“, sagte sie. „Sie ist eine Puppe, die Papa für mich kaufen wird. Wir werden zusammen ausgehen, um sie zu finden. Ich habe sie Emily genannt. Sie wird meine Freundin sein, wenn Papa weg ist. Ich möchte, daß sie über ihn spricht.“
Miß Minchins breites, unaufrichtiges Lächeln wurde sehr schmeichelnd.
„Was für ein originelles Kind!“, sagte sie. „Was für ein liebes kleines Ding!“
„Ja“, sagte Captain Crewe und zog Sara an sich. „Sie ist ein liebes kleines Ding. Passen Sie gut auf sie auf. Miß Minchin.“
Sara blieb einige Tage bei ihrem Vater in seinem Hotel. Tatsächlich blieb sie bei ihm, bis er wieder nach Indien zurücksegelte. Sie gingen zusammen aus und besuchten viele große Läden und kauften eine Menge Dinge. Sie kauften tatsächlich viel mehr Dinge, als Sara brauchte; aber Captain Crewe war ein kurzentschlossener, unbedachter junger Mann und wollte, daß sein kleines Mädchen alles hatte, was sie bewunderte und alles, was er selbst bewunderte, so daß sie beide zusammen eine Garderobe ansammelten, die für ein siebenjähriges Kind viel zu groß war. Da waren mit kostbaren Pelzen verbrämte Samtkleider, Spitzenkleider und bestickte Kleider, Hüte mit großen, weichen Straußenfedern, Hermelinmäntel und -muffs sowie Schachteln mit winzigen Handschuhen, Taschentüchern und Seidenstrümpfen in einer solchen Fülle, daß die höflichen jungen Frauen hinter den Ladentheken sich zuflüsterten, daß das seltsame kleine Mädchen mit den großen, ernsten Augen zumindest eine ausländische Prinzessin sein müsse – vielleicht die kleine Tochter eines indischen Rajah. Und ganz zum Schluß fanden sie auch Emily, aber sie gingen in eine Reihe von Spielzeuggeschäften und sahen sich sehr viele Puppen an, bevor sie sie schließlich entdeckten.
„Ich möchte, daß sie so aussieht, als wäre sie in Wirklichkeit keine Puppe“, sagte Sara. „Ich möchte, daß sie so aussieht, als würde sie mir zuhören, wenn ich mit ihr rede. Das Problem mit den Puppen, Papa“ – und sie legte den Kopf schief und dachte darüber nach, als sie es sagte – „das Problem mit den Puppen ist, daß sie nie zuzuhören scheinen.“ Also schauten sie sich große und kleine Puppen an – Puppen mit schwarzen Augen und Puppen mit blauen – Puppen mit braunen Locken und Puppen mit goldenen Zöpfen, angezogene Puppen und ausgezogene Puppen.
„Weißt du“, sagte Sara, als sie eine untersuchten, die keine Kleider hatte, „wenn sie keine Kleider hat, wenn ich sie finde, können wir sie zu einer Schneiderin bringen und ihr passende Sachen machen lassen. Sie passen besser, wenn sie anprobiert werden.“
Nach einer Reihe von Enttäuschungen beschlossen sie, zu Fuß weiterzugehen und in die Schaufenster zu schauen und die Droschke hinter ihnen folgen zu lassen. Sie waren an zwei oder drei Läden vorbeigekommen, ohne überhaupt hineingegangen zu sein, und näherten sich gerade einem Geschäft, das nicht sehr groß war, als Sara plötzlich zusammenfuhr und den Arm ihres Vaters packte.
„Oh, Papa!“, rief sie. „Da ist Emily!“
Ihr Gesicht war etwas gerötet, und in ihren grüngrauen Augen lag ein Ausdruck, als hätte sie gerade jemanden erkannt, mit dem sie vertraut war und den sie sehr mochte.
„Sie wartet tatsächlich auf uns!“, sagte sie. „Laß uns zu ihr hineingehen.“
„Du liebe Güte!“, sagte Captain Crewe. „Ich habe das Gefühl, wir sollten jemanden haben, der uns einander vorstellt.“
„Du mußt mich vorstellen und ich werde dich vorstellen“, sagte Sara. „Aber ich erkannte sie sofort, als ich sie sah – vielleicht erkannte sie mich auch.“
Vielleicht hatte sie sie erkannt. Sie hatte jedenfalls einen sehr intelligenten Ausdruck in den Augen, als Sara sie in die Arme nahm. Sie war eine große Puppe, aber nicht zu groß, um sie leicht herumzutragen.
Sie hatte natürlich gelocktes goldbraunes Haar, das wie ein Mantel um sie hing, und ihre Augen waren von einem tiefen, klaren, grauen Blau und hatten weiche, dicke Wimpern, die echte Wimpern waren, und keine bloßen gemalten Linien.
„Aber ja“, sagte Sara und sah ihr ins Gesicht, als sie sie auf den Knien hielt, „natürlich ist das Emily, Papa.“
Also wurde Emily gekauft und tatsächlich in ein Geschäft für Kinderausstatter gebracht und für eine Garderobe vermessen, die so großartig war wie Saras eigene. Sie bekam ebenfalls Spitzenkleider und außerdem Kleider aus Samt und Musselin, Hüte und Mäntel und wunderschöne Unterwäsche mit Spitzenbesatz sowie Handschuhe und Taschentücher und Pelze.
„Ich möchte, daß sie immer so aussieht, als wäre sie ein Kind einer guten Mutter“, sagte Sara. „Ich bin ihre Mutter, wenn ich auch eine Gefährtin aus ihr machen werde.“
Captain Crewe hätte das Einkaufen wirklich sehr genossen, aber jener traurige Gedanke nagte immer wieder an seinem Herzen. Dies alles bedeutete, daß er von seiner geliebten, drolligen kleinen Kameradin getrennt werden würde.
Mitten in dieser Nacht stand er auf und sah auf Sara herab, die mit Emily im Arm schlief. Ihr schwarzes Haar war auf dem Kopfkissen ausgebreitet, und Emilys goldbraunes Haar vermischte sich damit, beide hatten spitzenbesetzte Nachthemden, und beide hatten lange Wimpern, die auf ihren Wangen lagen. Emily sah so sehr aus wie ein echtes Kind, daß Captain Crewe froh war, daß sie da war. Er seufzte tief und zog mit einem jungenhaften Ausdruck an seinem Schnurrbart.
„Ach, kleine Sara!“, sagte er zu sich selbst. „Ich glaube nicht, daß du weißt, wie sehr dein Papa dich vermissen wird.“
Am nächsten Tag brachte er sie zu Miß Minchin und ließ sie dort zurück. Sein Schiff sollte am nächsten Morgen ablegen. Er erklärte Miß Minchin, daß seine Anwälte, die Herren Barrow & Skipworth, für seine Angelegenheiten in England verantwortlich wären und sie sich, wenn sie Fragen hätte, an sie wenden könnte. Auch würden sie die Rechnungen bezahlen, die sie ihnen für Saras Ausgaben senden würde. Er würde Sara zweimal in der Woche schreiben, und ihr sollte jedes Vergnügen gewährt werden, um das sie bäte.
„Sie ist ein vernünftiges kleines Ding, und sie verlangt nie etwas, das man ihr nicht mit gutem Gewissen geben könnte“, sagte er.
Dann ging er mit Sara in ihren kleinen Salon und sie verabschiedeten sich voneinander. Sara setzte sich auf seine Knie, faßte mit ihren kleinen Händen das Revers seines Mantels und sah ihm lange und fest ins Gesicht.
„Versuchst du mich auswendig zu lernen, kleine Sara?“, fragte er und strich ihr übers Haar.
„Nein“, antwortete sie. „Ich kenne dich in- und auswendig. Du bist in meinem Herzen.“ Und sie legten ihre Arme umeinander und küßten sich, als würden sie sich niemals gehen lassen.
Als die Droschke davonfuhr, saß Sara auf dem Boden ihres Salons, und verfolgte, die Hände unter dem Kinn verschränkt, ihren Kurs mit den Augen, bis sie um die Ecke des Platzes gebogen war. Emily saß neben ihr, und sie sah ebenfalls der Droschke nach. Als Miß Minchin ihre Schwester, Miß Amelia, schickte, um nachzusehen, was das Kind tat, stellte diese fest, daß sie die Tür nicht öffnen konnte.
„Ich habe sie abgeschlossen“, sagte eine drollige, höfliche kleine Stimme von innen. „Ich möchte jetzt bitte ganz alleine sein.“
Miß Amelia war rundlich und plump und hatte große Ehrfurcht vor ihrer Schwester. Sie war wirklich die gutmütigere Person der beiden, aber sie gehorchte Miß Minchin stets. Sie ging wieder die Treppe hinunter und sah beinahe beunruhigt aus.
„Ich habe noch nie ein so seltsames altkluges Kind gesehen, Schwester“, sagte sie. „Sie hat sich eingesperrt und macht nicht den geringsten Lärm.“
„Das ist viel besser, als wenn sie um sich schlagen und kreischen würde, wie manche von ihnen“, antwortete Miß Minchin. „Ich hatte erwartet, daß ein so verwöhntes Kind das ganze Haus in Aufruhr versetzen würde. Wenn jemals einem Kind in allem willfahren wurde, dann diesem.“
„Ich habe ihre Koffer geöffnet und ihre Sachen eingeräumt“, sagte Miß Amelia. „Dergleichen habe ich noch nie gesehen – Zobel und Hermelin an ihren Mänteln und echte Valenciennes-Spitze an ihrer Unterwäsche. Du hast einige ihrer Kleider gesehen. Was hältst du davon?“
„Ich halte sie für vollkommen lächerlich“, antwortete Miß Minchin scharf; „aber sie werden sich sehr gut ganz vorn an der Reihe machen, wenn wir die Schulkinder am Sonntag zur Kirche bringen. Sie ist ausgestattet, als ob sie eine kleine Prinzessin wäre.“
Sara und Emily saßen oben im verschlossenen Zimmer auf dem Boden und starrten auf die Ecke, um welche die Droschke verschwunden war, während Captain Crewe zurückblickte und winkte und ihr Küsse zublies, als könnte er es nicht ertragen, damit aufzuhören.
Kapitel 2
—
Eine Französischstunde
ALS Sara am nächsten Morgen das Schulzimmer betrat, schauten sie alle mit neugierigen Blicken an. Zu diesem Zeitpunkt hatte jede Schülerin – von Lavinia Herbert, die beinahe dreizehn Jahre alt war und sich ziemlich erwachsen fühlte, bis zu Lottie Legh, die erst vier Jahre alt und das Küken der Schule war – bereits viel über sie gehört. Sie wußten sehr genau, daß sie Miß Minchins Vorzeigeschülerin war und als Stolz der Einrichtung galt. Eine oder zwei von ihnen hatten sogar einen Blick auf ihre französische Zofe Mariette erhascht, das am Abend zuvor angekommen war. Lavinia war es gelungen, an Saras Zimmer vorbeizukommen, als die Tür geöffnet war, und hatte Mariette gesehen, wie sie eine Kiste geöffnet hatte, die spät von einem Laden angeliefert worden war.
„Sie war voller Petticoats mit Spitzenrüschen – Rüschen über Rüschen“, flüsterte sie ihrer Freundin Jessie zu, als sie sich über ihre Geographieaufgaben beugte. „Ich habe gesehen, wie sie sie ausgeschüttelt hat. Ich habe gehört, wie Miß Minchin zu Miß Amelia gesagt hat, daß ihre Kleider so prächtig aussähen, daß sie für ein Kind lächerlich wären. Meine Mama sagt, Kinder sollten einfach angezogen sein. Sie hat jetzt einen dieser Petticoats an. Ich habe ihn gesehen, als sie sich setzte.“
„Sie hat Seidenstrümpfe an!“, flüsterte Jessie und beugte sich ebenfalls über ihre Geographieaufgaben. „Und was für kleine Füße sie hat! Ich habe noch nie so kleine Füße gesehen.“
„Oh“, schniefte Lavinia boshaft, „das liegt am Schnitt ihrer Schuhe. Meine Mutter sagt, daß man auch große Füße klein aussehen lassen kann, wenn man einen geschickten Schuhmacher hat. Ich finde sie überhaupt nicht hübsch. Ihre Augen haben so eine sonderbare Farbe.“
„Sie ist nicht hübsch wie andere hübsche Leute“, sagte Jessie und warf einen verstohlenen Blick durch den Raum. „Aber sie bringt einen dazu, sie noch einmal anzusehen. Sie hat unglaublich lange Wimpern, aber ihre Augen sind fast grün.“
Sara saß ruhig auf ihrem Platz und wartete darauf, daß man ihr sagte, was sie tun sollte. Sie war in die Nähe von Miß Minchins Pult gesetzt worden. Sie war trotz der vielen Augenpaare, die sie beobachteten, nicht verlegen. Sie war neugierig und schaute ruhig zu den Kindern zurück, die sie ansahen. Sie fragte sich, woran sie dachten und ob sie Miß Minchin mochten, ob sie ihren Unterricht mochten und ob eine von ihnen einen Papa hatte, der wie ihr eigener war. Sie hatte an diesem Morgen ein langes Gespräch mit Emily über ihren Papa geführt.
„Er ist jetzt auf dem Meer, Emily“, hatte sie gesagt. „Wir müssen sehr gute Freundinnen sein und einander alles erzählen. Emily, sieh mich an. Du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe – aber ich wünschte, du könntest sprechen.“
Sie war ein Kind voller Phantasie und wunderlicher Gedanken, und eine ihrer Vorstellungen war, daß es eine Menge Trost spenden würde, auch nur so zu tun, als ob Emily am Leben wäre und wirklich zuhören und verstehen würde. Nachdem Mariette sie in ihr dunkelblaues Schulkostüm gekleidet und ihr Haar mit einem dunkelblauen Band zusammengebunden hatte, ging sie zu Emily, die auf ihrem eigenen Stuhl saß, und gab ihr ein Buch.
„Du kannst das hier lesen, während ich unten bin“, sagte sie; und als sie bemerkte, daß Mariette sie neugierig ansah, sagte sie sie mit einem ernsten Gesicht zu ihr:
„Ich glaube“, sagte sie, „daß Puppen Dinge tun können, die sie uns nichts wissen lassen wollen. Vielleicht kann Emily wirklich lesen und sprechen und gehen, aber sie wird es nur tun, wenn niemand im Zimmer ist. Es ist ihr Geheimnis. Wissen Sie, wenn die Leute wüßten, daß Puppen solche Dinge tun können, würden sie sie zum Arbeiten zwingen. Deswegen haben die Puppen sich vielleicht miteinander abgesprochen, es geheimzuhalten. Wenn Sie im Zimmer bleiben, wird Emily einfach dasitzen und ins Leere blicken; aber wenn Sie hinausgehen, beginnt sie vielleicht zu lesen oder geht zum Fenster und sieht hinaus. Wenn sie dann eine von uns kommen hört, wird sie einfach zurückrennen, auf ihren Stuhl springen und so tun, als ob sie die ganze Zeit dort gewesen wäre.“
„Comme elle est drôle!“, sagte Mariette zu sich selbst, und als sie die Treppe hinunterging, erzählte sie dem obersten Hausmädchen davon. Aber sie hatte bereits begonnen, dieses seltsame kleine Mädchen zu mögen, das ein so intelligentes Gesicht und so perfekte Manieren hatte. Sie hatte zuvor Kinder gehütet, die nicht so höflich waren. Sara war eine sehr freundliche kleine Person und hatte eine höfliche, anerkennende Art zu sagen: „Könnten Sie bitte, Mariette“ und „Danke, Mariette“, was ganz bezaubernd war. Mariette erzählte dem obersten Hausmädchen, daß sie sich bei ihr bedankte, als würde sie sich bei einer Dame bedanken.
„Elle a l'air d'une princesse, cette petite“, sagte sie. In der Tat war sie sehr zufrieden mit ihrer neuen kleinen Herrin und mochte ihre Anstellung sehr.
Nachdem Sara einige Minuten auf ihrem Platz im Schulzimmer gesessen hatte und von den Schülern angeschaut worden war, klopfte Miß Minchin achtunggebietend auf ihr Pult.
„Junge Damen“, sagte sie, „ich möchte euch eure neue Kameradin vorstellen.“ Alle kleinen Mädchen standen von ihren Plätzen auf, und Sara erhob sich ebenfalls. „Ich erwarte von euch allen, daß ihr liebenswürdig zu Miß Crewe seid; sie ist gerade aus großer Entfernung zu uns gekommen – tatsächlich aus Indien. Sobald der Unterricht vorbei ist, müßt ihr euch gegenseitig kennenlernen.“
Die Schülerinnen verbeugten sich förmlich und Sara machte einen kleinen Knicks, und dann setzten sie sich wieder und sahen einander an.
„Sara“, sagte Miß Minchin in ihrem Schulzimmertonfall, „komm zu mir.“
Sie hatte ein Buch vom Pult genommen und blätterte darin. Sara ging höflich zu ihr.
„Da dein Papa eine französische Zofe für dich eingestellt hat“, begann sie, „komme ich zu dem Schluß, daß er wünscht, daß du dich besonders der französischen Sprache widmest.“
Sara fühlte sich etwas unbehaglich.
„Ich denke, er hat sie eingestellt“, sagte sie, „weil er – weil er dachte, ich würde sie mögen, Miß Minchin.“
„Ich fürchte“, sagte Miß Minchin mit einem etwas säuerlichen Lächeln, „daß du bisher ein sehr verwöhntes kleines Mädchen gewesen bist und glaubst, daß die Dinge immer so getan werden, wie du es willst. Mein Eindruck ist, daß dein Papa wünscht, daß du Französisch lernst.“
Wenn Sara älter oder weniger peinlich darauf bedacht gewesen wäre, höflich gegenüber anderen Menschen zu sein, hätte sie sich in wenigen Worten erklären können. Aber so wie es war, fühlte sie, wie ihre Wangen sich röteten. Miß Minchin war eine sehr strenge und imposante Person, und sie schien sich so sicher zu sein, daß Sara keinerlei Französischkenntnisse hatte, daß sie das Gefühl hatte, es wäre beinahe unhöflich, sie zu korrigieren. Die Wahrheit war, daß Sara sich an keine Zeit erinnern konnte, zu der sie kein Französisch gesprochen hatte. Ihr Vater hatte es oft mit ihr gesprochen, als sie noch klein gewesen war. Ihre Mutter war Französin gewesen, und Captain Crewe hatte ihre Sprache geliebt, so daß Sara es immer gehört hatte und damit vertraut war.
„Ich – ich habe nie wirklich Französisch gelernt, aber – aber – “, begann sie und versuchte schüchtern, sich verständlich zu machen.
Es war eine der größten geheimen Schwächen Miß Minchins, daß sie selbst kein Französisch beherrschte, und sie war bestrebt, die irritierende Tatsache zu verbergen. Sie hatte daher nicht die Absicht, die Angelegenheit zu erörtern und sich durch die Befragung einer neuen kleinen Schülerin eine Blöße zu geben.
„Das reicht“, sagte sie säuerlich. „Wenn du es nicht gelernt hast, mußt du sofort damit beginnen. Der Französischlehrer, Monsieur Dufarge, wird in wenigen Minuten hier sein. Nimm dieses Buch und sieh es dir an, bis er eintrifft.“
Saras Wangen brannten. Sie ging zu ihrem Platz zurück und schlug das Buch auf. Sie sah mit ernstem Gesicht auf die erste Seite. Sie wußte, daß es unhöflich sein würde zu lächeln, und sie war sehr entschlossen, nicht unhöflich zu sein. Aber es war sehr komisch, daß sie eine Seite lesen sollte, auf der stand, daß „le père“ „der Vater“ und „la mère“ „die Mutter“ bedeutete.
Miß Minchin sah sie prüfend an.
„Du siehst ziemlich verärgert aus, Sara“, sagte sie. „Es tut mir leid, daß dir der Gedanke, Französisch zu lernen, nicht gefällt.“
„Ich mag es sehr“, antwortete Sara, die dachte, daß sie es noch einmal versuchen könnte, „aber – “
„Du darfst nicht ‚aber‘ sagen, wenn man dich zu etwas auffordert“, sagte Miß Minchin. „Sieh wieder in dein Buch.“
Und Sara tat es und lächelte nicht, selbst als sie las, daß „le fils“ „der Sohn“ und „le frère“ „der Bruder“ bedeutete.
„Wenn Monsieur Dufarge kommt“, dachte sie, „kann ich es ihm erklären.“
Monsieur Dufarge traf sehr bald darauf ein. Er war ein sehr freundlicher, intelligenter Franzose mittleren Alters, und er sah neugierig aus, als sein Blick auf Sara fiel, die artig versuchte, sich in ihren kleinen Sprachführer zu vertiefen.
„Ist dies eine neue Schülerin für mich, Madame?“, sagte er zu Miß Minchin. „Ich hoffe, ich habe das Vergnügen.“
„Ihr Papa – Captain Crewe – ist sehr darauf bedacht, daß sie die Sprache lernt. Aber ich fürchte, sie hat ein kindisches Vorurteil dagegen gefaßt. Sie scheint sie nicht lernen zu wollen“, sagte Miß Minchin.
„Das tut mir leid, Mademoiselle“, sagte er freundlich zu Sara. „Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, daß es eine charmante Sprache ist, wenn wir einmal angefangen haben, es zusammen zu lernen.“
Sara erhob sich von ihrem Platz. Sie begann sich ziemlich verzweifelt zu fühlen, fast, als wäre sie in Ungnade gefallen. Sie sah mit ihren großen, grüngrauen Augen zu Monsieur Dufarge auf, und bat ihn stumm um Verzeihung. Sie wußte, daß er es verstehen würde, sobald sie sprach. Sie fing an, es mühelos in hübschem und fließendem Französisch zu erklären. Madame hätte nicht verstanden. Sie hätte nicht wirklich Französisch gelernt – nicht aus Büchern –, aber ihr Papa und andere Leute hätten es immer mit ihr gesprochen, und sie hätte es gelesen und geschrieben, so wie sie Englisch gelesen und geschrieben hätte. Ihr Papa liebte es, und sie liebte es, weil er es tat. Ihre liebe Mama, die bei ihrer Geburt gestorben sei, wäre Französin gewesen. Sie wäre froh, alles zu lernen, was Monsieur ihr beibringen würde, aber was sie Madame zu erklären versucht hätte, war, daß sie die Wörter in diesem Buch bereits kannte – und sie streckte das kleine Wörterbuch aus.
Als sie anfing zu sprechen, fuhr Miß Minchin ziemlich heftig zusammen und starrte sie beinahe empört über ihre Brille hinweg an, bis sie fertig war. Monsieur Dufarge begann zu lächeln, und es war ein sehr erfreutes Lächeln. Wenn er diese hübsche kindliche Stimme so einfach und charmant seine eigene Sprache sprechen hörte, fühlte er sich fast in seine Heimat versetzt – welche an dunklen, nebligen Tagen in London manchmal Welten entfernt schien. Als sie fertig war, nahm er ihr den Sprachführer mit einem beinahe liebevollen Blick ab. Aber er sprach zu Miß Minchin.
„Ach, Madame“, sagte er, „es gibt nicht viel, was ich ihr beibringen kann. Sie hat Französisch nicht gelernt; sie ist Französin. Ihre Aussprache ist vorzüglich.“
„Du hättest es mir sagen sollen“, rief Miß Minchin, die sehr beschämt war, an Sara gewandt.
„Ich – ich habe es versucht“, sagte Sara. „Ich – ich nehme an, ich habe es nicht richtig angefangen.“
Miß Minchin wußte, daß sie es versucht hatte und daß es nicht ihre Schuld war, daß sie es nicht erklären durfte. Und als sie sah, daß die Schülerinnen zugehört hatten und Lavinia und Jessie hinter ihrer französischen Grammatik kicherten, wurde sie wütend.
„Still, junge Damen!“, sagte sie streng und klopfte auf das Pult. „Seid sofort still!“
Und von dieser Minute an begann sie einen ziemlichen Groll gegen ihre Vorzeigeschülerin zu hegen.
Kapitel 3
—
Ermengarde
ALS Sara an diesem ersten Morgen an Miß Minchins Seite saß und sich bewußt war, daß jeder im Schulzimmer sie beobachtete, bemerkte sie sehr bald ein kleines Mädchen in etwa ihrem Alter, das sie mit einem Paar hellen, eher stumpfen blauen Augen anstarrte. Sie war ein pummeliges Kind, das nicht so aussah, als wäre es im mindesten schlau, aber sie hatte einen gutmütigen Schmollmund. Ihr flachsfarbenes Haar war zu einem straffen Zopf geflochten, der mit einem Band zusammengebunden war, und sie hatte diesen Zopf um ihren Hals gezogen und kaute am Ende des Bandes, wobei sie die Ellbogen auf das Pult gelegt hatte, während sie die neue Schülerin verwundert anstarrte. Als Monsieur Dufarge anfing, mit Sara zu sprechen, wirkte sie etwas verängstigt. und als Sara vortrat, ihn mit unschuldigen Augen bittend ansah und ihm ohne Vorwarnung auf Französisch antwortete, fuhr das dicke kleine Mädchen erschrocken zusammen und wurde vor Erstaunen ganz rot. Nachdem sie wochenlang vergebliche Tränen geweint hatte, bei dem Versuch, sich daran zu erinnern, daß „la mère“ „die Mutter“ und „le père“ „der Vater“ bedeutete, war es fast zu viel für sie, plötzlich einem gleichaltrigen Kind zuzuhören, das mit diesen Worten nicht nur vertraut zu sein schien, sondern anscheinend eine beliebige Anzahl anderer kannte und sie mit Verben verbinden konnte, als wären sie bloße Kleinigkeiten.
Sie starrte so angestrengt und kaute so fest auf dem Band an ihrem Zopf, daß sie die Aufmerksamkeit von Miß Minchin auf sich zog, die im Moment äußerst aufgebracht war und sich sofort auf sie stürzte.
„Miß St. John!“, rief sie streng. „Was soll dieses Verhalten? Nimm deine Ellbogen herunter! Nimm das Band aus deinem Mund! Setz dich gerade hin!“
Darauf fuhr Miß St. John ein weiteres Mal zusammen, und als Lavinia und Jessie kicherten, wurde sie röter als je zuvor – so rot, daß sie fast aussah, als ob Tränen in ihre armen, stumpfen, kindlichen Augen schießen würden; und Sara sah sie an, und sie tat ihr so leid, daß sie eine Zuneigung zu ihr faßte und ihre Freundin sein wollte. Es war ihre Art, daß sie immer zur Hilfe eilen wollte, wenn sich jemand unwohl oder unglücklich fühlte.
„Wenn Sara ein Junge gewesen wäre und vor ein paar Jahrhunderten gelebt hätte“, pflegte ihr Vater zu sagen, „wäre sie mit gezogenem Schwert durch das Land gezogen, um jeden in Not zu retten und zu verteidigen. Sie will immer kämpfen, wenn sie sieht, daß Menschen in Schwierigkeiten sind.“
Also begann sie die pummelige, langsame kleine Miß St. John zu mögen, und schaute den ganzen Morgen zu ihr hinüber. Sie sah, daß der Unterricht für sie keine leichte Angelegenheit war und keine Gefahr bestand, daß sie jemals verwöhnt würde, indem sie als Vorzeigeschülerin behandelt würde. Ihre Französischstunde war eine traurige Vorführung. Ihre Aussprache brachte sogar Monsieur Dufarge zum Lächeln, und Lavinia und Jessie und die glücklicheren Mädchen kicherten oder sahen sie verächtlich an. Aber Sara lachte nicht. Sie versuchte so zu tun, als hätte sie nichts gehört, als Miß St. John „le bon pain“ „lee bong peng“ aussprach. Sie hatte ein hitziges Temperament und sie wurde ziemlich wütend, als sie das Kichern hörte und das arme, dümmliche, verzweifelte Gesicht des Kindes sah.
„Es ist wirklich nicht lustig“, sagte sie zwischen den Zähnen, als sie sich über ihr Buch beugte. „Sie sollten nicht lachen.“
Als der Unterricht zu Ende war und die Schülerinnen sich in Gruppen versammelten, um sich zu unterhalten, machte sich Sara auf die Suche nach Miß St. John und fand sie ziemlich trostlos auf einem Fenstersitz zusammengekauert. Sie ging zu ihr hinüber und sprach sie an. Sie sagte nur das, was kleine Mädchen immer zueinander sagen, um eine Bekanntschaft zu schließen, aber Sara