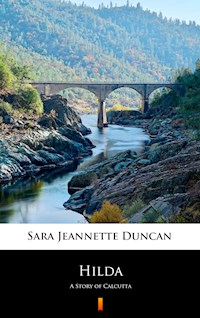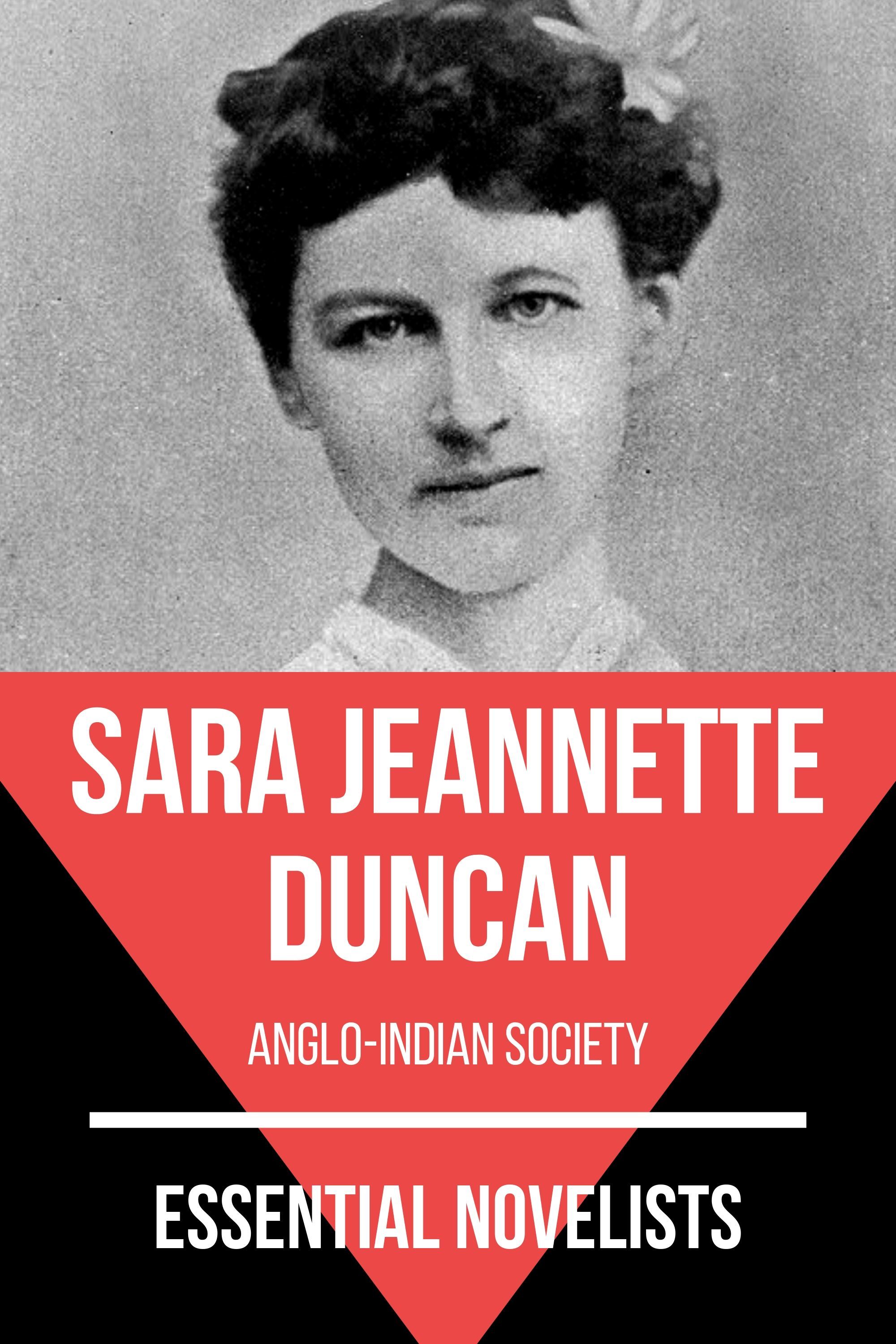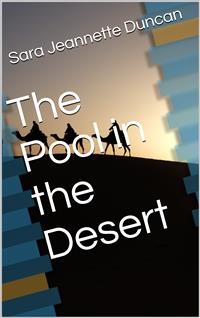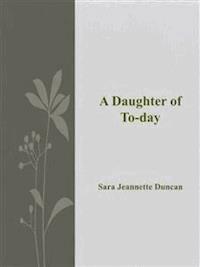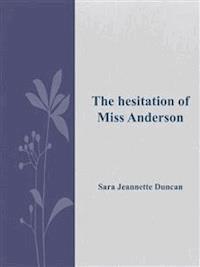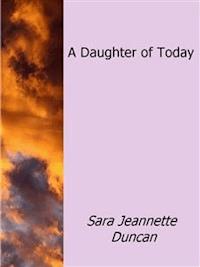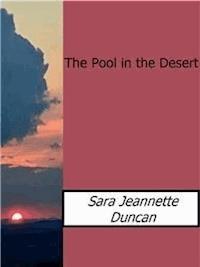Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mutter werden ist nicht schwer, Mutter sein dagegen sehr. Mit dem abgewandelten Zitat von Wilhelm Busch läßt sich 'A Mother in India' von Sara Duncan auf die einfachste Formel bringen. Einundzwanzig Jahre dauert es, bis die Mutterschaft von Helena Farnham auf die Probe gestellt wird. Die Frau eines Soldaten in Indien muß den kränkelnden Säugling zu Verwandten nach England in Pflege geben. Was sie zurückbekommt, ist eine stattliche junge Frau im heiratsfähigen Alter, die bedauerlicherweise so gar nicht ihrer Vorstellung entspricht. Ausgerechnet in dem makellosen Charakter der Tochter vermag sich die Mutter nicht wiederzuerkennen. Denn Cecily verkörpert eine Gesellschaft, die Helena, die den größten Teil ihres Lebens an der Grenze des Kolonialreichs verbracht hat, inzwischen fremd geworden ist. Und so spiegelt Duncan am Beispiel einer Situation sublimer Konkurrenz die Entfremdung zwischen Mutter und Tochter ebenso wie zwischen Mutterland und Kolonie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Mutter in Indien
Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6NachwortImpressumKapitel 1
Es gab Zeiten, da mußten wir auf den Pudding verzichten, um Johns Uniformrechnungen zu bezahlen, und ich machte die Kragenspiegel mit einem Stoffball, um keine neuen kaufen zu müssen. Ich hätte auch sein Schwert geputzt, wenn man mich gelassen hätte. Ichliebtesein Schwert. Und ich erinnere mich, wie wir einmal unserendogcartselbst anmalten und lackierten, um fünfzig Rupien zu sparen, und wie schick er danach aussah. Wir hatten nichts als unseren Sold – John hatte seine Kompanie, als wir heirateten, aber was ist das schon? – und das Leben bestand aus kleinen, wohlbedachten Einsparungen, rückblickend spaßiger als in der Praxis. Wir waren arm wie die Kirchenmäuse, das ist unbestreitbar, und arm und gewissenhaft, was schlimmer war. Eine dicke fette Spinne von Geldverleiher betrat eines Tages unsere Veranda und köderte uns – wir lebten in einer Hütte, aber sie hatte eine Veranda – und John drohte, ihn bei der Polizei anzuzeigen. Arm, während alle anderen genug besaßen, um auf die großzügige indische Art zu leben, das war es, was es so schwer machte. Wir waren allein in unserem kleinen elenden Alltag. Als wir Cecily erwarteten, gaben wir vor, entzückt zu sein, im Wissen, daß uns der ganze Stützpunkt bemitleidete, und als Cecily dann da war, begleitet von einer Flut an Ausgaben, wahrten wir hervorragend den Schein. Sie war empfindlich, das arme kleine Ding, und drohte von Anfang an zu krampfen, dabei wußten wir beide, es wäre abnormal, sie nicht bedingungslos zu lieben, mehr als das Leben, sofort und immer mehr. Und wir unternahmen wirklich alles, das Thermometer auf 102 und mit einer Krankenschwester, die uns schließlich verließ, als sie feststellte, daß wir fürs Gedeck von Jedem nur sechs hatten. Um die Tugenden eines Gatten zu erkennen, muß man arm heiraten. Das Regiment verfügte wie üblich über zu wenige Offiziere, und John mußte bei Tage dreimal die Woche den Appell abnehmen; trotzdem ging er mit Cecily bis zwei Uhr morgens, wenn es ein wenig abkühlte, die Veranda auf und ab. Ich lag für gewöhnlich die übrige Nacht wach, in der Furcht, ein Skorpion würde von der Decke auf sie fallen. Nichtsdestotrotz hatten wir die allerbeste Einstellung, was Cecily betraf; wir fürchteten uns nicht so schrecklich, ihr gegenüber unsere Pflichten zu vernachlässigen als gegenüber den Maßstäben der Menschheit. Wir taten wirklich alles, damit es an nichts fehlte. Als zu gering für den eigenen Platz in der Natur befunden zu werden, wäre abscheulich gewesen. Wir unterhielten uns stundenlang über sie, selbst wenn Johns Dienstpferd Rotz zu bekommen drohte, und ich bemerkte, wie seine Gedanken beständig zu den Ställen abwanderten. Ich sagte John dann, daß sie etwas Neues in unser Leben brachte – das war wirklich so! – woraufhin John sagte „Ich weiß, was du meinst.“ und fortfuhr vorherzusagen, daß sie uns „verbinden“ würde. Wir mußten nicht verbunden werden; dort in der Einöde eines Vorpostens in der Wüste waren wir mehr füreinander als die meisten Eheleute, aber es schien uns angemessen und hoffnungsvoll, daran zu glauben, und deshalb glaubten wir daran. Natürlich wäre uns eine Prüfung nicht erspart geblieben, schließlich waren wir keine Monster, aber das Schicksal kam der Gelegenheit zuvor. Sie war gerade fünf Wochen, als uns der Arzt erklärte, wir müßten sie entweder nach Hause schaffen oder wir würden sie verlieren, und den folgenden Tag lag John mit Typhus darnieder. Also schickten wir Cecily mit der Frau eines Sergeanten nach Hause, die ihre Zwillingen verloren hatte, und ich widmete mich unter Anleitung des Arztes dem Kampf um das Leben meines Mannes, ohne Eis oder geeignete Nahrung oder irgendwelche Annehmlichkeiten des Krankenzimmers. Ach, Fort Samila! Wo die Sonne vom Sand herauf blendet! Wie dem auch sei, das ist inzwischen lange her. Ich überließ das Kind bereitwillig Mrs. Berry und der Vorsehung und quälte mich nicht. Meine Fähigkeit zur Sorge war vollkommen ausgeschöpft. Mrs. Berrys Brief, in dem sie ausführte, daß es dem Kind während der Reise zunehmend besser ging und sie wohlbehalten angekommen waren, traf, wie ich mich erinnere, an dem Tag ein, an dem John zum ersten Mal wieder einen Bissen feste Nahrung zu sich nehmen durfte. Es war ein langer Kampf gewesen. „Armes kleines Wesen.“ sagte er, als ich ihm laut vorlas; danach wurde Cecily eine Episode.
Sie war zu den Leuten meines Mannes gekommen; es war die beste Lösung. Wir waren froh, daß es möglich war; so viele Kinder mußten an Fremde und Mietlinge weggegeben werden. Gegenüber einem unglücklichen Kind, das in die Welt gesetzt und seinem Schicksal überlassen werden muß, erwies sich der sichere Hafen seiner Großmutter und seiner Tanten Emma und Alice gewiß als vorteilhaft. Ich hatte absolut keinen Grund zur Besorgnis, wie ich den Leuten oft erklärte, die sich fragten, ob ich nicht dennoch ein wenig davon besäße. Ich wußte, daß nichts über die gewissenhafte Hingabe aller drei Farnham-Damen dem Kind gegenüber ging. Über ihrem ein wenig kargen Gesichtskreis würde sie als eine neue interessante Aufgabe erscheinen, und das geringe Zuverdienst, welches sie ebenfalls darstellte, war fast symbolisch für die Pflege, die sie empfing. Sie waren ausgezeichnete Personen, von jener Art, die über Metten und Vespern sprechen und an beiden teilnahmen. Sie halfen bei kleinen Wohltätigkeitsveranstaltungen und gaben kleine Tees und schrieben kleine Mitteilungen und machten entwürdigende Zugeständnisse an die Exzentrizitäten ihrer blaublütigen oder begüterten Bekannten. Sie waren die unauffälligen, lächelnden, einfallslos gekleideten Frauen mit kleinem festem Einkommen, wie man sie bei jeder Gartengesellschaft auf dem Land antrifft; ein wenig hochnäsig, ein wenig selbstgefällig, ganz und gar konventionell, jedoch abgesehen von diesen Schwächen solide, einfach und gediegen, die ihre beiden Hausangestellten unter Zurschaustellung penibelster Gepflogenheiten führen und einen diffusen und nachträglichen, nichtsdestoweniger beharrlichen Blick auf das Geschehen ihres Landes halten, wie es von einer zweiwöchentlichen Zeitschrift festgehalten wird. Sie zeigten alle starkes Interesse am Königshaus und lasen einander laut Absätze darüber vor, wie Prinzessin Beatrice oder Prinzessin Maud einen modischen Basar eröffnet hatten – wobei sie sich erstaunlich gut gemacht hätten, in schlichtem grauem, mit irischer Spitze abgesetztem Popelin – ein Zweig, den wiederzubeleben sich die Königliche Familie, wie hinreichend bekannt ist, vorgenommen hatte. Woraufhin Mrs. Farnhams Kommentar stets lautete „Wie rücksichtsvoll von ihnen, meine Liebe!“ und Alice antwortete üblicherweise „Also wenn ich eine Prinzessin wäre, ich würde etwas Hübscheres als grauen Popelin vorziehen.“ Von Alice, weil sie die Jüngste war, wurde nicht immer erwartet, daß sie nachdachte, ehe sie sprach. Alice malte in Aquarell, aber von Emma nahm man an, daß sie die vernünftigste war.
Sie schrieben uns abwechselnd mit größter Regelmäßigkeit über Cecily. Nur einmal, glaube ich, verpaßten sie die wöchentliche Post und das war, als sie Diphterie zu bekommen drohte, und sie meinten, uns besser in Unkenntnis zu lassen. Der freundliche, warmherzige Ton dieser Briefe änderte sich nie, abgesehen von den Tatsachen, die sie beschrieben: das Zahnen, Kriechen, die Masern, Bäckchen, die rund und rosig wurden, alles wurde in den gleichen glatten, oberflächlichen, gebührlichen Formulierungen übermittelt, so vollkommen bar jeglichen Anzeichens der Persönlichkeit des Kindes, daß es uns nach den ersten paar Monaten vorkam, als läse man in einem Buch über ein ziemlich uninteressantes Kind. Ich war mir sicher, daß nicht Cecily uninteressant war, sondern ihre Chronistinnen. Wir pflegten uns durch die langen, dünnen Blätter durchzuarbeiten und erkannten, um wie befriedigender es wäre, wenn Cecily uns selbst schreiben könnte. In der Zwischenzeit registrierten wir ihren wöchentlichen Fortschritt mit einer Regung, die jemand einem Stück Land in der Ferne entgegenbrächte, das keine Probleme bereitet und sich überaus gut macht. Wir würden Cecily in Besitz nehmen, wenn es uns gefiele. Bis dahin war es erfreulich, von unserem unverdienten Zuwachs aus liebenswerten kleinen Pickeln und süßen kleinen Löckchen zu hören.