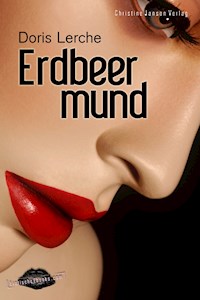3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mit scharfem Blick für alte Peinlichkeiten und neue Tabus erzählt Doris Lerche grotesk-tragische Geschichten zwischen 68 und heute in denen Ratlose beiderlei Geschlechts umeinander herumschleichen, gepeinigt von Ängsten und Ansprüchen, pendelnd zwischen Abenteuer und Anlehnungsbedürfnis. Wie in ihren verqueren Beziehungs-Cartoons schildert sie die Schwierigkeiten, sich im modernen Dschungel der Gefühle zurechtzufinden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Doris Lerche
Eine Nacht mit Valentin
Erzählungen
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Frau in der Gesellschaft
Herausgegeben von Ingeborg Mues
Die Erzählungen »Draußen in der Dunkelheit«, »Das war die Liebe«, »Die Katze«, »Zwischenlösung«, »Marsala« und »Schattenzeit« sind erstmals 1984 in dem Band »Die Unschuld verlieren« im Rowohlt Verlag, Reinbek, erschienen.
Eine Nacht mit Valentin
»Hier ist Katharina.«
Ich war überrascht, daß sie anrief. Und dann mit solch einem Stimmchen! Ich hätte ihr eine kräftige Stimme zugetraut, nach dem Foto, das eine selbstbewußte, ausgesprochen attraktive Frau gezeigt hatte.
Ich nahm den Telefonapparat und lauschte in den Hörer, während ich mich in meinem Polstersessel niederließ.
»Ich möchte mit dir reden.«
»Warum?« Was sollte dieses vertrauliche »Du«.
»Wegen Valentin.«
»Was gibt es da zu reden?« Ich klemmte den Hörer zwischen Ohr und Schulter und versuchte, mir eine Zigarette anzustecken, während ich Katharina zuhörte.
»Ich leide«, sagte sie. »Und du leidest auch. Du weißt doch, daß Valentin uns gegeneinander ausspielt. Ich komme nicht mehr damit zurecht.«
»Ich weiß nicht, wovon du redest.« Ich sog an meiner Zigarette.
»Mach es mir nicht so schwer«, bat sie, und gegen meinen Willen war mir ihre Stimme angenehm, »du weißt doch, daß ich seit einem halben Jahr Valentins Geliebte bin.«
Ich stieß eine Rauchwolke aus und starrte ihr nach, wie sie nach oben stieg und sich auflöste.
Seit einem halben Jahr? Das hatte mir Valentin nicht gesagt, als ich Katharinas Foto in seiner Jackentasche gefunden hatte.
Du kennst mich doch, hatte er gesagt und dazu sein schuldbewußtes Kleinjungengesicht gemacht, sie ist ein Flirt wie so viele. Sie bestand darauf, mir ihr Foto zu schenken.
Seit einem halben Jahr? Ich wußte, er schwindelte gelegentlich. Aber dabei ging es um Kleinigkeiten. Eine Geliebte würde er mir nicht verheimlichen, da war ich ganz sicher. Wahrscheinlich bildete sich diese Frau in ihrer Verliebtheit auf zwei, drei Nächte mit ihm etwas ein, das er nicht einzulösen gedachte. So was kenne ich ja auch, dachte ich, daß man sich an die kleinste Hoffnung klammert.
»Und was hab ich damit zu tun?«
»Ich brauche deine Hilfe.«
Es war mir unangenehm, daß sie sich so erniedrigte und mich, ihre Rivalin, anflehte.
»Ich kann dir nicht helfen«, sagte ich kurz.
Warum ließ ich mich auf ein solches Gespräch überhaupt ein? Warum warf ich nicht den Hörer auf die Gabel und stellte Valentin zur Rede?
»Bitte«, sagte sie. »Ich muß mit dir sprechen.«
Ich schnipste die Asche von meiner Zigarette, sagte: »Gut, wo treffen wir uns?« und kam mir sehr großmütig vor.
»Magst du zu mir kommen?« Sie gab mir ihre Adresse, wir machten einen Termin aus, ich legte auf.
Ich schob eine Kassette in meinen Rekorder, spanische Flamenco-Musik. Ich drückte sie gleich wieder aus, fand aber keine Musik, die zu meiner Stimmung passen wollte. Ich ging in die Küche und wärmte den Eintopf vom Vortag auf, deckte den Tisch, holte eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank. Als das Essen heiß war, hatte ich keinen Appetit mehr. Was macht mich so nervös, dachte ich und stellte den unbenutzten Suppenteller zurück ins Regal. War es möglich, daß diese fremde Frau die Wahrheit sagte und Valentin mich seit einem halben Jahr belog? Es kribbelte mich, seinen Aktenkoffer, den er bei mir liegengelassen hatte, zu durchsuchen. Das mißfiel mir. Ich verachtete besitzergreifende Frauen, die ihrem Mann keinen harmlosen Seitensprung verzeihen können. Es war eine Bedingung unserer Beziehung gewesen, daß wir uns gegenseitig kleine Freiheiten ließen, wir hofften, dadurch das Verhältnis zu stabilisieren. Leider – und das störte mich manchmal – kostete Valentin seine Freiheiten mehr aus als ich. Ich entdeckte sogar schrecklich konservative Sehnsüchte in mir nach einer gemeinsamen Wohnung, nach gemütlichen Abenden vorm Fernseher oder im Bett, nach einem ruhigen Urlaub zu zweit in einem abgelegenen Gebirgsdorf, vielleicht in Nepal oder auf den Azoren. Diese Wünsche irritierten mich. Ich hatte mich immer für fortschrittlich, großzügig und unabhängig gehalten.
Natürlich erzählte ich Valentin nichts von diesen Phantasien.
Ich steckte mir eine Zigarette an.
Valentin war verreist für ein paar Tage, es hätte mir gutgetan, ihn zu sehen und mit ihm zu reden.
Seit einem halben Jahr? Ich versuchte, mich zurückzuerinnern. Tatsächlich, ich war über einige Merkwürdigkeiten gestolpert. Aber ich hatte nicht grübeln wollen. Selbst als ich dieses Foto entdeckte – zufällig, er hatte mich gebeten, seine Jacke in die Reinigung zu bringen, beim Ausleeren der Taschen fand ich es –, selbst da war ich ganz gefaßt gewesen.
Dennoch, gegen meinen Willen hatte mich diese Frau beschäftigt. Valentin mochte eigenwillige Frauen. Die auf dem Foto sah aus wie eine alternative Universitätsprofessorin mit ihren hennaroten Locken, die ein glitzerndes Kämmchen aus dem Gesicht raffte. Das freie Ohr trug einen Schmuck, der kostbar wirkte, Gold mit einem grünen Stein. Grün war auch die hochgeschlossene Satinbluse, die durch den Stehkragen etwas streng wirkte. Die läßt nicht so leicht los, hatte ich mehr geahnt als gedacht, die läßt sich nicht abspeisen mit einer Nacht. Und zum erstenmal, seit ich mit Valentin zusammen war, hatte ich mich bedroht gefühlt. Dann verdrängte ich das Foto, ich hatte keine Lust, mir das Leben mit eingebildeten Rivalinnen zu versauern. Valentin war ein sinnlicher Mann, das wußte ich, und das gefiel mir an ihm. Daß er auf jeden runden Arsch ansprach, war der Preis. Im übrigen hatte er mir immer wieder versichert, daß diese kleinen Abenteuer, die er brauchte, unser Verhältnis niemals gefährdeten.
Bevor ich Katharina besuchte, probierte ich lange aus, wie ich auftreten sollte. Ich entschied mich für mein pinkfarbenes Strickkleid, schminkte mich stärker als sonst, benutzte sogar Lippenrot, grell wie das Kleid, und zog mein einziges Paar hochhackige Schuhe an. In meinem normalen Alltag bevorzugte ich die Bequemlichkeit.
Ich wunderte mich über meine Ruhe, als ich bei Katharina klingelte. Ich war auf alles vorbereitet.
Und wieder überraschte sie mich. Sie trug einen schlichten schwarzen Pulli und eine schwarze Gymnastikhose mit Steg. Sie war vollkommen ungeschminkt, anders als auf dem Foto. Sie will einen ehrlichen Eindruck machen, dachte ich, sie tut so, als gäbe sie sich mir in die Hände, ich darf ihr nacktes Gesicht sehen. Schöne füllige Haare, ja, aber farblose Brauen und Wimpern und eine überschlanke Figur ohne Busen. Valentin mag Brüste, dachte ich mitleidig. Ihr Gesicht war blaß, fleckige Haut, wie man sie bei Frauen sieht, die täglich Makeup auftragen. Aber was mich halb schockierte, halb rührte: ihre Wangen trugen lange parallellaufende Narben wie Spuren von Fingernägeln. Auf dem Foto hatte ich nichts davon bemerkt, wahrscheinlich waren sie vom Make-up verdeckt gewesen.
Sie ließ mich eintreten, und ich wunderte mich über ihre Natürlichkeit. Ich hatte damit gerechnet, daß sie krampfhaft freundlich sein würde. Sie war freundlich, aber ganz unverstellt.
»Du bist jetzt sicher neugierig, wie ich bin«, sagte sie. »Schau dich um.«
Sie war mir sympathisch. Ich war auf der Hut.
»Magst du was trinken?«
»Ja.«
Ich entschied mich für Tee, und sie hantierte in der Küche, während ich im Zimmer umherging und alles sorgfältig betrachtete.
Sie wohnte in einem Zweizimmerappartement, das sie mit dem gediegenen Geschmack einer höheren Tochter eingerichtet hatte. Bequeme Schalensessel, ein niedriger Glastisch. Die Möbel sehen nicht billig aus, dachte ich. Sie schien nicht extra für mich aufgeräumt zu haben, auf dem Teppich waren mehrere kleine Bücherstapel verteilt, einige Bücher lagen auf dem Gesicht, andere trugen Papierschnipsel als Lesezeichen. Auf dem Glastisch stapelte sich benutztes Kaffeegeschirr. Für zwei Personen, registrierte ich. Den Aschenbecher füllten zusammengeknüllte Tempotaschentücher. Hat sie geheult, dachte ich, oder hat ein Männerbesuch mit Interruptus geendet.
Der Raum hatte gerade den richtigen Grad an Unordnung, um gemütlich zu wirken. Es könnte auch, dachte ich, eine Inszenierung sein.
Genau in der Mitte stand das breite Doppelbett, mit dem Kopfende gegen die Wand. Unter dem flauschigen Überwurf zeichneten sich die Wölbungen von Kopfkissen und Deckbett ab.
Die Tür zum Nebenraum stand offen, ich blickte auf eine Staffelei und ringsum an den Wänden aufgestellte Acrylbilder. Farbtuben und Pinsel bedeckten den mit weißer Plastikfolie ausgelegten Boden.
Katharina trug das schmutzige Kaffeegeschirr hinaus in die Küche: »Magst du Kandis?« – »Ja, gern.« Sie brachte den Tee auf einem silbernen Tablett, holte mit einer silbernen Zange die Kandisstückchen aus dem Glas, klirrend fielen sie in die Tassen.
Nachdem sie uns eingegossen hatte, legte sie sich der Länge nach aufs Bett. Sie wirkte nicht lässig, sondern erschöpft. Ich ließ mich in einem der Schalensessel nieder, trank den Tee in kleinen Schlucken, sagte nichts und wartete ab.
Sie hob den Arm und machte eine Bewegung um das Zimmer herum: »Was da hängt, habe ich gemalt!« Sie nippte an ihrem Tee und fuhr fort: »Ich bin nicht besonders talentiert. Aber malen tut mir gut. Ich kann da meinen ganzen Seelenkram loswerden.«
Ich betrachtete ihre Bilder. Sie alle zeigten stark kontrastierende Farben, vor allem kaltes Blau gegen aggressives Rot. Dargestellt waren Frauen, immer wieder Frauen, mit vorm Gesicht gespreizten Händen, mit verkrampften Fäusten, mit aufgerissenen Mäulern. Sie hat Probleme mit ihrer Weiblichkeit, dachte ich, solche Bilder habe ich in der Pubertät gemalt.
»Ich habe jede Menge Selbsterfahrungsgruppen mitgemacht«, sagte sie, »da hab ich das gelernt mit dem Malen, ich habe mir ja nie was Kreatives zugetraut. Du lebst vom Malen, nicht?«
»Mehr schlecht als recht«, gab ich zu. Was sollte ich ihr vormachen. »Die großen Aufträge kommen selten. Aber wahrscheinlich bin ich nicht geschäftstüchtig genug.«
Sie goß mir Tee nach und holte eine Flasche Rum aus der Küche: »Magst du?« Ich verneinte. Sie gab sich einen guten Schluck in ihren Tee.
»Du sollst sehen, wer ich bin«, sagte sie. »Wer weiß, was Valentin über mich erzählt hat …«, sie hielt fragend inne, aber ich sagte nichts. »Ich bin völlig kaputt, weißt du«, sie lachte bitter. »Du siehst ja meine Narben … Ich zerkratze mir das Gesicht. Ich bin voller Selbsthaß. Ich habe acht Jahre Therapie hinter mir, dadurch ist es besser geworden. Das Kratzen war ja eine richtige Sucht. Aber es bricht in Streßsituationen immer wieder durch.«
Sie setzte sich auf und legte ihre beiden Hände an die Wangen. Sie sieht aus wie ein erschrockenes Mädchen, dachte ich. Sie ist am Ende, dachte ich, sie weiß nicht weiter, ich bin ihre letzte Chance, sie hat nichts mehr zu verlieren. Ich stellte keine Fragen. Sie erzählte: »Ich habe eine neunjährige Ehe hinter mir. Wir haben einander nur verletzt und gedemütigt. Irgendwann schaffte ich den Absprung. So etwas will ich nie wieder. Eine Ehe ist ein Monster mit zwei Köpfen und vier Beinen, jeder strebt in die entgegengesetzte Richtung, aber man kommt nicht voneinander los. Als ich Valentin kennenlernte, war ich ziemlich fertig. Wahrscheinlich hat er es mir nicht angesehen. Ich kann gut spielen, wenn es sein muß. Die Männer merken so was nicht. Oder sie wollen es nicht merken.«
Ich wunderte mich, daß sie sich so in meine Hände gab. Ich fühlte mich ihr nah. Ich war wachsam.
»Mir gegenüber«, sagte sie, »war Valentin aufrichtig. Ich wußte von Anfang an, daß es dich gibt.« Sie lachte kurz auf. »Du hattest den Part der betrogenen Ehefrau, ich den der Geliebten.«
»Beides hat seine Vor- und Nachteile«, bemerkte ich und dachte, warum soll ich eigentlich den langweiligen Part der Ehefrau haben. Nur weil Valentin mich belog? Ich hatte genauso wenig Sicherheit wie sie. Wir wohnten nicht zusammen. Er kam und ging, wie es ihm paßte. Er war mir zu nichts verpflichtet. Jederzeit konnte es zu Ende sein. Wir hatten eine Beziehung ohne Zwänge gewollt, ohne Rollenverteilung, ohne Besitzanspruch. Sie sollte auf freiwilliger Basis nur von Gefühl getragen sein, es sollte keine Vermischung mit ökonomischen Abhängigkeiten geben, keiner sollte unterdrücken, keiner sich unterdrückt fühlen. Eine freie Liebe, die nie selbstverständlich, nie Gewohnheit wurde, die immer neu und frisch und spannungsvoll und leidenschaftlich sein sollte.
Auf keinen Fall wollten wir die trüben Ehen unserer Eltern wiederholen, die – um einer fragwürdigen Geborgenheit willen – einander ängstlich am Leben hinderten und irgendwann verbittert feststellen mußten, daß sich das, was sie versäumt hatten, nicht nachholen ließ.
»Dich gibt er nicht so schnell auf«, sagte Katharina. »Die Dauer der Beziehung ist ein wichtiger Faktor. Ihr kennt euch fünf Jahre, nicht?«
Ich nickte, die Teetasse in der Hand.
»Ich hatte eine andere Vorstellung von dir«, sagte sie. »Ich bin überrascht.« Sie musterte mich. »Valentin hat dich farblos genannt. Auf mich wirkst du …« Sie überlegte einen Moment, zögerte, hob den Blick: »Ein besseres Wort fällt mir nicht ein: ungebrochen.« Sie zupfte Fussel aus der Flauschdecke. »Ich bin gebrochen. Ich habe hart gekämpft, aber sie waren stärker.«
»Wer?«
Sie lachte unmotiviert: »Wir waren ein Frauenclan, meine Mutter, meine Großmutter und ich. Mein Vater war nicht wichtig, er hielt sich ohnehin meistens in der Mansarde unterm Dach auf, wo er sich eine Werkstatt eingerichtet hatte für seine Kunstobjekte. Alle haben sie einander gehaßt, jeder bekämpfte jeden. Mal hat mich meine Mutter auf ihre Seite gezogen, mal meine Großmutter, dann wieder ging’s mit beiden gegen meinen Vater. Als ich ein Mädchen war, haben die zwei Frauen überlegt, wie sie meinen Vater umbringen könnten. Aber ich wollte meinen Vater gar nicht umbringen. Ich lehnte ihn ab, er war jähzornig, er prügelte mich und meine Mutter. Aber ich wollte ihn nicht umbringen. Gott sei Dank starb er irgendwann an einem Herzinfarkt, er hatte es ja auch nicht einfach gehabt im Leben …«
»Dein Vater war Künstler?« fragte ich.
Sie zögerte: »Er war Kunsterzieher und malte und bildhauerte nebenher, er hat nicht ein einziges Bild verkauft in seinem Leben oder eine Plastik. Er haßte seine Schüler, denen er die Kunst beibringen sollte, denn sie nutzten den Unterricht, um sich auszutoben. Als er tot war, verbündeten sich die beiden Frauen gegen mich, oder die Großmutter verbündete sich mit mir gegen die Mutter, oder die Mutter verbündete sich mit mir gegen die Großmutter – ein fürchterliches Intrigennetz. Heute liegt mir viel an Frauensolidarität. Durch die Frauenbewegung habe ich eine Menge gelernt.«
»Du bist sehr offen«, sagte ich. »Ich trau dir nicht. Aber mir gefällt deine Offenheit.«
Sie zuckte die Achseln: »Trau mir oder trau mir nicht. Du hast gewonnen.«
»Was heißt das.«
Sie schaute mich an: »Valentin will dich nicht verlieren. Ohne deine Hilfe habe ich keine Chance.«
Ich fragte nach der Toilette.
Als ich die Tür verriegelte, fiel mein Blick auf ein riesig vergrößertes Foto, das die ganze Türfläche bedeckte.
Ich war schockiert. Ich ärgerte mich, daß ich schockiert war. Das bezweckt sie doch gerade, dachte ich.
Das Foto zeigte eine Möse mit leicht geöffneten Lippen, quer darüber war mit schwarzem Filzstift geschrieben: ICH.
Während ich auf der Klobrille saß und nirgendwo anders hinschauen konnte als auf dieses verzweifelt aufdringliche Foto, dachte ich, sie tut sich schwer mit dem Sex, und ich kam mir sehr gesund vor.
»Ich wüßte nicht«, sagte ich, als ich zurückkam und mich wieder in den Schalensessel gesetzt hatte, »ich wüßte nicht, was ich für dich tun könnte.«
»Ich will dir deinen Platz nicht streitig machen«, begann sie. »Ich will nichts weiter, als Valentin ab und zu sehen, das ist alles.«
»Und was hab ich damit zu tun?«
»Er zieht sich zurück von mir«, sagte sie leise. »Seit du weißt, daß er mit mir zusammen ist, setzt du ihn unter Druck. Er wird dir nachgeben, um dich nicht zu verlieren.«
Wie kam sie darauf? Ich hatte ihn überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Ich wußte doch erst seit einem Tag, daß er eine Geliebte hatte. Er war es also, der sich von ihr zurückzog. Das zu hören, tat mir gut. Darum also setzt sie alles auf eine Karte, dachte ich, darum demütigt sie sich vor mir. Traurig, wie sie bei der Konkurrenz betteln geht, um ein paar Brocken Liebe abzukriegen. Ich versuchte sie meine Überlegenheit nicht spüren zu lassen.
»Wie kann ich dir helfen?«
»Er hat uns beide betrogen«, sagte sie. »Er war jedesmal bei mir, wenn er dir erzählte, er sei in der Deutschen Bibliothek, um dort für sein Buch ›Die Frau in der bildenden Kunst der zwanziger Jahre‹ zu recherchieren.«
Das hatte ich nicht gewußt. Ich führte die Tasse zum Mund. Der kalte Teerest schmeckte übersüß. Ich hielt Katharina die Tasse hin. Sie schüttete nach.
Das also war es gewesen. Ein halbes Jahr lang hatte er mich angelogen. Ich hatte diffus empfunden, daß irgend etwas nicht stimmte, hielt mich für überspannt und hatte mir Vorwürfe gemacht. Und nun erfuhr ich, daß meine Empfindungen richtig gewesen waren.
Eine merkwürdige Heiterkeit ergriff mich. Mir war, als schritte ich über einen Bergkamm, leicht und ohne jede Angst, abzustürzen.
Ich lächelte Katharina zu, während ich in meinem Tee rührte, damit sich die Süße des Zuckers verteilte.
Sie lächelte zurück wie eine Komplizin.
Gleichzeitig hoben wir die Tassen, nickten uns über den Rand hinweg zu und tranken.
Und dann stürzten die schwarzen Gedanken auf mich ein.
Ist es möglich, sechs Monate lang einen Menschen zu belügen, und man liebt ihn dennoch? Wenn wir im Bett herumalberten, uns kindisch durch die Wohnung jagten, er mich heftig griff und atemlos an sich drückte, lächerliche Koseworte murmelte – da war ich sicher gewesen, daß er mich liebte. Das hatte mich ruhig gemacht. Da lachte ich nur über seine Frauengeschichten, die hatten nichts mit uns zu tun. Das war halt dieser unbezähmbare männliche Trieb, der keine Bedeutung hat.
Männer können Sex und Liebe trennen, dachte ich neidisch, ich bin immer gleich töricht verliebt. Der Schwanz an sich langweilt mich, ich brauche auch das Drumherum. Könnte ich mir doch, dachte ich, wie Valentin überall ein schnelles Glück holen, ohne die Qualen der Verliebtheit. Wie fremd sind mir Männer, dachte ich. Wie fremd ist mir Valentin. Vielleicht sind wir uns nie nahegekommen. Vielleicht habe ich nur von der Einbildung gelebt. Vielleicht ist unsere Liebe, die ich für etwas Besonderes gehalten habe, in seinen Augen ebenso bedeutungslos wie alle anderen Affären.
Merkwürdig, dachte ich, daß du auf jede Frau springen mußt, Valentin. Warum bist du so rastlos. Vielleicht treibt dich gar nicht dein Geschlecht. Vielleicht treibt dich ein Fluch, und du suchst die Erlösung und findest sie bei keiner Frau. Oder liegt es an mir? Bin ich nicht raffiniert genug? »Farblos« hatte er mich genannt. In der Tat, er schien ein doppeltes Spiel getrieben zu haben, wenn es stimmte, was Katharina sagte. Wenn nicht auch sie ein doppeltes Spiel trieb und mich einlud zu sich, um mich später bei Valentin schlechtzumachen.
»Ich hatte den Vorteil, daß er mich nicht belog«, sagte sie. »Er weihte mich sogar in seine Spielchen ein, die er mit dir trieb. Sicher tat es ihm gut, daß er sich mir gegenüber nicht zu verstellen brauchte. Weißt du, daß er Silvester mit mir auf Teneriffa war? Er hat mich eingeladen, mit ihm Urlaub zu machen …«
Ich griff in meine Handtasche: »Darf ich rauchen?«
Sie öffnete das Fenster und holte einen Aschenbecher.
Für Katharina waren also die tausend Mark gewesen, die er sich von mir geliehen hatte. Angeblich, um mit seiner kranken Mutter an die Nordsee zu fahren. Er hatte schon eine Menge Schulden bei mir, und ich war nicht sicher, daß ich das Geld je wiedersehen würde.
»Er verachtet Frauen«, bemerkte sie und nahm sich eine Zigarette aus meiner Packung. »Er verachtet uns beide, dich und mich. Im Bett sollst du ja ganz gut sein, aber von deiner Malerei hält er überhaupt nichts. Ich nehme an, daß er über mich genauso lästert. Er spielt uns gegeneinander aus, begreifst du das nicht?«
Ich wedelte das Streichholz aus und sog den Rauch tief in mich ein.
Irgend etwas sträubte sich in mir, mit Katharina über meinen Geliebten zu reden. Ich wollte ihn nicht mit ihr teilen, und sei es auch nur im Gespräch.
»Was liegt dir eigentlich an ihm?« fragte ich und betrachtete die Deckenlampe aus dünnem Chinapapier, die der Luftzug torkeln ließ, »warum willst du mit ihm zusammensein, wenn du ihn so ablehnst?«
»Ich weiß nicht«, sagte sie, die Zigarette steif zwischen den weggespreizten Fingern, »ich weiß nicht, ob ich noch mit ihm zusammensein will. Es ist ja wirklich jämmerlich, daß ein Mann in seinem Alter und in seiner Position solche Lügen nötig hat.«
»Von welcher Position redest du?« fragte ich.
Sie schien verunsichert: »Er ist doch Hochschullehrer?«
»Hat er dir das erzählt?« Ich lachte. »Nichts ist er. Sein Philosophiestudium hat er nach sechzehn Semestern abgebrochen. Er schreibt Artikel, schlecht bezahlte Artikel für Provinzzeitungen. Und er war aufgebrochen mit soviel Ehrgeiz.«
Sie betrachtete mich interessiert: »Ach, deshalb durfte ich ihn nie besuchen. Er wohnt wohl sehr ärmlich?«
»Er wohnt in einer besseren Rumpelkammer«, sagte ich. »Er schläft auf einer durchgelegenen Matratze mitten in einem Chaos von Büchern und Manuskripten.«
»Stört dich das nicht?«
Ich hob die Schultern: »In meiner eigenen Wohnung stört es mich, wenn er alles stehen und liegen läßt. Bei sich kann er machen, was er will.«
Sie wurde nachdenklich: »Da war er also auch mir gegenüber nicht ehrlich. Seine häßliche Seite, die ihm peinlich war, hat er mir nicht gezeigt. Er glaubte wohl, ich ließe ihn fallen, wenn ich herausbekäme, in was für armseligen Verhältnissen er lebt.« Sie seufzte. »Und ich war der Meinung, ich hätte dir gegenüber den Vorteil, daß er aufrichtig ist. Dann bin ich ja reich und etabliert neben ihm. Wie hat er Teneriffa bezahlen können? Er hat immer den Großzügigen gespielt, mich zum Essen eingeladen, kleine Geschenke gekauft … obwohl …«, sie zögerte kurz, bevor sie weitersprach, »ich habe viel Geld für ihn ausgegeben, fällt mir jetzt ein. Ich sehe nicht aufs Geld, weißt du, das interessiert mich nicht. Oft hatte er seinen Geldbeutel vergessen, und ich dachte mir: Aha, das Klischee vom zerstreuten Professor stimmt doch.«
»Kannst du dich an Ostern erinnern?« fragte ich, und die Frage tat mir weh, »ist er Ostern bei dir gewesen?«
Wir hatten Ostersonntag zusammen verbracht. Ostermontag mußte er angeblich zu seiner Mutter, die wieder kränkelte. Es war schön mit ihm gewesen, wir waren durch den frühlingshaften Spessart gelaufen. Er hatte ganz von sich aus vorgeschlagen, wir sollten mal wieder einen gemeinsamen Urlaub verbringen. Vielleicht auf Ibiza, er kenne dort jemanden, der ein Hotel besaß. Vielleicht könnten wir dort billig wohnen. Ich war selig gewesen, daß er so auf mich zuging …
Katharina dachte einen Moment nach: »Ich hatte Ferien. Ich wollte so gern mit ihm verreisen. Aber er sagte, er müsse arbeiten, er habe einen Stapel Klausuren durchzusehen … Am Ostermontag kam er kurz zum Kaffee …«
»Habt ihr gevögelt?«
Sie lächelte: »Er kam immer zum Vögeln. Manchmal war es mir zuviel. Ich wollte auch mal nur mit ihm sitzen und klönen …«
»… und dir erzählen lassen, was ihn alles an mir stört.«
»Ihn stört vor allem deine Kleidung. Ausgebleichte T-Shirts, schlabberige Hosen. Im Moment …«, sie lehnte sich zurück und musterte mich, »siehst du allerdings ganz pfiffig aus. Wenn du immer in solchen Klamotten rumlaufen würdest, wär ich sicher nur halb so interessant für ihn. An mir gefällt ihm, daß ich Sinn für elegante Kleidung habe, daß ich gern auffalle. Ein narzistischer Zug natürlich. Es macht ihm Spaß, sich mit mir in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wenn er ins Theater oder in die Oper geht, nimmt er grundsätzlich nur mich mit. Mit mir kann er mehr hermachen. Du würdest, sagt er, wahrscheinlich deine Jeans und irgendeinen dunkelblauen Pulli anziehen. Er liebt die Show, und die kann ich ihm bieten.«
»Ich kann mir gar nicht vorstellen«, sagte ich, »daß du so bist. Ich erlebe dich eher schutzbedürftig.«
»Schutzbedürftig«, wiederholte sie, drückte ihre Zigarette aus und warf mir einen schnellen Blick zu, als wollte sie ergründen, was ich mit der Aussage bezweckte. »Im Unterricht habe ich keine Probleme, mich durchzusetzen.«
»Du bist Lehrerin?«
»Stellvertretende Direktorin am Gymnasium«, sagte sie leichthin. »Aber die Schule ödet mich an.«
»Darum hast du mich also zu dir gelockt«, bemerkte ich, »ich soll dir ein bißchen Spannung in dein tristes Leben bringen.«
Mit einem tiefen Atemzug setzte sie sich aufrecht: »Ich habe dich hergebeten, weil ich dir einen Vorschlag machen möchte.«
»Bitte.«
»Immer wenn Valentin von dir weggeht, rufst du mich eine halbe Stunde später an. Ich sage dir dann, ob er bei mir ist. So haben wir ihn im Griff, und er kann uns nicht mehr belügen und gegeneinander ausspielen.«
Ich betrachtete den Rauch meiner Zigarette, wie der Luftzug ihn fortwirbelte. Mich gruselte bei der Idee, ich könnte Valentin ganz und gar unter Kontrolle haben. Das war es nicht, was ich mir unter einer Beziehung vorstellte.
»Das ist mir zu aufwendig«, sagte ich, »ich will mich nicht Tag und Nacht mit Valentin beschäftigen. Außerdem …«, ich schaute ihr gerade ins Gesicht, »möchte ich dich nicht gleichberechtigt einbeziehen.«
Sie saß sehr steif auf ihrem Bett: »Du willst also weiter mit Valentin zusammenbleiben? Trotz allem, was er dir angetan hat?«
Aha, dachte ich, darum ging es ihr also. Sie wollte mich so weit bringen, daß ich Valentin freiwillig verlasse. Ihre Offenheit war Taktik. Gott sei Dank, dachte ich, war ich vorsichtig und habe nur wenig von mir gezeigt. »Ich weiß«, sagte ich lässig, »daß Valentin hier und da kleine Affären hat. Das gestehen wir uns gegenseitig zu. Ich selbst bin auch kein Kind von Traurigkeit.«
»Seine Lügen gefallen dir sicher nicht«, sagte sie. »Aber egal. Ich mache dir einen anderen Vorschlag.«
»Bitte.«
Sie zog eine neue Zigarette aus der Schachtel und ließ ein Streichholz aufzischen. Ich sah ihr stolzes hohlwangiges Profil, als sie den Rauch einsog. Dann wandte sie sich mir zu, den Arm mit der Zigarette in die Handfläche gestützt. Sie schaute über mich hinweg, während sie redete: »Für eine Beziehung ist mir Valentin viel zu egoistisch. Zu wenig kooperativ. Ich wollte mit ihm zusammen eine Paartherapie machen. Aber er weigerte sich.« Gouvernantenhaft spitzte sie den Mund.
»Hör mal«, rief ich. »Den ganzen Abend erzählst du mir schon, was für ein Schurke Valentin ist. Dabei bist du wie besessen. Was willst du von ihm? Willst du ihn heiraten? Soll ich euch mein Jawort geben? Oder was?«
»Du hast mich unterbrochen«, sagte sie, »ich war noch nicht fertig. Also: Ich will keine Ehe mit ihm, da kannst du beruhigt sein. Er ist unterhaltsam. Das ist alles. Er langweilt mich nicht wie andere Männer. Die meisten sind doch Trottel. Wissen nichts mit einer Frau anzufangen.«
»Und dein Vorschlag?«
»Moment«, sagte sie, »laß mich ausreden. Wenn wir mehr als eine Nacht zusammen sind, strengt er mich an. Dann bin ich immer froh, wenn er geht. Ich will nichts weiter«, sagte sie und schob sich mit dem Oberkörper näher, während sie mir in die Augen schaute – sie roch blumig nach Badezusatz –, »ich will nichts weiter, als ihn einmal die Woche sehen. Schenk mir eine Nacht, bitte. Wir können sogar ein festes Date machen, Donnerstag oder Freitag paßt mir am besten. Den Rest der Zeit hast du ihn ganz für dich allein.«
»Und was hab ich damit zu tun?«
Sie schaute mich erstaunt an: »Ich wollte nur wissen, ob du einverstanden bist. Wenn ja, kriegen wir das schon hin.«
»Das ist nicht meine Sache«, sagte ich, »frag Valentin.«
Sie sank in sich zusammen: »Er will nicht«, sagte sie. »Deinetwegen. Er hat Angst, dich zu verletzen.«
Sollte ich frohlocken? Ich fühlte mich so kalt.
»Ich möchte nichts weiter«, bettelte sie, »als ihn ab und zu sehen. Ich nehme ihn dir nicht weg, das verspreche ich dir. Ich bin keine Frau, die dauernd mit ihrem Kerl zusammensein muß. Das habe ich hinter mir. Meine Ehe war ein Alptraum. Ich brauche viel Freiheit, verstehst du das?«
Ich fühlte mich unwohl, wie sie so in mich drang.
»Wir könnten auch«, mit ihren schlanken, gepflegten Fingern faßte sie plötzlich nach meiner breiten Hand voller Farbspuren, »wir könnten es auch zu dritt versuchen. Du gefällst mir. Ich habe schon lesbische Beziehungen gehabt …« Ich entzog ihr meine Hand, um die Teetasse zu nehmen.
»Ich will Valentin«, sagte ich und erschrak über die Klarheit meiner Formulierung – war das schon Besitzdenken? »Was habe ich mit dir zu schaffen!«
Ich sah, wie sie die Lippen nach innen zog, und griff ihren Arm: »Jeden Donnerstag … ich könnte das nicht, meine Wünsche so regeln … versteh das nicht als Kritik, ich habe nichts gegen dich, wir könnten uns weiterhin treffen, behutsam, ohne Anspruch auf Freundschaft oder Liebe. Aber ich denke, du willst Valentin, nicht mich. Du machst dir was vor.«
Sie schaute mich traurig-trotzig an: »Schade«, sagte sie. »Schade, schade, schade.«
»Wenn du magst«, sagte ich und erhob mich, »kannst du mich anrufen. Ich würde gern wieder einen Tee mit dir trinken. Aber das hat mit Valentin nichts zu tun.«
Wir standen beim Abschied zögernd in der Tür: ich reckte mich vor, um ihr einen Kuß zu geben, sie zuckte beiseite, wir stießen mit den Köpfen aneinander, lachten verschämt. Bei einem zweiten Versuch erwischte ich mit meinem Mund ihre zerkratzte Wange.
Sobald ich zu Hause ankam, packte mich die Unruhe. Ich haßte es, wenn mich Grübeleien bei der Arbeit störten. Ich saß an einem größeren Auftrag für eine Elektrofirma, ein Wandgemälde für die repräsentative Vorhalle. Nach meinen Angaben sollten einzelne Fliesen bemalt und zusammengesetzt werden. Die Arbeit war gut bezahlt, und ich hoffte, damit meiner finanziellen Misere für die nächsten Monate zu entkommen.
Als Valentin von seiner Reise zurückkehrte, erzählte ich zunächst nichts, ich wollte, daß er mir freiwillig und von sich aus beichtete, daß die Geschichte mit Katharina mehr war als ein unbedeutender Flirt.
Er war liebevoll wie sonst auch, ich staunte, daß ich ihm so gar nichts anmerkte. Lange hielt ich es nicht aus und gestand ihm, was ich von Katharina erfahren hatte.
Ja, sagte er zerknirscht, er habe diese Frau öfter getroffen. Mit Absicht habe er mir das verschwiegen. Ich sollte nicht annehmen, daß er ernsthaft an dieser Frau interessiert sei. Er habe Mitleid mit ihr gehabt. Ich wisse doch, daß er einer bedürftigen Frau nur schwer einen Korb geben könne. Ihre Ansprüche seien ihm aber schnell zu viel geworden. Er habe sich längst von ihr distanziert. Ich solle diese Geschichte um Gottes willen nicht aufbauschen. Ich sei doch sonst so vernünftig. Wenn ich Wert darauf legte, würde er den Kontakt zu dieser Frau gänzlich abbrechen.
Ich wollte nicht mißtrauisch sein. Ich wollte nicht nachhaken, ihn in die Enge treiben, ihn festnageln, ihn überführen. Ich wollte, daß er aus Liebe bei mir blieb und nicht aus Angst.
»Wenn ich meinen Auftrag fertig habe«, sagte ich, »würde ich gern mit dir nach Ibiza fahren.«
Er strahlte. Ja, auch er sehne sich nach südlicher Sonne und gebackenem Tintenfisch. Er schlage als Reisetermin das übernächste Wochenende vor.
»Das wird knapp«, sagte ich, »vielleicht schaffe ich meine Arbeit nicht bis dahin …«
Dann sollte ich halt ein paar Tage später nachkommen.