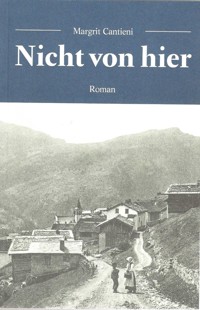Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franka lehnt sich gegen ihre verarmte, zerrüttete Familie und gegen die Enge ihres Bündner Dorfes auf. Mit achtzehn Jahren träumt sie von Freiheit und Abenteuer. Heimlich reist sie dem zwielichtigen Henry nach, der in Casablanca eine Bar eröffnen möchte. Als die heimatlichen Behörden davon erfahren, setzen sie alles daran, um Franka zurückzuholen. Sie unterstellen ihr ein haltloses, liederliches Leben. Franka wird unter Vormundschaft gestellt und in ein Erziehungsheim eingewiesen. Ihr gelingt die Flucht. Doch die Behörden lassen ihr keine Ruhe. Der Roman spielt in den 1950er Jahren und beruht auf einer wahren Lebensgeschichte. Schauplätze der Handlung sind Graubünden, Bad Ragaz, Casablanca, Bern, Nizza. Der Roman thematisiert ein unrühmliches Kapitel bündnerischer und schweizerischer Sozialgeschichte, das viele Menschen geprägt hat, noch gar nicht so lange her ist und bis heute nachwirkt. Bis in die 1980er Jahre gehörten willkürliche Entmündigungen und fragwürdige Einweisungsverfahren in institutionelle Einrichtungen bei Menschen unterer Schichten, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprachen, zum sozialstaatlichen Handeln. Mit einem Nachwort von Historikerin Dr. Loretta Seglias Ein schwieriges Thema wird durch den angenehmen Schreibstil der Autorin leicht lesbar umgesetzt. Das Schicksal der Protagonistin wird auf berührende Weise aufgezeichnet und lässt den Leser und die Leserin nicht mehr los. Mit einem Nachwort von Historikerin Dr. Loretta Seglias, das den Roman in den historischen und gesellschaftlichen Kontext verortet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Schachtel voller Lügen
Margrit Cantieni
Roman
Mit einem Nachwort von Historikerin Dr. phil. Loretta Seglias
1
Haldenstein / Graubünden, 18. Juli 1984
Franka vergoss keine Träne, als der Sarg ihrer Mutter in die Grube sank. Sie wollte vor den Menschen, die das Grab umstanden, keine Schwäche zeigen. Sie hatte im stillen Kämmerlein geweint, als es niemand gesehen hatte.
Pfarrer Windrig las aus der Bibel vor, einen Text, in dem es um die Erlösung ging und ums Verzeihen. Sein Gesicht blieb starr, nur der harte Mund bewegte sich.
Ihre Mutter hätte nicht gewollt, dass er die Abdankung hielte. Doch als Tote konnte sie sich nicht mehr wehren. Auch die anderen Wünsche, die sie zu Lebzeiten gehabt hatte, waren nicht in Erfüllung gegangen. Ein Leben in Schmerz, Kampf und Resignation war zu Ende gegangen.
Frankas Blick wanderte zu Brusch. Der ehemalige Präsident der Amtsvormundschaft war alt geworden, die mächtige Postur in sich zusammengefallen. Die Wangen hingen schwer hinunter, das Kinn flatterte, der Kopf zitterte, ebenso die Hand, die den Stock hielt, auf den er sich stützte. Vielleicht hat er Parkinson, überlegte Franka und fühlte kein Bedauern.
Sie fing Jelschas Blick auf, in dem Hoffnung auf Versöhnung lag. Ihr wundervolles lockiges rotes Haar war zu einem Rossschwanz zusammengebunden. Franka hatte sie sofort erkannt, obwohl sie einander fünfundzwanzig Jahre nicht mehr gesehen hatten. Nach wie vor war sie eine attraktive Frau. Lachte sie immer noch gerne? Sie waren Freundinnen gewesen, bis Jelscha sie verraten hatte. Vielleicht hatte Franka zu viel von ihr verlangt. Sie war eine junge Frau gewesen damals, mit Flausen und Träumen im Kopf.
Pfarrer Windrig verstummte. Alle blickten zu Franka.
«Gehen wir?», fragte ihre Tochter Ria leise.
Franka schwieg, schaute ins Grab, aufs helle rohe Holz des Kiefernsarges. Als Lukas sich abwandte und zum Tor ging, folgten ihm die anderen: Lukas’ Frau, Jelscha, Durs Brusch, Ria, der Pfarrer und die alten Frauen aus dem Dorf, die gekommen waren, weil es sich so gehörte. Und Bandi, ihr ehemaliger Lehrer. Dass er da war, freute Franka.
Henry blieb neben ihr stehen.
«Wie geht es dir?»
«Und dir?»
Sie hatte oft an ihn gedacht und sich gefragt, was er mache, wie er lebe. Vor allem, nachdem ihr Mann Karl sie verlassen hatte, weil er ihr Schweigen und ihren Ernst nicht aushalte, wie er gesagt hatte.
Sie gingen zusammen zum Tor. Rechts davon befand sich das kaum vier Quadratmeter kleine, mit einem handhohen Steinmäuerchen und einer verrosteten Kette eingefriedete Familiengrab der von Salis. Verwitterte Grabsteine und die in der Friedhofsmauer eingelassenen Grabmäler verlangten, dass jeder Kirchgänger sich an sie und ihre Macht gemahnte, obwohl diese lange vergangen war. Ein Friedhof im Friedhof. Das waren halt wichtige Menschen, pflegte Frankas Mutter mit einem Seufzen zu sagen. Schlossherren. Selbst im Tod wollten sie für sich sein.
An der Pforte wartete Pfarrer Windrig.
«Herzliches Beileid, Franka. Ich habe deine Mutter sehr geschätzt.»
Warum duzte er sie immer noch, als wäre sie das Mädchen, das er als Kind gekannt, und die junge Frau, die er bevormundet hatte? Er fragte nicht, wie es ihr gehe. Das hatte er nie getan. Er hielt ihr die Hand hin, ein Zögern lag in der Bewegung, als hätte er Angst, sich mit einer Krankheit anzustecken. Ich habe keine Läuse, zischte Franka ihn insgeheim an. Sie wandte sich ab, ohne seine Hand zu ergreifen.
Henry kam ihr nach.
«Er hat meine Mutter nicht geschätzt. Er hat sie verachtet. Und sie ist ihm auf die Nerven gegangen, weil sie sich nicht unterkriegen liess», sagte sie.
Die anderen warteten an der Strasse. Nur die alten Frauen waren in ihren Häusern verschwunden.
«Gehen wir einen Kaffee trinken?», fragte Lukas.
Franka nickte. Ihr Bruder wischte sich dünne Tränen ab. Er hatte ein Trauermahl gewünscht, doch Franka hatte so vehement dagegengesprochen, dass er nachgegeben hatte. Sie war sich sicher, dass ihre Mutter es nicht gewollt hätte. Sie hatte seit Jahren keinen Kontakt mehr zu der Dorfbevölkerung gehabt.
«Darf ich mitkommen?», fragte Brusch mit zittriger Stimme.
«Natürlich», sagte Lukas, bevor Franka ablehnen konnte. Das war typisch für Lukas. Er hatte nie jemanden verletzen wollen und dadurch viel Leid verursacht.
Sie gingen ins «Calanda». Das Gasthaus lag gegenüber dem Schloss, das Franka nie betreten hatte. Als Kind hatte sie sich aufgrund des mächtigen Gemäuers ein prächtiges, märchenhaftes Inneres ausgemalt. Später hatte sie erfahren, dass der schönste Raum im Schloss, das Prunkzimmer, vor Jahrzehnten an ein deutsches Museum veräussert worden war, weil die Schlossherren Geld gebraucht hatten. Dass vermeintlich reiche Leute finanzielle Sorgen haben konnten, war für Franka ein tröstlicher Gedanke gewesen.
Schloss, Kirche und Gasthaus lagen nur wenige Meter voneinander entfernt, als wären sie Geschwister, die sich gegenseitig im Auge behielten, um sich zu überwachen, aber auch um sich zu stützen und einander beizustehen, wenn Ungemach ihre Macht und Einheit zu stürzen drohte.
«Ich komme nach», sagte Franka vor dem Eingang zum Restaurant und holte die Zigarettenpackung aus der Handtasche.
Die anderen gingen ins Lokal. Nach einigen Minuten kam Henry zurück.
«Gibst du mir eine?»
Er betrachtete die Zigarettenpackung, die Franka ihm hinhielt.
«Rauchst du immer noch die gleiche Marke?»
«Ja.»
Er liess sich Zeit mit dem Anzünden. Nach dem ersten Zug fragte er:
«Denkst du manchmal an Casablanca zurück?»
«Manchmal. Und du?»
Er schaute den Rauchkringeln nach. «Es hätte so schön werden können.»
Franka zuckte mit den Achseln. Was gab es darauf zu erwidern?
2
Casablanca / Marokko, August bis September 1958
Henry holte Franka am Flughafen in Casablanca ab. Sein Teint war sonnengebräunt, in den Augenwinkeln zeigten sich zarte Falten. Sein Lächeln hatte etwas von seiner Leichtigkeit verloren. Er trug einen kakifarbenen leinenen Anzug, ein helles Hemd, dessen oberste zwei Knöpfe offenstanden, und beige, staubbedeckte Schuhe. Verlegen drehte er den Hut in den Händen, blickte sie unsicher an, als wisse er nicht, wie er sie begrüssen solle.
«Hier bin ich also», sagte sie und reichte ihm die Hand. Er fasste sie und drückte fest, sekundenlang.
«Ich freue mich sehr, dass du da bist.»
Seine Stimme hatte einen raueren Klang bekommen. Franka antwortete nicht mit einem «Ich auch». Das konnte sie nicht. Seit Tagen hatte sie nicht mehr geschlafen, wegen der abenteuerlustigen Hochstimmung und wegen der Angst vor dem, was auf sie zukommen würde in diesem fernen, aufregenden Afrika.
Drei Stunden hatte sie im Flugzeug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob es richtig war, was sie tat. Sie stellte sich vor, was die aus ihrem Dorf sagen würden, wenn sie erführen, dass ausgerechnet die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Franka Ruschett in einem Flugzeug sass. Sie kannte niemanden, der schon einmal geflogen war. Der Flug hatte sie enttäuscht. Eine dicke Wolkenschicht hatte verhindert, dass sie auf die Alpen, die Côte d’Azur, Spaniens Küste und das Mittelmeer hinuntersehen konnte. Vielleicht war es gut gewesen, dass über dem Wolkenweiss der stahlblaue Himmel unendliche Weite und Möglichkeiten versprach und keine Wehmut zuliess. Erst über Afrika hatten sich die Wolken aufgelockert und bruchstückhaft die Sicht auf braune und sanftgrüne Felder ermöglicht.
«Wie war der Flug?», fragte Henry.
«Es schüttelte ein paar Mal heftig. Der Mann neben mir hat gesagt, das sei normal und nicht gefährlich. Es hat Reis mit kleinen Fleischkugeln und zum Dessert einen farblosen Pudding gegeben. Es hat nicht mal etwas gekostet.»
Henry ergriff ihren Koffer, schien überrascht, dass er so leicht war.
«Er gehört Jelscha», sagte Franka, fast entschuldigend. Ihre Freundin war die Einzige, die von der Reise wusste.
«In ein paar Minuten fährt der Zug in die Stadt. Vom Bahnhof aus müssen wir eine halbe Stunde laufen, bis wir zuhause sind. Wenn du zu müde bist, können wir ein Taxi nehmen.»
Sie schüttelte den Kopf. Sie war nicht müde. Ganz im Gegenteil. Nach Hause, hatte er gesagt. Wie das klang. Sie war doch erst von ihrem Zuhause weggegangen, in die Fremde.
Franka schwieg während der vierzigminütigen Fahrt. Sie hatte noch nie so flaches Land gesehen. Nichts hielt den Blick auf, höchstens hin und wieder ein paar Bäume oder Büsche. Sie sah Ziegen und Schafe und von mageren Männern mit topfartigen Mützen geführte Eselkarren. Mit halbem Ohr hörte sie Henrys Ausführungen zu, dass Marokko vor zwei Jahren unabhängig geworden sei und einen König als Staatsoberhaupt habe. In Casablanca seien die meisten Stadtteile von Europäern bewohnt, hauptsächlich Franzosen und Spanier. Viele hätten das Land jedoch verlassen, seit es keine französische Kolonie mehr war. Dabei sei es in Casablanca angenehm zu leben. Die Temperaturen stiegen wegen der Lage am Atlantik kaum über dreissig Grad. Im Gegensatz zum Landesinnern, wo die Hitze manchmal kaum zum Aushalten sei.
Als der Zug im Bahnhof einfuhr, stieg Frankas Aufregung, die durch Henrys Plaudern gedämpft worden war, wieder an. Er fragte nochmals, ob sie ein Taxi wolle, sie lehnte ab, und sie machten sich auf den Weg.
Die Stadt sah ganz anders aus als in Frankas Vorstellungen. Sie hatte schlichte, aus Lehm gebaute Häuser erwartet. Doch die Gebäude waren mehrere Stockwerke hoch, die Strassen grosszügig und als Boulevards angeschrieben, die dem Autoverkehr zweispurig Platz boten und von Palmen und Büschen mit feinen Blüten in intensivem Violett und Rosa gesäumt waren. Die Franzosen hätten aus dem Provinznest in wenigen Jahrzehnten eine grosse Stadt gemacht, erklärte Henry. Mit Anzug, Krawatte und Hut bekleidete Europäer und in elegante Röcke gekleidete Europäerinnen flanierten auf den Trottoirs. Weit mehr Interesse entfachten bei Franka die braunhäutigen Männer mit den schwarzen glatten Haaren und den dunklen Augen. Einige von ihnen hatten schlichte Stoffhosen, Jacken und Pullover an – was Franka bei diesen Temperaturen übertrieben fand –, andere trugen ein wadenlanges Überkleid oder einen wallenden Mantel mit einem Filzhut oder hatten sich ein Tuch um den Kopf geschlungen wie einen Kranz.
Sie kamen in eine schmale Strasse voller winziger Läden. In jedem sass oder stand ein Verkäufer hinter oder vor seiner Auslage. Franka konnte sich nicht sattsehen an den seltsamen Früchten und Gewürzen, der Vielfalt an Töpfen, Schuhen, Haushaltsgeräten, Werkzeugen. Sie hielt sich dicht hinter Henry, der zügig voranschritt. So trat sie ihm fast in die Fersen, als er unvermittelt stehenblieb.
«Da sind wir», sagte er.
Vor ihnen erhob sich ein strahlend weisses Gebäude, das alle anderen überragte. Frankas Blick wurde hinaufgezogen, von einem Stockwerk zum anderen, immer weiter aufwärts, bis der Kopf tief im Nacken lag und die Augen im Himmelblau stehen blieben. Jedes Stockwerk war wie von einem weichen Band umgeben, getragen von wenigen, schmalen Säulen. Die Hausecken waren abgerundet, die Bänder bildeten rundum laufende Balkone, die Fenster waren teils frontartig nach hinten versetzt, teils knapp an der Brüstung ausgerichtet. Wäre Franka ein Riese, würde sie mit der Hand sanft über die Fassade streichen und sie liebkosen. Sie zählte. Einmal, zweimal, und kam auf siebzehn Stockwerke.
«Es ist das höchste Haus in Casablanca. Ein Schweizer hat es 1951 gebaut», sagte Henry mit einem Stolz in der Stimme, als hätte er es selbst errichtet. «Damals war es sogar das grösste Gebäude in Afrika.»
Auf der Rückseite war das Gebäude offen wie ein U, dessen Schenkel sich leicht nach aussen wölbten. Im Innern des U befanden sich dicht nebeneinander Fenster, die wie alte Weiber über kleine halbrunde Balkone hinweg miteinander zu schwatzen schienen.
«Hier wohnst du?», fragte Franka ungläubig.
«Ich hatte Glück. Die Wohnung gehört einem französischen Offizier, der zurück nach Frankreich beordert worden ist. Er will die Wohnung behalten, und deshalb kann ich sie mieten, vorläufig zumindest. Komm, ich stell dich dem Concierge vor.»
Er zog Franka zum Haupteingang. Die Fassade des Erdgeschosses war mit sandbraunen Platten eingekleidet. Sandfarbene Storen verdeckten die Fenster neben der vergitterten Glastüre. Henry zog die Tür auf, sie traten ein. Der Eingangsbereich war ebenfalls mit Platten ausgestattet, diese waren dunkler und glänzten in den einfallenden Sonnenstrahlen. Es sah elegant aus. Franka fragte sich, ob das Marmor sei. Zwei Lifte lagen gegenüber, rechts ging eine Treppe mit einem schlichten, elegant geschmiedeten Geländer hoch. An deren Fuss fanden sich hölzerne Briefkästen, mindestens fünfzig Stück. Franka wollte näher gehen, um die Namen zu entziffern, als ein kleiner Mann aus einem Kabäuschen auf der linken Seite des Eingangs trat. Er hatte ein längliches Gesicht, dichte Augenbrauen, einen sorgfältig geschnittenen Schnurrbart und ebenso gepflegte kurze schwarze Haare. Sein Körper schien nicht fertig gewachsen zu sein, die Schultern waren schmal, die Brust eingefallen und die Beine zu kurz. Er sah ein wenig verloren aus in der tiefblauen Uniform mit den goldenen Knöpfen. Der warme Blick machte ihn Franka auf den ersten Blick sympathisch.
«Das ist der Concierge, Monsieur Allami. Die gute Seele des Hauses», sagte Henry. «Und das …», fuhr er mit einer Handbewegung zu Franka fort, «… ist meine Cousine Franka Ruschett. Ich habe Ihnen von ihr erzählt. Sie möchte Casablanca kennenlernen.»
Franka war verblüfft, als Henrys Cousine vorgestellt zu werden. War das gemeinsame Wohnen ein Problem in Marokko? So wie es eines in der Schweiz war? Der Concierge verbeugte sich leicht.
«Herzlich willkommen im ‹Immeuble Libérté›, dem schönsten Gebäude in Casablanca. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mademoiselle. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier. Wenn Sie etwas brauchen oder wissen wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich bin tagsüber immer hier.»
«Danke. Vielen Dank, Monsieur. Ich, äh …» Sie stockte, weil ihre Französischkenntnisse nicht ausreichten, um ihm zu sagen, dass es ihr hier sicher gefallen würde. So schenkte sie ihm ein herzliches Lächeln.
Die Wohnung lag im dritten Stock. Eine braune Sitzgruppe, die mit Kissen in allen Formen und Farben übersät war, ein runder Tisch mit einem spitzenbesetzten Tuch, das bis zum Boden reichte, und zwei Stühle standen im Wohnzimmer. Ein bunt gemusterter Teppich bedeckte die Hälfte des Steinbodens, der schachbrettartig in graue und schwarze Felder unterteilt war. Im Schlafzimmer stand ein eisernes Bett, zugedeckt mit einer tiefroten dicken Decke, und ein hoher Schrank. Der flauschige Teppich hatte ein grün-gelb-braunes Muster.
«Die Möbel gehören dem Offizier», sagte Henry und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: «Ich schlafe auf dem Sofa.»
Das Bad und die kleine Küche waren mit hellen Fliesen ausgekleidet. In einem winzigen Stauraum befand sich ein Koffer, einige an Haken aufgehängte Kleider und ein Klappstuhl. Franka trat auf den Balkon. Er war schmal, kahl und leer, offensichtlich nicht dazu gedacht, dort zu verweilen, sondern um Wäsche aufzuhängen.
«Komm, ich zeige dir das Schönste», sagte Henry und bedeutete ihr, ihm zu folgen.
Mit dem Lift fuhren sie in den obersten Stock. Dort öffnete Henry eine Tür und liess Franka vorausgehen.
«Oooh, ist das schön!»
Franka blieb mit offenem Mund stehen. Frei konnte ihr Blick über die Stadt schweifen, über die Häuser, die wie hohe und flache, schmale und breite Schachteln oder Klötze sorgfältig hingesetzt waren, die meisten blendend weiss, einige wenige in einem hellen Grau-Beige, strahlend, stolz, zwischen ihnen grosszügig Platz für die Strassen und für Palmen mit mächtigen Wedeln. Dahinter, unter dünnen Wolkenzügen lag ein dunkler Streifen, der in bräunlichen Dunst überging. Der Atlantik. Das riesige Meer, das Afrika und Europa von Amerika trennte.
Ungläubig starrte Franka in diese Weite, die ihr minutenlang die Kehle zuschnürte. Sie schloss einen Moment die Augen, und als sie sie wieder öffnete, war zu ihrer Erleichterung alles noch da. Ihre Anspannung löste sich, ihr Atem wurde ruhiger, ging tief in den Bauch, kam wieder hoch, wie befreit. Es war, als würde sie von einer warmen Heiterkeit umfangen. Sie, Franka Ruschett aus Haldenstein, stand hier, an diesem Ort, den sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht so überwältigend vorgestellt hatte.
«Gefällt es dir?», hörte sie Henrys Stimme, in der ein hoffnungsvoller Ton lag.
Langsam nickte sie, ohne den Blick vom Meer zu lösen. «Es ist wunderschön», hauchte sie.
***
«Wie geht es Ihnen, Mademoiselle?», fragte der Concierge jeden Morgen.
«Gut, danke», antwortete Franka.
Es klang nicht überzeugend. Sie wusste selbst nicht, wie es ihr ging. Vieles gefiel ihr: der immer wolkenlose Himmel, die langgezogenen Wellen des Meeres, die rauschend an den Pier schlugen, die Palmen, die Schulbilder aus dem Paradies in Erinnerung riefen, die rege Geschäftigkeit in den Strassen, die Mangos, Bananen, Oliven, getrockneten Früchte, Orangen. Sie lernte die Gewürze kennen – Zimt, Ingwer, Safran, Gewürznelken, Koriander und viele mehr – und probierte sie beim Kochen aus, was mal mehr, mal weniger gut gelang und dazu geführt hatte, dass sie einen selbstgemachten Couscous wegwerfen musste, weil die Schärfe der Paprikaschoten oder der eigenartige Geschmack des Kardamoms ihr und Henry den Appetit verdarben. An anderes gewöhnte sie sich: an die Rufe des Muezzins, an die forschenden Blicke der einheimischen Männer, und sie lernte, freundlich, aber bestimmt die Einladungen der Verkäufer zum Begutachten der Ware auszuschlagen.
Die angenehme Wärme, die knapp an Hitze vorbeiging, gefiel ihr. So machte ihr das Laufen durch die Stadt nichts aus. Mehr jedoch der Grund für diese Spaziergänge. Bereits am dritten Tag nach ihrer Ankunft hatte sie begonnen, bei Versicherungen, Handelsunternehmen, Banken und Treuhändern vorzusprechen, in kleinen versteckten Büros und in prächtigen Bauten, wo sie ihren ganzen Mut zusammennehmen musste, um einzutreten. Sie solle an ihrem Französisch arbeiten, hiess es nur. Sie hatte sich ein Wörterbuch gekauft. Der Concierge gab ihr Zeitungen in Französisch, die Franka mit Henrys Hilfe zu lesen versuchte. Mit jedem neuen Wort, das sie lernte, wurde sie sicherer.
Henry hatte am ersten Abend umständlich erklärt, dass sie sorgfältig mit dem Geld umgehen müssten. Er habe zwar Arbeit als Monteur bei einer Firma, die Klimaanlagen installiere, doch wie lange, sei ungewiss. Nichts sei sicher in Marokko seit der Unabhängigkeit. Franka hatte nicht weiter gebohrt. Es durfte nicht sein, dass ihre Illusion eines angenehmen Lebens weitab der Heimat so schnell Risse bekam.
Als er eines Abends nach Hause kam, fasste sie sich ein Herz.
«Henry, was ist mit der Bar, die du eröffnen wolltest? Deshalb bist du nach Casa gekommen, oder? Das war dein Traum. Wie bei diesem Rick im Film.» Sie fühlte sich wie eine Einheimische, wenn sie die Stadt so nannte.
Henry schwieg, schenkte sich Pfefferminztee ein, den Franka genauso intensiv gesüsst hatte, wie es die Marokkaner machten. Er nahm einen Schluck, dann noch einen, setzte langsam die Tasse ab. Franka wurde ungeduldig.
«Was ist denn nun damit?», wiederholte sie.
«Den Film ‹Casablanca› meinst du? Nun, Rick’s Café gibt es nicht. Das war eine Erfindung der Amerikaner. Der Film wurde gar nicht hier gedreht.» Die Enttäuschung war ihm anzusehen. «Ausserdem ist es für Europäer schwierig geworden, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Sie dürfen nicht mehr
Alleininhaber einer Firma sein.»
«Davon hast du mir nichts geschrieben.»
Er drehte die Tasse in seinen Händen, wich ihrem Blick aus.
«Ich habe Angst gehabt, dass du sonst nicht kommen würdest.»
Missmut kam in Franka hoch. Sie stand auf, trat ans Fenster, betrachtete die weissen Häuser und die bunt gekleideten Frauen in der Strasse, die hupenden Autos und überlegte. Wäre sie tatsächlich nicht gekommen, wenn sie gewusst hätte, in welcher Lage Henry war? Oder war es vielleicht besser, dass er nichts geschrieben und ihr so die Entscheidung nicht schwerer gemacht hatte?
«Ich habe deine Frau kennengelernt», sagte sie.
Ein heftiges Atmen traf ihren Rücken. Sie wandte sich nicht um.
«Sie ist im Hotel Edelweiss in Olten aufgekreuzt. Im Juni, kurz nachdem ich dort als Rezeptionistin angefangen hatte. Sie hat gesagt, dass du die Alimente nicht bezahlst.»
Die Wut über den peinlichen Besuch von Henrys Exfrau kam wieder hoch. Sie hatte Franka beschimpft, dass sie ihre Ehe zerstört habe, und verlangt, dass sie sagen solle, wo Henry stecke. Mit gesenkten Köpfen waren die beiden Kinder – das dreijährige Mädchen und der vierjährige Junge – dagestanden und hatten geflennt. Der Hotelier war eingeschritten und hatte Franka angezischt, das Gezänk sofort zu beenden. Mit Mühe und mit der wiederholten Beteuerung, keinen Kontakt mit Henry zu haben, war es ihr gelungen, die Frau mit den Kindern aus dem Hotel zu drängen. Sie werde wiederkommen, hatte die Frau gedroht. Mit der Behörde. Der Hotelier hatte Franka gewarnt, dass sie ihre Sachen packen könne, wenn so etwas noch einmal vorkomme. Hatte sie sich an diesem Tag entschieden, Henry zu folgen?
Sie wandte sich um, traf auf seinen flehentlichen Blick.
«Ach, Franka», sagte er mit einem Seufzer, der Frustration, Unwillen und Hoffnung in einem ausdrückte. «Vergessen wir unser altes Leben. Lassen wir alles zurück, was uns behindert. Wir sind hier. Das ist das Einzige, was zählt. Hier schikaniert uns niemand, hier sind wir einfach zwei junge Menschen, die ein gutes Leben führen wollen.»
Das stimmte. Deshalb war sie hier. Sie wollte alles hinter sich lassen, was sie belastete. Die Menschen vergessen, die sie behandelt hatten, als wäre sie weniger wert als andere. Und sie wollte die Schulden verdrängen, die mehr drückten als die heisseste Sonne Afrikas.
«Meinst du, dass ich Arbeit finden werde?»
Henry stellte die Tasse auf den Tisch, stand auf, ergriff ihre Hände.
«Ganz sicher wirst du das. Du bist gescheit und tüchtig. Glaube an dich! Dann wird es klappen. Ganz sicher.» Er küsste ihre Hände. «Alles wird gut.»
Alles wird gut, wiederholte Franka seine Worte im Kopf. Alles wird gut, alles wird gut ... Sie zog ihre Hände zurück und trat wieder ans Fenster. Unten auf dem Platz sprach der Concierge mit einer jungen Frau. Sie lachte fröhlich. Franka beneidete sie darum.
***
Eines Morgens erwachte Franka von einem schmerzhaften Stöhnen, das durch die Zimmertür drang.
«Henry? Was ist los?», rief sie.
«Ich … ich habe solche Bauchschmerzen», hörte sie seine gepresste Stimme. Hastig stand sie auf, ging barfuss ins Wohnzimmer. Er lag seitlich zusammengekrümmt auf der Couch, die Beine angewinkelt, den Kopf zur Brust gezogen. Langsam hob er den Kopf und blickte sie hilfesuchend aus kaum geöffneten Augen an.
«Hast du Fieber?» Sie legte die Hand auf seine Stirn. Die war heiss. Ratlos blickte sie ihn an. «Vielleicht hast du etwas Schlechtes gegessen.»
Ein erneuter Krampf überkam Henry.
«Seit wann hast du diese Schmerzen?»
«Seit … seit ein paar Tagen. Heute Nacht sind sie schlimmer geworden.»
«Ich mache dir einen Tee.»
Der Tee half nicht. Henry vermied jede Bewegung, atmete schwer. Als sie leicht seinen Bauch drückte, der hart war wie Stein, stöhnte er auf. Trotzdem liess sie die Hand einen Moment sanft ruhen, als wolle sie ihn dadurch gesund machen. Tatsächlich schien er sich einen Moment lang zu entspannen, dann krümmte er sich erneut. Rasch zog sie ihre Hand zurück, wusste nicht, ob sie sie tröstend auf seine Wange legen sollte.
«Wir müssen zum Arzt», sagte sie.
«Der … kostet … zu viel.» Sie zögerte.
«Wenn es morgen nicht besser ist, gehen wir in eine Klinik.»
«Nein, wir haben kein Geld. Es wird sicher bald vorübergehen.»
Das hoffte Franka auch. Sie litt mit Henry mit, wusste sie doch nur zu gut, wie es sich anfühlte, wenn scharfe Messer den Bauch zu peinigen schienen. Sie schaute in der Dose nach, in der sie das Bargeld aufbewahrten. Umgerechnet fünfzig Franken waren da.
«Soll ich Geld holen auf der Bank? Falls wir zum Arzt müssen.»
Henry atmete heftig aus. «Ich habe kein Bankkonto.»
«Dann …?» Sie stockte, als Henry sich wieder zusammenkrümmte. Fünfzig Franken. Das war alles?
Sie ging an diesem Tag nicht auf Arbeitssuche, kochte ihm Tee und eine Bouillon, die er nicht anrührte. In der Nacht liess sie die Tür offen, hörte sein Stöhnen.
Am nächsten Morgen rief Franka ein Taxi. Henry widersprach nicht.
Die Untersuchung beim Arzt dauerte fast eine halbe Stunde. Er war ein alter Franzose, der Frankas holprigen französischen Ausführungen geduldig zuhörte, während Henry sich auf kurze Einwürfe beschränken musste. Er konnte kaum aufrecht sitzen. Franka wartete die Ergebnisse der Untersuchung im Wartezimmer ab.
«Es ist eine schwere Darmentzündung», sagte der Arzt, als er sie in sein Sprechzimmer gerufen hatte, wo sich Henry langsam das Hemd anzog. «Ich habe ihm eine Spritze gegeben gegen die Schmerzen. Und er sollte ein paar Tage hier in der Klinik bleiben.»
«Wir haben kein Geld», sagte Franka.
Der Arzt zog eine Schnute.
«Es ist Ihre Entscheidung. Ich gebe Ihnen Penicillin mit. Und ich rate Herrn Sturn, vorsorglich Chinin gegen Malaria zu nehmen. Er würde in seinem Zustand grosse Probleme bekommen, wenn er malariakrank würde. Und Ihnen, Fräulein, rate ich das Gleiche. Ausserdem …», er musterte Franka eindringlich, «... sind Sie beide viel zu mager.» Er stand auf und begleitete sie zur Tür. «Wenn es Herrn Sturn in drei Tagen nicht besser geht, kommen Sie wieder. Verstanden?»
Franka nickte und sie gingen zur Theke, um die Behandlung zu bezahlen. Henry lehnte sich an die Wand.
«Möchten Sie die zwei Packungen Chinin?», fragte die Arztgehilfin.
«Nur eine.» Die würde Henry benötigen. Sie selbst würde verzichten. Da kam ihr ein Gedanke. «Herr Doktor!», rief sie zur offenen Tür des Untersuchungszimmers.
Er erschien in der Tür.
«Was noch?», fragte er.
«Hätten Sie nicht Arbeit für mich? Irgendwas? Ich bin fleissig. Ich mache alles. Auch Putzen.»
Es war Franka egal, was die zwei Patienten, die im Wartezimmer sassen, von ihr dachten. Der Arzt blickte sie prüfend an. Endlich sagte er:
«Ich hör mich um. Kommen Sie nächste Woche vorbei. Aber machen Sie sich keine allzu grossen Hoffnungen.»
«Danke», sagte sie, behielt für sich, dass sie sich diese Hoffnungen machte.
Im Taxi sank Henry gegen ihre Schulter. Er kämpfte gegen das Einschlafen. Die Spritze wirkte. Er ergriff Frankas Hand.
«Es tut mir leid, dass alles so schlecht läuft. Bitte verzeih mir.»
Sie verzog den Mund. Es lief tatsächlich nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie war seit fünf Wochen in Casablanca und hatte immer noch keine Arbeit. Henry war krank, erhielt keinen Lohn, wenn er nicht arbeitete. Der Arzt und das Taxi hatten viel Geld gekostet, zu viel für ihre Verhältnisse.
Zweiundzwanzig Franken blieben ihnen.
Henry verschlief den ganzen folgenden Tag. Franka beruhigte ihren knurrenden Magen mit einer Bouillon und einem Stück Brot. Dann nahm sie Papier und den Füller aus der Schublade, setzte sich an den Tisch und begann zu schreiben:
Liebe Jelscha
In Casablanca ist jeden Tag schönes Wetter. Man braucht nie eine Jacke, auch in der Nacht ist es warm. Es ist wirklich angenehm, hier zu leben. Die Menschen sind nett. Vor allem der Concierge ist hilfsbereit und freundlich.
Im Moment fehlt uns etwas Geld. Henry ist krank geworden und kann derzeit nicht arbeiten. Aber er wird bald wieder gesund sein. Ich habe eine Stelle in Aussicht, doch dauert es bis dahin noch zwei, drei Wochen. Henry wird bald mehr verdienen, das hat ihm sein Vorgesetzter zugesichert. Deshalb bitte ich dich, uns etwas Geld zu schicken, fünfzig Franken würden genügen. Das Leben hier ist viel günstiger als in der Schweiz. Natürlich bekommst du das Geld zurück, sobald ich meinen ersten Lohn erhalten habe. Und wenn du noch ein Päckchen Zigaretten schicken kannst, sind wir dir sehr dankbar. Am liebsten die North Pole. Stärkere kann man in dieser Trockenheit kaum vertragen.
Ich lege dir einen Brief an Mama bei. Bitte bringe ihn zur Post. Und gell, du darfst niemandem sagen, wo ich bin. Niemandem!!!
Also besten Dank für alles
Deine Franka
Im Brief an ihre Mutter hatte sie geschrieben, dass es ihr im Hotel in Olten gut gehe, dass sie jedoch keine Zeit habe, auf einen Besuch nach Hause zu kommen. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Freundin und ihre Mutter belog.
Am nächsten Tag ging Franka zu einem Pfandleiher und versetzte ihren Wecker und ihren Mantel. Die Uhr ihres Vaters behielt sie. Als letzte Reserve.
3
Haldenstein / Graubünden, 18. Juli 1984
«Wie geht es deinen Kindern?», fragte Franka.
Immer noch standen sie vor dem Restaurant Calanda unterhalb des Friedhofs. Sie blickte die Gasse hinauf zu den kärglichen Resten der Burgruine Haldenstein, die trotz ihrer Dürftigkeit einen stillen Stolz über ihre erhabene Position auf dem Felsen oberhalb des Dorfes ausstrahlte.
Henry drückte mit dem Schuh die Zigarette aus. Die Schuhe aus glattem braunem Leder hätten eine Politur vertragen.
«Ich sehe sie kaum.» Es klang wie eine Feststellung, dass heute schönes Wetter oder der Herbst in weiter Ferne sei.
«Sie müssen um die dreissig Jahre alt sein», insistierte Franka.
«Mein Sohn hat eine Tochter. Ich bin also Grossvater.» Henry war vierundfünfzig Jahre alt, acht Jahre älter als sie.
Franka musterte ihn unverhohlen, die Falten um die Mundwinkel, auf der Stirn und in den Augenwinkeln. Henry liess die Prüfung lächelnd über sich ergehen. Dieses Lächeln hatte sie nach Marokko gebracht. Damals.
«Was machst du so?»
«Ich handle mit afrikanischen Souvenirs. Die sind begehrt. In Zürich reissen sie sich darum. Ein oder zwei Mal im Jahr reise ich nach Nordafrika und kaufe alles Mögliche ein: Holzfiguren, kleine Teppiche und so. Ein Freund von mir verkauft sie in seinem Laden.»
Also war er immer noch mit Afrika verbunden. Etwas stach Franka in den Magen. War es Neid?
«Komm doch mit!»
Franka zog heftig die Luft ein. Diesen Satz hatte sie schon vor mehr als fünfundzwanzig Jahren gehört. Von Henry. Sie hatte geglaubt, dass sie Herrin ihrer Zukunft sei und mit ihrem Leben machen könne, was sie wolle. Wie blauäugig war sie gewesen, wie unbeschwert, wie unbedarft.
Die Tür des Restaurants öffnete sich. Jelscha trat heraus. Sie hielt ein flaches, mit rotem Papier umwickeltes Paket in der Hand. Es war offensichtlich eine Schallplatte.
«Die habe ich dir mitgebracht.»
Franka stutzte, dann ergriff sie das Geschenk und machte es auf. In Pink und Grün lief der Name von Elvis Presley von oben nach unten am linken und von links nach rechts am unteren Rand über die Hülle. Jung und fröhlich sah der Sänger aus. Franka glaubte, die kräftigen Akkorde der Gitarre zu vernehmen und aus dem weitgeöffneten Mund seine Stimme zu hören, die manchmal weich und einschmeichelnd, manchmal wild und furios sein konnte.
«Weisst du noch?», fragte Jelscha. «Es war sein erstes Album. Wie oft haben wir bei mir zuhause zu seiner Musik getanzt und gesungen wie die Verrückten. Wir kannten alle seine Lieder auswendig.»
Franka fuhr behutsam mit der Hand über die Hülle.
«Du wolltest wie Marilyn Monroe sein», sagte sie leise.
«Ja, das stimmt. Sie war schön und sexy und hat allen Männern den Kopf verdreht. Und du wolltest wie Audrey Hepburn sein. Oder war es Shirley MacLaine? Ich bin mir nicht mehr sicher.»