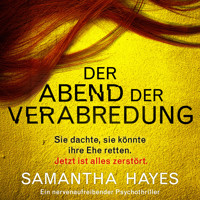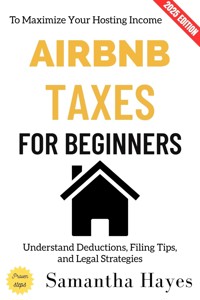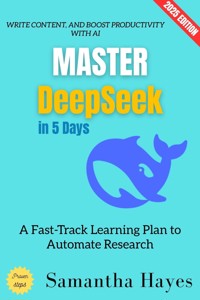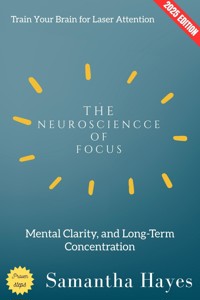Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine von uns wird bezahlen. Eine von uns wird sterben. Als ihr Haus abbrennt, wird Ginas Leben und das ihrer Familie auf den Kopf gestellt. Glücklicherweise ist ihre alte Freundin Annie nicht in der Stadt und bietet ihnen an, vorübergehend bei ihr zu wohnen – in einem wunderschönen, renovierten georgianischen Haus. Gina nimmt das Angebot dankend an. Als es bald darauf an der Tür klingelt und Mary auftaucht, die behauptet, die Haushälterin zu sein, stellt Gina das nicht infrage, denn Annie lobt ihre Angestellte in den höchsten Tönen. Doch Gina hat das Gefühl, dass Mary etwas zu verbergen hat. Schon bald wird sie von albtraumhaften Erinnerungen heimgesucht – Erinnerungen an eine verhängnisvolle Nacht vor vielen Jahren. Doch der wahre Albtraum steht erst noch bevor. Dieser Thriller ist wie eine rasante Achterbahnfahrt – Achtung: Schleudertrauma möglich! »›Eine von uns‹ war für mich ein echtes Highlight unter den Psychothrillern, die ich in letzter Zeit gelesen habe.« Rezension von Vorablesen.de »Ich konnte dieses Buch nicht aus der Hand legen. Total super und fesselnd geschrieben und einfach mehr als lesenswert. Ein Thriller der brillant geschrieben ist.« Rezension von Vorablesen.de »Ein absolut gelungener Thriller, der mit psychologischer Raffinesse, spannungsgeladener Handlung und einem starken Schreibstil überzeugt.« Rezension von Vorablesen.de »›Eine von uns‹ war für mich ein echter Pageturner, den ich kaum aus der Hand legen konnte. Spannung, Dynamik und ein starker Schlusspunkt – ein rundum gelungenes Leseerlebnis.« Rezension von Vorablesen.de
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Als ihr Haus abbrennt, wird Ginas Leben und das ihrer Familie auf den Kopf gestellt. Glücklicherweise ist ihre alte Freundin Annie nicht in der Stadt und bietet ihnen an, vorübergehend bei ihr zu wohnen – in einem wunderschönen renovierten georgianischen Haus. Gina nimmt das Angebot dankend an. Als es bald darauf an der Tür klingelt und Mary auftaucht, die behauptet, die Haushälterin zu sein, stellt Gina das nicht infrage, denn Annie lobt ihre Angestellte in den höchsten Tönen. Doch Gina hat das Gefühl, dass Mary etwas zu verbergen hat. Schon bald wird sie von albtraumhaften Erinnerungen heimgesucht – Erinnerungen an eine verhängnisvolle Nacht vor vielen Jahren.
Samantha Hayes
Eine von uns
Thriller
Aus dem Englischen von Anne Rudelt
Für Ben, Polly und Lucy, in immerwährender Liebe xxx
PrologSara
Es ist komisch – nie hätte ich gedacht, mir selbst beim Sterben zuzusehen. Vor allem nicht mit fünfzehn Jahren.
Irgendwann kommt ein Zeitpunkt, an dem man es einfach weiß, ohne jeden Zweifel, dass es geschehen wird, dass es kein Zurück gibt, ein Punkt, an dem das Ende im wahrsten Sinne des Wortes nah ist. Es ist wie eine Art Droge, zum Zeugen des eigenen Sterbens zu werden und von oben zuzusehen. Trotz der mörderischen Umstände ließen mich meine Sinne langsam ziehen, wie in einem liebevoll-zärtlichen Abschied. Sie ließen mich taub werden gegenüber allem Schlechten. Und ich fand es beinahe befreiend, loszulassen, den Schmerzen zu entfliehen, mich davon zu erlösen, mich zu wehren. Wobei ich ohnehin wenig hätte ausrichten können. Er war viel größer als ich.
Es hatte mit einer Hand um meinen Oberarm begonnen. Schon durch die Art, wie er nach mir gepackt hatte, spürte ich, dass Ärger drohte. Sein Griff war grober als sonst.
»Oh nein, das machst du nicht«, hatte die Stimme in mein Ohr geknurrt und Angst durchlief mich. Er hatte mich herumgeschleudert.
Geh weiter, einfach weitergehen, sprach ich zu mir. Schließlich war er nicht hinter mir her. Ich war draußen, um sie zu suchen, ich wollte sie in Sicherheit bringen, wobei auch das wenig Aussicht auf Erfolg hatte, denn der Ort, von dem wir kamen, war alles andere als sicher. Sie war nicht zum ersten Mal weggelaufen.
Es war einfach Pech, dass ich ihm während meiner Suche in die Arme gelaufen war.
»Wenn ich sie nicht haben kann, dann wirst du genügen müssen«, sagte er und zwang mich, neben ihm herzustolpern. »Strafe.«
Er ging nicht sehr schnell – dazu war er nicht in der Lage –, doch er war stark. Auf keinen Fall konnte ich seinem Griff entfliehen. Seine Hände waren groß, nachdrücklich in ihrer Kraft und ich wusste, sie würden bald schon meinen Körper erobern. Ich fügte mich, während wir weitermarschierten. Das passierte heute nicht zum ersten Mal.
Zuerst dachte ich, er würde mich zu seinem Haus führen. Ich mochte es dort nicht besonders. Es roch modrig und alt, es war zu groß und dunkel. Doch wir landeten dort in der Nähe – an einem Ort, der mir leider viel zu vertraut war. Nachdem er seine Hose geöffnet hatte, zwang er mich, alle möglichen Dinge mit ihm zu tun, und die ganze Zeit über dachte ich an meine Schwester, an meine Freunde, an meinen Freund. Mein Körper musste diese Dinge machen, doch mein Geist war woanders – er lebte ein Leben, das ich nicht hatte. Ein Leben, das ich niemals haben würde. Die Kälte ließ mich zittern.
Als es vorüber war, griff er nach mir und schleppte mich durch das Unterholz. Mir war klar, das bedeutete nichts Gutes. Sonst ging er einfach fort und ließ mich liegen, oder er legte mich vor seine Haustür, schubste mich in die Nacht wie eine Straßenkatze.
Dann kam die Strafe. Ich schrie. Schlug um mich. Bettelte um mein Leben. Als ich diesmal von oben auf mich hinabschaute und mich hier unten so hilflos sah, da wusste ich, dass das Ende nahte. Es schien ewig zu dauern.
Doch dann hörte es auf. Ich befand mich wieder in meinem Körper.
War dort noch jemand?
Um ehrlich zu sein, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich, ob ich lebte oder tot war.
1Gina
Die Klingel läutet zum dritten Mal und ich eile zur Haustür – das altmodische Geräusch schallt durch das gesamte Erdgeschoss des herrschaftlichen Georgianischen Stadthauses. Ebendieses Stadthauses an der Küste in Hastings, in dem wir leben – wenn auch nur vorübergehend – und ich kann es noch immer nicht glauben.
Und abgesehen von dem Grund für unseren Umzug finde ich das Leben derzeit ziemlich großartig. Was will man auch aussetzen an einem Leben an der Südküste, gemeinsam mit meinem Mann und zwei Kindern, und das völlig umsonst?
Als ich die Tür öffne, steht davor eine Frau, ein paar Jahre jünger als ich – vielleicht Mitte dreißig – auf der unteren Stufe und strahlt mich mit einem perfekten Lächeln an.
»Hallo … hallooo …«, flötet sie und ihr Lächeln wird noch breiter.
Einen Moment lang starre ich sie an, amüsiert, während ich grüble, was ich vergessen habe.
»Hi«, erwidere ich und fühle mich nicht ganz ebenbürtig, während ich sie von oben bis unten mustere. Auf meinem T-Shirt entdecke ich einen Fleck Babykotze, als ich Tommy, meinen Dreijährigen höher auf die Hüfte schiebe. Er greift sich ein Büschel meiner ungekämmten Haare, sodass ich zusammenfahre und mein Kopf zur Seite zuckt. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin Mary«, antwortet die Frau etwas säuselnd und blickt zu mir auf, als müsste ich genau wissen, wer sie ist. Sie trägt ein knielanges, hellblaues Tunika-Kleid, mit kurzen Ärmeln und einem gestärkten weißen Kragen. Sie wirkt etwas kleiner als ich, allerdings steht sie mit ihren flachen, schwarzen Ballerinas eine Stufe tiefer als ich. Ihr blondes Haar ist ordentlich zu einem festen Dutt auf ihrem Oberkopf gebunden und ihre blasse Haut ist makellos und ungeschminkt. Mir kommt der Gedanke, dass sie sicherlich die Hauptrolle in einem Film bekäme, der eine Mischung aus Kill Bill und Manhattan Love Story wäre.
Doch es sind ihre Augen – weit auseinanderstehend und durchdringend, hinter dem Kobaltblau schlummert etwas Tiefes, Ungreifbares –, die mich in ihren Bann ziehen, ungeachtet des wieder erklingenden Weinens meines Neugeborenen in der Küche. Es läuft mir kalt den Rücken herunter.
»Wie kann ich Ihnen helfen, Mary?«, frage ich und trete von einem Fuß auf den anderen, der ausgefranste Saum meiner alten dunkelblauen Jogginghose liegt auf meinen nackten Zehen.
»Hat Annie Ihnen nicht Bescheid gegeben?«, fragt sie und streckt ihre schlanken Finger in Tommys Richtung, der sofort aufhört, zu nörgeln und lachen muss, als Mary seine Handinnenfläche kitzelt. »Meinetwegen?«
Unsicher schüttele ich den Kopf und versuche, in den Untiefen meines von Stilldemenz zerfressenen Hirns irgendetwas zu finden, was erklären würde, warum diese Frau keine vierundzwanzig Stunden, nachdem wir in unser neues Zuhause gezogen sind, auf meiner Schwelle steht. Na ja, nicht wirklich unser neues Zuhause im klassischen Sinne, doch zumindest solange Annie während der kommenden Monate auf Reisen ist – sie will sich finden oder »auftanken«, wie sie es in ihrer WhatsApp-Nachricht formuliert hatte – und unser Haus renoviert wird. Oder viel mehr wieder aufgebaut. Das Feuer hat den größten Teil des Äußeren sowie das gesamte Innenleben des Hauses zerstört.
»Leider nicht, sie hat Ihretwegen nichts erwähnt.«
Was der Wahrheit entspricht. Annie hatte geradezu wenig gesagt, als sie mir das erste Mal wegen der Idee unseres Umzugs hierher geschrieben hatte. Ich hatte sie sogar daran erinnern müssen, uns den Zahlencode für die Schlüsselbox zukommen zu lassen.
Impulsiv, waghalsig, vergesslich und wild, das waren immer schon Annies zweite Vornamen. In der Schule hatten wir sie immer damit aufgezogen, dass ihr Nachname – Stone – so gar nicht dem entsprach, was sie eigentlich ausmachte – ihr Geist war immer wach, ihr Gehirn erschuf ständig neue Dinge, ihr Körper bebte vor Energie. Unserem Freundeskreis erzählte sie später, der Spitzname, den wir ihr damals gegeben hatten, sei der Grund gewesen, weshalb sie sich den Künstlernamen Wilde als Nachnamen ausgewählt hatte. Du bist eine ganz Wilde, Annie.
Mary lacht und wirft dabei ihren Kopf zurück, wobei ihr sehniger Hals sichtbar wird. »Typisch Annie«, meint sie und steigt eine Stufe weiter hinauf, sodass sie jetzt auf einer Höhe mit mir ist. Unsere Gesichter sind nah beieinander und ich spüre ihren Atem warm an meiner Wange, als sie spricht. »Sie würde sogar vergessen, zu ihrer eigenen Beerdigung aufzutauchen«, fügt sie lachend hinzu.
Merkwürdige Wortwahl, geht mir sofort durch den Kopf, aber ich will nicht unhöflich sein, also lächle ich zurück.
»Ich habe einen eigenen Schlüssel, aber ich wollte Sie nicht erschrecken. Kann ich reinkommen? Geht nicht anders, wenn ich meinen Job machen soll.« Noch ein perfektes Lächeln.
»Ihren Job?«
Irgendwie gelingt es Mary, sich an mir vorbeizuschieben und sie schwebt den langen, schachbrettartig gefliesten Flur entlang bis zur Küchentür. Hier dreht sie sich um, ihre zarte Figur eine Silhouette im Licht, das durch die Unmengen an Glas im riesigen, lichtdurchfluteten Küche-Essbereich-den-Rest-des-Hauses-überflüssig-machenden Anbau hereinströmt, den Annie an die Rückseite des Hauses gesetzt hatte. Er war erst vor einigen Monaten fertig geworden und sie hatte keine Kosten gescheut.
»Soll ich alles wie immer machen?«, fragt Mary und der Lichtschein um sie herum lässt sie engelsgleich erscheinen.
»Also gut, du darfst runter, Tommy«, seufze ich und setze meinen sich windenden Sohn auf den Boden. »Und sei vorsichtig mit Gracie!«, rufe ich ihm nach, während er in die Küche flitzt, wie ein Löwe brüllt und sein Spielzeugauto in die Höhe streckt.
Mary lacht. »Er scheint ein ziemliches Energiebündel zu sein.«
»Das kann ich Ihnen sagen, ziemlich mutig von Annie, uns Rasselbande hier unterzubringen.« Ich schließe die Haustür und stimme in Marys Lachen ein, während ich den Flur entlang auf sie zu gehe. »Und es tut mir leid, dass ich verwirrt bin. Vielleicht hat Annie mir erzählt, dass Sie kommen, aber … Sie wissen schon.« Ich tippe an meine Schläfe, »wahrscheinlich habe ich es vergessen.« Dann schiebe ich mich an ihr vorbei und steuere auf die gläsernen Falttüren zu, die sich zum Garten hin öffnen, um einen Blick auf Gracie zu werfen, die sich in ihrer Babyschale regt. »Hallo Schlafmütze«, säusele ich, ehe ich mich wieder umdrehe. »Oh …!«
Mary steht direkt hinter mir und blickt hinab auf mein Baby.
»Was für eine süße Maus«, sagt sie, ohne ihren Blick abzuwenden. »Wie alt ist sie?«
»Morgen sind es sieben Wochen«, sage ich, beuge mich hinunter und öffne den Sicherungsgurt der Babyschale. Als ich vorhin vom Bahnhof zurückkam, wo ich Matt, meinen Mann, vor einer guten halben Stunde abgesetzt hatte, damit ich das Auto für den Tag behalten konnte, schlief sie noch tief und fest. Meine Hoffnung war, dass ich noch in Ruhe den Frühstückstisch abräumen und vielleicht sogar ein paar Sachen auspacken könnte. Nach unserer Ankunft gestern ist alles so stressig gewesen, dass ich nicht mehr viel geschafft habe.
»So ein kleines Schätzchen«, sagt Mary und streckt bereits ihre Arme aus, ehe ich mein inzwischen weinendes Baby überhaupt aus ihrer Schale heben kann. »Darf ich?«
Einen Moment sehe ich sie an. »Oh, na klar«, sage ich und reiche sie ihr. Als Tommy ein Baby war, habe ich immer irgendeinen Grund gefunden, um nur niemals eine fremde Person mein Baby nehmen zu lassen – ich war zum ersten Mal Mutter und eine solche Glucke. Mit Gracie jedoch bin ich viel entspannter und im Ergebnis scheint auch mein Baby viel ausgeglichener zu sein.
»Ooh, bist du nicht ein süßes kleines Mädchen?«, begrüßt Mary sie, nimmt sie geschickt entgegen und stützt auch ihren Kopf auf eine Weise, die einige Erfahrung mit Neugeborenen erkennen lässt. »Du wirst eine Menge Herzen brechen, wenn du groß bist, oder, Mama?« Mit einem Funkeln in den Augen sieht sie mich an.
»Auf jeden Fall«, lache ich und zucke zusammen, als Tommy die Reifen seines Spielzeugautos an Annies makellos weißen Wänden entlangrollen lässt. »Halt, Tommy, lass das!«, rufe ich ihm zu. »Spiel auf dem Teppich, sei ein lieber Junge.«
Mein Sohn grummelt, wirft sich dann aber auf den dicken cremefarbenen Teppich vor dem riesigen, modernen Kamin.
»Also, ähm, Mary … tut mir leid. Sie haben Ihren Job erwähnt?« Ich beobachte, wie sie Gracie in den Armen wiegt, ihr Köpfchen liegt in ihrer rechten Armbeuge, die andere Hand stützt sanft ihren Rücken. Langsam wippt sie das Baby und schwenkt sie ein wenig hin und her. Gracie schaut hinauf in das unbekannte weibliche Gesicht, blubbert zufrieden vor sich hin und pustet Bläschen durch ihre zartrosa Lippen.
»Ich arbeite seit knapp einem Jahr für Annie«, erklärt sie und richtet ein beruhigendes Geräusch an Gracie. »Und jetzt bin ich auch für Sie da!«
»Für mich?« Irgendetwas in mir geht auf Abstand. Ich bin es nicht gewohnt, jemanden um mich herum zu haben.
»Ich bin schließlich ihre Haushälterin«, erklärt Mary, beugt sich nach vorn, um meinem Baby einen Kuss auf die Stirn zu geben und behält mich dabei fest im Blick.
2Gina
»Eine Haushälterin?«, fragt Matt später nach und schüttelt ungläubig den Kopf. »Du machst doch Witze, oder?«
»Nix da. Uniform. Staubpuschel. Strahlendes Lächeln. Die ganze Palette.«
Er pfeift anerkennend und nimmt einen weiteren Schluck Bier aus seiner Flasche Peroni. »Das habe ich nicht erwartet.«
»Ich auch nicht«, stimme ich zu und horche für einen Moment nach dem Baby. »Sie war etwas … intensiv«, sage ich und suche nach einer passenden Beschreibung für Mary, ohne gemein zu klingen.
Ich stehe auf, um das Babyfon von der riesigen Kücheninsel aus weißem Marmor am anderen Ende des großen, verglasten Anbaus zu uns auf das L-förmige Sofa am Kamin zu holen, wo wir es uns gemütlich gemacht haben – dem weißen Sofa, das ich unbedingt abdecken muss, ehe Tommy es zerstört. Hier werden keine Holzstücke aus dem Schuppen hineingeschleppt oder der Aschefang geleert – auf keinen Fall. Ein einfacher Klick mit der Fernbedienung erweckt den topmodernen Einbaukamin zum Leben und die Flammen flackern um riesige unechte Kieselsteine.
»Irgendwie komisch, dass Gracie und Tommy oben sind, so weit weg von uns.« Ich lege mein Ohr an das Babyfon und lausche. »Ich hoffe, es funktioniert. Das Haus ist so groß, die Wände sind wahrscheinlich wirklich dick.«
»Entspann dich, Liebling. Wir haben es doch gestern Abend getestet und es funktionierte einwandfrei.« Er reicht mir meinen Kamillentee. »Hier, den hab ich dir gemacht. Waren ziemlich hektische Tage.«
Ich schnaube. »Eher hektische Wochen.«
Das stimmt. Es war furchtbar und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es uns gelungen ist, das alles zu überstehen – ganz besonders mit einem Neugeborenen, um das wir uns kümmern mussten. Es ist kein einziger Tag vergangen, an dem ich meinen Schutzengeln nicht dafür gedankt habe, dass wir in jener Nacht vor drei Wochen, in der unser Haus abgebrannt ist, nicht daheim gewesen sind. Zum ersten Mal hat sich der Kater am nächsten Tag gelohnt, den wir nur deshalb hatten, weil wir bei unseren guten Freunden Laura und Patrick am Abend ein bisschen zu viel getrunken hatten, sodass wir alle dort übernachtet haben – Kinder, Reisebettchen, abgepumpte Milch, das volle Programm. Das hat uns das Leben gerettet.
»Wohin gehst du jetzt schon wieder?«, fragt Matt, als ich erneut aufspringe, weil ich nicht zur Ruhe kommen kann.
»Ich will herausfinden, wie man die Jalousien schließt«, erwidere ich. »Ich fühle mich wie auf dem Präsentierteller hinter all dem Glas, voll sichtbar für alles dort draußen.« Oder für jeden, denke ich automatisch, als ich in die stockfinstere Nacht hinausblicke, und ein Schauer läuft mir über den Rücken. Doch vor dem Nachthimmel sehe ich nur mein Spiegelbild und das des Zimmers hinter mir.
»Wer sollte in einer nieseligen Herbstnacht schon dort draußen sein und uns beobachten? Hinter dem Garten liegt nur das leer stehende Grundstück. Da kommt niemand rein. Als Couchpotatoes sind wir sowieso ziemlich uninteressant.« Matt klopft auf den Platz neben sich.
Ich halte inne und mir fallen die Worte des ermittelnden Beamten wieder ein, als er erstmals die Möglichkeit einer Brandstiftung erwähnte und sich bemühte, uns taktvoll zu fragen, ob irgendwer etwas gegen uns haben könnte, ob wir Auseinandersetzungen mit den Nachbarn hatten oder Streit auf der Arbeit – und ob uns irgendwer aufgefallen sei, der sich in der Nachbarschaft herumgetrieben und vielleicht unsere Abläufe beobachtet hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre mir niemals der Gedanke gekommen, irgendwer könnte uns ausspionieren oder gar unser Haus zerstören wollen. Die Vorstellung erschien mir völlig abwegig.
Verzweifelt rufe ich: »Alexa, schließe die Jalousien!«
»Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen ›Jalousien‹ finden …« erklärt eine süßliche Stimme.
Auf der Suche nach einer weiteren Fernbedienung wandert mein Blick erneut durch den Raum, doch ich kann nichts finden, was wir nicht zuvor schon entdeckt haben. Und dann, wie schon am Nachmittag, beginnen die Deckenleuchten zu flackern. »Das meinte ich vorhin«, erkläre ich Matt und halte inne, während ich zur Decke schaue und darauf warte, dass es erneut geschieht. »Siehst du, genau so«, füge ich hinzu, als sie für ein paar weitere Sekunden an- und ausgehen.
Matt starrt die eingelassenen Deckenspots an und zuckt mit den Schultern. »Das ist bestimmt kein Grund zur Besorgnis. Aber ich verstehe, dass du angespannt bist, das ist doch kein Wunder.«
Eine Zeit lang sage ich nichts und warte ab, ob es noch mal passiert, doch das tut es nicht. Der Gedanke, irgendwo zu bleiben, wo die Elektrik spinnt, ist für mich unerträglich – nach all dem, was in unserem alten Haus geschehen ist.
»Liebling, diese Lampen sind buchstäblich nagelneu. Und sie wurden von einem Elektriker eingebaut«, fährt Matt fort, als er meine Zweifel wahrnimmt. »Du könntest doch Annie einfach schreiben und nach den Jalousien fragen«, schlägt er vor und klopft wieder auf den Sofaplatz neben ihm. »Und dann komm her und entspann dich.«
»Aber Annie ist doch damit beschäftigt, sich zu finden. Sie hat ziemlich deutlich gemacht, dass sie im Urlaub nicht gestört werden will«, ahme ich Annies Nachricht mit alberner Stimme nach, in der sie uns von ihrem kenianisch-thailändisch-japanischen Abenteuer berichtet hat. »Wobei sie wahrscheinlich schon nächste Woche wieder zurück ist und unbedingt wieder arbeiten will, so wie ich sie kenne.«
»Wenn sie nicht mal einen Moment finden kann, um dir zu sagen, wie du die Jalousien schließt, dann hat sie ohnehin keine Chance darauf, sich selbst zu finden, oder?«
»Da hast du recht«, stimme ich zu, greife nach meinem Handy und tippe eine kurze Nachricht.
Schon kurz darauf, während wir Netflix nach etwas durchforsten, was wir sehen möchten, trifft Annies Antwort ein.
Schalter für die Jalousien am Hauptlichtschalter xxx
Einen Augenblick später erscheint ein Foto von einem Zebra in einer struppigen Landschaft vor einem beeindruckenden Sonnenuntergang auf meinem Bildschirm. »Sie scheint auf einer Safari gewesen zu sein«, sage ich und werfe Matt einen Blick zu, ehe ich mich auf die Suche nach dem Lichtschalter begebe. »Zauberei!«, rufe ich aus und lasse die Jalousien in den doppelverglasten Fenstern herunter. »Endlich Privatsphäre.«
Ich lasse mich wieder neben Matt fallen, sinke in die weichen Federkissen, während er seinen Arm um mich legt, und doch fällt es mir schwer, zur Ruhe zu kommen und es mir gemütlich zu machen.
»Was ist los?«, fragt er und drückt die Pausetaste der Fernbedienung. »Du stehst irgendwie neben dir.«
»Tut mir leid«, sage ich seufzend. »Ich fühle mich einfach irgendwie … aufgekratzt. Du weißt schon, innerlich unruhig.«
Matt sieht mich an, in seinen Augenwinkeln entstehen leichte Fältchen, während er mich betrachtet. »Kein Wunder«, sagt er, drückt mich und küsst mich auf die Stirn. »Du hast vor sieben Wochen ein Baby bekommen und unser Haus ist abgebrannt, als sie gerade erst einen Monat alt war. Das kommt davon.« Und der Aufenthalt in diesem Haus, bin ich ziemlich sicher, ihn murmeln zu hören.
»Ich weiß, du hast recht.« Ich lege meinen Kopf an seine Schulter, denke an unsere beiden süßen Mäuse, die oben schlafen und danke Gott zum eintausendsten Mal dafür, dass sie in Sicherheit sind. »Aber nicht deshalb fühle ich mich so komisch. Es liegt an dieser Frau von heute Vormittag …«
»Ich bin übrigens Gina«, sagte ich heute früh zu Mary, während sie Gracie auf dem Arm hatte. Ich wollte unbedingt, dass sie mir die Kleine zurückgab. Im Grunde hatte ich eine Fremde von der Straße in unser Zuhause gelassen und ihr schon nach wenigen Minuten mein Baby überlassen.
»Ja. Gina. Ich weiß«, antwortete Mary lächelnd und sah mich mit diesen durchdringend blauen Augen an, während sie sie weiter hin und her wiegte. Gracie schien selig, sie starrte sie an und gluckerte vor sich hin. »Annie hat mir alles von Ihnen erzählt. Es tut mir so leid, was Sie durchmachen mussten. Das klingt schrecklich.«
»Danke, das war es wirklich«, gab ich zurück. »Ich glaube, wir wären durchgedreht, hätten wir nur noch eine weitere Nacht in diesem Hotelzimmer bleiben müssen, während wir nach einem Mietobjekt suchten. Wir sind so dankbar für Annies Großzügigkeit.«
Zuerst hatten wir versucht, das Gute zu sehen – einfach erleichtert darüber, alle in Sicherheit und unverletzt zu sein, und immerhin war uns das Trauma erspart geblieben, mit zwei zu Tode erschrockenen Kindern mitten in der Nacht aus einem brennenden Haus zu fliehen. Aus diesem Albtraum war ich seit dem Feuer mehr als einmal erwacht, mein Gehirn spielte das Worst-Case-Szenario durch, während ich alles verarbeitete.
Zum Glück übernahm die Gebäudeversicherung unseren Hotelaufenthalt, bis wir ein Mietobjekt gefunden hatten, doch es stellte sich als schwierig heraus, etwas zu finden. Unsere technischen Geräte wie Laptops und die übrigen Basics wurden zügig ersetzt, doch die vollständige Begutachtung und die Auszahlung der Versicherungssumme würden noch eine ganze Weile dauern, zum damaligen Zeitpunkt auch abhängig von den Ermittlungsergebnissen. Und doch kann kein Geldbetrag den emotionalen Wert der Dinge ersetzen, die wir verloren haben.
Der leitende Ermittler der Brandpolizei ließ uns in den ersten Tagen nicht in die Ruine unseres Hauses – einem unauffälligen frei stehenden Haus aus den Fünfzigerjahren am Rande Crawleys -, weil es zu unsicher war. Nachdem die Ermittler und die Polizei mit ihrer Suche nach dem Brandherd fertig waren, retteten sie von unserem Eigentum, soviel sie konnten – das meiste jedoch war entweder dem Löschwasser zum Opfer gefallen oder, wenn die Flammen es nicht zerstört hatten, vollständig vom Rauch ruiniert und mit einer teerigen schwarzen Schicht überzogen.
»Dann war das doch das perfekte Timing, oder?«, meinte Mary und beruhigte mein Baby, während sie es hielt, wiegte und bewundernde Laute von sich gab. »Dass Annie jetzt weggefahren ist und Ihnen ihr Haus überlassen hat.«
»Das stimmt«, hatte ich erwidert und mir fiel ein, wie in diesem Augenblick Marys Gesichtsausdruck von süß und freundlich zu leer und starr gewechselt war. Ich streckte meine Arme aus, um Gracie wieder zu mir zu nehmen. Das Schaukeln hatte aufgehört und ich fragte mich, ob sie vergessen hatte, dass sie noch immer mein Baby hielt und Gracie dann aus ihren Armen und auf den Boden fallen würde. Doch Mary wollte sie nicht hergeben.
»Es war so merkwürdig«, erzähle ich Matt jetzt. »Als ich Gracie zurücknehmen wollte, hätte ich schwören können, dass wir für ein paar Augenblicke fast so etwas wie einen kleinen Kampf ausfochten.«
»Wahrscheinlich war sie nur übervorsichtig. Mach dir nicht solche Sorgen, Liebes. Sie ist Annies Putzfrau. Sie wird auf Herz und Nieren überprüft worden sein.«
Ich unterdrücke ein Lachen. »Du hast recht. Wobei du sie unter gar keinen Umständen eine Putzfrau nennen darfst, wenn du sie mal triffst. Sie hat mir sehr deutlich gemacht, dass sie ihre Haushälterin ist.« Ich lache und greife nach einer Handvoll M&Ms aus der Tüte, die Matt gerade geöffnet hat.
»Alles das Gleiche«, erklärt er und richtet die Fernbedienung erneut auf den Fernseher. »Wie häufig kommt sie denn?«
»Das ist der Haken«, sage ich und beiße mir auf die Lippe. »Offenbar kommt sie fast täglich. Sie meinte nur, sie habe jeden Monat ein paar freie Tage, nach einem Wechselmodell.«
Matt wirbelt zu mir herum und sieht mich zweifelnd an. »Na ja, für irgendetwas muss Annie ihre enormen Reichtümer wohl ausgeben.« In seiner Stimme klingt leichte Verbitterung mit und nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob er ein wenig neidisch auf sie ist.
»Hey, sei nicht so fies«, sage ich und boxe ihm spielerisch in die Seite. »Annie mag gut betucht sein, aber sie unterstützt eine Menge Wohltätigkeitsvereine. Und sie verhilft jemandem zu einem Job.« Ganz zu schweigen von dem Dach über unseren Köpfen, denke ich, spreche es aber lieber nicht aus, um Matt nicht das Gefühl zu vermitteln, er würde nicht für uns sorgen können.
Er ist ziemlich stolz und wollte daher Annies freundliches Angebot zuerst nicht annehmen. Er gibt sich ohnehin schon die Schuld an dem Feuer. Seitdem wir Kinder haben, ist das Geld etwas knapp, trotzdem haben wir gemeinsam entschieden, dass ich aufhören würde zu arbeiten, bis beide in die Schule gehen – angesichts der Kinderbetreuungskosten hätte alles andere auch keinen Sinn gemacht, schließlich verdiente ich im Gartencenter nicht viel. Als Bauleiter ist Matts Gehalt nicht schlecht und wir kommen jeden Monat über die Runden, gerade so, aber es bleibt nicht viel übrig.
»Ich mach doch nur Witze, Liebling. Wenn eine Singlefrau, die kaum je in ihrem großzügigen Haus an der Küste ist, eine Vollzeithaushälterin beschäftigen möchte, damit sie sich um sie kümmert, was sollte ich dagegen haben? Vor allem dann, wenn wir davon profitieren.« Er hält inne und hebt die Brauen, als würde er nicht ein Wort dessen glauben, was er gerade gesagt hat. »Aber egal, was hat diese Mary denn heute sauber gemacht?« Matt sieht sich in dem hübsch möblierten Haus um.
»Das ist es ja«, gestehe ich. »Ich habe gesagt, sie könne heute frei machen und habe sie nach Hause geschickt.«
Matt legt die Stirn in Falten. »Aber sie hätte doch sicher irgendetwas machen können?«
»Als wir ankamen, war das gesamte Haus makellos und wir sind doch erst einen Tag hier. Glaub mir, es wird nicht lange dauern, bis wir alles verwüstet haben«, sage ich. »Ich musste einfach erst mal ankommen. Etwas Zeit mit Tommy verbringen. Es scheint ihm gut zu gehen, aber seit dem Feuer verhält er sich irgendwie … komisch. Weißt du, was ich meine?«
»Verstehe«, erklärt Matt nickend. »Du hast richtig gehandelt. Wann kommt Mary Poppins denn wieder?«
»Gleich morgen früh«, sage ich und wünsche mir zugleich, sie käme nicht. Matt wird auf der Arbeit sein, also betrifft es ihn nicht, aber ich bin es nicht gewohnt, Leute um mich herum zu haben, wenn ich mich um meine Kinder kümmere. Ganz besonders keine Leute, die ich nicht kenne.
Doch was mich am meisten umtreibt, ist das, was geschehen ist, nachdem ich Mary erklärt hatte, dass wir erst einmal ankommen mussten und sie sich den Tag freinehmen sollte.
Sie schien alles andere als glücklich und nickte mir nur knapp zu, ehe sie ging.
Eine Stunde war bereits vorbei, seit Mary gegangen war, als ich zufällig aus dem Vorderfenster schaute, und ich könnte schwören, dass Mary auf dem Rasen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand. Sie stand halb versteckt hinter einem Baum und starrte herüber zum Haus. Erst als sie mein Gesicht im Fenster entdeckte, zog sie sich zurück, drehte sich um und ging zügigen Schrittes davon.
3Gina
Am nächsten Morgen klemmt mein Handy an meinem Ohr und Gracie liegt in meiner Armbeuge, während ich mich unseren morgendlichen Abläufen widme. Tommy klammert an meinen Beinen und nörgelt und ich versuche, die Küche zu durchqueren Richtung Kaffeemaschine, um mir einen Espresso zu machen.
»Sie sind Anrufer Nummer zwölf … bitte legen Sie nicht auf …« Ich rolle die Augen wegen der Automatenstimme. Ich hatte gehofft, das Verfahren der Anmeldung in der Praxis etwas beschleunigen zu können, wenn ich die Rezeptionistin bitte, mir die Anmeldeformulare schon per E-Mail zu schicken, ehe wir uns auf den Weg machen, doch jetzt fürchte ich, Tommy wird keine weiteren elf Anrufer mehr abwarten, ehe er komplett ausrastet und mit dem Gesicht nach unten schreiend und tretend auf dem Boden liegt.
»Tommy, Liebling, lass Mama bitte laufen, ja?«, seufze ich und ziehe mein Bein mit meinem Sohn daran mit mir, auf der Suche nach den Tassen. Ich habe noch immer keinen Überblick darüber, was ich wo finde, schließlich bin ich zuvor nur einmal bei Annie in diesem Haus gewesen.
Über die Jahre war unser Freundeskreis in Kontakt geblieben, und auch wenn wir drei uns nicht immer so häufig sehen, wie wir es gerne würden, treffen Laura und ich uns doch einmal im Monat, schließlich wohnen wir näher beieinander – Matt und ich leben in Crawley, Laura und Patrick in Royal Tunbridge Wells. Annies Schauspiel- und Gesangskarriere hatte in den letzten zehn Jahren Fahrt aufgenommen, darum haben wir sie nicht mehr so häufig gesehen. Sie ist oft bei Dreharbeiten oder reist, und seit sie in dieses Haus gezogen ist, war sie abgetaucht in die Organisation ihrer Renovierungsarbeiten.
Dennoch werde ich den Gedanken nicht los, dass es auch einen anderen Grund dafür gibt, dass wir sie inzwischen nicht mehr so häufig besuchen – weil sie hier lebt, in Hastings … in dem Ort, in dem wir alle aufgewachsen sind. Dem Ort, in dem wir einst eine Gruppe von vier Freundinnen waren. Dem Ort, an dem alles schiefging.
»Das kann doch nicht wahr sein!«, beschimpfe ich mein Telefon in genau dem Moment, als ein verdächtiger Geruch aus Gracies Windel aufsteigt. »Wie kann ich plötzlich Anrufer Nummer vierzehn sein? Ich rutsche immer weiter nach unten! Verdammter Mist.«
Sofort bereue ich, vor Tommy geflucht zu haben. Er hängt noch immer an meinem Bein, schmiert sein Marmeladentoast an meine Schlafanzughose und singt jetzt in Dauerschleife und so laut er kann »verdammter Mist«.
»Guten Morgen!«, erklingt eine fröhliche Stimme hinter mir, sodass ich mich, so gut ich das mit zwei Kindern an mir hängend kann, umdrehe.
Neben der weißen marmornen Kücheninsel steht Mary, trägt ihre makellose Uniform und ein Lächeln im Gesicht. Wobei ich schwören könnte, ihre Oberlippe ein wenig zucken zu sehen, während sie uns anschaut.
»Mary … hallo«, begrüße ich sie und beende meinen Anruf in der Praxis, während ich versuche, Tommy von meinem Bein abzuschütteln. Doch davon will er nichts wissen. VerdammterMistverdammterMistverdammterMist wird zu einem bedeutungslosen Lied, das in einer endlosen Nörgelei den Mund meines Sohnes verlässt. »Sie sind da«, fahre ich trotz des Lärms fort, denn mir fällt nicht ein, was ich sonst sagen könnte, ohne das Chaos um mich herum zu entschuldigen, dessen Zeugin sie gerade wird, oder sie spüren zu lassen, wie sehr es mich ärgert, dass sie sich eigenständig ins Haus gelassen hat.
»Es macht Ihnen doch nichts aus, dass ich meine Schlüssel benutzt habe, oder?«, zwitschert sie und sieht mich von der Seite an. »Heute steht viel an, also tun Sie einfach so, als wäre ich nicht da. Ich versuche, Ihnen nicht im Weg zu sein.«
»Möchten Sie zuerst einen Kaffee?«, frage ich, unsicher, ob ich ihr spezielle Aufgaben geben muss. Ich will das Wasser in der Maschine nachfüllen und trage den Tank zum Spülbecken. »Lieber Gott, nicht schon wieder …«, murmele ich, als das Wasser mit zu wenig Druck aus dem Hahn stottert und spuckt. Ganz plötzlich ist es jedoch wieder bei voller Kraft und spritzt mich komplett voll. »Das geschieht immer wieder«, sage ich. »Ich glaube, irgendetwas stimmt damit nicht.«
Mary greift nach einem Geschirrtuch und gibt es mir. »Normalerweise mache ich keine Kaffeepause«, antwortet sie. »Aber danke. Das gibt uns die Gelegenheit, uns etwas kennenzulernen.« Sie klettert auf einen Barhocker und Tommy schaut um die Ecke der Kücheninsel und starrt zu ihr hoch.
Ich trockne mich ab und schalte die Maschine an, damit sie vorheizt. »Tommy, komm her, ich möchte deinen Mund abwischen. Er ist voller Marmelade.« Ich wedele mit einem Stück Küchenpapier in seine Richtung, was er geflissentlich ignoriert, stattdessen schneidet er Mary Grimassen.
»Sieht aus, als hätten Sie mit diesen beiden alle Hände voll zu tun«, sagt sie. »Soll ich vielleicht den Kaffee machen, während Sie es noch mal in der Arztpraxis versuchen?«
Ich halte inne und starre sie an. Woher weiß sie, wen ich angerufen habe? Ich mag den Gedanken nicht, dass sie gelauscht hat – ich muss mit mir selbst geredet haben.
»Danke, aber das ist in Ordnung«, erwidere ich. »Ich fahre gleich direkt hin, um uns anzumelden. Ich muss die Hebammenbesuche für Gracie verabreden – vorausgesetzt die beiden benehmen sich lange genug, damit ich die Formulare ausfüllen kann.«
Ich will lieber unerwähnt lassen, dass ich Typ-1-Diabetikerin bin und außerdem meine Verschreibung der Insulinspritzen für die örtliche Apotheke benötige. Meine Diagnose habe ich schon in meiner Jugend bekommen und heutzutage denke ich gar nicht mehr viel darüber nach – ich bin so daran gewöhnt, meinen Blutzucker regelmäßig zu überprüfen und mich zu spritzen; das alles im Griff zu haben ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist ein solcher Segen, dass meine beiden Schwangerschaften so komplikationslos verlaufen sind.
Ich drücke ein paar Knöpfe an der futuristisch aussehenden Kaffeemaschine, als mir plötzlich auffällt, dass ich vergessen habe, eine Tasse unter den Auslauf zu stellen. »Oh oh …«, sage ich und reiße die Schranktüren auf, um einen Becher zu finden.
Wie durch Zauberhand steht Mary plötzlich neben der Maschine und stellt eine Espressotasse unter den fließenden Kaffee, wischt die Schweinerei weg und wenige Augenblicke später, nachdem sie die Getränke fertig hat, sitzen wir nebeneinander an der Kücheninsel.
»Wissen Sie, Sie könnten Tommy und Gracie auch hier bei mir lassen, während Sie unterwegs sind. An der Praxis kann man so schlecht parken, ich würde Ihnen darum raten, dorthin zu laufen. Ist viel weniger Aufwand für Sie. Auf dem Rückweg könnten Sie sogar noch in ein paar Geschäfte schauen. Es gibt in der Nähe ein paar nette Boutiquen.« Sie mustert mich von Kopf bis Fuß.
Die Art, wie sie die Namen meiner Kinder ausspricht, lässt meine Nerven sofort in Alarmmodus umschalten – als wäre sie schon bestens vertraut mit ihnen. Das, und die Art, wie sie ihre Nase kaum sichtbar kräuselt, gerade genug, damit ich ihren Hinweis verstehe.
Doch ich komme gar nicht dazu, etwas zu erwidern. »Oh, Gracie, deine Windel«, sage ich, bücke mich und rieche an ihr. »Die böse Mami hat dich noch immer nicht gewickelt.«
»Böse Mami … böse Mami …«, singt Tommy und wirft seinen Toast gegen meine Beine, sodass er über die Fliesen segelt.
»Plötzlich hasst er Marmelade«, erkläre ich und stehe auf, um die Wickeltasche zu suchen. »Und er wirft neuerdings mit Essen, einfach weil er es kann …«
»Es würde Ihnen bestimmt guttun«, höre ich Mary von meinem Platz neben dem Kamin sagen, wo ich knie, und die Wickeldecke ausbreite. »Es ist ein wunderschöner Tag. Wann hatten Sie zuletzt mal Zeit ganz für sich allein?«
Mir ist danach, hysterisch loszulachen, weil ich nicht in der Lage bin, mich an den letzten Moment ganz ohne Kinder zu erinnern, doch ich werde das Bild von ihr auf der Lauer gegenüber dem Haus nicht los. Ich öffne Gracies Windel und spüre, dass Mary inzwischen direkt über mich gebeugt steht und auf mein halb nacktes Baby in seiner schmutzigen Windel auf Annies teurem cremefarbenen Teppich starrt. Dann entdecke ich einen M&M von gestern Abend, völlig zertreten und die Schokolade in den tiefen Fasern klebend. Ehe Mary sich neben mir hinkniet, schnipse ich den Fund schnell unter das Sofa, zurück bleibt ein brauner Fleck.
»Ohh, sieh dich nur an, du kleine Süße!« Mary singt und streichelt Gracies Kopf. Sofort hört mein Baby auf zu nörgeln und wedelt aufgeregt mit seinen Armen und Beinen, auf eine Weise, die ich bei Gracie bisher noch nicht gesehen habe. »Wenn Sie möchten, kann ich sie wickeln. Und Sie machen sich in der Zeit fertig.«
Ich schaue an mir hinab und schäme mich ein wenig dafür, dass ich noch immer das trage, worin ich geschlafen habe – eine Flanellschlafanzughose und ein ausgewaschenes Green-Day-T-Shirt, das früher Matt gehörte. Zugegebenermaßen ist das ein verlockendes Angebot.
»Ich könnte wirklich eine Dusche vertragen«, sage ich und denke, dass dies auch eine gute Gelegenheit wäre, meine Haare zu waschen. »Sind Sie sicher?« Ich fühle mich nur deshalb wohl dabei, weil Mary Annies Angestellte ist. Wahrscheinlich hat sie nur auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet, als ich sie auf der anderen Straßenseite gesehen habe. Außerdem wischt sie Gracie bereits mit Feuchttüchern sauber, wodurch sie es mir leicht macht.
»Einhundert Prozent«, antwortet sie mit einem freundlichen Blick. »Und machen Sie sich keine Sorgen«, fügt sie hinzu und legt mir die Hand auf den Arm, »solange Sie unterwegs sind, beseitige ich auch den Schokofleck auf dem Teppich.«
4Mary
Wüsste Gina, wer ich bin, würde sie ihre Kinder niemals in meiner Obhut lassen. Auf keinen Fall wäre sie glücklich nach oben in die Dusche geflitzt und hätte den Luxus genossen, sich ungestört die Haare zu waschen und zu föhnen. Und ganz sicher hätte sie nicht ihren Mantel angezogen, nach ihrer Tasche gegriffen und jedes ihrer Kinder auf den Kopf geküsst, ehe sie mit einem Lächeln auf den Lippen und voller Dankbarkeit an mich das Haus verlassen hätte.
Nein. Niemals hätte sie irgendetwas davon getan.
Wahrscheinlich wird sie schon sehr bald einen Moment des Zweifels erleben und Annie eine Nachricht schreiben, sich versichern lassen, dass ich wirklich eine vertrauenswürdige Angestellte bin und meine Referenzen fantastisch sind, dass ich ein tadelloses Führungszeugnis habe und so tadellos sauber bin wie die Fenster, die ich gerade poliere. Und ganz sicher wird Annie all das in ihrer begeisterten Antwort bestätigen – denn es entspricht der Wahrheit. Ich bin so sauber wie man nur sein kann. Eine vorbildliche Haushälterin.
Meine Fähigkeiten im Haushalt stehen nicht zur Debatte.
»Tommy, setz dich hin!«, ermahne ich den nervigen Dreijährigen zum wiederholten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Kind in diesem Alter beschäftigt, doch die Zeichentrickfilme im Fernsehen schien er zu mögen – zumindest zwei Minuten lang. Dann war er schon wieder unterwegs, rannte herum und rempelte gegen Dinge, er stieß Annies Vase aus Muranoglas vom Sockel und beinahe auf das Baby, das nebenan in seiner Wippe lag und sinnlos ein paar bunte Plastikfiguren anglotzte, die über ihm hinabhingen. Die schwere Vase konnte ich gerade noch so auffangen.
Nach eigenen Kindern steht mir absolut gar nicht der Sinn und ich rufe mir in Erinnerung, dass dieser kurze Einsatz als Babysitterin notwendig ist, während ich abwarte. Beobachte. Ausharre. Bereit dafür, das zu tun, was ich tun muss.
Zum Glück dauert es nicht lange, bis Gracie beim Klang des sich vor- und zurückschiebenden Staubsaugers einschläft, den ich eilig über den Teppich bewege, damit es aussieht, als wäre ich fleißig gewesen. Dankbarerweise ist das Baby entspannt. Im Kühlschrank sei ein Vorrat an Muttermilch, sagte mir Gina, für alle Fälle, wobei ich sie unterbrochen habe, als sie mir erklären wollte, wie man die zubereitet.
»Habe ich alles schon mal gemacht«, ließ ich sie wissen, um sie zu beruhigen, während mir leicht übel war. Sie musste nicht erfahren, dass ich nicht vorhatte, das Zeug in die Hand zu nehmen oder das Baby zu füttern. Es wird schon nicht sterben, wenn es mal für ein paar Stunden ohne auskommen muss. »Vor meiner Zeit als Haushälterin habe ich ein paar Jahre als Kindermädchen gearbeitet«, log ich sie an. Sie schien mir zu glauben, denn ihr sorgenvoller Gesichtsausdruck verschwand.
»Na gut, dann gehe ich jetzt«, sagte sie, wobei ich spürte, dass sie noch immer ein wenig nervös war und noch mehrfach zu ihren Kindern blickte, während sie Richtung Tür ging.
»Du sitzt jetzt still und schaust fern, in Ordnung?«, sage ich jetzt zu dem Jungen. »Nicht bewegen.« Er wirft eine Actionfigur nach mir und lacht teuflisch.
»Datdan …«, sagt er durch ein schnoddriges Grinsen.
»Ja, Batman«, wiederhole ich und er scheint erfreut, von mir verstanden zu werden. Ich gebe ihm ein Taschentuch, doch er wirft es auf den Boden und beobachtet, wie es hinabschwebt. »Bleib einfach hier.«
Ich eile durch die Diele und die Treppe hinauf, denn ich habe mir bereits ausgerechnet, dass mir bei dreizehn Minuten Fußweg pro Strecke zur Praxis und geschätzten fünfzehn Minuten zum Ausfüllen der Formulare und fürs Anstehen im schlechtesten Fall einundvierzig Minuten bleiben, ehe Gina zurückkehrt. Wahrscheinlich wird es in Wahrheit etwas mehr als eine Stunde sein, und länger, falls sie sich entschließt, meinem Vorschlag zu folgen und durch die Geschäfte auf der High Street zu bummeln. Ich habe die Idee einfließen lassen, sie könne ein paar Spezialitäten im Feinkostgeschäft besorgen und sich vielleicht etwas Schönes zum Anziehen in den Boutiquen aussuchen, doch ich kenne ihre Gewohnheiten und ihre Vorlieben nicht gut genug, um einschätzen zu können, ob sie bei diesem Ablenkungsversuch anbeißt.
Achtundzwanzig Minuten bleiben mir, nachdem ich gerade dreizehn damit verschwendet habe, unten sauber zu machen.
Ich komme in das Schlafzimmer, das Gina und Matt nutzen – Annies Gästezimmer. Sie sind erst seit zwei Tagen hier und es herrscht bereits Chaos. Es ist mir völlig schleierhaft, wie es zwei Menschen gelingen konnte, eine solche Verwüstung anzurichten, obwohl der Großteil ihres Hab und Guts durch ein Feuer vernichtet worden ist. Doch letztendlich, das rufe ich mir in Erinnerung, während ich über ihre hingeworfenen Kleidungsstücke steige, bin ich noch begabter darin, Verwüstung anzurichten. Allerdings ebenfalls darin, meine Spuren zu beseitigen.
Sobald ich in einer Ecke des Zimmers die Laptoptasche auf einem Stuhl entdecke, steuere ich direkt darauf zu. Wenig überraschend ist das silberfarbene MacBook (die Schmetterlingsaufkleber auf der Außenseite deuten darauf hin, dass es Gina gehört) durch Touch-ID oder ein Passwort geschützt. Wenig überraschend ist ebenfalls, dass sie ihr Passwort nicht aus den Namen ihres Mannes und ihrer Kinder zusammengesetzt hat. Dafür ist sie viel zu klug. Ich kenne jemanden, der ohne Weiteres in den Computer hineinkommen könnte, und notfalls frage ich ihn danach. Ginas Ehemann, Matt, habe ich bisher noch nicht kennengelernt – zumindest nicht offiziell –, doch das werde ich auch demnächst einfädeln.
Ich stopfe den Laptop zurück in seine Tasche und fahre mit den Fingern durch die Seitentaschen, dabei hole ich ein paar einzelne Kassenbelege heraus – Benzin, ein Café, ein Friseur, ein Paar Nike-Turnschuhe – und mache Fotos von ihnen mit meinem Telefon. Sie helfen mir dabei, mir ein Bild zu machen, ein paar Leerstellen auszufüllen, das Puzzle ihres Lebens zu ergänzen. Außerdem finde ich ein kleines spiralgebundenes Notizbuch mit ein paar Ziffern auf mehreren Seiten – offenbar eine Art Buchhaltung. Für den Fall, dass das nützlich sein könnte, mache ich auch hiervon Bilder.
Anschließend gehe ich zum Schminktisch, der vor dem Fenster steht und auf den hinteren Garten blickt. Hinter dem Garten und noch vor den großen Häusern in der benachbarten Straße liegt eine zugewucherte Fläche voller Bäume, Hecken, Unkraut und verwachsener alter Büsche. Soweit ich weiß, gehört all das der Stadt, doch seitdem vor etwa zehn Jahren die modernen Wohnungen auf der Westseite gebaut worden sind, kann man die Fläche nicht mehr auf direktem Weg erreichen, nur noch durch die Gärten der angrenzenden Grundstücke. Außerdem kann sie nicht bebaut werden, also wird sie einfach vergessen und wächst zu. Ein Überbleibsel vergangener Zeiten.
Vergangener Schrecken.
Ich starre dorthin – stelle mir Dinge vor, male sie mir aus, überlege. Plötzlich könnte ich schwören, ein kleines Mädchen im Unterholz zu sehen, sie rennt sorglos, mit einem Lachen auf den Lippen, ihren Kopf zurückgeworfen, ihr blondes Haar weht im Wind. Doch dann erkenne ich das Blut auf ihrem Gesicht, die Grimasse, die ihr Lachen in Wahrheit ist, und die Augen voller Grauen, ihr Haar herabhängend und matschig. Ich muss mich am Schminktisch festklammern, um die Fassung zu wahren, schaue weg und kneife die Augen zusammen.
Nur noch neunzehn Minuten, ich muss mich beeilen.
Am Treppenabsatz lausche ich kurz nach unten und höre nur den Klang der Cartoons, die Tommy bei Laune halten, solange ich tue, was ich tun muss.
Ich atme langsam aus, stemme meine Hände in die Hüfte und schließe meine Augen erneut, bis meine Wut verflogen ist. Anschließend durchwühle ich die beiden Kosmetiktaschen auf dem Schminktisch – eine davon enthält ein bisschen billiges Make-up, die andere Dinge wie Haarspray, Bodylotion, Gesichtsreiniger und Deo. Ein ziemlicher Gegensatz zu den Nobelprodukten in Annies Badezimmer.
Ein kurzer Blick auf meine Uhr sagt mir, dass ich einen Zahn zulegen muss – und ein weiterer kurzer Blick ins Bad zeigt mir, dass es dort ebenfalls nicht viel zu entdecken gibt, abgesehen von zwei Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife und einiger nasser Handtücher. Doch gerade, als ich durch das Schlafzimmer zurückgehe, fällt mir das Glitzern auf.
Auf dem Nachttisch liegt etwas, das mir zuvor entgangen ist – es leuchtet in einem Sonnenstrahl, der gerade durch das Fenster fällt. Ich komme ein paar Schritte näher und erkenne eine messingfarbene Kette mit einem kitschigen, angelaufenen Anhänger daran – die Hälfte einer Herzform mit einer scharfen Kante und dem Wort Best auf der Vorderseite eingraviert. Wie etwas, das man für ein Teenagermädchen kaufen würde.
Einen Moment lang kann ich meinen Blick nicht lösen, meine Lippen formen ein leichtes Lächeln, während mein eigenes Herz zu einem festen Knoten wird. Sie hat ihn noch immer. Ich kämpfe mit den Tränen, ehe ich die Kette auf den Boden wische und nach unten gehe, um mich wieder den Kindern zu widmen. Noch ist die Zeit nicht gekommen, die Kette an mich zu nehmen.
5Gina
Auf halbem Weg zur Praxis frage ich mich plötzlich, was eigentlich in mich gefahren ist. Es scheint mir plötzlich nicht die beste Idee, mein Baby und meinen Dreijährigen in der Obhut einer Fremden zu lassen. Der erschöpfte und ängstliche Teil von mir malt sich ein Szenario aus, in dem ich zurückeile, um meine Kinder aus Marys bösen Krallen zu befreien. Doch der vernünftige Teil ermahnt mich, mich zusammenzureißen, dass es ihnen gut geht, dass Mary zuverlässig und freundlich ist und dass ich die freie Zeit geschickt nutzen sollte, so selten, wie ich sie habe. Dass ich Annies Haushälterin dafür dankbar sein sollte, mir zu helfen, obwohl es überhaupt nicht ihre Aufgabe ist.
Dennoch fische ich mein Handy aus meiner Handtasche und tippe eilig eine Nachricht.
Hallo Annie! Will nur kurz sichergehen, dass man Mary im Umgang mit Kindern vertrauen kann. Sie hat Tommy und Gracie für eine Stunde oder so. Dicker Kuss usw. xx
Es sind die längsten fünf Minuten meines Lebens und meine Beine fühlen sich doppelt so schwer an, als ich weiter Richtung Praxis gehe, meine Augen auf das Telefon gerichtet – um die Strecke zu überprüfen, aber auch in Erwartung von Annies Antwort. Sobald sie eintrifft, öffne ich sie.
Entspann dich! Mary ist ein Schatz. Völlig vertrauenswürdig für Kinder und Haus xoxo
Sofort spüre ich die Erleichterung in jeder Faser meines Körpers und steuere auf die Praxis zu.
»Hallo, ich bin es«, spreche ich eine halbe Stunde später auf Matts Mailbox. Normalerweise sprechen wir einander mehrmals am Tag. »Ich komme gerade zurück vom Arzt. Hoffe, dein Tag ist spannender als meiner. Vielleicht können wir mit den Kindern nachher noch runter ans Wasser gehen, wenn du von der Arbeit zurück bist. Lieb dich.«
Ich lege auf und lächle, denn es sind die kleinen Dinge, die meinen Mann und mich während der letzten Wochen über Wasser gehalten haben. Gracie hat das Meer bisher noch nicht gesehen und wir möchten beide dabei sein, wenn sie es zum ersten Mal wahrnimmt – wobei sie sich mit gerade einmal sieben Wochen an nichts davon später erinnern wird. Doch für uns wird es ein besonderer Moment sein. Zumal Tommy sich nicht mehr an seinen letzten Besuch an der Küste vor ein paar Jahren erinnern wird, daher wird er völlig aus dem Häuschen sein, wenn er ein Eis schlecken darf und dabei den Wellen zusieht, wie sie auf den Strand prallen.
Ich stecke mein Handy weg und beschließe, einen kleinen Umweg über die Geschäfte zu nehmen, die Mary erwähnt hatte. Im Feinkostladen hole ich etwas Schinken zum Mittagessen und kurz entschlossen ein paar Steaks für Matt und mich heute Abend, als Belohnung. Dann gehe ich in das Lebensmittelgeschäft nebenan.
Auf dem Rückweg wird deutlich, wie sehr diese Wohngegend Londoner gen Süden gelockt hat, sodass kleinere Viertel einen künstlerischen Vibe ausstrahlen. Als Teenager haben wir vier in unserer Freundesgruppe nie die Gegend, in der wir aufgewachsen waren, oder die Freuden des Lebens an der Küste zu schätzen gewusst. Damals konnten wir es kaum erwarten, fortzugehen, wir planten genau, wie wir unsere heranwachsenden Flügel ausbreiten und in die weite Welt fliegen wollten.
Doch eine von uns hat diese Möglichkeit nie bekommen.
Emotional waren wir damals nicht in der Lage, den Verlust unserer Freundin unter solch schrecklichen Umständen zu verarbeiten. Miteinander trugen wir schwer an den Vorwürfen, der Schuld, dem nagenden Schmerz, der an unseren jungen Seelen knabberte, bis wir es nicht mehr ertrugen. Den Ort unseres Heranwachsens zu verlassen war weniger zum Abenteuer, mehr zur Flucht geworden.
Doch nun war Annie hierher zurückgekehrt, um hier zu leben, und sosehr ich die Stadt selbst gern wieder lieben würde, so wenig kann ich vergessen, was hier geschehen ist oder wer daran die Schuld trug. Über jedem meiner Besuche wird immer ein dunkler Schatten schweben. Und sosehr ich mich auch bemühe, alles zu verdrängen, nichts macht Sara wieder lebendig.
Ich erklimme die Stufen zu Annies Haus und mir wird klar, dass meine Fähigkeit zur Verdrängung mir ebenfalls dabei geholfen hat, mit den Folgen des Hausbrands umzugehen. Ich wünschte nur, Matt würde sich nicht mehr länger quälen mit den Fragen nach was wäre gewesen, wenn und hätten wir nicht. Keiner von uns hätte das Feuer vorhersehen können, doch nachdem Brandstiftung ausgeschlossen worden war, suchte Matt weiter nach einem Schuldigen.
Und dieser Schuldige ist am Ende immer er selbst.
Nachdem als Grund für den Brand fehlerhafte Leitungen in der Deckenleuchte der Diele gefunden waren – der Leuchte, die Matt nur eine Woche zuvor angebracht hatte –, begann mein Mann, sich selbst zu verfluchen, verfiel in Schweigen und weigerte sich drei Tage lang, das Bett zu verlassen, während wir in unserem engen Hotelzimmer feststeckten. Ich war damit beschäftigt, ihm Sandwiches von dem kleinen Supermarkt um die Ecke zu holen, Tommy im Park in der Nachbarschaft bei Laune zu halten und Gracie dabei in ihrem Kinderwagen zu schaukeln, während Matt vor Selbstmitleid verging.
Ich wollte nicht, dass unser Sohn seinen Vater so erlebte, und obwohl Matts Laune besser geworden ist, seit er seinen Arzt aufgesucht und Tabletten bekommen hat, weiß ich, dass er sich noch immer die Schuld an dem Geschehenen gibt. Dafür, das Haus zerstört zu haben, für dessen Kauf wir uns alles vom Munde abgespart hatten – all das haben wir innerhalb weniger Stunden verloren.
»Hätte ich einfach auf den Elektriker gewartet«, hatte Matt seitdem tausendmal in unterschiedlichsten Tonlagen gesagt. »Was, wenn wir an dem Abend nicht bei Laura und Patrick geblieben wären?« ist ein weiteres populäres Mantra der Selbstbezichtigung, von ihm weitere tausend Male gesungen.
Was, wenn … was, wenn … was, wenn …, denke ich jetzt, schließe die Haustür auf und trete ein.
»Hallo, ich bin wieder da!«, rufe ich und lege die Schlüssel auf das Tischchen in der Diele. Es gelingt mir nicht, zu Hause zu sagen.
Ich lausche einen Moment, doch im Haus herrscht Stille.
6Gina
»Mary, hallo, ich bin wieder da!«, rufe ich ein drittes Mal, gehe erneut durch die Küche und lasse meinen Blick wandern.
Vielleicht habe ich beim ersten Mal einfach etwas übersehen. Der Teppich vor dem Kamin scheint frisch gesaugt und Gracies Babywippe steht verlassen neben den gläsernen Schiebetüren.
Auf der Sofalehne balanciert Tommys geliebte Batman-Figur – merkwürdig, ist sie doch sein aktuell meistgeliebtes Spielzeug, das er überallhin mitnimmt.
Zurück in der Diele rufe ich die Treppe hinauf: »Tommy! Gracie! Wo seid ihr?« Den Namen meines Babys zu rufen, erscheint mir albern – als würde ich damit rechnen, dass es mir antwortet –, doch ebendieses Gefühl wird schnell zu einem leisen Flüstern von Panik, als ich, bereits zum zweiten Mal, ins Wohnzimmer eile … ins Esszimmer … ins Arbeitszimmer mit den dunkelgrauen Wänden und Bücherregalen … ich reiße alle Türen auf, meine Augen suchen panisch alles ab. Sogar das Gästebad im Erdgeschoss überprüfe ich, falls Tommy mal musste, doch auch das ist leer.
Meine Kinder sind nicht hier. Ebenso wenig wie Mary.
Ich stürme die Treppen wieder hinauf, bemüht, meine Sorge zu verbergen, falls Mary plötzlich auftaucht, mit Gracie auf dem Arm und Tommy neben sich. Vielleicht sucht sie nur nach Spielzeug, mit dem sie Tommy bei Laune halten kann, oder sie wählen ein Buch aus, holen ihr Ladekabel oder … oder …
»Mary, ich bin wieder da!« Ich reiße ein paar Türen in der ersten Etage auf, dann sehe ich in dem Zimmer nach, in dem Tommys kleines Bett in Form eines Rennautos steht, das wir erst kürzlich gekauft haben, ebenso wie die paar Spielsachen, die wir ihm ersetzen konnten.
Leer.
Anschließend gehe ich ins Bad, mein Blick sucht eilig alles ab, und als ich die roten Punkte auf den weißen Bodenfliesen entdecke, erstarre ich. Ich lasse mich auf die Knie fallen, fahre mit dem Zeigefinger über die dunkelroten Flecken und betrachte das, was daran hängen bleibt. Es gibt für mich keinen Zweifel daran: Das ist Blut.
»Tommy!«, schreie ich und mein Herz wummert in meinem Brustkorb, während ein Adrenalinstoß mich hinauf ins Obergeschoss jagt – hier befinden sich die Räume unter dem Dachboden, von denen Annie sagte, sie habe sie bisher nicht renovieren können.
»Ist hier jemand?«, rufe ich nach Luft schnappend. »Tommy, Mama ist wieder da. Wo bist du?«
Von dem kleinen Treppenabsatz unter den Dachschrägen gehen drei Türen ab – eine führt zu einem Duschbad, die anderen beiden zu Zimmern, in denen eine Menge Kartons und Möbel stehen, die unter weißen Tüchern verborgen sind. Das durch die Vorhänge gedämpfte Licht verleiht dem Ganzen ein unheimliches Gefühl. Mein Blick sucht alles ab, doch es wird schnell klar, dass auch hier niemand ist.
Voller Sorge, eines meiner Kinder könnte verletzt sein, eile ich zurück ins Erdgeschoss. Am Rande einer Panikattacke fummele ich an dem Schloss der schweren Terrassentüren zum hinteren Garten hin herum und schiebe sie auf. Doch schon ehe ich hinaustrete, wird klar, dass der Garten verlassen ist. Trotz ihrer georgianischen Pracht und Größe haben die Häuser in dieser Straße lediglich überschaubare Freiflächen – dennoch gehe ich den Pflasterweg von der marmorgefliesten Terrasse hinab, für den Fall, dass Mary meine Kinder aus irgendeinem Grund mit hinter das Gartenhäuschen genommen hat –, vielleicht machen sie einen kleinen Streifzug durch die Natur oder suchen einen verloren gegangenen Ball. Ich habe keine Ahnung … meine Gedanken ergeben keinen Sinn und meine Panik nimmt zu.
»Mary! Tommy!«, rufe ich erneut, sehe mich um und meine Stimme ist bereits einige Oktaven in die Höhe geklettert. Das einzige Geräusch, das ich im Gegenzug wahrnehme, ist das halbherzige Bellen eines Hundes, ein paar Häuser weiter – gefolgt von meinem eigenen Winseln, als mir klar wird, dass weder meine Kinder noch Mary irgendwo hier sind.
Dann entdecke ich es. Das Holztor in dem fast zwei Meter hohen Zaun am Ende des Gartens, gut verborgen hinter einem Lorbeerbusch und seitlich gelegen.
Das Tor steht einen Spaltbreit offen.
Und es führt auf das freie Grundstück hinter dem Haus. Meine Hand fliegt zu meinem Mund. Der Spalt ist gerade groß genug, damit sich ein Kind hindurchquetschen kann.
Ich renne hinüber und reiße das Tor ganz auf – wobei das Unkraut dabei im Weg ist. In Gedanken gehe ich all die schrecklichen Dinge durch, die geschehen sein könnten: Vielleicht hat Tommy allein hier draußen gespielt, entdeckte das offen stehende Tor und ist hindurchspaziert … Ein Einbrecher könnte sich Zutritt verschafft und meinen Sohn und mein Baby entführt haben … Oder vielleicht hat auch Mary selbst meine Kinder mitgenommen und sich mit ihnen über das verwilderte Grundstück hinter dem Haus aus dem Staub gemacht, vielleicht kannte sie einen geheimen Weg, auf dem sie entkommen konnte.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, stottere ich und stehe auf Zehenspitzen, um das buchstäblich undurchdringliche Gelände zu überblicken. Schnell wird mir klar, dass niemand mit zwei kleinen Kindern im Schlepptau durch diese dichten Brombeersträucher und das Unterholz sehr weit kommen würde, also schieße ich den Weg wieder hinauf und in das Haus zurück, betend, dass meine Kinder auf wundersame Art und Weise plötzlich wieder in der Küche sind. Aber nein – noch immer niemand.
Ich renne in die Diele, um mein Handy aus meiner Manteltasche zu holen. Zuerst werde ich Annie anrufen, um mir Marys Nummer geben zu lassen, wenn das nichts bringt, dann rufe ich die Polizei. Inzwischen ist das hier alles andere als lustig. Es könnte einen Unfall gegeben haben … alles Mögliche könnte geschehen sein.
»Ich wusste, dass ich sie niemals hätte hierlassen dürfen«, heule ich auf und bleibe wie angewurzelt neben dem Garderobenständer stehen. »Oh!«, rufe ich aus und ein Stoß kalter Luft kommt mir plötzlich entgegen, als die Haustür aufgeht. Mit der frischen Luft dringen auch Kindergebrabbel und Kichern zu mir.
»Ahh, schaut, Mami ist schneller gewesen als wir!«, ruft Mary aus, als sie mit Tommy an der Hand hereinkommt. Er hüpft über die Türschwelle und grinst. Gracie ist in ihren gefütterten Schneeanzug gekuschelt und liegt in Marys Armbeuge, ihre Augen fallen langsam zu.
»Oh mein Gott, Tommy!«, rufe ich, hocke mich vor ihn und schließe ihn fest in die Arme. Dann stehe ich auch schon wieder und greife nach meinem Baby. »Sie … Sie hätten wirklich nicht rausgehen müssen mit ihnen …«, sage ich zu Mary und kann das Beben in meiner Stimme ebenso wenig verbergen wie das Zittern meiner Arme, als ich Gracie an mich nehme, ihr weiches Köpfchen gegen meine Lippen presse und ihren süßen Geruch einsauge. Erleichterung überschwemmt und überwältigt mich. Zugleich bin ich unfassbar wütend.
»Ach, das war schon in Ordnung«, zwitschert Mary fröhlich und legt ihre Hand auf meine Schulter. »Tommy ist im Garten gestürzt und hat sich am Knie verletzt, also habe ich ihn verarztet und dann sind wir runter an die Promenade gegangen als Trost«, erklärt sie in weicher, aber bestimmter Tonlage. »Sie fanden es toll und Tommy hat sogar ein Eis bekommen, stimmt’s, Kleiner?«
Sie wuschelt meinem Sohn durch die Haare und ich entdecke das Pflaster an seinem Knie.
»Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus, Gina?«, fügt sie hinzu, legt ihren Kopf auf die Seite und widmet mir ein kleines Lächeln, das für sie so typisch scheint.
7Gina
Es ist Samstag und wir sind inzwischen seit einer Woche in Annies Haus. Matt und ich haben bereits unseren vertrauten Rhythmus wiedergefunden: Er fährt zeitig zur Arbeit – sein aktuelles Projekt ist glücklicherweise nur weniger als eine Stunde Fahrzeit von uns entfernt – und ich wecke die Kinder, ziehe sie an und gebe ihnen Frühstück, ehe Mary dann pünktlich wie ein Uhrwerk um neun Uhr eindringt. Immerhin schaffe ich in den letzten Tagen mehr Schritte, weil wir lange Spaziergänge machen – Gott sei Dank gibt es Doppelkinderwagen –, wir schlendern hinüber zum Alexandra Park, manchmal bummeln wir die Promenade entlang oder vor bis zur Landzunge, gestern sind wir zur Abwechslung sogar mal in den Bus gehüpft und nach Bexhill-on-Sea gefahren. So kriegen wir den Vormittag rum, damit Mary so gut wie fertig mit dem Saubermachen ist, wenn wir zurückkommen.
Ich schätze, für sie ist es angenehmer, ohne uns im Weg zu arbeiten, wobei ich mich frage, woran sie jeden Tag vier Stunden putzt. Ginge es nach mir, würde ich sie nur einmal in der Woche kommen lassen, da aber Annie uns hier umsonst wohnen lässt, habe ich das Gefühl, ich sollte mich in ihre Abläufe nicht einmischen.
»Deine Mum wirkt etwas beunruhigt«, meint Matt jetzt und fährt den Toyota rückwärts aus der Einfahrt. Während wir davonfahren, schaue ich noch einmal durch die Windschutzscheibe und sehe Tommys Gesicht durch Annies Wohnzimmerfenster, wo meine Mum ihn hochhebt, damit er uns zum Abschied winken kann. Hinter ihr erkenne ich Dads Umrisse, während er Gracie in den Armen wiegt und sie liebevoll anschaut, hingebungsvoller Großvater, der er ist.
»Sie werden zurechtkommen«, sage ich, mehr im Versuch, mich selbst zu überzeugen als Matt. »Mum bekommt das hin.« Ich winke meinem Sohn ein letztes Mal zu und sende ihm einen Luftkuss. »Es sind nur ein paar Stunden und unter keinen Umständen sollte Tommy das Haus so sehen, wie es im Moment aussieht.«