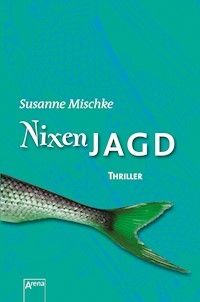17,48 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Schwarzen Moor bei Hannover machen Jäger einen schrecklichen Fund: Inmitten der düsteren Landschaft liegt die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes. Dem Toten wurde das Herz aus dem Leib gerissen. Kommissar Bodo Völxen stößt bei seinen Ermittlungen schon bald an seine Grenzen. Denn erste Spuren führen zu einer Gruppe von Tierschutzaktivisten, der auch seine Tochter Wanda angehört. Kann er gegen seine eigene Tochter ermitteln? Und weshalb hält sich die Witwe des Verstorbenen in ihren Aussagen so bedeckt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96619-1
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Covergestaltung und -motiv: Hauptmann & Kompanie
Werbeagentur, Zürich
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ES IST STILL,
VIEL ZU
STILL. Die Luft ist stickig, und es riecht nach Blut. Völxen kann sich beim besten Willen nicht erinnern, schon jemals ein solches Massaker gesehen zu haben: abgerissene Köpfe, aufgeschlitzte Leiber, Blut, überall Blut. Sieben Opfer. Er mag sich die Panik und die Todesangst, die hier geherrscht haben müssen, lieber nicht vorstellen. Aber sosehr er sich auch gegen die aufsteigenden Bilder wehrt, seine Phantasie ist stärker. Wie lange es wohl gedauert hat, bis alle tot waren und diese Stille einkehrte, diese, ja, Totenstille?
DABEI HAT DER TAG gerade erst angefangen. Wie immer wurde Völxen früh am Morgen von Kreuzschmerzen aus dem Bett getrieben, doch daran hat er sich mittlerweile gewöhnt. Leise, um Sabine nicht zu wecken, ging er in die Küche hinunter, wo Oscar aus seinem Korb sprang, um ihn zu begrüßen, wie immer strotzend vor Energie. Ganz anders sein Herrchen: Noch halb im Tran stopfte Völxen die Taschen seines Bademantels mit Zwieback voll, schlüpfte barfuß in die Gummistiefel und schluffte durch das taunasse Gras bis zur Schafweide. Oscar natürlich hinterher. Unterwegs pinkelten Herr und Hund hinter den Holzschuppen, was Völxen jedes Mal ein finsteres Vergnügen bereitet, weil er weiß, dass Sabine das unmöglich findet. Aber funktionieren und sich anpassen kann er schließlich noch den ganzen Tag auf der Dienststelle, und dem Terrier flößt er damit einen gehörigen Respekt ein. Zumindest glaubt Völxen das.
Die fünf Schafe standen, wie meistens, unter dem Apfelbaum, an dem rote Früchte hängen und darauf warten, geerntet zu werden. Die keilförmigen Gesichter in seine Richtung gewandt stierten sie ihn mit ihren glasigen Augen ausdruckslos an. Völxen, auf die schrundigen Bretter des Zauns gestützt, genoss eine Weile die Aussicht auf die abgeernteten Kornfelder und auf den Deister, dessen lang gezogener Rücken sich scharf und schwarz wie ein Scherenschnitt vom blassen Morgenhimmel abhob. Die Luft war kristallklar und erfüllt vom Duft frisch gemähten Grases. Es würde warm werden und sonnig, die letzten Tage des Spätsommers. Weit draußen auf dem Acker zog ein Trecker seine Bahn, verfolgt von einer Schar Möwen, als wäre der Trecker ein Schiff, das über die Furchen des Feldes schaukelt. Fast wie an der Küste, dachte Völxen, während er darauf wartete, dass sich seine kleine Herde zu ihm hinbequemen würde, um ihm den Zwieback aus der Hand zu fressen. Aber wie jeden Morgen brauchten die Schafe ein Weilchen, um sich daran zu erinnern, wer er war und dass sie von ihm Futter bekamen.
MITTEN HINEIN IN diesen friedlichen, schwerelosen Moment bohrte sich der Schrei. Er kam von Köpckes Hof. Eben hatte Völxen von dort drüben noch das Klappern der Futtereimer gehört und damit gerechnet, gleich seinen Nachbarn in der unvermeidlichen blauen Latzhose zu sehen, der ihm »Moin, moin, der Herr Kommissar« zurufen und vielleicht noch seinen Lieblingsspruch von der senilen Bettflucht hinterherschicken würde. Aber der Hühnerbaron war nirgends zu sehen, und die Stille, die diesem Schrei folgte, hatte etwas Unheimliches. Eine Sekunde lang erwog Völxen, Anlauf zu nehmen und über den Bretterzaun zu flanken. Doch rechtzeitig realisierte er, dass er die Fünfzig überschritten hatte und nicht mehr der Beweglichste war. Außerdem würde sich sein Bademantel bei dieser Übung sicherlich als hinderlich erweisen. Also kletterte er etwas lendenlahm über den Zaun und rannte dann mit wehendem Mantel über die Schafweide, was Amadeus, der Schafbock, prompt als Provokation auffasste. Das Haupt gesenkt, schickte der Bock sich an, seinen Ernährer auf die Hörner zu nehmen. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Doch zum Glück wurde die Attacke von Terrier Oscar vereitelt, der dem heranstürmenden Bock den Weg abschnitt, ihn kläffend umkreiste und ihm in die Hacken zwickte. Dies wiederum verschreckte Doris, Mathilde, Salomé und Angelina, die in einem einzigen ängstlichen Knäuel in Richtung Schafstall flohen. Zwischenzeitlich erreichte Völxen schwer atmend das andere Ende der Weide. Jetzt galt es, dem Elektrozaun auszuweichen, der Hanne Köpckes Gemüsegarten vor Übergriffen der Schafe bewahren soll. So tief, wie seine maroden Bandscheiben es zuließen, duckte sich Völxen ins taunasse Gras, bekam aber dennoch irgendwo im Nacken einen elektrischen Schlag ab.
»Scheiße!«, schimpfte er, während er sich anschickte, auch noch den Bretterzaun hinter dem Draht zu überwinden. Obwohl er durch Nordic Walking und andere Fitness-Torturen über den Sommer zwei Kilo abgenommen hat, knarzten die Balken bedenklich unter seinem Gewicht. Dann, endlich, stand er drüben, zwischen Rüben und Zucchini. Er war gerade dabei, seinen Bademantel wieder in Ordnung zu bringen – schließlich wollte er sich nicht wie ein Exhibitionist auf dem Nachbarhof präsentieren –, da hörte er Jens Köpcke fluchen. Wer flucht, lebt noch, registrierte Völxen erleichtert. Die Stimme kam aus dem neuen, kleinen Stall, den der Nachbar im Frühjahr erst errichtet hatte. »Für die Engländer« hatte Köpckes Begründung für den Anbau gelautet. Auf diese Weise hatte Völxen zum ersten Mal davon Kenntnis erhalten, dass man Hühner unterschiedlicher Nationalitäten anscheinend nicht ohne Weiteres im selben Stall unterbringen konnte.
JETZT STEHT DER Kommissar wie angewurzelt neben seinem Nachbarn, der noch immer den Eimer mit dem Futter darin am Henkel festhält. Futter, das nun nicht mehr gebraucht wird. Flaumige Federn schwirren durch die staubige Luft, kleben blutig an den Wänden und auf dem Boden. Ein Huhn hängt kopflos von einem der Dachsparren.
»Marder«, erklärt Köpcke.
Völxen nickt. Ein Marder sei das Schlimmste, was einem Hühnerstall passieren kann, hat Köpcke ihm seinerzeit erklärt, als er den Drahtzaun um seine Ställe einen halben Meter tief im Boden vergraben hat. Ein Fuchs sei dagegen harmlos, der hole sich nur ein Huhn, um es zu essen. Ein Marder aber gerate in einen regelrechten Blutrausch.
»Der killt alles, was sich bewegt, und zwar so lange, bis sich nichts mehr bewegt. Und dann saugt er seinen Opfern das Blut aus, wie ein Vampir, und lässt die Kadaver liegen.«
Völxen war dieses Szenario damals allzu drastisch erschienen, weiß er doch um Köpckes dramaturgisches Talent, das sich besonders unter dem Einfluss von ein, zwei Flaschen Herrenhäuser entfaltet. Aber jetzt sieht der Kommissar mit eigenen Augen, dass der Nachbar seinerzeit nicht übertrieben hat. Offenbar hat der Marder ein Schlupfloch im Zaun gefunden oder sich durchgegraben, um dann dieses Blutbad anzurichten.
Köpckes breiter Kopf, der ohne Andeutung eines Halses auf seinem gedrungenen Körper sitzt, nickt bekümmert.
»Ausgerechnet die Orpington!«, sagt er und spricht dabei jede Silbe buchstabengetreu aus.
Orpington. Sieben Hennen und einen Hahn dieser englischen Rasse hat er sich – zusätzlich zu seinen anderen fünf Dutzend Hühnern – angeschafft, um zu testen, ob die Tiere wirklich so legefreudig sind, wie behauptet wird.
»Wenn ich dieses Drecksvieh erwische!«
»Soll ich eine Fahndung rausgeben?« Der, zugegeben, etwas plumpe Versuch, seinen Nachbarn ein wenig aufzumuntern, geht voll daneben.
»Das ist nicht witzig«, faucht Köpcke, normalerweise ein Ausbund an Gelassenheit. »Was würdest du sagen, wenn einer deine Schafe so zurichten würde?«
»Tut mir leid«, murmelt Völxen verlegen. Täuscht er sich, oder hat sein Nachbar sich tatsächlich gerade eine Träne aus dem Augenwinkel gewischt? Die Sache scheint ihm wirklich nahezugehen. Erstaunlich, wo er doch sonst seinen Hühnern eigenhändig und ohne mit der Wimper zu zucken den Kopf abschlägt, wenn ihm nach einem Suppenhuhn ist. Das kapier einer. So etwas würde Völxen seinen Schafen niemals antun.
Als könnte Köpcke Gedanken lesen, brummt der: »Schon gut, Kommissar. Das versteht ihr Städter eben nicht.«
Völxen macht erst gar keinen Versuch, sich gegen den Begriff »Städter« zu verwahren. Vor gut einem Vierteljahrhundert hat er den alten Bauernhof gekauft, dessen Renovierung noch immer nicht ganz abgeschlossen ist. Seine Tochter Wanda ist hier groß geworden, und seine Frau Sabine, von Beruf Klarinettistin, begleitet regelmäßig den Kirchenchor. Sie kennen hier fast jeden im Dorf, und jeder kennt sie, und doch gelten sie immer noch als Städter. Sollte Wanda eines hoffentlich noch fernen Tages Kinder haben und auf den Hof ziehen, wäre wahrscheinlich auch sie immer noch keine Einheimische, und ihre Kinder ebenfalls nicht. Und wenn Völxen ganz tief in sich geht, dann muss er zugeben, dass Köpcke irgendwie recht hat. Die Zugehörigkeit zum einen oder anderen Lager ist vermutlich eine Frage der Gene.
Inzwischen hat der Terrier sein Scharmützel mit dem Schafbock beendet, schlüpft durch den offenen Spalt der Stalltür, schnüffelt aufgeregt herum und verbellt die toten Hühner. Der Geruch nach Blut scheint den Hund ganz kirre zu machen. Plötzlich flattert etwas über ihren Köpfen. Ein Huhn sitzt oben, auf einer der Stangen, reichlich zerrupft und bestimmt schwer traumatisiert. Aber immerhin lebendig.
Völxen deutet mit einem kleinen Lächeln nach oben: »Wir haben eine überlebende Zeugin!«
Köpcke runzelt die Stirn. »Das nützt jetzt auch nicht mehr viel.«
»Wie wär’s mit ’nem Klaren?«, fragt Völxen, denn dies ist ein Notfall, so viel steht fest. Außerdem ist Samstag, er muss nicht zum Dienst. Er kann sich einen Kurzen erlauben, seinem gebeutelten Nachbarn zuliebe.
Die beiden verlassen den Ort des Grauens und gehen ins Haus. Die Küche sieht unaufgeräumt aus, Hanne Köpcke ist zur Kur. Völxen holt den Schnaps aus dem Kühlschrank und gießt zwei Gläser großzügig ein. Sie setzen sich an den Küchentisch, und der Korn fließt mit tröstlicher Wärme die Kehlen hinab. Der Alkohol und vielleicht auch Völxens stumme Anteilnahme scheinen Köpcke gutzutun, seine Miene hellt sich zusehends auf.
»Schade, Sabine mochte die englischen Eier besonders gern«, bricht Völxen das Schweigen.
Da kann Köpcke schon wieder grinsen. »Ja, bei mir gibt’s wirklich ›Bio‹, auch wenn’s nicht draufsteht.«
Seit im Frühjahr der Skandal mit den fälschlich als Bio deklarierten Eiern ans Licht kam, blüht Jens Köpckes Geschäft. Nun kommen auch Leute zu ihm, die ihre Eier bisher im Bioladen gekauft haben und denen Köpcke eiskalt fünfzig Cent pro Ei abknöpft. »Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist«, lautet sein Motto. Neulich hielt einer dieser Typen mit seinem Volvo auch vor Völxens Anwesen und fragte, ob er bei ihm Schafskäse oder Lammfleisch kaufen könne. Lammfleisch! Völxen hat ihn zum Teufel gejagt.
Die beiden Nachbarn geraten ins Plaudern. Köpcke behauptet, er habe einen Schock, und außerdem könne man auf einem Bein schlecht stehen. Also füllt Völxen ein weiteres Mal die Gläser.
Auf dem Rückweg lässt er sich mehr Zeit als vorhin und geht um die Weide herum. Sogar Oscar läuft ungewöhnlich brav bei Fuß. Die Schafe stehen jetzt geduldig wartend an der gewohnten Stelle vor dem Zaun. Völxen holt den Zwieback heraus, der durch die Kletteraktion über den Zaun ziemlich gelitten hat. Er verfüttert die Brösel an die Tiere, und ihre rauen, warmen Zungen kitzeln seine Handfläche. Als er gerade weitergehen will, sieht er Köpcke aus dem Hühnerstall kommen, in der linken Hand die Beine der überlebenden Orpington-Henne. Er legt das Tier, das nur noch matt mit den Flügeln schlägt, auf den Hackstock. Als das Beil niedersaust, hat Völxen sich schon umgedreht, doch das Geräusch des Axthiebs hallt über die Weide und fährt ihm durch Mark und Bein.
FABIAN GÄHNT. Die Waldluft strotzt vor Sauerstoff und ist noch angenehm kühl, aber dennoch macht sie ihn nicht wach. Er hat wenig geschlafen, und jetzt langweilt er sich. Eine Treibjagd hat er sich wirklich aufregender vorgestellt. Bloß zum Herumstehen ist er nicht in aller Herrgottsfrühe aufgestanden. Erst hat es ewig gedauert, bis sich die Jagdgesellschaft versammelt hatte, denn natürlich kamen etliche von diesen alten Säcken zu spät. Dann, als endlich alle da waren, hat der Jagdleiter haarklein erklärt, welches Wild geschossen werden darf – Hasen, Füchse, Fasane und natürlich ganz besonders Wildschweine – und wie das Ganze abzulaufen hat. Dabei kapiert das doch der dümmste Idiot! Die Treiber stellen sich im Abstand von zehn, zwanzig Metern an diesem Waldweg auf, der durch das Resser Moor führt, und gehen dann langsam, möglichst in einer Linie, durch das Waldstück, um das Wild aufzuscheuchen. Am Waldrand und an den bekannten Wildwechseln postieren sich die Jäger, und wenn ein Wildschwein rausläuft – bumm!
Fabian Zimmer bereitet sich gerade auf die Jägerprüfung vor, daher ist es für ihn Pflicht, sich als Treiber zur Verfügung zu stellen. Nur hatte dummerweise sein bester Kumpel gestern Geburtstag. Fabian ist um drei Uhr in der Früh nach Hause gekommen und alles andere als nüchtern. Vielleicht wäre es besser gewesen, erst gar nicht ins Bett zu gehen, die zwei Stunden Schlaf haben es auch nicht rausgerissen. Er schaut zu seinem Freund Timo hinüber. Wann kommt endlich das Signal zum Losgehen? Wie lange brauchen die Jäger denn noch, bis sie sich richtig postiert haben? Es wurmt Fabian, dass er nur Treiber sein darf. Aber in wenigen Monaten ist es so weit, dann hat auch er endlich seinen Jagdschein, dann steht auch er mit seiner Flinte auf der anderen Seite und muss sich nicht mehr mit einer orangefarbenen Warnweste durch die Büsche schlagen. Es ist eine recht große Jagd, viele der anderen Treiber kennt er gar nicht. Leute aus der Stadt, Bekannte des Revierpächters, die hier ein bisschen Landluft schnuppern wollen und etwas Nervenkitzel suchen.
»Das dauert noch!«, meint Timo. Er war schon öfter auf Treibjagden dabei. »Ich geh solange in die Pilze.«
Gute Idee! Seine Mutter würde sich über ein paar Steinpilze oder Maronen sicherlich freuen. Fabian beschließt, es auf der anderen Seite des Weges zu versuchen. Nicht, dass er Timo noch ins Gehege kommt, denn wenn es um Pilze geht, versteht der keinen Spaß. Fabian schlüpft durch das Gesträuch, das den Wegrand säumt, und geht ein paar Schritte in den Wald hinein. Das grünliche Dämmerlicht ist eine Wohltat für seine vor Müdigkeit brennenden Augen. Weich federt der Boden unter seinen Schritten, die ersten Buchenblätter segeln herab. Ein Eichelhäher stößt einen heiseren Warnruf aus. Fabian zuckt erschrocken zusammen. Den Blick auf den Boden geheftet, geht er weiter. Keine Pilze. Nur Moos und ein paar Blaubeeren. Doch da drüben, hinter den hohen Farnen, liegt etwas. Etwas Kompaktes, Dunkles. Fabian wird plötzlich von einer seltsamen Unruhe ergriffen, aber er ignoriert das Gefühl und geht auf den unförmigen Schatten zu.
Im Jagdkurs haben sie ihm beigebracht, wie man ein Stück Wild nach dem Schuss aufbricht. Angefangen vom Drosselschnitt bis zum Öffnen der Brandadern kann Fabian jeden einzelnen Handgriff genau schildern. Mit seinem Onkel zusammen hat er schon einmal einen Hirsch aufgebrochen, und neulich durfte er es bei einem Rehbock selbst versuchen. Es war ein ziemliches Gemetzel gewesen. Nicht umsonst nennt man die Tätigkeiten nach dem Schuss »die rote Arbeit«.
Als Fabian an das Ding am Boden herangetreten ist, dauert es ein paar Augenblicke, ehe sein Verstand begreift, was seine Augen sehen. Aufgebrochen, denkt Fabian unwillkürlich. Allerdings ist das, was vor ihm liegt, kein Tier.
PFITSCH! SCHON WIEDER klatscht ein Insekt gegen das Visier seines Helms und verwandelt sich in einen schmierigen Klecks. Bald kann man die Straße kaum noch erkennen. Und das schon in aller Herrgottsfrühe! Vom Anruf der Leitstelle aus dem Bett geworfen, blieb Fernando Rodriguez nichts anderes übrig, als seine samstägliche Motorradtour in die Wedemark zu verlegen. Plattes Land. Äcker, Wälder, Moore. Außerdem ein Biotop für Luxusgeländewagen und Pferde. Bisweilen stört der Lärm vom Flughafen Langenhagen das Idyll.
Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Kreuzung, irgendwo im Nichts des Waldes. Fernando hält an und reißt sich den verdreckten Helm vom Kopf. Eine junge blonde Kollegin in Uniform kommt auf ihn zu.
»Moin. Hier ist gesperrt.«
»Für mich nicht.« Er zückt seinen Dienstausweis, den die Beamtin etwas länger als notwendig betrachtet. Zumindest kommt es Fernando so vor.
»Hat sich das frühe Aufstehen ja doch noch gelohnt.« Er setzt sein gewinnendstes Lächeln auf. Unter ihm bebt und spotzt seine Guzzi Bellagio.
»Da geht’s lang«. Sie zeigt mit dem Daumen über ihre Schulter auf ein asphaltiertes Sträßchen.
»Und was genau ist da los?«, erkundigt er sich.
»Leichenfund«, kommt es knapp und ohne ein Lächeln.
Langsam beginnt Fernando, sich unwohl zu fühlen. Was ist los mit ihm, mit seiner Wirkung auf Frauen? Seit er fünfunddreißig geworden ist, scheint es damit rasant bergab zu gehen. »Man sieht sich!«, sagt er und stülpt sich rasch den Helm über sein unrasiertes Gesicht.
Die junge Polizistin dreht sich wortlos um, setzt sich wieder in den Streifenwagen und sagt zu ihrem Kollegen: »Du hattest recht: Es fahren nur noch alte Säcke Motorrad.«
Währenddessen gibt Fernando schon wieder Gas. Die Fahrbahn wird schmaler, Unkraut wuchert in die Straße hinein. Auf dem Land, stellt er fest, gibt es einfach viel zu viel Vegetation. Obwohl er gerne mit dem Motorrad eine Spritztour ins Grüne macht, ist Fernando doch ein echtes Lindener Stadtkind. Nein, aufs Land zu ziehen käme für ihn niemals infrage. Er mag Bürgersteige, Straßenbeleuchtung, Geschäfte, die lange offen haben, und die Stadtbahn vor der Tür. Er schätzt es, eine gewisse Auswahl an Kneipen und Restaurants vorzufinden, für den Fall, dass seine Mutter einmal nicht für ihn kocht.
Jetzt geht die asphaltierte Straße über in einen Feldweg. Das musste ja so kommen! Gras, Sand, Pfützen und Schlaglöcher, groß wie Badewannen, erschweren die Weiterfahrt. Immer wieder schießt Matsch unter den malmenden Rädern der Guzzi in die Höhe wie die Wasserfontäne in den Herrenhäuser Gärten.
»Verdammte Scheiße«, flucht Fernando ein ums andere Mal. »Und dafür hab ich nun mein Mopped geputzt!«
Die Fahrt endet auf einer Wiese, die zum Parkplatz umfunktioniert wurde. Die Mehrzahl der Autos sind Kombis und Geländewagen. Die Heckklappen sind geöffnet, Hunde sitzen hechelnd auf den Ladeflächen, an den Fahrzeugen lehnen Waffen. Menschen in grüner Kleidung stehen grüppchenweise und mit ernsten Gesichtern herum. Ein paar wenige Frauen sind auch dabei. Was ist passiert, haben sich die edlen Waidmänner gegenseitig umgenietet? Nein, vermutlich nicht. »Leichenfund im Schwarzen Moor bei Resse«, hieß es bei der Leitstelle. Mehr war nicht zu erfahren. Drei Streifenwagen sind bereits vor Ort. Ein älterer Polizist mit Bullenbeißermiene nähert sich Fernando. »Bist du der vom 1.1.K?«
»Bin ich.«
»Na, dann mach dich mal auf was gefasst.«
IN DER KÜCHE duftet es nach Kaffee, dabei wollte Völxen doch das Frühstück für Sabine machen.
»Hab ich dich geweckt?«, fragt er.
»Nein, dein Handy. Es lärmt in einer Tour.«
»Warum bist du nicht rangegangen?«
»Es ist dein Telefon. Am Ende ist noch eine andere Frau dran.«
»Ja, die rufen immer um diese Zeit an.« Sabine lächelt, dann schnuppert sie in seine Richtung. »Sag mal, kann es sein, dass du nach Schnaps riechst?«
Frauen und ihre feinen Nasen! Die von Sabine ist nicht nur fein, sondern auch hübsch. Völxen berichtet in dürren Sätzen vom Hühnermassaker, während er versucht herauszubekommen, wer angerufen hat. Vor Kurzem hat Sabine ihm dieses Smartphone geschenkt, aber er beherrscht den Apparat noch immer nicht so ganz. Endlich findet er die Anruferliste. Wenn man dem teuflischen Gerät trauen kann, war es Fernando Rodriguez, der ihn mehrmals zu erreichen versucht hat, das erste Mal vor einer halben Stunde. War er so lang bei Köpcke? Der letzte Anruf ist fünf Minuten her, und es gibt auch noch eine SMS. LFimResserMoor. Krass. Besser, du kommst.
Krass. Völxen schüttelt den Kopf.
»Was ist los?«, will Sabine wissen.
Er lässt sie den Text lesen.
»LF?« Sie zieht die Augenbrauen hoch.
»Leichenfund«, erklärt Völxen.
»Voll krass«, meint Sabine. »Trink deinen Kaffee und putz dir gründlich die Zähne, ehe du verschwindest.« Sie stellt den gefüllten Becher vor ihn auf den Tisch und lächelt verständnisvoll, aber auch ein wenig resigniert.
»Wer sagt denn, dass ich verschwinde?«, widerspricht Völxen. Er nimmt einen Schluck Kaffee und ruft dann Fernando an. »Worum geht’s?«
»Ein … Jagd … Leiche … Moor gefunden«, dringt Fernandos Stimme abgehackt zu ihm durch.
»Großartig. Eine stinkende Moorleiche hat mir heute Morgen noch gefehlt.« Der Kommissar verdreht die Augen.
»Es ist keine … nach Mord aus.«
»Herrgott, ich kann dich kaum verstehen«, schimpft Völxen. Immerhin kann er herausfiltern, dass Fernando bereits seine Kollegin Oda Kristensen benachrichtigt hat.
»Na, wenn Oda schon unterwegs ist …«, versucht Völxen seinen freien Samstag zu retten. Aber was heißt schon frei? Das Dach des Schafstalls ist undicht, und neben dem Schuppen wartet ein Riesenhaufen Holz darauf, gehackt und aufgestapelt zu werden.
»Komm trotzdem«, meint Fernando. »Es ist …« Der Rest ist nicht zu verstehen. Wahrscheinlich wieder »krass«.
»Wo genau im Resser Moor seid ihr gerade?« Er schickt einen reumütigen Hundeblick und ein entschuldigendes Lächeln in Sabines Richtung, während er versucht, den Sprachfetzen eine Wegbeschreibung zu entnehmen. Die Leiche wurde in der Nähe von Brelingen gefunden, so viel bekommt er immerhin heraus. Inzwischen sind bestimmt schon ein paar Streifen vor Ort und werden ihm weiterhelfen. Hastig verschlingt er ein Marmeladenbrot und leert den Kaffee. Nicht noch eine Leiche auf nüchternen Magen. Er eilt die Treppe hinauf, zieht sich an und gurgelt mit Mundspülwasser. Für die gewohnte Rasierprozedur ist keine Zeit, er muss den normalen Nassrasierer verwenden. Völxen würde niemals zugeben, dass moderne Klingen seine Stoppeln nicht nur schneller, sondern auch gründlicher entfernen als das Rasiermesser seines Großvaters, aber gefahrloser sind sie auf jeden Fall. Allzu oft ist er schon morgens auf der Dienststelle erschienen, und Frau Cebulla musste ihm noch den letzten Fetzen blutigen Klopapiers vom Hals pflücken.
Ein Gutes hat die Sache wenigstens, denkt Völxen, während er das Tor des Schuppens öffnet, ich kann meine geliebte DS wieder einmal bewegen. Und als er gleich darauf in seiner französischen Staatskarosse über die noch leeren Landstraßen schwebt, stellt sich eine unangemessen gute Laune bei ihm ein.
FERNANDO HAT FÜR Jäger und Jagd nicht allzu viel übrig, das ganze Brimborium findet er albern und suspekt, aber dennoch bedauert er den Treiber, der das Pech hatte, den Toten zu finden. Den jungen Mann hat die Sache so sehr mitgenommen, dass er anfangs sogar Mühe hatte, Angaben zu seiner Person zu machen. Schließlich konnte Fernando ihm entlocken, dass er Fabian Zimmer heißt, einundzwanzig ist, in Resse wohnt und gerade dabei ist, den Jagdschein zu machen. Nun, da er einmal angefangen hat zu reden, wird er doch noch gesprächig und berichtet, wie er die Leiche gefunden hat: »Die Treiber sollten hier, an diesem Waldweg, auf das Signal zum Losgehen warten. Mein Kumpel Timo und ich haben derweil Pilze gesucht. Damit man wenigstens etwas nach Hause bringt.«
»Das Signal – kam das mit einem Jagdhorn?«, will Fernando wissen.
»Nein, per Handy.«
»Die Jagd ist wohl auch nicht mehr das, was sie einmal war«, meint Fernando, aber der Junge schaut ihn nur groß an, das Gesicht grau wie ein Eierkarton.
»Und wie ging’s weiter?«
»Ich bin ein Stück in den Wald reingegangen, und da sah ich was liegen. Ich bin darauf zu, und dann …« Der junge Mann hält inne.
»Und dann?«, hakt Fernando nach.
»Was glauben Sie? Als ich begriffen habe, dass da ein Toter liegt, der … der … also, ich habe, glaube ich, laut geschrien und bin weggerannt. Und dann sind ein paar von den anderen gekommen, mein Freund Timo und noch welche, die in der Nähe waren, und jemand hat die Polizei gerufen.«
Den Rest kennt Fernando. Nach all den Jahren im Dezernat für Todesermittlungen und Delikte am Menschen müsste er eigentlich langsam an den Anblick von Leichen gewöhnt sein. Dennoch dreht sich ihm jedes Mal der Magen um. Und das da eben – schon beim Gedanken daran rumort es wieder in seinen Eingeweiden, und seine Hände werden eiskalt.
Auf eine gründliche Untersuchung der Leiche hat Fernando verzichtet. Er hat lediglich nach Papieren gesucht, aber nichts gefunden, auch kein Handy, nicht einmal einen Schlüsselbund. Den Rest überlässt er gerne Dr. Bächle, dem Rechtsmediziner. Dessen Wagen nähert sich gerade der Wiese, auf der die Fahrzeuge der Jagdteilnehmer stehen. Noch immer lungern Jäger und Treiber zwischen den Autos herum, einerseits genervt, andererseits aber wohl auch neugierig. Ab und zu bellen und jaulen Hunde. Der Leichenfund hat alle um ihr Jagdvergnügen gebracht, aber nach Hause können die Leute auch nicht, denn Fernando hat sie gebeten, sich für die Polizei noch zur Verfügung zu halten. Etliche Streifenwagen sperren inzwischen das Gelände rund um den Fundort ab, und die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Maschinerie ist angelaufen.
Hinter Bächles Audi holpert nun auch Odas Golf über den Feldweg. Aber nicht nur Oda selbst steigt aus, sondern auch der Hauptkommissar höchstpersönlich. Die drei kommen näher, und Fernando hört Völxen zu Dr. Bächle sagen, dass eine DS nun einmal kein Geländewagen sei und er sie deshalb »in der Zivilisation« geparkt habe. Fernando muss grinsen. Völxen und seine klapprige Franzosenkiste!
Man begrüßt sich. Oda macht eine Bemerkung über Fernandos Gesichtsfarbe – »grün wie die Oliven im Laden deiner Mutter« –, als aus dem Gebüsch, das den Wegrand säumt, urplötzlich Rolf Fiedler auftaucht.
»Moin«, sagt der Chef der Spurensicherung und fügt mit unglücklicher Miene hinzu: »Ihr wollt sicher alle sofort zur Leiche.«
»Nein, ich bin zum Picknick hier«, antwortet Völxen, und Dr. Bächle legt seine Dackelstirn in Falten und entgegnet: »Ja, was denn sonscht?« Der weißhaarige Schwabe ist zwar Frühaufsteher, aber dennoch stünde er jetzt lieber auf der Driving Range anstatt in diesem Moor, in dem die Sonne wie durch einen Filter durch die Bäume scheint und nur ganz langsam den Bodennebel auflöst. Der Beginn eines wunderschönen Tages. Läge da nicht diese Leiche im Gebüsch.
»Da lang, aber bitte hintereinander. Und bleibt zwischen den Absperrbändern, damit ihr mir nicht sämtliche Spuren zertrampelt.«
»Gibt’s denn welche?«, erkundigt sich Oda. Ihre Stimme ist dunkel wie ein alter Bordeaux und so rau wie die Selbstgedrehten, die sie pausenlos raucht. Es grenzt an ein Wunder, dass sie sich bis jetzt noch keine angesteckt hat.
»Ja, jede Menge«, antwortet Fiedler. »Von den Typen, die ihn gefunden haben, und noch mehr von Wildschweinen.«
Völxen murmelt, er habe für heute eigentlich schon die Schnauze voll von Viechern aller Art.
»Kommst du nicht mit?«, fragt Oda Fernando.
Der streicht sich verlegen über sein Haar, das er neulich so kurz hat abschneiden lassen, dass seine Frisur jetzt aussieht wie eine Persianermütze. »Ach nein, ich will Fiedler nicht unnötig Kummer machen. Außerdem muss ich mich noch um die Personalien der Jagdteilnehmer kümmern.«
»Weiß man schon, wer der Tote ist?«, fragt Völxen.
»Noch nicht«, erwidert Fernando.
»Dann finde es raus!« Er schlägt nach einer Mücke an seinem Hals. »Und ruf Jule an, wir brauchen jede Hilfe.«
»Mit dem größten Vergnügen.«
Dr. Bächle schlüpft in ein Paar Gummistiefel, die fast halb so hoch sind wie er selbst. Seine weiße Haarpracht leuchtet im Morgenlicht wie ein Champignon im Grün. Auch Völxen hat vorausgedacht: Er trägt eine Cordhose, die an den Knien schon etwas abgewetzt ist, und robuste alte Stiefel. Eigentlich ist der Waldboden ziemlich trocken, da die ganze Woche schönes Wetter herrschte, aber im Moor kann es urplötzlich passieren, dass man doch eine feuchte Stelle erwischt und bis zum Knöchel im Schlamm versinkt. Fernandos neue Mokassins, ein italienisches Designerschnäppchen, haben unter diesen tückischen Bodenverhältnissen schon arg gelitten, und es ist fraglich, ob seine Mutter die Schuhe wieder richtig sauber bekommen wird.
Eine Krähe stößt einen heiseren Ruf aus und fliegt auf, als sich der kleine Trupp in Bewegung setzt.
Fernando schickt den dreien noch die Warnung »Macht euch auf was gefasst!« hinterher, dann beobachtet er amüsiert, wie sich die Absätze von Odas Pumps bei jedem Schritt im Boden festsaugen. Ihre schwarze Hose ist im Nu voller Schlammspritzer. Oda trägt immer Schwarz, ein aparter Kontrast zu ihrem hellen Haar und den eisblauen Augen, aber hier im Moor ist Eleganz fehl am Platz. Früher hätte Dr. Bächle Oda sicherlich seine Gummistiefel angeboten oder sie notfalls auf Händen bis zur Leiche getragen, aber inzwischen dürfte es sich wohl auch bis ins Rechtsmedizinische Institut herumgesprochen haben, dass Oda mit dem chinesischen Wunderheiler Tian Tang liiert ist. Fernando kann nachfühlen, wie es Dr. Bächle gehen muss. Seit Jahren umgarnt er seine Kollegin Jule unter Aufbietung all seines südländischen Charmes, und was macht sie? Lässt sich mit Hendrik Arschloch Stevens ein! Das will ihm einfach nicht in den Kopf, Jule und dieser Kotzbrocken von einem Staatsanwalt. Immerhin hat Fernando nun das Vergnügen, den beiden den Samstagmorgen zu vermiesen. Mit grimmiger Genugtuung greift er nach seinem Handy, während er zum Parkplatz hinübergeht.
Dort stellt sich heraus, dass einer der Treiber, die auf Fabian Zimmers Schrei hin zum Fundort geeilt sind, mit seinem Handy Fotos des Toten gemacht hat und diese schon bei der Jagdgesellschaft herumgezeigt hat.
»Das ist der Hühner-Hannes!«, vermeldet eine Frau in Jagdkluft, die etwa so alt sein dürfte wie Fernando. Sie schüttelt den Kopf mit den schreiend rot gefärbten Haaren, die vom Kopf abstehen wie Bürstendraht. »Scheußlich.« Dann aber atmet sie tief durch und meint: »Andererseits – da hat es doch wenigstens den Richtigen getroffen.«
»Und Sie sind?«, fragt Fernando streng.
»Merle Lissack. Biobäuerin aus Brelingen. Hoffentlich erwischt es noch mehr von denen!«
»Wie bitte?«
»Schauen Sie sich Falkenbergs Hühner-KZ mal an, dann wissen Sie, wovon ich rede.«
»Zuerst hätte ich gerne mal Ihre Personalien«, sagt Fernando, wendet sich um und ruft: »Das gilt für alle hier!«
EIN SCHWARM FLIEGEN erhebt sich, als Dr. Bächle die Plane hochhebt, mit der der Tote zwischenzeitlich zugedeckt worden ist.
Oda Kristensen zieht scharf die Luft ein, Völxen schaudert und presst sich die Faust vor den Mund, und Dr. Bächle flüstert: »Jessesmaria!«
Irgendjemand hat sich nicht damit begnügt, den Mann umzubringen. Er liegt auf dem Rücken, und der Rumpf ist ein einziges Durcheinander aus Haut, Fleisch, Rippen und Teilen des Gedärms. Dazwischen befinden sich die Fetzen eines ehemals hellblauen T-Shirts. Die Farbe ist nur noch an wenigen Stellen erkennbar. Es muss eine Menge Blut geflossen sein, so viel, dass nur ein Teil davon vom weichen Boden aufgesogen wurde. Der Rest ist an der Oberfläche angetrocknet, schwarz und zäh wie Motoröl. Dieser Geruch! Völxen hält die Luft an, während er das Gesicht des Mannes betrachtet. An den Wangen haften Erde und Pflanzenteile, die Augenhöhlen sind zwei schwarze, blutverkrustete Löcher, die in den Himmel starren.
Die Fliegen sind überall. Sie schwirren um ihre Köpfe, und ihr Summen bildet die penetrante Geräuschkulisse zu dem Grauen, das sich ihnen offenbart, während sich die Käfer, die über den Kadaver kriechen, davon nicht weiter stören lassen.
Der untere Teil des Körpers scheint intakt zu sein. Der Stoff der dunkelgrauen Jogginghose ist ebenfalls blutgetränkt, aber sonst weitgehend unversehrt, und die Füße des Mannes stecken in neongelben schmutzigen Laufschuhen. Die Arme liegen leicht abgespreizt neben den Hüften. Am linken Handgelenk trägt er einen Pulsmesser. Es sind kräftige Hände mit kurzen, dicken Fingern. Bauernhände, denkt Völxen und stellt sich vor, wie sich der Mann zum Laufen angekleidet hat, nicht ahnend, dass er in diesen Kleidern sterben würde. Aber wer sieht das schon kommen? Freute er sich auf den Sport oder hat er sich überwinden müssen? Wann ist er losgelaufen? Heute früh, im Morgengrauen? Wartet gerade irgendwo eine Frau mit dem Frühstück auf ihn?
Die ganze Zeit – Völxen kann unmöglich sagen, wie lange – war es, als hätte sich ein Ring aus Schweigen um die kleine Gruppe gelegt. Jetzt hört man ein Knacken, als Dr. Bächle in die Knie geht und sich über den Leichnam beugt. Leise und in seiner professionellen Art beginnt er, vor sich hin zu schwäbeln: »Männliche Leiche, um die fünfzig, circa eins fünfundachtzig groß, leicht übergewichtig. Der Bruschtraum wurde geöffnet, und zwar mit einem Messer. Hier sind deutliche Schnittflächen zu erkennen. Auffällig ischt das Fählen der Organe. Das Herz, zum Beischpiel, ischt nicht mehr vorhanden, ebenso fählt der Magen. Die Lunge und das Gedärm sind nur noch teilweise vorhanden.«
Völxen zwingt sich, genauer hinzusehen. »Heißt das, er wurde … ausgeweidet?«, fragt er entsetzt.
»Vielleicht.« Bächle richtet sich wieder auf und zuckt mit den Achseln. »Aber Wildtiere mögen halt Innereien am liebschten …«
»Und das … das mit den Augen?«, fragt Oda mit erstickter Stimme. Sie hält die rechte Hand vor Mund und Nase, während sie mit der linken Insekten verscheucht.
»Das waren ganz bestimmt diese Malefitzkrähen, werte Frau Krischtensen.«
Völxen schaudert. Wut, denkt er. Da war große Wut im Spiel. Wut und Hass.
Dr. Bächle klappt seinen Alukoffer auf und holt ein Paar Latexhandschuhe heraus. »Bevor Sie fragen, meine Herrschaften – anhand des Insektenbefalls kann ich mich dahingehend feschtlägen, dass der Todeszeitpunkt schon etliche Schtunden zurückliegt.«
»Geht es vielleicht etwas genauer?«, bedrängt Völxen den Arzt.
»Ja, freilich«, antwortet Bächle. »Nur obduzier ich net so gern im Wald.«
Der Kommissar stößt einen demonstrativen Seufzer aus, woraufhin Dr. Bächle sich zu der Aussage hinreißen lässt, dass der Tod wahrscheinlich gestern Abend eingetreten sei.
»Es sei denn, der Ärmschte wäre nachts gejoggt«, fügt der Mediziner hinzu.
Völxen wendet sich ab. Keine Sekunde länger erträgt er den Anblick dieses Leichnams, der kaum noch etwas Menschliches hat, sondern vielmehr an ein abgeschlachtetes Tier erinnert. Die Bestialität hat dem Toten jede Würde geraubt, und wie so häufig beim Anblick von Mordopfern kommt Völxen sich wie ein Voyeur vor. Außerdem befürchtet er, dass ihm von dem süßlichen Blutgeruch, der von der Leiche ausgeht, gleich schlecht wird.
»Danke, Dr. Bächle. Wir haben vorerst genug gesehen, was meinst du, Oda?« Er sieht seine Kollegin fragend an.
»Auf jeden Fall.«
Stumm gehen die beiden zurück. Es ist wärmer geworden, in der Sonne ist es schon recht angenehm. Oda steckt sich eine Zigarette an. Jetzt ist auch sie ein wenig blass um die Nase. Auf dem Parkplatz haben zwei Mitarbeiter der Spurensicherung damit begonnen, Sohlenabdrücke von den Schuhen der Jäger und Treiber zu nehmen.
»Die Presse ist auch schon da.« Oda deutet mit einer Kopfbewegung auf einen kleinen Pulk von Journalisten, die sich vor der Absperrung versammelt haben. »Ist das nicht dein Freund Markstein?«
»Markstein ist nicht mein Freund!«
»Es heißt, für Leute, denen man einmal das Leben gerettet hat, ist man sein Leben lang verantwortlich«, sagt Oda lächelnd.
»Wer behauptet das, Konfuzius?«, brummt Völxen. »Und selbst wenn: Für Bild-Reporter gelten andere Regeln.«
Fernando kommt auf sie zu und meldet: »Die Identität des Opfers ist geklärt. Man nennt ihn hier den Hühner-Hannes … Was schaust du so grimmig? Ich habe keinen Schafswitz gemacht! Er heißt Johannes Falkenberg und hat in der Nähe von Resse eine Hühnerfarm, also eine für Eier – heißt das dann Eierfarm? Na, egal. Er selbst wohnt in der Waldsiedlung Brelingen.«
»Hühner«, sagt Völxen.
»Genau, Hühner«, antwortet Fernando.
Der Hauptkommissar schüttelt den Kopf. Fernando sieht Oda an, beide zucken mit den Schultern. Währenddessen nähert sich Rolf Fiedler und teilt mit, dass er eine Schleifspur identifizieren konnte, vom Weg bis zum Fundort der Leiche.
»Gibt es Sohlenabdrücke?«, will Völxen wissen.
»Einen Teilabdruck, bis jetzt. Wir suchen weiter.«
»Habt ihr auf dem Weg auch Blut gefunden?«
Fiedler schüttelt den Kopf. »Nein. Die Metzelei fand definitiv an der Fundstelle im Gebüsch statt. Wäre ja auch unlogisch, wenn nicht. Schließlich ist man dort ungestört. Hier kann dagegen jederzeit jemand vorbeikommen. Aber wir haben ein Handy ein paar Meter neben dem Weg im Gebüsch gefunden.«
»Sehr gut, vielleicht sind ja Fingerabdrücke drauf«, presst Völxen hervor. Ihm ist noch immer ein wenig übel. »Wir müssen eine Hotline einrichten und die Presse um Zeugenaufrufe bitten. Irgendjemand muss doch gestern Abend etwas beobachtet haben.«
»Da kann sich Markstein ja gleich nützlich machen«, sagt Oda und winkt dem Reporter zu, der sich soeben an die Ermittler heranpirscht.
Auch Fernando hat Neuigkeiten. »Ich habe herausbekommen, dass Falkenberg verheiratet war. Seine Frau heißt Nora Falkenberg, und es gibt auch noch einen Sohn, der aber nicht mehr bei den Eltern wohnt.«
»Gut. Oda und ich fahren jetzt gleich zu der Frau«, beschließt Völxen.
»Ja, das sollten wir. Nicht dass ihr noch einer ein Handyfoto schickt, auf dem ihr Mann aussieht wie eine aufgeplatzte Wurst.«
»Oda, also wirklich!« Völxen wirft ihr einen bösen Blick zu und fragt Fernando, ob er Jule erreicht habe.
Fernando nickt. Er hat zuerst Jules Festnetzanschluss angerufen, aber dort nahm niemand ab. Auf dem Handy hat er sie dann erwischt. Sie klang etwas atemlos – er möchte sich lieber gar nicht vorstellen, wovon. »Sie ist unterwegs. Hoffentlich bringt sie das Arschloch nicht mit.«
»Rodriguez!«, knurrt Völxen warnend.
»Einen wunderschönen guten Morgen, die Herrschaften!«, grüßt der Bild-Reporter, der sich in diesem Moment zu ihnen gesellt.
»Ihnen auch, Herr Markstein, Ihnen auch!«, flötet Völxen, während Fernando das Gesicht verzieht, als wäre er in einen Hundehaufen getreten. Marksteins Wieselgesicht dagegen strahlt. Bestimmt hat er schon die Fotos des Leichnams auf dem Handy und wurde von der gelangweilten Jagdgesellschaft mit allerlei grausigen Schilderungen unterhalten.
»Hauptkommissarin Kristensen wird Sie umgehend über die Fakten informieren, Herr Markstein.« Völxen bedeutet Oda mit einer Handbewegung, sich des Reporters anzunehmen. Dann macht er ein paar Schritte auf Fernando zu und legt seine Hand auf dessen Schulter. Eine ungewohnt vertrauliche Geste, wie Fernando alarmiert feststellt. Auch dass Völxen ihn beim Nachnamen nennt, ist kein gutes Zeichen. Als sie sich außer Hörweite von Oda und dem Bild-Reporter befinden, sagt Völxen mit gefährlich leiser Stimme: »Rodriguez, reiß dich zusammen, du kommst sonst in Teufels Küche, und wir mit dir. Wenn du mit … dieser Sache ein Problem hast, dann sag es. Dann muss ich Maßnahmen ergreifen.«
Maßnahmen? Was für Maßnahmen? Fernando ist verwirrt. Will Völxen etwa Jule in ein anderes Dezernat versetzen? Nein, ganz bestimmt nicht Jule. Er hat sich damals schier ein Bein ausgerissen, um sie in seine Abteilung zu locken, die lässt er doch jetzt nicht wieder vom Haken. Soll am Ende er versetzt werden, nur weil es ihn ärgert, dass Jule mit dem Weisungsbefugten rummacht? Das wäre ja wirklich das Allerletzte. Niemand mag den. Völxen selbst gerät regelmäßig mit dem arroganten Pinsel aneinander, Oda nennt ihn hinterrücks SS, was angeblich für Staatsanwalt Stevens steht, und sogar Frau Cebulla, die Sekretärin des Dezernats, geht ihm aus dem Weg.
Völxen hat seine Pranke wieder von Fernandos Schulter genommen, doch die grauen Augen unter den buschigen Brauen mustern ihn noch immer finster.
Jetzt nur keinen Fehler machen. »Nein, nein, natürlich habe ich überhaupt kein Problem mit der Kollegin Wedekin oder dem Staatsanwalt Stevens«, versichert Fernando übertrieben förmlich, wobei er sich nicht verkneifen kann, die zwei S scharf zu betonen.
»Dann ist es ja gut. Bis Jule hier ist, kannst du schon mal mit der Befragung der Jagdgesellschaft anfangen. Ich will alles über diesen Falkenberg wissen: Fakten, Klatsch und Tratsch, das Übliche.«
»Geht klar.«
»Wir treffen uns dann um elf zu einer ersten Besprechung in der PD. Oder nein! Bei deiner Mutter im Laden, ich habe Hunger.«
Seit wann verlegt Völxen Meetings in den Laden seiner Mutter? Das sind ja ganz neue Moden. Doch dann fällt der Groschen bei Fernando, und er grinst. Raffiniert, der alte Silberrücken! In der Polizeidirektion kann man schlecht verhindern, dass SSan der Besprechung teilnimmt, falls der davon Wind bekommt. Im spanischen Laden seiner Mutter dagegen ist man sicher. Sollte sich Herr Hendrik A. Stevens je dort hinwagen oder sollte Jule die Geschmacklosigkeit besitzen, ihn dorthin mitzunehmen, dann aber …
»WER WAR DAS?«
Jule legt das Handy auf den Nachttisch zurück. »Was Dienstliches. Ich muss los.« Sie steht auf und huscht hinüber ins Bad, während sie sich fragt, warum sie nicht einfach »Fernando« geantwortet hat. Er ist schließlich ihr Kollege und darf sie anrufen, wann immer es nötig ist.
»Und was ist so dienstlich?«, ruft Hendrik ihr nach, aber Jule stellt die Dusche an und tut, als hätte sie seine Frage nicht gehört. Sie seift sich mit seinem Duschbad ein, irgendeine holzig duftende Herrenserie. Sie sollte hier mal ihr eigenes Duschgel deponieren, denkt sie, aber irgendetwas in ihrem Kopf sorgt dafür, dass sie es immer wieder vergisst. Sie trocknet sich ab, greift nach der Körperlotion und zieht dann die Hand wieder zurück, als hätte sie etwas gebissen. Nein, das geht nicht. Sie kann nicht an einem Tatort erscheinen und riechen wie er. Hoffentlich verfliegt der Geruch des Duschgels, bis sie am Tatort eintrifft. Oda würde den Duft sofort erkennen, sie hat eine Nase wie ein Trüffelschwein. Und wenn schon?, fragt eine innere Stimme. Es wissen doch ohnehin alle Bescheid. Trotzdem verzichtet sie auf das Eincremen. Stattdessen geht sie ins Wohnzimmer, um dort ihre Zahnbürste aus der Handtasche zu holen. Eine leere und eine angebrochene Flasche Chianti stehen auf dem Glastisch vor der Couch. Die Einrichtung des Zimmers passt zu ihrem Besitzer: klar und nüchtern, nichts Überflüssiges, alles passt zueinander, als hätte man es in einem Rutsch durchgeplant, gekauft und dann so gelassen. Höchstwahrscheinlich ist das auch der Fall gewesen. Kein Schnickschnack ist dazugekommen, nichts, was die minimalistische Ordnung stören könnte. Jule Wedekin kann gut verstehen, dass ihre Kollegen Staatsanwalt Hendrik Stevens nicht besonders mögen. Sie mochte ihn anfangs ja auch nicht. Aber es gibt eben den Staatsanwalt Stevens – und der kann echt nervig sein in seiner unerbittlichen Gründlichkeit und seinem Kontrollwahn – und den Menschen Hendrik Stevens. Letzterer ist kultiviert, klug, aufmerksam und zuweilen sogar recht witzig. Und er sieht nicht schlecht aus, zumindest auf den zweiten Blick. Okay, manchmal überschneiden sich der Staatsanwalt und der Mensch, und immer wenn das geschieht, dann wird es für Jule schwierig. So wie jetzt. Sie geht wieder ins Bad. Die Zehen in seine weiche Badematte gekrallt, putzt sie sich die Zähne. Im Spiegel sieht sie ihn hinter sich im Türrahmen lehnen. Weite weiße Boxershorts schlackern um seine sehnigen Beine, sein Gesicht sieht ohne die Brille leer aus.
»Die meisten zivilisierten Menschen pflegen nach dem Koitus noch ein paar freundliche Worte zu wechseln. Einige sollen sogar schon zusammen gefrühstückt haben.«
»Tut mir leid. Ich muss los«, nuschelt Jule durch den Schaum der Zahnpasta.
»Muss ich Hauptkommissar Völxen anrufen, oder sagst du mir freiwillig, was passiert ist?«
»Ein Leichenfund im Resser Moor.«
»Interessant!«
»Ach, ich glaube nicht.«
»Wenn du einen Moment wartest, dann komm ich mit.«
»Nein«, ruft Jule, und es klingt schriller, als sie eigentlich wollte.
»Du musst nicht gleich die Nerven verlieren«, sagt er und lächelt. Jule mag sein Lächeln. Allerdings scheint er es als etwas zu betrachten, das man sich unbedingt fürs Privatleben aufbewahren muss. Sie spült sich den Mund aus und quetscht sich an ihm vorbei. »Ich … ich muss noch nach Hause, mich umziehen. Ich kann nicht im kleinen Schwarzen an einem Tatort aufkreuzen.«
»Tatort? Dann ist es also ein Mord?«
Oh, ich dummes Huhn!, ärgert Jule sich im Stillen über sich selbst. »Leichenfundort. Ich wollte Leichenfundort sagen«, nuschelt sie, während sie ihre Unterwäsche vom Boden des Schlafzimmers aufklaubt.
»Jule, ich hoffe, du wirst niemals kriminell. Du würdest im Verhörraum keine fünf Minuten durchhalten.«
»Ich wusste nicht, dass dies ein Verhör ist.« Sie schlüpft in ihr Kleid.
»Wir können mit zwei Autos fahren, wenn es dir peinlich ist, mit mir gesehen zu werden«, schlägt er vor.
»Hör zu: Ich kann dich nicht hindern, dorthin zu fahren, aber es wäre mir wirklich lieber, du würdest es lassen. Ich komme mir eh schon vor wie die Dienststellen-Mata-Hari. Ich merke, dass es in den Meetings förmlicher zugeht als früher, zumindest wenn ich dabei bin. Es werden Gespräche unterbrochen, wenn ich dazukomme …«
Er umfasst ihre Schultern, schaut sie durch seine randlose Brille, die er inzwischen aufgesetzt hat, ernst an und sagt: »Alexa Julia Wedekin, da stehst du doch drüber. Außerdem legt sich das alles wieder, glaub mir!«
Jule, die ihren vollen Namen nicht gerne hört, was er im Übrigen genau weiß, entgegnet giftig: »Du scheinst ja Erfahrung zu haben, was Verhältnisse mit Mitarbeitern nachrangiger Behörden betrifft.«
Er geht nicht darauf ein. »Man kommt nicht voran, wenn man es immer allen recht machen will.«
»Es gefällt mir da, wo ich bin. Ich strebe keinen Sessel im Ministerium an. Hätte ich Karriere machen wollen, hätte ich mein Medizinstudium beendet, und mein Vater hätte mit Freuden seine Beziehungen spielen lassen.«
Hendrik runzelt die Stirn. »Das glaube ich dir nicht.«
»Was?«
»Dass du keinen Ehrgeiz hast. Ganz im Gegenteil.«
»Du hast recht, ich habe schon Ehrgeiz. Wenn es gilt, einen Mord aufzuklären, kann ich verdammt ehrgeizig sein. Aber ich gehe für meine Karriere nicht über Leichen.« Keine gute Metapher. Hat schon fast etwas Komisches.
Aber Hendrik lacht nicht, sondern fragt zurück: »Kann das angespannte Klima in eurem Dezernat vielleicht damit zu tun haben, dass Rodriguez sich aufführt wie ein eifersüchtiger Gigolo?«
»Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass du im Dienst unbedingt immer den scharfen Hund raushängen lassen musst?«, entgegnet Jule angriffslustig. Das musste ja mal gesagt werden. Eigentlich, fällt ihr ein, hat sie das ihm gegenüber schon öfter erwähnt, aber es hat nicht viel geändert.
Er lächelt versöhnlich. »Okay, Frau Kommissarin, ich lasse dich ziehen. Unter einer Bedingung. Ich möchte informiert werden, wenn es ein Tötungsdelikt ist.«
»In Ordnung.«
»Und wenn es ein Meeting gibt, wäre ich gern dabei.«
»Klar.« Erleichtert schlüpft Jule in ihre Pumps, schnappt sich ihr Handy und die Handtasche und drückt ihm einen Kuss auf die Lippen. Dann eilt sie auf klackernden Absätzen die Treppen hinunter.
DURCH DIE WALDSIEDLUNG Brelingen führt eine schnurgerade Straße, von der in großzügigen Abständen Einfahrten abzweigen. Die der Falkenbergs endet nach zehn Metern vor einem eisernen Tor. Oda und Völxen steigen aus und werfen einen Blick auf das Anwesen. Dann sehen sie einander an. Oda zuckt nur mit den Schultern und fängt an, sich eine Zigarette zu drehen. Beide kennen sich lange genug, um zu wissen, dass sie gerade dasselbe denken: Hier hat jemand auf Teufel komm raus versucht, seine Träume und Sehnsüchte zu materialisieren.
Aus architektonischer Sicht ist das Haus der Familie Falkenberg durchaus akzeptabel, vorausgesetzt, die terrakottafarben gestrichene Villa mit den Lamellenfensterläden und dem beinahe flachen Dach aus Nonne- und Mönch-Ziegeln stünde in der Toskana oder in Südfrankreich.
»Tja. Resser Moor statt Mittelmeer, dumm gelaufen«, bemerkt Oda und zündet ihre Zigarette an.
Ein hoher Metallzaun umgibt das weitläufige Grundstück, das sich weiter hinten im Wald verliert. Rechts der Einfahrt schimmert das nächste und wohl auch einzige Nachbarhaus durch die Bäume.
»Einsam hier«, meint Völxen.
Oda schickt eine Rauchwolke in die Luft. »Schon, ja. Aber ihr wohnt doch auch so ähnlich. Hat Sabine keine Angst, wenn du nicht da bist?«
Völxen wäre nie auf den Gedanken gekommen, seine Wohnsituation als »einsam« zu beschreiben. Ländlich großzügig, das ja, aber einsam? »Wir haben ja jetzt Oscar. Außerdem kann man den Nachbarhof gut sehen, und das Dorf auch. Dieser Wald und das Moor dagegen … Das wäre nichts für mich.«
»Sag mal, Völxen, kann es sein, dass du nach Schnaps riechst?«
»Ja.«
Völxen wartet geduldig, bis Oda zu Ende geraucht hat. Er fühlt sich unwohl. Gleich werden sie in ein fremdes Leben platzen, und nichts wird mehr so sein wie vorher. Schon ist es wieder da, dieses vage Schuldgefühl, obwohl das doch vollkommen blödsinnig ist. Schuld hat einzig und allein derjenige, der Johann Falkenberg auf so grausame Weise umgebracht hat. Um sich abzulenken, fragt er Oda: »Freust du dich schon?«
»Ja, ich liebe es, Angehörigen Todesbotschaften zu überbringen, nur deshalb bin ich Polizistin geworden.«
»Ich meine auf Peking.«
Oda zuckt mit den Schultern. »Geht so. Mir graut vor dem Flug. Ich kann einfach nicht begreifen, wie so ein schweres Trumm fliegt, auch wenn man es mir schon zigmal erklärt hat. Es braucht nur ein winziges Luftloch, und ich kriege Panik. Außerdem höre ich in letzter Zeit nur noch Negatives über China. Du weißt schon – Gift im Essen, schlechte Luft, ein gestörtes Verhältnis zur Gewaltenteilung und den Menschenrechten …«
Völxen nickt und gesteht: »Mich würde es auch nicht unbedingt in eine Stadt mit zwanzig Millionen Einwohnern ziehen, mir reicht schon Hannover am Samstagvormittag. Aber auf der Chinesischen Mauer würde ich schon gerne einmal stehen. Außerdem hast du doch die beste Begleitung, die man sich denken kann.«
»Ja, sicher«, seufzt Oda. »Aber trotzdem …«
»Du wirst doch nicht einer von diesen Gutmenschen werden, die nur noch in Länder fahren, von denen wir glauben, dass es dort politisch korrekt zugeht?«
Oda grinst. »Hast du was gegen Gutmenschen, Völxen?«
»Seit ich einen davon in der Familie habe, schon«, bricht es aus Völxen heraus. »Wanda geht mir mit ihrem Tierschutzfimmel dermaßen auf die Nerven. Zuerst war ich traurig, als sie in diese Studenten-WG gezogen ist, aber inzwischen bin ich froh, dass ich nicht mehr alles mitkriege, was sie und ihre Freunde so treiben.«
»Ja, mit Töchtern hat man immer Spaß.« Oda tritt ihre Zigarette aus. »Los, bringen wir’s hinter uns.«
Das Tor ist nicht verschlossen. Vor einer Doppelgarage steht ein schwarzes Peugeot Cabrio, und Völxen hört Oda »Tussenauto« murmeln, während sie auf die Haustür zugehen. Sie ist aus hellem Eichenholz und mit Schnitzereien verziert, die eine Art Wappen darstellen. Auf ihr Klingeln hin wird die Tür von einer Frau in den Vierzigern geöffnet, die die Besucher misstrauisch mustert.
»Nora Falkenberg?«, fragt Oda.
»Ja?«
Große braune Augen in einem länglichen Gesicht, das trotz einem etwas zu kräftigen Kinn nicht unattraktiv ist. Das dunkelbraune Haar ist im Nacken zusammengebunden. Auf Völxen wirkt sie wie eine dieser durch Fitnessstudios und Diäten ausgemergelten Frauen. Ihre 34er-Figur steckt in engen Reithosen, und aus den kurzen Ärmeln ihrer sandfarbenen Bluse stechen sehnige, sonnengebräunte Arme hervor wie dünne Äste.
Völxen verzichtet darauf, ihr einen Guten Tag zu wünschen. Es wäre der blanke Hohn, denn was soll an einem solchen Tag schon gut sein? Stattdessen zeigt er ihr seinen Dienstausweis und stellt Oda und sich vor, wobei er laut sprechen muss, um die Stimme einer aufgekratzten Radiomoderatorin zu übertönen, die im Hintergrund zu hören ist. Warum müssen die immer so verflucht fröhlich sein, das hält doch kein Mensch aus!
»Wenn es schon wieder um diese Eiergeschichte geht, dann setzen Sie sich bitte mit unserem Rechtsanwalt in Verbindung«, sagt Frau Falkenberg schroff.
»Es geht nicht um Eier«, sagt Völxen. »Dürfen wir reinkommen?«
»Wenn’s nicht zu lange dauert … Ich bin auf dem Sprung, sozusagen, ich muss zu einem Turnier.« Sie lächelt flüchtig über ihr eigenes kleines Wortspiel und bittet die beiden herein. Kann es sein, dass sie ihren Mann noch gar nicht vermisst? Völxen betritt das Haus und stößt aus Versehen ein Paar Reitstiefel um, die einsatzbereit im Flur standen. Er entschuldigt sich und stellt sie wieder ordentlich hin. Frau Falkenberg trägt rosa Sneakers mit glitzernden Nieten. Sie betreten ein geräumiges Zimmer; offenes Wohnen mit einem Kaminofen aus grauen Mauersteinen und einer Scheibe, die um die Ecke geht. Vor dem Fenster steht ein mächtiger Holztisch mit einer dicken, rauen Platte, der aussieht, als hätte hier schon König Arthur seine Tafelrunden abgehalten. Ein Strauß bunter Sommerblumen prangt in der Mitte, sonst liegt nichts auf dem Tisch. Das alles, inklusive Garten, sieht aus wie ein Arrangement für ein Lifestylemagazin. Völxen vermisst das gewisse Maß an Unordnung, die das Leben ausmacht. Bei sich zu Hause muss er auf dem Küchentisch immer erst Bücher, Notenhefte, Gläser und halb ausgetrunkene Tassen zur Seite stellen, wenn er Platz zum Zeitunglesen haben will. Und die Zeitung bleibt dann auch meist liegen.
Frau Falkenberg stellt das Radio aus. Die plötzliche Stille ist wie ein Vakuum, das nach Worten verlangt, und Völxen sagt: »Frau Falkenberg, wir haben eine schlimme Nachricht für Sie. Ihr Mann wurde heute früh tot aufgefunden, im Wald, nicht weit von hier …«
Sie lässt sich auf die breite Armlehne eines Ledersessels sinken. Dann beißt sie die Zähne zusammen, die Kaumuskeln treten hervor. »Ich habe befürchtet, dass das irgendwann mal passiert«, presst sie hervor.
»Das müssen Sie mir jetzt aber erklären«, meint Völxen überrascht.
»Sein Herz. Hatte er … hat es versagt?«
»Nein. Nein, es sieht vielmehr so aus, als wäre Ihr Mann ermordet worden«, sagt Völxen.
Ihre Porzellanhaut färbt sich rot, und sie atmet durch den Mund, als bekäme sie zu wenig Luft.
Oda geht zur Spüle und füllt Wasser in ein Glas aus dem Schrank darüber, welches sie anschließend Frau Falkenberg reicht. Die trinkt einen Schluck und stellt das Glas dann auf den Couchtisch. Jetzt füllen sich die braunen Augen mit Tränen. Oda zückt ein Papiertaschentuch, und die Frau tupft sich damit die Augen ab, vorsichtig, um die Wimperntusche nicht zu verschmieren. Ihr Aussehen scheint ihr selbst in dieser Situation noch wichtig zu sein, oder es ist die Gewohnheit.
»Fühlen Sie sich in der Lage, uns noch ein paar Fragen zu beantworten?«, erkundigt sich Völxen.
Sie nickt und weist auf das Sofa. Oda und der Hauptkommissar setzen sich, Frau Falkenberg zieht es offenbar vor, weiterhin auf der Armlehne des Sessels zu balancieren. Hinter ihr, auf dem Küchentresen, bemerkt Völxen ein angebissenes Croissant, und prompt fängt sein Magen an zu knurren. Ein einziges Marmeladenbrot hält schließlich nicht ewig vor. Dabei hat er eben noch, beim Anblick der grausam zugerichteten Leiche, Mühe gehabt, es bei sich zu behalten. Hoffentlich hat man das Knurren gerade nicht gehört.
»Ermordet? Von wem?«
»Das wissen wir noch nicht.«
»Und wie ist das … ich meine, wie wurde er …?
Völxen möchte ihr die Details lieber ersparen und erklärt, dass man das erst nach der Obduktion werde sagen können.
»Aber woher wissen Sie denn dann, dass er ermordet wurde?«
»Wir wissen es, glauben Sie uns«, sagt Oda, und Völxen, der befürchtet, dass Frau Falkenberg keine Ruhe geben wird, ergänzt, dass ihr Mann höchstwahrscheinlich mit einem Messer erstochen wurde. »Wie es aussieht, geschah die Tat gestern Abend.«
»Gestern?«
»Ja«, bestätigt er. »Haben Sie Ihren Mann denn seither nicht vermisst?«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich war in der Stadt, mit einer Freundin, und bin erst gegen Mitternacht nach Hause gekommen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er nicht da war.« Ehe Völxen fragen kann, erklärt sie: »Wir haben jeder unser eigenes Schlafzimmer.«
Gut möglich, dass das heutzutage zum trendigen Wohnen gehört, überlegt Völxen. Es könnte aber auch ein Indiz dafür sein, dass es mit der Ehe der Falkenbergs nicht zum Besten stand. Er findet jedoch, dass jetzt nicht der passende Moment ist, sie danach zu fragen.
»Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen?«, erkundigt sich Oda.
»Gestern Abend. Ich bin um halb sieben weggefahren, da war er noch hier.«
»Welche Kleidung hatte Ihr Mann an, als Sie gefahren sind?«, will Völxen wissen.
Sie zuckt mit den Schultern.
»Als man ihn fand, trug Ihr Mann Sportkleidung«, hilft er ihr auf die Sprünge.
»Stimmt, ja. Er wollte noch laufen.«
»Ging er regelmäßig laufen?«
»Ja, dreimal in der Woche.«
»Immer um dieselbe Zeit?«, fragt Oda.
»Meistens am Abend, am liebsten kurz vor Sonnenuntergang.«
Zurzeit geht sie um halb acht unter, das weiß Völxen so genau, weil er in der Abenddämmerung gern am Zaun der Schafweide steht. Bei so schönem Wetter wie gestern wird es sogar noch später dunkel, bis acht Uhr kann man beim Laufen einigermaßen gut sehen.
»Wie lange lief ihr Mann denn immer?«, erkundigt sich Völxen.
»Ungefähr eine Dreiviertelstunde.«
»Nahm er immer dieselbe Strecke?«
»Ich glaube schon.«
»Ihr Mann hatte keine Schlüssel bei sich …«, beginnt Völxen
»Ja, er meint, der Schlüsselbund würde ihn beim Laufen stören. Ich hatte schon Mühe, ihn dazu zu bringen, sein Handy einzustecken. Falls mal … falls er …« Sie stockt, fängt sich dann aber wieder. »Er legt die Schlüssel immer unter den Blumentopf neben der Tür, wenn er laufen geht. Nicht gerade ein sehr originelles Versteck.« Ein wehmütiges Lächeln huscht über ihr Gesicht.
Oda geht hinaus und kommt mit einem Schlüsselbund zurück. »Ist er das?«
Nora Falkenberg nickt und knetet ihre Hände. Irgendwo klingelt ein Telefon in jenem antiquierten Klingelton, den man inzwischen überall hört. Sie zuckt nervös zusammen. »Das Turnier. Ich muss das ja jetzt absagen«, murmelt sie verwirrt.
»Frau Falkenberg, hatte Ihr Mann Feinde?«, fragt Völxen.
»Ist das Ihr Ernst?« Ein trockenes Lachen begleitet die Frage, während das Telefon hartnäckig weiterklingelt.
»Allerdings«, antwortet Völxen, der sich wundert, was an seiner Frage so erheiternd sein soll. Die meisten Menschen in ihrer Situation weisen den Gedanken an Feinde empört zurück.
»Er hatte eine ganze Menge Feinde seit dieser Sache. Ich kann Ihnen die ganzen Droh-E-Mails zeigen, wenn Sie möchten. Er hat sie gesammelt.«
»Ja, das möchte ich«, sagt Völxen. Das Klingeln hat endlich aufgehört. »Verzeihen Sie, was genau meinen Sie denn mit ›dieser Sache‹?«
Sie schaut ihn verwundert an, ehe sie erklärt: »Mein Mann wurde beschuldigt, Eier falsch deklariert zu haben.«
»Ach, diese Sache«, entschlüpft es Oda. »Da war er ja wohl nicht der Einzige, der die zahlende Kundschaft verarscht hat.«
Frau Falkenbergs eisiger Blick prallt an Oda ab, die selbst eine Meisterin im Verschleudern frostiger Blicke ist.
Ende der Leseprobe