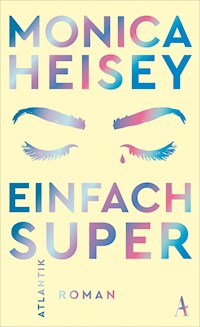
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Jeder Satz, den Monica Heisey schreibt, ist ein Geschenk.« Dolly Alderton Sunday-Times-Bestseller Maggie ist achtundzwanzig und war genau sechshundertacht Tage mit Jon verheiratet, als ihr erstes Scheidungsjahr beginnt. Während die Deko der Verlobungsparty noch die Wohnung schmückt, ist Jon schon ausgezogen. Maggie ist plötzlich wieder allein. Gern wäre sie eine dieser eleganten Geschiedenen, die ihre Freiheit genießen. Aber Maggie fühlt sich wie ein Kleinkind, das Stöckelschuhe anprobiert. Bedeutet Scheidung Scheitern oder eine neue Chance? Selbstzweifel oder ein Push für den Selbstwert? Trennungstherapie oder Online-Dating? Maggie sucht Rat: bei ihrer Doktormutter Merris, bei ihrer Freundin Amy und in ihrer Chatgruppe (natürlich!). Sie versucht wieder zu daten und stellt sich bei alldem die ganz großen Fragen des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Monica Heisey
Einfach super
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Atlantik
Für Louise, in Dankbarkeit
Als ich ein Kind war und
das Leben meiner Eltern sah, weißt du
was ich dachte? Ich dachte
herzzerreißend. Heute denke ich
herzzerreißend, aber auch
verrückt. Und
sehr lustig.
Louise Glück, Telemachos’ Loslösung
Meine Ehe ist gescheitert, weil ich herzlos war. Oder weil ich im Bett aß. Weil er elektronische Musik und anspruchsvolle Filme über Männer in der Wildnis mochte und ich nicht. Oder weil ich verunsichert war und deshalb Kontrolltendenzen entwickelte. Weil Rotwein mich überkritisch werden lässt, genauso wie Hunger, Stress und Weißwein. Weil ich auf Partys an ihm hing wie eine Klette. Weil er jeden Tag Gras rauchen wollte und ich seine Ansicht nicht teilte, es wäre »eigentlich dasselbe« wie meine zwei Becher Kaffee am Morgen. Weil wir uns zu jung kennengelernt hatten (wie sollte unser Zusammenleben Vorstellungen entsprechen, die wir als knapp Zwanzigjährige mit unglaublich straffen Körpern entwickelt hatten?). Oder vielleicht, weil wir es 2011 drei Monate lang mit einer offenen Beziehung versucht hatten (war okay, aber auch nicht toll). Oder weil er scharfe Sauce auf jedes Essen kippte, ohne es vorher zu probieren, selbst wenn ich Stunden damit zugebracht hatte, ein Rezept mit perfekt ausbalancierten Aromen nachzukochen, das ich erst lesen durfte, nachdem ich den langatmigen und detailreichen Urlaubsbericht irgendeiner Frau durchgescrollt hatte. Oder weil er einmal unseren Jahrestag vergessen hatte. Weil ich mich nicht um die Wäsche gekümmert habe, nie. Weil seine griechische Großfamilie mich nicht einmal dann als vollwertiges Mitglied akzeptierte, als ich das Lieblingsgedicht seiner Yiayia auswendig gelernt und auf ihrem Geburtstag vorgetragen hatte. Oder weil er einmal ins Bad kam und mich beim Kacken überraschte. Weil wir 2015 bei neun Hochzeiten eingeladen waren und deshalb dachten, so eine Party wäre eine tolle Sache, auf der einem die Leute gratulieren, als habe man eine Meisterleistung vollbracht, und einem noch dreitausend Dollar schenken. Oder weil wir nach Paris geflogen sind und uns dort, statt uns neu zu verlieben oder wenigstens mal in den Arm zu nehmen, nur gestritten haben. Weil ich irgendwann aufhörte, mir unsere gemeinsamen Kinder vorzustellen. Weil er nie damit angefangen hatte. Weil ich manchmal unsicher und kleinlich war, oder weil er auf veganer Ernährung bestand und, sobald ich im Bett war, heimlich Pizza bestellte. Weil wir Die Sopranos zu Ende geschaut und danach nicht mit The Wire angefangen hatten. Weil ich kurz nach unserer ersten Begegnung einen anderen geküsst hatte und manchmal immer noch an ihn denken musste. Wegen seiner völlig unnötigen Streitlust und seiner leicht überheblichen Art. Oder weil ich ein Feigling war und mein erklärtes Jobziel nicht, den Staat »bewusst zu demontieren«. Weil ich mich über die Formulierung lustig machte und ihn fragte, wie seine aktuelle Werbekampagne für Burger King mit dem Sozialismus vereinbar sei. Weil er mich eine Fotze nannte und ich mich manchmal wie eine benahm. So oder so, es war vorbei.
Also, mehr oder weniger. Er war ausgezogen und hatte eine Spielkonsole, drei Akustikgitarren und (vorläufig) die Katze mitgenommen. Die Vorstellung, dass Jon jetzt in einem dunklen WG-Zimmer saß und Trennungslieder schrieb, erfüllte mich mit ebenso tiefer Verzweiflung wie unglaublicher Erleichterung – Verzweiflung, weil ich ihm diesen Schmerz zugefügt und ihn ins experimentelle Songwriting getrieben hatte, Erleichterung darüber, dass ich mir die Songs nicht anhören musste.
Nicht, dass ich ihm den Impuls verdenken konnte. An dem Morgen, als er ausgezogen war, hatte ich prompt ein Selfie gemacht, denn ich wollte »den Moment festhalten« und bildete mir zudem ein, der entsetzliche Verlust würde eine hochkreative Phase einleiten. Vielleicht würde ich von nun an und für den Rest meines Lebens an jedem bedeutsamen Tag ein Foto von mir schießen und das ganze Konvolut pünktlich zu meinem achtzigsten Geburtstag in einer Ausstellung präsentieren: mein breites Kartoffelgesicht, wie es bei der Verleihung der Doktorwürde lächelt, bei der Beerdigung meiner Mutter weint und nachdenklich die erste von meinem Kind selbst zubereitete Speise kaut, dazu ein paar grenzüberschreitende Nahaufnahmen während des Orgasmus, um für größere Aufmerksamkeit zu sorgen, und so weiter. Aber dann machte ich das Foto, sah meine Tränensäcke und lud sofort FaceTune runter. Im echten Leben fühlten die dunklen Halbkreise sich richtig an. Wenn ich mich im Spiegel sah, dachte ich: Das ist mal eine Achtundzwanzigjährige mit krasser Lebenserfahrung. Doch auf den Fotos, das wurde mir schnell klar, wollte ich vor allem heiß aussehen.
Jon endgültig aus dem Haus zu haben, war eine Erleichterung, nicht weil ich mich ohne ihn besser oder ruhiger gefühlt hätte, sondern weil die zwei Wochen zwischen »Ich ziehe aus« und »Ich habe einen Transporter gemietet« die längsten und zähesten meines Lebens waren. Wir lebten einen absoluten Widerspruch: An einem Tag schlichen wir auf Zehenspitzen umeinander herum und redeten so befangen miteinander wie zwei neue Kollegen beim Betriebsausflug, am nächsten rutschten wir in die alten Gewohnheiten zurück, küssten uns zum Abschied, aßen vom Teller des anderen oder vögelten. Und immer, wenn uns so ein Ausrutscher passierte (alles war zu einfach, zu vertraut), fragte ich mich, ob wir die ganze Sache nicht einfach abblasen und als mehrmonatige schwierige Phase verbuchen sollten. Aber dann kam er eines Abends mit mehreren Kartons nach Hause, und wir mussten entscheiden, wem welche Platten gehörten und was aus dem Schrottsofa werden sollte, das wir vor nicht mal einem Jahr gekauft hatten. Die Garantie auf das unbequemste Sofa der Welt hatte unsere Ehe überdauert.
Wir hatten es nicht kommen sehen, das beteuerten wir beide. Wir hatten keins dieser großen Probleme, die für gewöhnlich zu einer Trennung führen. Wir hatten ein paar kleinere, klar: Abgesehen davon, dass ich im Bett aß, war meine Stimme nicht für geschlossene Räume gemacht, außerdem hielt ich mich nicht an sein Kühlschrank-Ordnungssystem. Er war launisch und wollte, dass wir beide mit dem Joggen anfingen. Wir waren nicht wirklich unglücklich, eher unzufrieden … bis wir dann plötzlich wahnsinnig unglücklich waren, nicht mehr miteinander lachen konnten, keinen Sex mehr hatten und der eine im Thairestaurant keine Bestellung aufgeben konnte, ohne dass der andere ihm einen Blick zuwarf, als wollte er fragen: Wer bist du? Wer war diese fremde Person, für die wir uns mit neunzehn beziehungsweise neunzehneinhalb entschieden hatten? Es war nicht unbedingt so, dass wir uns gegenseitig hassten, dennoch mussten wir uns fragen, ob wir für den Fall, dass der andere ohne Vorwarnung starb – eines natürlichen Todes vielleicht, oder durch einen schrecklichen Unfall, was natürlich nicht schön wäre, es wäre eine Tragödie, aber nur mal angenommen –, ob das Leben dann vielleicht einfacher wäre. Und eines Abends war mir beim Essen die Frage herausgerutscht: »Funktioniert das noch mit uns?« Keiner von uns hatte eine Antwort, und das war anscheinend Antwort genug.
Es hatte fast zehn Jahre lang funktioniert, oder wenigstens schien es so. Jon und ich hatten uns in der Uni kennengelernt und ineinander verliebt. Überraschenderweise erwies sich sein fröhlicher Nihilismus als die perfekte Ergänzung zu meiner grüblerischen Art. Anfangs waren wir nur befreundet (sehr wichtig, das sagen alle) und erlebten ein aufregendes promiskes erstes Jahr, bevor wir dann irgendwann im dritten Semester merkten, dass wir uns nicht nur gut verstanden, sondern auch irre geil aufeinander waren. Wir dockten an Mund und Genitalien an und ließen erst nach dem Studium wieder los. Wir teilten gewisse Vorlieben und brachten einander zum Lachen, und unsere Streitereien verliefen nicht dramatischer als die unserer gleichaltrigen Freunde. Wir unternahmen ein paar kleinere Reisen und stellten einander unseren Eltern vor. Am Ende zogen wir zusammen – wir kannten uns gerade lange genug, und keiner von uns beiden hätte sich eine eigene Wohnung leisten können. Eine Wand strichen wir mit Tafelfarbe. Es gab unpassende Geburtstagsgeschenke, kleinliche Eifersüchteleien und den einen oder anderen minder schweren Betrug, meistens aber Behaglichkeit und müheloses Einverständnis. Und nachdem wir sechs Jahre lang bewusst Zeit zu zweit verbracht, ein Haustier angeschafft und die Zubereitung einer anständigen Carbonara gelernt hatten, gab es für uns anscheinend nichts mehr zu tun. Jon fragte: »Was meinst du, Maggie?«, und ich sagte: »Ja, okay«, und dann heirateten wir. Weil alle anderen es taten und weil die Tatsache, dass nichts besonders schieflief, sich so anfühlte, als laufe alles genau richtig.
Offiziell verheiratet zu sein, hatte für mich immer etwas Surreales. Wenn ich im Gespräch mit anderen Menschen »mein Mann« sagte und sie die Augenbrauen hochzogen, dachte ich: Ja, genau, wie merkwürdig. Jon hingegen fand es kein bisschen merkwürdig. Nicht, dass er besonders romantisch veranlagt war, aber seine Eltern waren die letzten auf dieser Welt, die immer noch verliebt waren, und so besaß er überdurchschnittlich viel Vertrauen in die Institution Ehe. In seinen Augen war sie das natürliche Resultat einer längerfristigen Liebe. Als wir in unserem italienischen Billighotel in die Flitterwochensuite eincheckten, hatte die gesprächige amerikanische Rezeptionistin gekreischt: »O mein Gott, Sie sind ja eine richtige Kinderbraut!« Jon hatte gelacht, ich wurde seltsam verlegen. Das Ganze war irgendwie lächerlich. Kannte ich denn nicht die Statistiken? Glaubte ich wirklich, unsere Ehe würde halten, während so viele andere scheiterten? Vielleicht war mir die Situation auch deswegen so peinlich, weil ich es tatsächlich glaubte. Ich hätte meinem jüngeren Ich am liebsten auf die Schulter getippt und gesagt: Schätzchen, wenn es dir jetzt schon peinlich ist …
Am ersten Morgen ohne ihn wachte ich weinend auf. Mein Kopfkissen war nass, aber statt es umzudrehen oder den Bezug zu wechseln, rollte ich mich zur Seite und plumpste zu Boden. Selbst wenn wir alles so freundschaftlich wie möglich regeln, dachte ich, wird es einfach nur furchtbar sein. Selbst wenn wir einen zivilisierten Umgang pflegten, niemals übereinander lästerten und keinen Sex mit dieser einen Person von der Arbeit hätten, auf die der andere immer so eifersüchtig gewesen war. Selbst wenn wir darauf verzichteten, rachsüchtig verführerische Fotos in den sozialen Medien zu posten oder exzessiv über unser aufregendes Singleleben zu twittern, würde es uns für die nächsten Jahre schlecht gehen, vielleicht sogar für immer. Wenigstens fühlte es sich in dem Moment so an.
Ich legte großen Wert auf eine einvernehmliche Trennung. Nachdem wir seine Sachen in den Kartons verstaut hatten, einigten wir uns darauf, einander wohlgesonnen zu bleiben und das zu ehren, was wir einander bedeuteten (oder bedeutet hatten). Wir einigten uns auf eine gemeinsame Sprachregelung für unseren Freundeskreis – »Wir haben uns auseinandergelebt«, was ebenso zutreffend war wie nichtssagend – und versprachen, den Kontakt zu halten, wenigstens in der ersten Zeit. Inzwischen war Jon seit vierundzwanzig Stunden weg, und wir hatten beide schon mehrere Nachrichten verschickt, meistens Abwandlungen von »Wie geht es dir?«, »Tut mir leid, dass es so gekommen ist« und »Hast du es deinen Eltern schon gesagt?«. Ich konnte mir gut vorstellen, dass wir nach einer Weile zu der Sorte von Geschiedenen gehören würden, die zur Geburtstagsparty des jeweils anderen erscheinen, für eine höfliche Anzahl Drinks bleiben, den neuen Partner umarmen und sich vom Acker machen, bevor es unschön wird. Aber jetzt in dem Moment beschäftigte mich vor allem, wie sehr wir es vermasselt hatten, wie still die Wohnung ohne ihn war und wie wenig ich am Wochenende vorhatte.
Ich blieb bis nachmittags neben dem Bett liegen. Es fühlte sich nicht gut an, war aber anscheinend genau das, was man tat, wenn die eigene Ehe in die Brüche gegangen war. Im Film legen die meisten Leute sich nach einer Trennung auf den Boden, und dann betrinken sie sich, ziehen sich eigenhändig und am eleganten Schalkragen aus dem Tief heraus und lernen, sich selbst zu lieben, vorzugsweise in einem gemieteten Strandhaus, das einem charmanten, gutaussehenden Mann in der zweiten Lebenshälfte gehört, der erst seit kurzem verwitwet ist, und obwohl er seine verstorbene Frau natürlich immer noch liebt, sieht es danach aus, als wäre er langsam bereit, sich auf etwas Neues einzulassen, und als könntet ihr euch gegenseitig helfen, den seelischen Schmerz zu überwinden. Eine Scheidung im Film kommt nicht ohne Rosenkrieg und Anwälte aus, nicht zuletzt ist sie deswegen so schmerzhaft, weil die Kinder es den Eltern übel nehmen und man sich nicht entschließen kann, wer das Haus bekommt, das große, schöne Haus, das man jahrelang zusammen eingerichtet hat, in dem die gesamten Ersparnisse stecken und in dem man mehrere Kinder oder mindestens einen großen Hund aufgezogen hat. In den Filmen bist du Diane Lane (oder Keaton oder Kruger), eine schöne Diane mittleren Alters, die freiberuflich tätig ist und sich mit gutem Weißwein auskennt. Du bist nicht gezwungen, wochenlang mit deinem Ex unter einem Dach zu wohnen, weil du dir die renovierungsbedürftige Zweizimmerwohnung allein nicht leisten kannst. In der Regel handelt es sich bei dem Paar im Film auch nicht um eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und einen Werbetexter, deren größter finanzieller Aktivposten diese eine Freundin ist, die regelmäßig Gratishandys von der Arbeit mitbringt. Und ganz bestimmt bist du keine Achtundzwanzigjährige, die Geburtstagspartys mit dem Dresscode »Jimmy-Buffett-Schlampen« plant.
Aber da war ich nun, in halber Bauchlage, und fragte in den Gruppenchat, wie viel ein Banner mit dem Aufdruck »Parrothead Pussy« wohl kosten würde und ob ein Kuchen mit Tequilageschmack Clives Backkünste überstieg. Alle waren sich einig, dass er so etwas hinkriegen würde, mehr noch, er würde damit seinem Erzfeind eins auswischen, dem gutaussehenden Fernsehkoch, der neulich demonstriert hatte, wie man Maiskolben »kocht«. Amirah hatte einen Partybus mit abwischbaren Sitzen ausfindig gemacht. Normalerweise wird er wohl weniger für Geburtstagsfeiern als für Gangbangs vermietet, aber er kostet fast hundert Dollar weniger als der andere … Lauren, das Geburtstagskind, schrieb zurück: Vielleicht sollten wir es nicht zu kompliziert machen und das gesparte Geld für Alkohol ausgeben. Alle waren ihrer Meinung.
Im Gruppenchat schrieben vier meiner engsten Freunde von der Uni mit: Amirah, eine fahrige, hochemotionale Krankenpflegerin, die ich im Wohnheim kennengelernt hatte, Clive, ein großer, eleganter Schwuler, der sich wegen so banaler Angewohnheiten, wie Taxifahrten bar zu bezahlen, selbst als »chaotisch« beschrieb, und die beiden Laurens. Die eine Lauren war nah am Wasser gebaut, die andere behauptete, sie habe in ihrem ganzen Leben nur ein einziges Mal geweint, nämlich als McDonald’s die Pizza von der Karte nahm. Der Einfachheit halber nannten wir Erstere die »emotionale Lauren«.
Ich hatte der Chatgruppe noch nicht gebeichtet, dass Jon ausgezogen war. Alle wussten, dass wir über eine Trennung nachgedacht hatten und dass es in der letzten Zeit nicht so gut gelaufen war, aber nun konnte ich mich offenbar nicht dazu durchringen, die entscheidenden Worte – er ist weg – ins Handy zu tippen. Wahrscheinlich glaubte ein Teil von mir immer noch, wir würden trotz allem wieder zusammenkommen, trotz der Tatsache, dass er ausgezogen war. Ich konnte mir uns beide einfach nicht dauerhaft getrennt vorstellen. Bei wem sollte ich mich zukünftig über das langsame WLAN beschweren? Wer würde ihn an den Geburtstag seiner Mutter erinnern? Von wem sollte ich mir meine vielen kleinen Alltagsentscheidungen absegnen lassen? Und was war mit den Sonntagen, was würden wir sonntags tun? Ich stellte es mir so vor, dass er irgendwann zurückkam. Wir würden beide sagen: »War echt anstrengend, ha, ha«, uns anschließend bekiffen und Das große Backen anschauen, eine Sendung, die nach meiner Einschätzung gut sechzig Prozent aller Ehen zusammenhält.
Ich hatte es ihnen auch deswegen noch nicht gebeichtet, weil ich mir so unglaublich dumm vorkam. Es ist einfach zu beschämend, seine Hochzeit groß zu feiern und sich so kurz darauf wieder scheiden zu lassen. Unsere Beziehung hatte länger gedauert als unsere Ehe, viel länger sogar. Na und? Dass der große Tag, an dem man im Mittelpunkt steht und alle zum denkwürdigen Augenblick gratulieren, dieser Bis-dass-der-Tod-euch-scheidet-Tag, für den man aufwändige Vorbereitungen, Kämpfe mit der Familie und der Sitzordnung in Kauf genommen und Tausende von Dollar bezahlt hatte, am Ende nicht mehr war als ein sehr teures Tinder-Fotoshooting für alle Singles im Freundeskreis – das ist … nun ja, suboptimal. Und du selbst kannst die Fotos nicht einmal für Tinder benutzen, erstens weil du keine Ahnung hast, wie Tinder funktioniert, und zweitens weil du auf allen ein Hochzeitskleid trägst.
Anstatt eine Beichte abzulegen, zog ich eine Show ab. Ich erzählte Geschichten von den lustigen Hunden, die ich getroffen hatte, und von dem Check-up neulich, bei dem ich der Ärztin Märchen über meinen gesunden und aktiven Lebensstil erzählt hatte, während sie verwundert den orangeroten Bereich der BMI-Tabelle auf ihrem Klemmbrett betrachtete. Oje, Maggie hat mit BMI angefangen, schrieb Lauren, wir werden heute Nacht noch hier sitzen. Clive erzählte, er habe vor kurzem beschlossen, dass das Kürzel eigentlich für »Beautiful-Man-Index« stehe, was einleuchtete, schließlich war sein Wert ziemlich hoch. Die emotionale Lauren berichtete von einem neuen Podcast, der unser Leben verändern werde. Amirah schickte einen Link zu einem Video von diebischen Möwen und trat damit eine Diskussion über kriminelle Wassertiere los. Wir zogen über gemeinsame Bekannte her und jammerten leidenschaftlich über die Ungerechtigkeit der Welt und das verlogene Social-Media-Profil eines Möchtegern-Promis der Torontoer Szene.
Irgendwann würde ich es ihnen sagen müssen, so viel war klar, aber ich wollte auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ich würde mich ihren Fragen erst stellen, wenn ich selbst ein paar Antworten hatte. War ich bereit für das Leben als Single? Wo sollte ich wohnen? Wie würde ich mit dem Geld auskommen? Ich hatte ein bisschen was zurückgelegt, klar, aber Jon hatte viel mehr Geld – durch seinen Job, seine Familie, seine klugen Finanzstrategien. Er wusste, wie man Geld spart und anlegt, und dass man das langersehnte Freiberuflerhonorar nicht gleich wieder für gewagte Crop-Tops oder Delikatesskatzenfutter ausgibt. Er hatte einen Teil meiner Miete übernommen sowie alle Einkäufe, und wenn wir Urlaub machten, bezahlte er alles außer meinem Flug, den ich bezahlen »durfte«, wie ein Kind nach dem Thanksgiving-Essen beim Tellerabräumen helfen »darf«. Ein paar Wochen vor unserer Hochzeit hatte ich gewitzelt, dass es langsam Zeit würde für einen Ehevertrag. Was, wenn wir uns trennten und er die Hälfte von allem beanspruchte? Woraufhin er antwortete, ich könne die achtzig Dollar gern behalten. (Bis vor kurzem war das eine lustige Anekdote gewesen.)
Tage vergingen, und ich spukte herum wie eine umgekehrte Miss Havisham. Ziellos schlich ich von einem Zimmer ins andere, und während ich mich in der stillen, leeren – na ja, halb leeren – Wohnung umsah, wurde mir bewusst, dass meinem Mann (»Exmann«) der Fernseher, die Bilder an den Wänden und die Küchenstühle gehört hatten, und auch das Ding, auf das wir unsere Füße legten, wenn wir auf dem abscheulichen Sofa saßen. Ehrlich gesagt gehörte fast alles in der Wohnung ihm. Obwohl ich ihn aufgefordert hatte, sein Eigentum mitzunehmen, hatte er vieles davon zurückgelassen, und jetzt war die Wohnung zwar funktional, aber seltsam lückenhaft eingerichtet. Es gab einen zu großen Kleiderschrank ohne Schuhregal, eine Besteckschublade ohne große Messer und einen Küchentisch ohne Sitzgelegenheit. Ich ließ mich auf das unerträglich harte Sofa fallen, stellte meinen Drink dort auf den Boden, wo vorher der Barwagen gestanden hatte, und weinte mir die Äuglein aus.
Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden, woran ich denken oder wie ich meine Zeit verbringen sollte. Jeder einzelne Gegenstand schien vor Erinnerungen nur so zu triefen. Der Toaster war ein Hochzeitsgeschenk, also aß ich das Brot bei Zimmertemperatur. Weil der Anblick der Kühlschranktür – Quittungen, Einkaufszettel, Hinweise zur richtigen Lagerung von Bananen und Eiern, Pläne zur Anschaffung eines Fahrradschlosses – zu schmerzhaft war, trank ich meinen Kaffee ohne Milch. Das eingerahmte Foto im Badezimmer klebte ich mit einem Blatt Papier ab. Ich war noch nicht bereit, es herunterzunehmen, doch ansehen wollte ich es auch nicht. Ein von unserer Verlobungsfeier übriggebliebenes Banner glitzerte einsam über der freien Fläche, an der zuvor ein Bild von Jon gehangen hatte. LÜCKWUNSCH, stand da in goldenen Lettern. Das G war irgendwann heruntergefallen, aber wir hatten das Banner trotzdem behalten, irgendwie fanden wir es so noch besser. Es jetzt zu sehen, war unfassbar deprimierend.
Doch ich machte auch ein paar positive Entdeckungen: Nun, da ich nicht mehr gezwungen war, unsere beiden Einrichtungsstile in Einklang zu bringen, konnte ich mir eingestehen, dass ich fast keins der Objekte mochte, die mein Mann in die Wohnung mitgebracht hatte. Alle Sachen, bei denen ich gedacht hatte, das müssen wir irgendwann mal ersetzen, gehörten ihm oder waren ein Kompromiss, wobei wir Kompromiss als »ein Objekt, das wir beide gleichermaßen hässlich finden« definiert hatten. Und nun waren die meisten dieser Gegenstände verschwunden. Meine wenigen Besitztümer ließen die Wohnung fast ärmlich erscheinen. Ich hatte keine großen Badetücher mehr, doch immerhin waren die Wände jetzt frei von Konzertplakaten, in der Küche standen keine Schnapsgläser mit Werbung mehr herum, und im Bad lag keine leicht angeschimmelte Holzmatte, die er einmal bekifft bei eBay bestellt hatte. Plötzlich hatte ich jede Menge Platz für meinen Kleinkram. Ich konnte die Duftkerze anzünden, die laut Jon »irgendwie komisch« roch, und Popmusik aus den Neunzigern hören, die er dumm und einfallslos fand. Aber natürlich reichten eine Tabak-Wacholder-Duftkerze und die Backstreet Boys nicht an das Gefühl heran, geliebt zu werden.
Alle Artikel und Foren, auf die ich durch verbissenes Googeln gestoßen war (Scheidungstipps; junge Ehe gescheitert; zum ersten Mal allein), hatten mich auf die Schlaflosigkeit vorbereitet, trotzdem war mir nicht klar gewesen, wie lang so eine Nacht sich anfühlen konnte. Eine weitere Überraschung war die Tatsache, dass ich weiterhin Essen runterbekam. Man hatte mir immer weismachen wollen, dass Liebeskummer den Appetit verdirbt. Als Teenager hatte ich einer zukünftigen Trennung geradezu entgegengefiebert (und eine Trennung war unvermeidlich, das wusste ich aus Teenie-Schmonzetten über gutaussehende Vampire und ihre minderjährigen Freundinnen). Sie würde dafür sorgen, dass ich nichts mehr aß und auf das wunderschönste abmagerte. Ich wäre dünn und von der Welt verkannt und absolut glücklich darüber. Einen Freund zu haben, ihn dann zu verlieren und mehrere Kleidergrößen noch dazu, möglicherweise so viele, dass ich in diese verfluchten Poloshirts passte, die Abercrombie in muffigen parfümierten Höhlen in der Mall anbot – damals konnte ich mir nichts Besseres vorstellen.
Doch leider war ich in einem überaus wohlwollenden Elternhaus aufgewachsen, das mir ein besorgniserregend stabiles Selbstwertgefühl eingetrichtert hatte, außerdem besuchte ich eine kunstorientierte Highschool, wo ein Großteil meiner schlummernden sexuellen Energien in überdrehte Theaterstücke über oralfixierte Frauen mittleren Alters umgeleitet wurde. Und so traf ich mich nie mit Jungs und blieb drall und glücklich, bis mir ungefähr in der zwölften Klasse die Tatsache, immer noch nicht flachgelegt worden zu sein, schier das Herz brach und ich in kürzester Zeit und ohne große Anstrengung fünfundzwanzig Kilo abnahm. Ich hatte nichts weiter dafür getan, als auf feste Nahrung zu verzichten und meine Kalorienaufnahme lückenlos zu überwachen und zu dokumentieren. Alle freuten sich für mich, bis ich eines Tages im Matheunterricht in Ohnmacht fiel, weil ich in der Mittagspause nichts gegessen hatte als ein Wassereis.
Die Wahrheit ist nämlich die: Wenn man auch nur mit einem bisschen Übergewicht in die Essstörung einsteigt, merken die anderen erst etwas, wenn die Phase »Was wäre, wenn ich nur noch zweimal täglich etwas zu mir nehme, und auch dann nur Suppe?« erreicht ist. Ich musste Kopfschütteln und Vorträge über ausgewogene Ernährung über mich ergehen lassen und wurde zu einem Hypnotiseur geschickt, der mir riet, ich solle mir einfach vorstellen, ich wäre auch im Badeanzug schön, und schon war ich geheilt. Scherz. In Wirklichkeit verliebte ich mich und konnte die Sache mit dem Essen vorübergehend beiseiteschieben. Zu der Zeit war ich eher rundlich und gehörte zu der Sorte Frau, die herablassend als »wohlgeformt«, »kurvig« oder noch häufiger als »stark« bezeichnet wurde, ein Wort, das unter der euphemistischen Last praktisch zusammenbrach. Wenn ich gestresst war und zu viele Frauenzeitschriften gelesen hatte, oder wenn eine viel dünnere Freundin über den Umfang ihrer Oberschenkel gejammert hatte, merkte ich, wie ich wieder still und heimlich ins Kalorienzählen abrutschte – ich aß ein Ei, und eine innere Stimme sagte: siebzig. Andererseits hat wohl niemand ein völlig ungestörtes Verhältnis zu Essen und Sport, zumindest niemand, dessen Jugend in jene Zeit fiel, in der die Titelgeschichte jeder Supermarktzeitung eine Variation von »Auch dünne Frauen haben Cellulite« war. Solange ich keine täglichen Kalorientabellen führte wie als Teenager, hielt ich mich für mehr oder weniger gesund.
Trotzdem war die Versuchung plötzlich groß, die alte Essstörung zu reaktivieren und wie eine dieser Romanheldinnen zu leben, deren Knochen sich deutlich unter der Haut abzeichnen – alle Freundinnen machen sich Sorgen um sie, und in ihrem Leid sieht sie absolut hinreißend aus. »Irgendwie ließen die dunklen Schatten ihre großen Augen nur noch blauer erstrahlen. Maggie war zu traurig, um zu essen, denn zu viele Leute wollten mit ihr schlafen«, etwas in der Richtung. Auf keinen Fall würde ich die einzige Frau auf dem Planeten sein, deren Gefühlswelt erschüttert wird, ohne dass ihre Schlüsselbeine dramatisch hervortreten.
Doch anscheinend war ich in dem Bereich tatsächlich geheilt und weiterhin entschlossen, meinem Körper Gutes zu tun, und so blieben mein weicher Hintern und ich wohlgenährt. In den langen, zähen Stunden der ersten Woche ohne Jon stellten die Mahlzeiten die einzige Abwechslung dar. Ich kramte in den Küchenschränken und förderte längst vergessene Currypasten und »für den Notfall« gebunkerte Instantnudeln zutage. Wann immer ich mich über ein tröstliches Pfannengericht hermachte oder eine fetttriefende hausgemachte Quesadilla anstach, hatte ich David Attenboroughs ruhige Erzählstimme im Ohr: »Selbst in den finstersten Zeiten geht das Leben … weiter.« Ich wusste, irgendwann würde mir das Essen ausgehen, eine belastende Vorstellung, konnte ich mir doch nicht vorstellen, das Haus zu verlassen und Nachschub zu besorgen.
Aber die schlaflosen Nächte waren nicht das größte Problem, außerdem schläft heutzutage sowieso niemand mehr gut. Die Welt kollabiert, und wir liegen da und halten uns ein leuchtendes Display vors Gesicht, um nachzuschauen, was der Präsident nun schon wieder gesagt und welcher Exfreund einen neuen Haarschnitt hat. Wenn ich mich wirklich nach Ruhe sehnte, könnte ich immer noch Alkohol trinken oder Schlaftabletten nehmen. Jon hatte mir erzählt, dass er vor seinem Auszug welche genommen hatte, was ich allerdings auf das unbequeme Sofa schob. Als er ging, bot er mir eine an. Ich wollte zugreifen, doch dann dachte ich, es wäre eine bessere Antwort auf die Frage, wie ich mich fühle, wenn ich ablehnte, und so lag ich nachts meistens wach oder schaute britische Thrillerserien auf Netflix.
Früher hatte ich diese Sendungen viel zu unheimlich gefunden – wir (ich) lebten in einer Erdgeschosswohnung mit klapprigen Fensterrahmen, außerdem neigten wir (ich) zu leichtem Schlaf und Schreckhaftigkeit. Doch nun fand ich die Serien beruhigend. Sie folgten klaren Mustern und hatten eine Moral. Ja, der gestörte Ermittler trank vielleicht zu viel und betrog seine Frau, aber immerhin war er kein pädophiler Mörder, der in einer Art Horror-Bunker in Swansea hauste. Am Ende wurde der pädophile Mörder gefasst, und die leidgeprüfte Kollegin musste zugeben, dass der Detective Inspector seinen Job ziemlich gut gemacht hatte. Es war schön zu wissen, dass der Unterschied zwischen schuldig und nicht schuldig klar erkennbar war. Es war schön, David Tennant fluchen zu hören. Thriller haben im Übrigen auch viel von ihrer Bedrohlichkeit verloren, seit mir klar wurde, dass der Mörder immer derjenige ist, der am langsamsten spricht.
Wenn ich doch einmal eingeschlafen war, wachte ich mitten in der Nacht auf und fühlte mich wie erschlagen und orientierungslos. Ich tastete im plötzlich riesengroßen Bett herum, suchte nach Jons warmem, vertrautem Leib und fand … nichts. In solchen Momenten packte mich die Angst, ich riss die Augen auf und versuchte, mich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Manchmal brach mir der Schweiß aus, so verwirrt, verängstigt und aufgebracht war ich. Hatte ich eine Textnachricht übersehen? Wir hatten eine Vereinbarung! Dem anderen mitzuteilen, dass man später nach Hause kommt, gehört zu den wichtigsten Dingen in einer Ehe! Und dann fiel es mir natürlich wieder ein.
In diesen Moment fühlte ich mich der Reihe nach dumm, traurig, enttäuscht und zuletzt bestätigt, weil ich mich daran erinnerte, in Joan Didions Das Jahr des magischen Denkens etwas ganz Ähnliches gelesen zu haben. Anschließend war ich peinlich berührt, mich auf Joan Didion berufen zu haben, und dann wieder bestätigt, weil es im Stillen vielleicht doch einige Ähnlichkeiten zwischen uns gab, dann noch mal traurig und zuletzt nur noch müde. Nein, ich war nicht die unglaublich glamouröse Stimme einer ganzen Generation, und ich hatte auch nicht die Liebe meines Lebens verloren. Ich hatte ja nicht einmal ein Auge für den gerade angesagten Hosenschnitt, und mein größtes literarisches Werk war meine unvollendete Doktorarbeit über die »gelebte Geschichte der Objekte« im Theater der frühen Moderne. Selbst wenn sie fertig geworden wäre, hätte niemand sie gelesen. Ich hatte meinen Mann nicht verloren, sondern verlassen. Besser gesagt hatte ich ihm vorgeschlagen, aus unserer Wohnung auszuziehen, und er hatte den Vorschlag überraschend schnell in die Tat umgesetzt. So waren wir uns wenigstens zum Schluss noch mal in einer Sache einig.
Und damit war unsere Ehe vorbei, sechshundertacht Tage nach der Hochzeit. Im einen Moment hatten wir uns noch geliebt, im nächsten war unsere Liebe schal geworden, und plötzlich kannten wir anscheinend nur noch zwei Umgangsformen: entweder Schweigen oder Streit. Wenn wir nicht gerade aufgesetzt unbeschwerten Small Talk machten, führten wir Hunderte, Tausende Streitgespräche, verdrehten die Augen, seufzten oder stichelten wegen immer derselben Themen:
Berufliche Zufriedenheit, mangelnde
Beziehungsarbeit, Definition von
Wer das letzte Kaffeepulver verbraucht hatte
Wer die letzten drei Stromrechnungen bezahlt hatte
Wer hier eigentlich wem gegenüber herablassend war
Ob es akzeptabel oder sogar völlig normal ist, bis vier Uhr morgens aufzubleiben und online mit frustrierten europäischen Jugendlichen zu zocken
Unsere Eltern, unsere Freunde in der Elternrolle, das Schreckgespenst von uns beiden in derselben
Pornografiekonsum
Ob Pornografie ein feministisches Projekt sein kann
Bedeutung des feministischen Porno-Projekts für den PornHub-Premium-Account eines Heteromannes
Zehennägel, Länge und Ablageorte derselben
Ob ein Wegzug aus Toronto dasselbe ist wie »aufgeben«
»Barcelona«, Aussprache von
Warum war das Schlafzimmer immer noch lila, wir sind vor Jahren eingezogen und haben gesagt, wir würden es streichen
Dass er meinen Beruf einmal versehentlich mit »Leerbeauftragte« angegeben hatte, was eigentlich völlig harmlos war, schließlich kommt das Wort der »Lehrbeauftragten« schon ziemlich nahe, aber weil ich sowieso schon die meiste Zeit gekränkt war, fasste ich es als beleidigende Anspielung auf meine stockende Karriere auf, und weil ich an dem Tag hungrig und müde war und PMS hatte, fing ich in der Öffentlichkeit an zu weinen, und weil wir einander überhatten, sagten wir gemeine Sachen, die wir nicht so meinten, und reagierten verletzt, was wir in der Tat so meinten, und am Ende dauerte die ganze Angelegenheit einen ganzen Tag länger als die vier oder fünf Sekunden, die es gebraucht hätte, die Sache richtigzustellen und drüber hinwegzugehen, und ich konnte nie zugeben, dass es meine Schuld war, nicht mal, als er sich später entschuldigte.
Eine unspektakuläre Trennung. Keine Affären, kein großer Knall. Bloß mehrere kleinere Brandherde, die wir nicht löschten. Stattdessen saßen wir vor unseren Kaffeebechern wie der Zeichentrickhund aus dem Internet: This Is Fine.
Und nun war ich allein. Der Juniabend war warm, ich aß Brot mit Butter und trug dabei meine Hochzeitsdessous, weil meine restliche Unterwäsche schmutzig war. Ich streute Salz auf ein Stück Baguette und sprach das Wort »Scheidung« laut aus, um herauszufinden, wie es sich anfühlte, oder vielleicht wollte ich auch nur theatralisch sein. Ich zupfte an meinem teuren Spitzentanga und fragte mich – wie ich es seit einer Woche fast stündlich tat –, ob das Ganze vielleicht ein riesengroßer Fehler war. Als Paar durch die Welt zu gehen, war so viel einfacher gewesen – alle Kosten und XL-Sweater zu teilen und jemanden zu haben, der einem in der Warteschlange in der Bank Gesellschaft leistet.
Vor kurzem hatten Jon und ich begonnen, uns mit Paaren anzufreunden und zu viert oder sechst essen zu gehen. Wir schäkerten über kleine Teller hinweg und fuhren dann nach Hause und hatten eingespielten Sex in der Annahme, dass Ben und Esther wahrscheinlich gar keinen mehr hatten. Die anderen Paare waren meistens ein bisschen älter als wir und kannten Jon von der Arbeit, und nun würde er sie behalten, wie er unsere Geschirrtücher behalten hatte. Wahrscheinlich würde ich nie wieder zu einer zwanglosen Dinnerparty eingeladen werden. Ausgerechnet jetzt, in der Rosenkohl-Zeit! Ich musste kichern und wünschte mir, ich könnte Jon den Witz schicken. Zwar hatte ich mein tägliches Lebenszeichen schon von mir gegeben, aber nichts war befriedigender, als ihn zum Lachen zu bringen.
Die ganze Situation kam mir vor wie ein Scherz, als könnte einer von uns jeden Moment anrufen und mit tränennassen Wangen sagen: O mein Gott, du hättest dein Gesicht sehen sollen! Ich hasste Streiche dieser Art, Jon liebte sie. Nach unserer Verlobung hatte er ein paar Mal so getan, als müsste er sterben, wenn ich mich anschickte, das Zimmer zu verlassen, und wenn ich zurückkam, lag er quer auf dem Sofa ausgestreckt oder war am Küchentisch zusammengesackt, die dunklen Augen leer und leblos. Ich sagte ihm, ich fände das gruselig, woraufhin er entgegnete, im besten Fall ende eine Ehe damit, dass einer den anderen tot auffindet. Aber weil Frauen in der Regel ihre Ehemänner überleben und er seinen Körper eher nachlässig behandelte (seine Worte), war es garantiert so, dass ich ihn finden würde und nicht umgekehrt. Auf diese Weise, erklärte er mir, würde sein Tod – vorgeblich einer der schlimmsten Momente meines Lebens – zu etwas Lustigem und Verbindendem werden, zu einer Art Insiderwitz. Niemand, dem ich je davon erzählt habe, sah es ähnlich, aber ich fand es trotzdem süß.
Im Sommer traurig zu sein, ist einfach nur schrecklich.
Google-Suchanfragen, 10. Juni
dunkle augenringe blasse haut
koreanische hautpflegeroutine weniger schritte
sichtbare adern
natürliche schlafmittel
haut wirkt grau?
instagram storys ansehen anonym
kate bush nicht bei itunes
kate bush this woman’s work
kate bush youtube exportieren
kanadisches scheidungsrecht was
verursacht schlafen in bauchlage falten
juristische definition »nicht vertretbar«
bell hooks pdf
jacquard hosenanzug
botox gegen doppelkinn
bill hader scheidung
bill hader in t-shirt
bill hader warmes lachen
normaler mensch heiratet prominenten
gua sha videos
was ist »jacquard«
wie freunde bleiben nach trennung
brust übungen
tinder regeln
einwohner toronto
männliche einwohner toronto
lcbo bloor street ecke ossington öffnungszeiten
risottorezept leicht
arborio-reis ersatz
parmesan abgelaufen noch ok
24 stunden lieferservice toronto
getränke lieferservice toronto
was ist tiktok
kate bush this woman’s work karaoke
tiktok wie löschen
Den ersten Monat verbrachte ich wie in einem Nebel. An einem typischen Tag wachte ich gegen eins auf, blieb im Bett liegen und masturbierte lustlos, während im Hintergrund Die letzten fünf Jahre lief (eine Aufnahme der ersten Off-Broadway-Produktion). Nachmittags versuchte ich zu arbeiten, gab es nach einer Weile auf und postete stattdessen Instagram-Storys mit vagen Anspielungen auf meinen Gefühlszustand. Und irgendwann dazwischen wurde ich neunundzwanzig.
Nur aus dem Grund vertraute ich mich schließlich meinen Freunden an. Unsere Gruppe ließ es zu Anlässen jeder Art krachen, und ein neunundzwanzigster Geburtstag durfte da keine Ausnahme sein. Wir hatten schon vor Monaten beschlossen, ihn mit einem Ausflug zum Nacktbadestrand auf den Toronto Islands zu feiern. Wir würden Kuchen und Cocktails mitnehmen und sonst nichts. Doch als im Gruppenchat über die Bedeutung von Sonnenschutz und die Vorteile privater Wassertaxis diskutiert wurde, hielt ich dem Druck nicht länger stand. Ich muss das verschieben, schrieb ich, Jon ist ausgezogen … ich glaube für immer? Nach mehreren bedrückenden Minuten Funkstille schrieb Clive: Bin in einer halben Stunde da.
Ich ließ mich ins Bett zurücksinken und starrte den Wasserfleck unter der Decke an, bis ich auf der Vortreppe eilige Schritte hörte. Ich stand auf, strich mir übers Haar und stellte mich an die Tür, und ganz kurz wollte ich ihn nicht hereinlassen. Er würde meine kahle Wohnung sehen, die leeren Fast-Food-Verpackungen, die Lücken im Bücherregal. Wenn ich es Clive zeigte, würde ich es anschließend auch den anderen zeigen müssen. Ich würde das Haus verlassen und draußen in der Welt sein müssen, ganz allein.
Ich fasste mir ein Herz und entriegelte die Tür.
»Auf einer Skala von eins bis zehn«, fragte er, »wie bereit wärst du, drüber zu lachen?«
Ich musste nachdenken. »Sechs?«
»Okay«, sagte er. »Über die Augenbrauen reden wir dann ein andermal.«
Clive und ich hatten uns im zweiten Studienjahr in der Uni-Theatergruppe kennengelernt. Angefreundet hatten wir uns bei einer The-Music-Man-Produktion »nur für Dicke«, wie er es nannte. Wir spielten zwei Verliebte. Wenn er ein paar Drinks zu viel hatte, rief er manchmal immer noch: »Madam Librarian!«, zog mich an sich und gab mir einen feuchten Kuss. Während wir am Küchentisch lehnten (ich musste unbedingt ein paar Stühle besorgen) und ich mir Bartfarbe in die Augenbrauen schmierte, versicherte Clive mir, ich würde schon bald wieder ganz die Alte sein.
»So was kommt vor«, sagte er. »Wenn du dich mit neunzehn auf alles festgelegt hättest, was dir damals gefiel, würdest du immer noch diese komische Weste tragen. Und rein statistisch gesehen sind kinderlose, unverheiratete Frauen die glücklichsten Menschen der Welt. Glückwunsch!« Er drückte meine Hände, als hätte unser Schülerteam gerade ein wichtiges Spiel gewonnen.
Sich so gleichgültig zu geben, war typisch für Clive. Er nahm nichts im Leben ernst, außer Kochen, seinen Job als Produzent gescripteter Reality-Shows und seinen Neujahrsvorsatz für das Jahr 2011 (»berühmt werden«), an dem er immer noch arbeitete. Als er den Vorsatz fasste (und möglicherweise, um ihn schneller umzusetzen), hatte er uns gebeten, ihn ab sofort Clive zu nennen statt Brandon, was sein eigentlicher Vorname war, und obwohl wir uns erst daran gewöhnen mussten, sahen wir alle ein, dass man stilvolle Brandons mit der Lupe suchen musste und die Änderung daher völlig in Ordnung ging.
Clive und ich teilten uns eine Tüte fettarmer geriffelter Chips und stießen auf den Beginn meiner »Schlampenphase« an, aber als unsere Gläser aneinanderklirrten, fing meine Unterlippe an zu beben, und er musste zurückrudern. Um mir Mut zuzusprechen, betonte er, dass selbstverständlich jede Schlampe ihr Leben in dem Tempo bewältigte, das für sie gut ist. Als sein Assistent ihn per Textnachricht darüber informierte, dass Scott Moir drauf und dran war, als Gastjuror der neuen Show abzuspringen, in der Eishockeyspielerinnen und Eiskunstläufer Zweierteams bildeten, musste Clive dringend los. Er versprach, am nächsten Tag wiederzukommen.
Etwa eine Stunde später war Amirah da und lenkte mich mit einem ihrer klassischen Arbeitsplatzdramen von meiner persönlichen Tragödie ab. Obwohl sie seit über einem Jahr glücklich liiert war, konnte sie es nicht lassen, ständig neue emotionale Affären mit Kollegen aus der Klinik anzufangen, die dann von ihr besessen waren. Der letzte dieser armen Schlucker war ein Pfleger namens Brian.
»Langsam wird es richtig schlimm«, sagte Amirah halb zerknirscht, halb begeistert. »Vergangene Woche hat er mir eine Playlist zusammengestellt. Er fragt mich ständig, ob ich sie mir schon angehört habe, aber für mich geht das wirklich einen Schritt zu weit.«
»Die Playlist anzuhören?«
»Ja«, antwortete sie ernst. »Wer weiß, was da alles drauf ist.«
Dass Amirah im C-Trakt für romantisches Chaos sorgte, wunderte mich kein bisschen. Sie sah einfach umwerfend aus, selbst in einem OP-Kittel, und sie war schnippisch auf diese Art, die Männer magisch anzieht. Als ich damals mein Wohnheimzimmer bezog, hatte sie sich schon im Raum gegenüber eingerichtet und war gerade dabei, neben dem Fenster ein Pussycat-Dolls-Poster aufzuhängen. »Haben die, die nicht Nicole heißen, überhaupt Namen?«, fragte ich, und sie sagte: »Vielleicht heißen sie alle Nicole.« So viel dazu.
»Wie haben deine Eltern es aufgenommen?«, fragte sie, nachdem wir Brians Playlist überflogen hatten (handgeschrieben auf schwerem Papier, und alle wichtigen Lyrics waren mit Textmarker angestrichen … ach, Brian!). Ich sagte ihr, dass sie damit so ähnlich umgingen wie ich, was bedeutete, dass wir kaum miteinander redeten. Meine Mutter hatte mir sofort angeboten, nach Toronto zu kommen und mich abzuholen; ich könne so lange bei ihr in Kingston bleiben, wie ich wollte, und sie würde mich so wie früher mit Selbstgebackenem aufpäppeln. Doch ich wollte bleiben, wo ich war. In gewisser Hinsicht war ich erleichtert, dass meine Familie – meine Mutter, mein Vater und meine Schwester Hannah, die jünger war als ich, aber viel weiser – in sicherem Abstand war und uns mehrere Autostunden trennten und dass sich das tatsächliche Ausmaß ihrer Sorge um mich nur in der täglichen Nachricht meines Vaters zeigte: Noch am Leben? j/n
Wer mich trösten wollte, sah sich mit einer unmöglichen Aufgabe konfrontiert. Zu viel Aufmerksamkeit und Fürsorge hätte ich womöglich als Mitleid aufgefasst, zu wenig als Beweis dafür, dass ich wertlos war und niemand etwas mit mir zu tun haben wollte. Ich erzählte Amirah, die perfekte Lösung (sofern man hier von perfekt sprechen konnte) bestünde für mich darin, dass alle von der anstehenden Scheidung wussten, ohne dass ich es ihnen erzählen musste. Außerdem wollte ich mich in einer Art Überdruck-Stressabbau-Kammer verkriechen und abwarten, bis ich wieder bereit wäre, unter Menschen zu gehen. Ich brauchte ein paar Wochen, um mich im Selbstmitleid zu suhlen und mich an mein neues Leben als leere, wenig liebenswerte Hülle zu gewöhnen. Amirah zog die langen Beine an, und ich konnte sehen, dass sie jetzt etwas Unerfreuliches sagen würde.
»Brauchst du die Nummer von der Therapeutin meiner Mom?«
Nein, die brauchte ich nicht. Es war bloß eine Trennung, und keine besonders spannende. Ich hatte ja nicht einmal Albträume – worüber sollte ich mit einer Therapeutin reden?
»Ich glaube, ich bin ganz generell nicht so der Therapietyp«, erklärte ich. »Das passt irgendwie nicht zu mir.«
Ich meinte es ernst. Die einzige mir bekannte Therapeutin war Jons Cousine Penelope, eine kleine Frau mit schlaffen blonden Dreadlocks. In ihren Workshops hoben die Leute ihr eigenes Grab aus und legten sich dann hinein, um den Tod des Egos zu erleben.
»Ich glaube, bei ihr läuft das … anders«, sagte Amirah. Sie führte einen Finger zum Mund, knabberte an der Nagelhaut, biss einen Fetzen ab und sah mich dabei nachdenklich an. »Ich habe das Gefühl, wenn es jemals Zeit für ein bisschen Therapie wäre, dann jetzt, oder?«
»Mir geht’s super«, versicherte ich ihr. »Ich habe mir eine Meditations-App runtergeladen und fange bald mit dem Joggen an … Sag mal, weiß Tom eigentlich von Brian?«
Tom war Amirahs tapsiger Freund, ein Mann mit riesigen Händen und dröhnendem Lachen, der einen wichtigen Job in einer angesagten Brauerei in der Innenstadt hatte. Die beiden hatten sich vor einem knappen Jahr über eine Dating-App kennengelernt, und seither waren sie unzertrennlich. Ihre Sprache der Liebe war anscheinend, sich gegenseitig in schmeichelhaften Fotos zu taggen und die Bilder mit ausführlichen Beschreibungen ihrer Beziehung zu versehen. Angeblich fühlte ihr gemeinsames Leben sich an wie ein Abenteuer, wobei ihre Lieblingsabenteuer offenbar in Restaurantbesuchen bestanden. Zunächst postete Tom ein Foto von Amirah mit Weißweinglas in der Hand – ein typischer Freitag –, und wenn das Hauptgericht serviert war, postete Amirah ein Foto von Tom – der Große langt zu –, woraufhin Tom das von ihm gepostete Foto abermals postete und Amirah den Kreis schloss, indem sie das ursprüngliche »Freitag«-Foto in ihrer Story teilte. Auf diese Weise bekamen wir beide Seiten des Tisches zu sehen. Dieses Verhalten sah Amirah gar nicht ähnlich, aber die Liebe, so ist es nun einmal, macht die Menschen rührselig und auch ein bisschen irrational.
Ich wollte wissen, wie die Krankenhausdramen ihrer Meinung nach mit den geposteten Fotos, den Austernessen und dem Großen zusammenpassten. »Ich fange mit den Typen doch nichts an«, sagte Amirah. »Und Tom ist nur mein Freund. Vorläufig.« Kurzzeitig hatte ich Amirahs ungewöhnliche Definition des Begriffs »Freund« vergessen, der ihr außerhalb der gemeinsam verbrachten Zeit keine wirklichen Verpflichtungen auferlegte. Amirah war gnadenlos locker, das aber nur bis zu dem Moment, in dem sie entschied, dass ein bestimmter Mann der Richtige war. Bislang hatte es zwei Richtige gegeben, einen Jungen aus der Highschool und einen Medizinstudenten, der ihr manchmal immer noch Nachrichten schrieb. Doch anscheinend stand Tom kurz vor einer Beförderung.
»Wie dem auch sei«, sagte Amirah. »Das eine ist das echte Leben und das andere nur, na ja, ein kleiner Nervenkitzel. Ich weiß, was ich mir langfristig wünsche, aber es gibt Momente, da möchtest du einfach hören, dass der andere noch nie was Schöneres gesehen hat als deinen Arsch.«
Das hörte sich in der Tat nett an. Vielleicht könnte auch ich den einen oder anderen Nervenkitzel erleben, selbst wenn mich langfristig ein Leben als leere Hülle erwartete. In dem Moment bekam Amirah eine Textnachricht. Sie sollte für eine Kollegin einspringen. »Ist es sehr schlimm, wenn ich gehe?«, fragte sie. »Ich versuche gerade, bei der Arbeit guten Willen zu zeigen, damit ich Silvester freikriege. Außerdem habe ich einer Patientin versprochen, dass wir heute Freundschaftsarmbänder basteln.«
»Muss ich eifersüchtig sein?«, fragte ich.
»Na ja, sie ist sieben und hat Knochenkrebs, also eher nicht«, sagte Amirah.
Ich saugte die Innenseiten meiner Wangen ein. »Scheiiiiße«, murmelte ich. »Scheiße. Ich wusste ja nicht …«
»Schon gut«, lachte Amirah. »Ihre Prognose ist ziemlich gut. Entspann dich.«
Ich staunte immer wieder darüber, wie locker Amirah mit den täglichen Anforderungen ihres Jobs umging, wie sie es schaffte, ins Krankenhaus zu gehen, Eltern schlechte Nachrichten zu überbringen und Kindern zu helfen, mit Schmerzen zurechtzukommen, die sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleiten würden, und dann ging sie wieder nach Hause oder traf sich mit uns zum Abendessen und hörte sich unser Gejammer über verrohte E-Mail-Sitten an. Wann immer sie ein erschütterndes Detail aus ihrem Krankenhausalltag preisgab, gerieten wir in Panik, auch wenn sie uns regelmäßig darauf hinwies, das Ganze sei kein Wettbewerb und der Stress, den Clive im Job erlebte, nicht weniger belastend, bloß weil er durch halbwegs bekannte Exsportler mit turbulentem Privatleben verursacht wurde. (»Findest du?«, hatte Clive sie einmal gefragt. Ich war mir da nicht so sicher.)
»Gott, das ist echt heftig«, sagte ich. »Ich an deiner Stelle hätte wirklich einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen.«
»In der Tat haben wir im zweiten Stock einen Raum extra zum Weinen«, sagte Amirah. »Aber meistens ist es sehr schön, für Menschen da zu sein, die eine schwere Zeit durchmachen. Es ist nicht immer leicht, aber es tut gut. Bestimmt geht es dir ganz ähnlich, wenn du den Leuten … Macbeth erklärst oder so … ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie dein Job aussieht.«
»Die Hälfte meiner Arbeit besteht darin, mir witzige Titel für irgendwelche Papers auszudenken, besonders für den Teil vor dem Doppelpunkt«, sagte ich. »Aber du hast schon recht, wahrscheinlich ist es vergleichbar damit, sich um krebskranke Kinder zu kümmern.« Ich stand auf und fing an, in den Schränken zu wühlen. »Bevor du gehst, solltest du noch was essen.«
Ich holte alle Zutaten für Amirahs Lieblingssandwich heraus, eine eher unappetitliche Kombination aus eingelegten Gurken, Hummus, Honig und dunklem Senf. Während ich das Sandwich zusammensetzte, stand Amirah hinter mir und steckte den Zeigefinger in die offenen Gläser, bevor sie sie zuschraubte und in den Kühlschrank zurückstellte.
»Warum meldest du dich nicht bei den Laurens«, sagte sie und nahm einen ersten triefenden Bissen. »Du solltest nicht den ganzen Tag allein rumsitzen. Ohne Janet ist es hier echt schrecklich.«
Um bei der Erwähnung der Katze nicht sofort in Tränen auszubrechen, stieß ich ein wenig überzeugendes »Gute Idee!« aus und zückte mein Handy. Wie sich herausstellte, würden sich die beiden Laurens gleich in einer Bar unweit vom Büro der emotionalen Lauren treffen und Wein bechern. Ich sagte Amirah, dass ich mich nicht besonders gesprächig fühlte, gegen Bechern aber nichts einzuwenden hatte.
»Wunderbar!«, sagte sie. »Du kannst mich zur Arbeit begleiten.«
Sie nahm ihre Tasche, und wir gingen in den Flur, wo ich versuchte, mich mit Wimperntusche, die sich auf das Regal für die Schlüssel verirrt hatte, ein wenig vorzeigbarer zu machen. Ich drückte auf den Tränensäcken unter meinen Augen herum und seufzte laut.
»Warum musste das auch ausgerechnet jetzt passieren, wo ich meinen letzten Rest jugendlicher Schönheit verloren habe«, sagte ich.
»Red nicht so«, sagte Amirah und stieg in ihre verzierten Plastikclogs. »Echt, ich könnte Jon umbringen. Ich bin so sauer.«
»Es ist nicht seine Schuld«, sagte ich, warf die Schlüssel in meine Handtasche und öffnete die Tür. »Ehrlich. Wenn überhaupt, ist es meine Schuld.«
Amirah schnitt eine Grimasse. »Warum?«
Das konnte ich nicht erklären. Es war nur so ein Gefühl.
Am darauffolgenden Tag sollte ich eigentlich arbeiten gehen, konnte mich aber nicht aufraffen. Zum einen war die Luftfeuchtigkeit in Toronto sprunghaft angestiegen, sodass nicht der Juni-typische herzerfrischende Sprühnebel vorherrschte, sondern ein Achselhöhlenklima, mit dem wir es normalerweise erst im August zu tun bekommen, zum anderen sah ich beschissen aus und war unverändert traurig.
Obwohl ich im Sommer nicht unterrichten musste, verbrachte ich ein paar Tage im Monat an meinem überladenen Schreibtisch im Institut für Anglistik. Ich arbeitete dort als wissenschaftliche Hilfskraft für Merris, eine ältere und verständnisvolle Anhängerin der Frühmoderne, die meine Masterarbeit betreut hatte und in meiner Vorstellung irgendwo zwischen gefürchteter, aber geliebter Tante und zaubermächtiger Hexe rangierte. In den letzten drei Wochen war ich nicht zur Arbeit erschienen und hatte ihr stattdessen an jedem Mittwoch eine vage und wenig überzeugende Entschuldigung geschickt. An diesem Mittwoch rief sie an.
»Merris, hallo … entschuldige bitte, ich …«
»Was ist es heute? Hat deine Großmutter einen dringenden Zahnarzttermin?«
Ich arbeitete gern für Merris. Einen gebildeteren Menschen als sie hatte ich nie getroffen. Sie hatte es nicht nötig, andere bloßzustellen. Nur manchmal, beispielsweise jetzt, konnte sie es sich nicht verkneifen, sie ein bisschen zappeln zu lassen. Ich stellte sie mir an ihrem Schreibtisch vor, wie sie schief lächelte und sich mit langen Fingern die Telefonhörerschnur um den knubbeligen linken Daumen wickelte. Wahrscheinlich trug sie eine Lesebrille auf der Nase und eine zweite auf dem Kopf. Manchmal baumelte eine dritte an einer eleganten Kette um ihren Hals.
»Ich glaube, ich lasse mich scheiden«, sagte ich. »Also, ich lasse mich ganz bestimmt scheiden, ich weiß nur noch nicht genau, wann und wie.«
»Oh.«
Ich wollte sowieso mit niemandem darüber sprechen, aber als ich Merris die Neuigkeit überbrachte, kam ich mir besonders lächerlich vor. Ich war Ende zwanzig und machte gerade eine Trennung durch, na und? Merris war zweimal verheiratet, einmal geschieden und einmal verwitwet und lebte gerade ihr, wie sie es nannte, »bestes Leben«. Sie teilte sich mit zwei anderen Professorinnen ein riesiges Doppelhaus im Osten der Stadt, wie die Golden Girls, nur in intellektuell.
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte sie. »Dann arbeite erst einmal von zu Hause aus, und wenn du dich bereit fühlst, kommst du zurück in die Uni.« Ich erklärte ihr, das würde vielleicht niemals der Fall sein. Merris lachte und tat schnell so, als wäre es ein Schluckauf. »Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst«, sagte sie. »Mit anderen Worten bis September.«
Merris konnte Jon nicht leiden, was vor allem daran lag, dass er sie vor ein paar Jahren bei einem Empfang im Fachbereich »stundenlang« über das frankokanadische Kino belehrt hatte. Als ich ihn später darauf ansprach, sagte er, die Unterhaltung habe weniger als eine Viertelstunde gedauert und er habe nicht über Filme geredet, sondern höchstens erwähnt, dass er sich kürzlich Xavier Dolans Mommy angesehen habe. Vermutlich waren beide gleich unausstehlich. Beide hatten eine ähnlich niedrige Toleranzschwelle und mochten es gar nicht, die eigene Überheblichkeit widergespiegelt zu sehen. Auf unserer Hochzeit hatte er sich bei ihr einschmeicheln wollen, indem er aus Sonnet 18 zitierte, und sie hatte gesagt: »Shakespeare, und das bei einer Hochzeit? Was für eine bahnbrechende Idee.« Wie alle Menschen, die ich je geliebt habe, waren beide manchmal ein bisschen anstrengend.
Nachdem Merris und ich aufgelegt hatten, wandte ich mich wieder den üblichen Aktivitäten zu: arbeiten, essen und Gründe suchen, die gegen eine Dusche sprachen. Wenn ich ein paar Stunden lang Theaterstücke aus dem sechzehnten Jahrhundert analysiert hatte, die schon zu ihrer Zeit unpopulär gewesen waren, belohnte beziehungsweise bestrafte ich mich meistens mit einem Blick in Jons unterschiedliche Social-Media-Profile. Er hatte unsere ohnehin schon knappe Kommunikation weiter heruntergefahren, was ich mit Gelassenheit hinzunehmen versuchte, doch innerlich flippte ich aus. In dem Bemühen, möglichst locker zu wirken, hatte ich ihm vorgeschlagen, wir könnten einander in den sozialen Medien blockieren und uns damit »den Abschied« aus dem Leben des jeweils anderen erleichtern. Auch diesen Vorschlag hatte er beunruhigend schnell umgesetzt. Nur der gemeinsame, für unsere Katze eingerichtete Instagram-Account war verschont geblieben.
Wenn ich mich aus meinem Profil aus- und als @perfectjanetgoodgirl neu einloggte, war Jon wieder da. Er postete nicht viel, aber in seinen in irgendeinem dunklen Keller aufgenommenen Storys spielte er Klavier und sang (!) dazu. Ich stöberte in den von ihm getaggten Fotos und sah mir die Storys seiner Freunde an, immer auf der Suche nach etwas Schmerzhaftem – ein Audio von ihm, wie er auf einer Party lacht, ein Konzertvideo, in dem er dicht neben einer mir unbekannten Frau steht –, nach Hinweisen auf Freude und Zufriedenheit in seinem neuen Leben als von mir getrennter Mann. Objektiv betrachtet war dieses Cyberstalking über einen Haustier-Account ohne jeden Zweifel gestört, aber immerhin konnte ich mich damit trösten, dass auch »Janet« sich gelegentlich meine Storys anzusehen schien.
Wer die Katze behalten sollte, unseren mit Abstand wertvollsten gemeinsamen Besitz, war noch nicht entschieden. Streng genommen gehörte sie ihm, aber wir (Janet und ich) lebten schon so lange zusammen, wie wir (ich und Jon) zusammengelebt hatten. Ich liebte sie über alles, obwohl ihr größtes Hobby war, zu schreien und auf meine Kleidung und die Teppiche zu kotzen. Sie war ein wahres Ungetüm, eine große, schlaue Straßenkatze mit zotteligem graubraunem Fell und intelligenten grünen Augen. Wenn ich im Bett saß und Hausarbeiten korrigierte, hörte sie das Papier rascheln und schlich sich an. Wenn ich merkte, dass sie mich ins Visier genommen hatte, war es zu spät: Sie war längst abgesprungen, segelte durch die Luft und landete mitten auf dem Essay, den ich in der Hand hielt. Mehr als einmal hatte ich meinen verwirrten Studierenden zerknitterte oder durchlöcherte Hausarbeiten zurückgeben müssen, was mir natürlich immer sehr unangenehm war. Aber im Zweifelsfall hätte die Katze alles zerstören dürfen, was ich besaß. Manchmal schien es, als wäre genau das ihre Mission. Ohne sie war es in der Wohnung so still. Es war ungewohnt, bei jedem Gang in die Küche keinen Kontrollblick zum Kühlschrank werfen zu müssen (sie liebte es, Menschen auf den Kopf zu springen), und der Anblick der ungeöffneten, stinkenden Katzensnack-Tüten im Schrank brach mir jedes Mal das Herz. Jon und ich hatten vereinbart, uns genug Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was das Beste für sie wäre. Vielleicht käme sogar ein geteiltes Sorgerecht infrage. Ich vermisste sie, wie so vieles aus meinem alten Leben.
Abends schaute ich meine Thrillerserien (nachdem ich das englische Angebot abgegrast hatte, beschäftigte ich mich nun mit sexualisierter Gewalt in Skandinavien) und dachte über das Alleinsein nach. Manchmal stellte ich auch einfach nur die Füße auf den Boden und seufzte. Wenn mich der Ehrgeiz packte, kämmte ich mir die Haare, öffnete und schloss die Fenster und legte teure Outfits für imaginäre Partys in Online-Warenkörbe. Der Gruppenchat erkundigte sich regelmäßig nach meinem Befinden, aber ich hatte nur selten etwas zu erzählen und wusste außerdem, dass die anderen damit beschäftigt waren, ihr Leben zu genießen, und sich wahrscheinlich nicht von einer weinerlichen, demnächst geschiedenen Frau runterziehen lassen wollten. Nachts konnte ich nicht schlafen, tagsüber machte ich viele Nickerchen. Ich versuchte, mich gesund zu ernähren, bis ich dann plötzlich Lust hatte, eine Bolognese, Fajitas oder irgendein kompliziertes Gericht zu kochen. Am Ende gab ich es meistens auf, aß Cornflakes und sah Idris Elba dabei zu, wie er durch London stapfte und seine Exfrau verfluchte, die die Dreistigkeit besessen hatte, sich ermorden zu lassen. Für mich allein zu kochen, fand ich mühsam und deprimierend.
Ich probierte die Achtsamkeits-App aus, hielt aber nie lange durch. Ich wollte gar nicht geerdet und im Jetzt sein! Das Jetzt war furchtbar! Ich versuchte, mich an vergangene Erfolgserlebnisse zu erinnern – an meinen Universitätsabschluss beispielsweise, oder daran, wie ich einmal einem Typen in Südfrankreich einen geblasen hatte – aber anscheinend war Jon der Augenzeuge meines gesamten Lebens. Um ihm aus dem Weg zu gehen, musste ich mich bis in meine Schulzeit zurückversetzen, und die Erinnerungen daran waren ausnahmslos langweilig. Bis zu unserem Kennenlernen hatte ich praktisch nichts erlebt. Die Begegnung mit ihm war mir wie das wichtigste Ereignis überhaupt erschienen, und bis vor ein paar Wochen hatte jedes vergehende Jahr diesen Eindruck noch verstärkt. Und jetzt?, dachte ich. Schließlich ließ sich selbst ein Gedicht wie »One Art« von Elizabeth Bishop nicht beliebig oft lesen, außerdem dauerte es nur drei oder vier Minuten, plus ein paar mehr fürs Weinen. Und wenn ich das geschafft hatte, war ich sofort wieder bei: Und jetzt? Ja, in der Tat, was jetzt?
Jon hatte nicht nur Janet mitgenommen, sondern auch die meisten hochwertigen Alkoholika aus unserem Barwagen (ganz zu schweigen vom Barwagen selbst), also mixte ich mir Cocktails aus Cointreau, Zitronensaft und Sodawasser. Irgendwann musste ich zu Leitungswasser übergehen, und zuletzt trank ich den Cointreau pur. Sobald er Wirkung zeigte, bekam ich einen wahnsinnigen Hunger auf das mittendrin abgebrochene Abendessen und bestellte notgedrungen einen sogenannten »Nachtburger« bei dem einzigen Laden, der laut der App um vier Uhr morgens noch geöffnet hatte, eine Filiale einer größeren Pub-Kette mit endlos langer Speisekarte, auf der unter anderem der mittelmäßigste Hamburger der Welt stand. Mein Nachtburger kam ohne Schnickschnack daher, nur mit Gurkenscheibe und Pommes frites. Er war fad und schwer verdaulich und bei der Lieferung meistens kalt, doch ich hatte an das Essen sowieso keine Erwartungen. Ich wollte, dass es so aussah und schmeckte, wie ich mich fühlte, nämlich nach nichts. Ich wollte einen lauwarmen Fleischpuck, und ich bekam ihn oft genug.
ZUM ERSTEN MAL ÜBERHAUPT LEBTE ich allein. Als ich mit meinen Eltern, meiner Schwester, zwei Hunden und wechselnden, stets todgeweihten Hamstern aufgewachsen war, hatte im Haus immer ein reges Treiben geherrscht. Der Umzug ins lärmende Studentenwohnheim, wo die Jungs in den Unisex-Waschräumen die Türen aus den Toilettenkabinen hebelten und Becher mit geschmolzener Eiscreme die elfstöckige Hintertreppe runterwarfen, bis alle Wände rosa Flecken hatten und der halbe Trakt für eine Woche gesperrt wurde, hatte für mich kaum eine Umstellung bedeutet. Und anschließend waren Amirah, Lauren und ich bei der ersten Gelegenheit in eine WG gezogen, um Realityshows zu sehen, tagsüber zu kiffen und nie, niemals das Bad zu putzen.
Nach dem Uni-Abschluss wagten wir uns tiefer nach Toronto hinein, und die emotionale Lauren und ich belegten die Zimmer fünf und sechs in einem riesigen Haus im West End, wo Künstler, Baristas und Doktoranden wohnten und – davon erfuhren wir erst nach dem Einzug – im Keller eine Fledermaus, weil der Vermieter irgendeines Freundes einer Mitbewohnerin ihm die Haltung bei sich im Haus untersagt hatte.
Folglich bildeten Jon und ich die kleinste Menschengruppe, in der ich je gelebt hatte, und ich hatte es geliebt. Als wir unsere erste eigene Wohnung bezogen, war ich dreiundzwanzig. Die meisten meiner Freundinnen lebten weiterhin in irgendwelchen heruntergekommenen WG





























