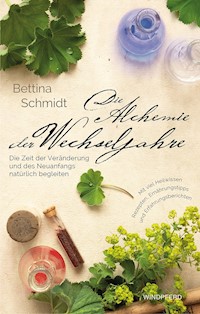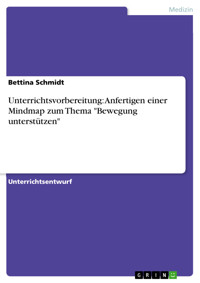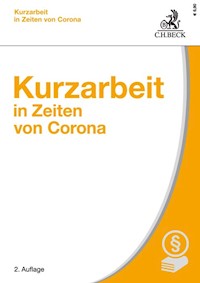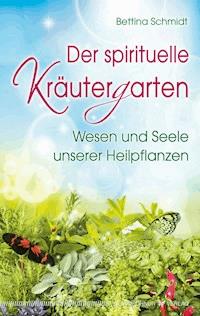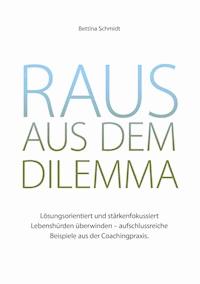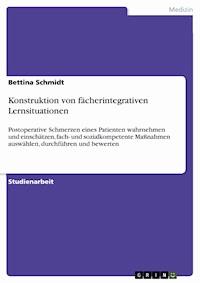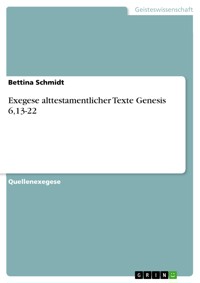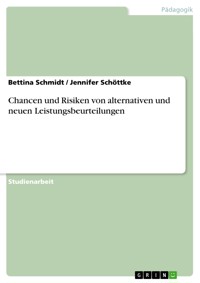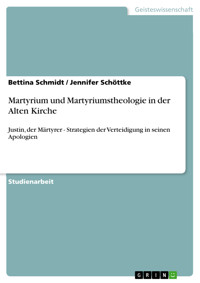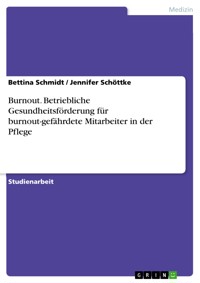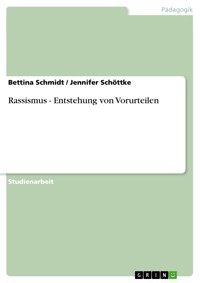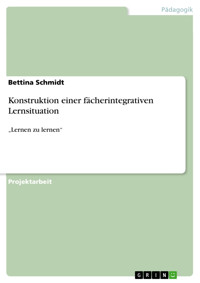29,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dietrich Reimer Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reimer Kulturwissenschaften
- Sprache: Deutsch
Warum glauben wir oder auch nicht? Was praktizieren Gläubige und warum? Warum überdauern einige Glaubensaspekte und andere nicht? Im Zentrum der Religionsethnologie steht die Beschäftigung mit fremden Glaubenssystemen, mit Weltbildern, Mythen, religiösen Praktiken und Heilsvorstellungen. Die Religionsethnologie untersucht das, was Menschen glauben und was sie täglich praktizieren, ob sie nun auf abgelegenen Inseln oder in einer Weltmetropole leben. Denn Religion ist Teil der Kultur und der Gesellschaft und stets verwoben mit Fragen nach der Identität, sozialer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bettina E. Schmidt
Einführung in die Religionsethnologie
Ideen und Konzepte
2., durchgesehene Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 20082., durchgesehene Auflage 2015
©
2015, 2008 by Dietrich Reimer Verlag GmbH, Berlin
www.reimer-verlag.de
Umschlaggestaltung: Nicola Willam, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-496-03001-0 (PDF)
ISBN 978-3-496-03002-7 (EPUB)
ISBN 978-3-496-03003-4 (Mobipocket)
I Grundlagen der Religionsethnologie
Einleitung – Nachdenken über „Religion“
Meinen ersten Vortrag vor der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde hielt ich 1993 auf einer Tagung in Leipzig. Ich kam gerade frisch vom Feld und berichtete über erste Ergebnisse meiner Forschung in Puerto Rico. Mein Thema war der puertoricanische Spiritismus, und ich erläuterte, dass es möglich sei, ethnische Identität auf der Basis einer Religion zu entwickeln. Interessanterweise wurde in der anschließenden Diskussion dieser Zusammenhang zwischen Ethnizität und Religion kaum beachtet, sondern es wurde vielmehr die Frage diskutiert, warum ich den puertoricanischen Spiritismus als Religion behandle. Diese für mich unerwartete Resonanz verdeutlichte mir, dass ich mich – wie mein Betreuer bereits angedeutet hatte – in meiner Dissertation auch mit der Frage auseinandersetzen musste, was denn Religion sei. Bis dahin hatte ich diese Frage ignoriert. Ich war der Ansicht, dass ein Glaubenssystem mit Ritualen, Gemeinschaften, einem ausgearbeiteten Weltbild und ethischen Grundsätzen, d. h. ein Glaubenssystem mit Gläubigen, eine Religion sei, auch ohne institutionalisierten Glauben und zentrale Dogmen, und dass ich solch ein System auch „Religion“ nennen dürfe. Nun, ich hatte mich geirrt. Ich kam zu der Erkenntnis, dass ich meine Einordnung mit einer Definition begründen musste. Aber mit welcher?
Religion, abgeleitet vom lateinischen religio (übersetzt als „Gottesfurcht“), ist ein Begriff, der in europäischen Sprachen alltäglich verwendet wird. Die Herkunft ist allerdings ziemlich unklar. Nach Cicero stammt der Begriff von relego („wieder zusammennehmen“), er wird aber auch mit religo verknüpft („zurückbinden“, „anbinden“, „festbinden“). Erst im 16. Jahrhundert hält der Begriff „Religion“ Einzug in die europäischen Sprachen. Erste Bibelübersetzungen verwenden das Wort „Religion“ nicht und ebensowenig die Religionsgründer. Ihnen ging es um den rechten Pfad, die richtige Lehre oder den Weg zur Erlösung, nie um Religion. So gab es ursprünglich in nichteuropäischen Sprachen keine Äquivalenzbegriffe für „Religion“. Der Begriff wurde als Fremdwort aus einer europäischen Sprache (häufig der jeweiligen dominierenden Kolonial- oder Imperialsprache) entliehen: meistens für importierte Religionen wie beispielsweise in Japan für das Christentum, nicht aber für die einheimischen Systeme wie Shinto in Japan oder Konfuzianismus in China (siehe dazu auch Hock 2006).
Dagegen wird in Puerto Rico Spanisch gesprochen, eine europäische Sprache, die den Begriff „Religion“ kennt. Aber auch hier wird er nur für bestimmte Glaubenssysteme angewendet, nicht für alle. Auf die Frage: „Was ist deine Religion?“ folgt in Puerto Rico (wie fast überall in Lateinamerika) meistens die Antwort: „Ich bin katholisch“ bzw. zunehmend häufig: „Ich gehöre zur Pfingstkirche“. Religion wird von fast allen mit Kirche und mit Christentum verbunden. Auch wenn Katholizismus nicht praktiziert wird (außer für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen), gilt es als respektabel, sich als katholisch zu bezeichnen. Die Antwort auf die Frage: „Was praktizierst du?“ würde allerdings anders lauten (sofern ein Vertrauensverhältnis vorliegen würde). Vergleichbares gilt für Vodou[1] in Haiti. Die Entscheidung der Regierung im Jahr 2003, zusätzlich zum Katholizismus Vodou zur offiziellen Religion zu ernennen, hat viele Vodou-Anhänger in Haiti erstaunt. Sie beantworten die Frage nach der Religionszugehörigkeit weiterhin mit katholisch, wenngleich sie „den Geistern dienen“, wie Vodou in Haiti meistens umschrieben wird.
Mehr als zehn Jahre nach Abschluss meiner Dissertation über Puerto Rico kämpfe ich immer noch mit der Frage, was denn Religion sei. Ich vermittle nun seit vier Jahren Studierenden der Theologie und Religionswissenschaft die theoretischen Grundlagen der Religionsforschung, und ein Überblick über Definitionen ist Teil des Curriculums. Die Diskussionen mit den Studierenden zeigen mir immer wieder, wie wichtig es ist, nicht nur auf die Mängel der Theorien und Grenzen der Definitionen zu verweisen, sondern diese mit Erkenntnissen aus der Forschung zu verbinden, d. h. mit gelebten Glaubenssystemen. Einige Kollegen in der Religionswissenschaft lehnen den Begriff Religion völlig ab und plädieren dafür, ihn einfach nicht mehr zu verwenden.
Diese Forderung geht mir allerdings zu weit. Wir können einen Begriff, der in der Alltagssprache verwendet wird und der Eingang in internationales Recht, in die Menschenrechte und andere Verfassungen erhalten hat, nicht einfach ignorieren und uns damit vom Alltag der Menschen, deren Kultur wir erforschen, distanzieren. Ethnologie arbeitet schon lange nicht mehr nur im Elfenbeinturm der Wissenschaft. Wir setzen uns mit Menschen und ihren kulturellen Systemen auseinander und gerade der Dialog ist die Stärke der Ethnologie. Im Zentrum der Religionsethnologie steht die Beschäftigung mit fremden Glaubenssystemen, mit Weltbildern, Mythen, religiösen Praktiken, Heilsvorstellungen und vielem mehr, d. h. die Beschäftigung mit dem, woran Menschen glauben und was sie täglich praktizieren. Ist das alles nun „Religion“? Vielleicht nicht nach einigen ausgefeilten Definitionen, die im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte entwickelt wurden, aber nach unserem heutigen Alltagsverständnis von Religion und Glauben.
Seit der Aufklärung trennen wir in Europa Religion von Wissenschaft; Religion gelangte dadurch in eine eigene „Schublade“, getrennt vom Rest der menschlichen Kultur. Religion gehört zum Arbeitsgebiet der Theologie und hat mit Kirche zu tun, mit Predigten und dem Papst. Ethnologie als die „Wissenschaft vom kulturell Fremden“ (Kohl) schaut auf die exotischen Religionen, auf Schamanen, Hexen und die Traumwege der Aborigines. Wo passt der puertoricanische Spiritismus hinein? In meiner Dissertation habe ich mich, mangels anderer Möglichkeiten, Tylors allgemeiner und inzwischen veralteter Definition angeschlossen und auf die Geister im Spiritismus verwiesen. In den 1990er Jahren hat kaum jemand über karibische Religionen oder gar über den lateinamerikanischen Spiritismus geforscht, so dass ich neue Wege in der wissenschaftlichen Einordnung der Religionen beschreiten musste. Das ist heute, zum Glück, anders.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!