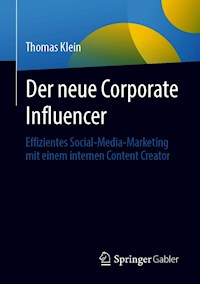8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin-Kreuzberg – Der erste Tag Es war ein schöner, sommerlicher Sonntagmorgen, angenehm warm, es roch nach Kiez und alles war neu. Die Stadt lag noch in den Federn, denn Kreuzberger Nächte sind ja bekanntlich lang. Und so schlenderte ich ein wenig durch den Görlitzer Park, legte mich dort noch ein bisschen auf die Wiese, hörte dem Vogelgezwitscher zu, beobachtete die Leute und genoss die morgendliche Stille. Gelegentlich kamen ein paar ältere Berliner Witwen in unregelmäßigen Abständen mit ihren Kleinsthunden an mir vorbei und schienen irgendwie zufrieden zu sein. Vielleicht ist es gerade dieser Blickwinkel im Alter, die kleinen Dinge vermehrt zu sehen, nur noch wenig Erwartungshaltung zu haben und auf ein bereits gelebtes Leben zurückschauen zu können, die Dinge einfach so anzunehmen, wie sie eben sind. Und vielleicht sind es genau nur noch diese wenigen Höhepunkte, wie der alltägliche Spaziergang durch den Park, die diese Leute zufrieden machen. Das Kontrastprogramm hierzu ließ dann aber nicht lange auf sich warten, denn einige Nachtschwärmer, vornehmlich in Schwarz gekleidet, zogen vorbei. Einigermaßen betrunken oder bekifft, mal lauter, mal still, schienen sie teilnahmslos, mitunter apathisch auf dem Heimweg oder wohin auch immer zu sein. Die durchzechte Nacht stand ihnen in den Gesichtern geschrieben. Und sofort fiel es mir ein. Berlin, die Stadt, die niemals schläft und 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet ist. Ein völlig neues Erlebnis für jemanden aus der schwäbischen Provinz. Gegen Mittag dann Kaffee und Kuchen in einem der vielen Cafés am Lausitzer Platz. Kreuzberg erwachte nun richtig, und seine Bewohner drängten ins Freie, füllten die Liegewiesen, die Bars und Restaurants und sorgten so für ein buntes und lebendiges Treiben. Ich machte mich wieder auf den Weg, lief ein wenig ziellos umher und beobachtete die Szene. Sehr viele kleine türkische Läden und Fressbuden prägten das Straßenbild. Und nur junge Leute in meinem Alter. Hier fühlte ich mich wohl, hier wollte ich hin. Ein kleiner Abstecher noch zum Mariannenplatz, das Bethanien stand auf dem Plan. Hier lebten und wirkten also „Ton Steine Scherben“, die Band, die mich seit den Siebzigern so begeistert und beeinflusst hatte. Sofort erinnerte ich mich an ihren Song „Land in Sicht singt der Wind in mein Herz“, und hier vor Ort bekam dieser sofort eine völlig neue Tragweite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Klein
Eingemauert und doch frei
Mein Sehnsuchtsort West-Berlin
Eingemauert und doch freiMein Sehnsuchtsort West-BerlinInhaltsverzeichnis
Impressum
Einleitung
Ankunft in West-Berlin 1984
Studentendorf Schlachtensee 1984 - 1986
Zossener Straße, Kreuzberg 1986 - 1987
Neckarstraße, Neukölln 1987 - 1990
Epilog / Nachwort
Impressum
1. Auflage 2025
Anschrift: Thomas Klein,
79252 Stegen, Berlachen 7
www.th-klein.de
Lektorat: Therese Piecha,
Rainer Kottmann, Thomas Klein
Umschlaggestaltung: Thomas Klein
Satz und Layout: Thomas Klein
Copyright © 2025, Thomas Klein
ISBN 978-3-759-29399-2
Einleitung
Schon mit den Augen eines neugierigen kleinen Jungen und später in den Siebzigern dann als Jugendlicher verfolgte ich immer wieder aufmerksam und mit großer Spannung die Geschichte und weitere Entwicklung von West-Berlin, der Stadt, die so scheinbar ganz anders tickte und der ein besonderer Ruf vorauseilte. Berlin war durch seinen politischen Status und der einmaligen geografischen Lage zwischen den Blöcken bis über die Grenzen hinaus weltweit bekannt und immer wieder Schauplatz spektakulärer Ereignisse.
Auch wenn mir zu jener Zeit die Zusammenhänge oft noch etwas unklar erschienen, so begriff ich doch die Bedeutung und Gewichtung für das Weltgeschehen, die von dieser Stadt ausgingen und die der Mauerbau von 1961 zur Folge hatte.
Und als John F. Kennedy im Juni 1963 während seines Deutschland-Aufenthaltes nach West-Berlin kam und in seiner legendären Ansprache vor dem Schöneberger Rathaus in Anwesenheit von Willy Brandt und Konrad Adenauer den historischen Satz „Ich bin ein Berliner“ aussprach, war das wohl über Tage hinweg das zentrale Medienereignis, das alles überstrahlte und dem man sich kaum entziehen konnte. Die sich ausbreitenden weltweiten Studentenproteste am Ende dieses Jahrzehnts, die in den USA ihren Anfang nahmen, erreichten 1968 dann auch Westeuropa und Deutschland, und so entstand an der Freien Universität in West-Berlin die außerparlamentarische Opposition (APO) als gesellschaftlicher Gegen-entwurf zu den bestehenden Verhältnissen. Diese Bewegung der 68er mit ihrer Galionsfigur Rudi Dutschke an der Spitze veränderte nachhaltig das gesellschaftliche Gefüge und hatte auch große Auswirkungen auf die Stadt.
Im Zuge dieser Umwälzungen entstanden in den Folgejahren alternative Lebensformen in West-Berlin, die extremer und radikaler waren als anderswo. Der Mythos von Berlin-Kreuzberg begann zu leben, multikulturelles Miteinander wie sonst nirgendwo, das zog viele Leute an, egal woher sie kamen oder welcher Herkunft sie waren.
Es war diese soziale Mischung von Studenten, Rentnern, Kulturschaffenden, radikalen Linken, Anarchos und Wehrdienst-Flüchtlingen, die dem Bezirk neues Leben einhauchte. Völlig neue Lebensentwürfe fernab des westdeutschen Mainstreams machten neue Formen des Miteinanders möglich, und so entwickelte sich seit den späten Siebzigern eine Subkultur, die es so nirgendwo sonst in Deutschland gab.
Autonome Projekte, politische Läden, Medienkollektive, das Experimentieren mit alternativen Strukturen und natürlich auch Drogen, Partys und Kneipen zeichneten dieses Kreuzberg in jener Zeit aus. Musikalisch getragen und beeinflusst wurde das Ganze durch britische Punkbands wie die Clashs und die Sex Pistols, die zu diesem neuen Lebensgefühl beitrugen. Aber auch die „Ton Steine Scherben“ und Nina Hagen standen für einen kulturellen Gegenentwurf, der das etablierte, verkrustete System ablehnte.
All diese Wahrnehmungen und Beobachtungen aus der Ferne in den späten Siebzigern hatten zur Folge, dass dieser Ort eine große magische Anziehungskraft auf mich ausübte. Keine andere Stadt zog mich so in ihren Bann wie West-Berlin und stand für Andersartigkeit, Lebensfreude, Lebenskunst, Individualität und Unabhängigkeit.
West-Berlin war Lebensanschauung, Utopie, Erwartungshaltung und vielleicht auch ein bisschen Illusion zugleich. So war zumindest meine Vorstellung, da wollte ich irgendwann hin, da wollte ich leben, das war der Plan, vielleicht nach der Schulzeit, dachte ich so bei mir.
Im Jahr 1979 machte ich mein Abi am Wirtschaftsgymnasium Böblingen, aber es sollten noch Jahre vergehen, bis es dann endlich so weit war. Erstmal verschlug es mich ins nahe Tübingen. Ich hatte mich dort nach einem kurzen Intermezzo als Soziologiestudent zum Jurastudium eingeschrieben. Aber schon nach kurzer Zeit stellte ich frustriert fest, dass ich für dieses Fach so überhaupt keine Neigung verspürte, und so beendete ich auch diese Episode schnell mit einem Gefühl der Erleichterung.
Etwas ziellos und mit wenig Orientierung tourte ich die nächsten zwei Jahre dann durchs Land, machte verschiedene Stationen bei Leuten in Saarbrücken oder half Freunden in Oberschwaben beim Bau von Gewächshäusern. Aber ich blieb ein Suchender in jener Zeit, war unzufrieden mit mir und fühlte mich seltsam entwurzelt, war ein Getriebener und irgendwie in ständiger Unruhe.
Und während ich so auf der Suche nach Neuem, mehr innerer Erfüllung und Ausgeglichenheit war, brach draußen gerade überall die Neue Deutsche Welle über uns herein. Neue Bands wie Ideal, Hansaplast und Fehlfarben gaben jetzt den Ton an, und in Berlin tobte der Häuserkampf. Spannende Zeiten standen bevor, und ich hatte mich jetzt entschieden, Geografie zu studieren, noch mal einen neuen Anlauf zu nehmen und doch endlich nach Berlin zu gehen, meinem Sehnsuchtsort, der Stadt, die niemals schläft.
Ankunft in West-Berlin 1984
Berlin-Kreuzberg – Der erste Tag
Es war sehr warm an diesem schönen Samstagnachmittag, an einem Spätsommertag irgendwann Ende August 84. Ich kam gerade per Anhalter aus meiner schwäbischen Heimat Sindelfingen und war mal wieder auf einem Autobahnrasthof gestrandet, diesmal Garbsen bei Hannover. Und wie schon so oft in den letzten Jahren befragte ich wieder eine Menge Leute, ob sie mich mitnehmen könnten. An diesem Tag aber fühlte es sich irgendwie anders an als sonst, denn ich wollte nicht irgendwohin, sondern nach West-Berlin, meinem Sehnsuchtsort.
Vorn sah ich zwei Frauen stehen, die vor ihrem VW mit Münsteraner Kennzeichen sich angeregt unterhielten, Kaffee aus Pappbechern tranken und dazu mitgebrachte Stullen aßen. Intuitiv hatte ich ein gutes Gefühl. Ich ging auf sie zu, bemühte mich charmant zu sein, was nach zweistündigem erfolglosem Stehen nicht mehr so ganz einfach war, und fragte sie, ob sie mich mitnehmen könnten nach Berlin.
Puh, Erleichterung, das war geschafft! Die beiden, die sich als Gaby und Annette vorstellten, verluden noch schnell ein paar Dinge, und los ging's. Es war diese gleiche Wellenlänge, gleiches Alter, ähnliches Weltbild, was mir gefiel. Mit den beiden fühlte es sich einfach sofort vertraut an. Während der ganzen Fahrt redeten wir so über dieses und jenes, mitunter sehr emotional, und berichteten im Schnelldurchlauf über das bereits Erlebte.
Gegen 18 Uhr erreichten wir dann den Grenzkontrollpunkt Dreilinden, standen etwa eine Stunde in einer von mehreren parallel verlaufenden Schlangen und warteten auf unsere Abfertigung. Man bemerkte sofort, dass die Volkspolizisten, auch Vopos genannt, hier keine Eile hatten. Und in der ohnehin schon aufgeladenen Atmosphäre bekam man klar und deutlich zu verstehen, wer hier das Sagen hat. Welten standen sich gegenüber und wir waren der Klassenfeind.
Aber dann hörte es irgendwie auf und wir waren plötzlich in West-Berlin. Überglücklich fuhren wir auf der Avus durch den sommerlichen Grunewald in Richtung Stadt. Es fühlte sich einfach verdammt gut an. Und Hunger hatten wir. Auf der Kantstraße, vorbei an prächtigen Bauten aus der Gründerzeit, kam die Idee nach einer Pizzeria auf, und wir mussten nicht lange suchen.
Das San Marino am Savignyplatz lud ein, und ich betrat zum ersten Mal Berliner Boden. Der Cameriere erwartete uns bereits auf dem Gehweg und ließ in seiner typisch italienischen, überfallartigen Art nicht mehr von uns ab. Gegenwehr zwecklos, und so sahen wir uns unvermittelt an einem der vielen Tische wieder und bestellten Pizza und Bier. Gesättigt und zufrieden schauten wir bei mittlerweile aushaltbarer Hitze dem wuseligen Treiben auf dem Platz und den angrenzenden Straßen zu. Ein leichtes Rauschen der üppig grünbehangenen Linden und Platanen in dem sommerlichen Abendhimmel ließ unsere Stimmung nochmals ansteigen. Aber ich bemerkte auch eine leichte Nervosität bei Annette, die langsam zum Aufbruch drängte. Sie schlug mir vor, mitzukommen zu ihrem alten Bekannten. Schlafplätze gäbe es dort zu Genüge, und wir könnten ja dort auch noch was gemeinsam trinken.
Ich willigte ein, und so trennten sich hier die Wege, da Gaby zu einem anderen Freund nach Moabit aufbrach. Eine halbe Stunde später, Kreuzberg 36, oder besser SO36, Reichenberger Straße: Wir waren da, in dem Stadtteil, von dem ich so viel gehört hatte. Es dämmerte bereits und die grauen, doch sehr heruntergekommenen Fassaden der alten Mietskasernen aus der Gründerzeit schufen eine ganz eigene, spezielle Atmosphäre.
Dann endlich im zweiten Hinterhof angelangt, Parterre, linker Eingang, wir hatten unser Ziel erreicht. Annettes Lover ließ noch auf sich warten, und zu meinem Erstaunen war alles unverschlossen, und so kamen wir direkt in die Wohnung. Drinnen musste ich aber erst mal tief durchatmen. Es sah gelinde ausgedrückt sehr befremdlich aus, für jemanden, der wie ich im gut situierten Südwesten der Republik beheimatet war. Alles war funktional, minimalistisch eingerichtet, die Wände dunkelbraun und einige Möbel aus Paletten und Bahnschwellen zusammengenagelt. Ein selbstgebautes Hochbett und überall funzelige Glühlampen rundeten dieses höhlenartige Erlebnis ab.
Ja, und dann stand er plötzlich da und er entsprach so ganz meinen Vorstellungen. Cooler Typ norddeutscher Prägung, schnoddrig, eher wortkarg, bloß keine Gefühle zeigen, so eine Mischung aus Udo Lindenberg und Rio Reiser von den Ton Steine Scherben. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich bemerkte schnell, dass er direkt zur Sache kommen wollte und an einem gemeinsamen Drink mit mir überhaupt kein Interesse hatte. Und so richtete er nur ein paar höfliche Floskeln an mich, zeigte mir, wo der Kühlschrank und das Bier sind und wo ich meinen Schlafsack ausrollen könnte – das war's.
Die beiden zogen sich sofort zurück aufs Hochbett und schufen Fakten. Annettes heftiges und lustvolles Stöhnen irritierte mich dann aber doch einigermaßen, und ich fühlte mich seltsam unwohl und allein, trank noch schnell zwei Bierchen, legte mich hin und versuchte mich irgendwie weit weg zu beamen. Nach einer Weile dann endlich Entspannung. Körper, Geist und Seele beruhigten sich, und ich war wieder in meiner Welt. Den Umständen entsprechend schlief ich wider Erwarten gut, wachte aber wohl für Kreuzberger Verhältnisse ziemlich früh auf.
Von meinem Liebespärchen dort oben kein Muckser, und so packte ich schnell meine Siebensachen und schlich mich unbemerkt nach draußen. Es war ein schöner, sommerlicher Sonntagmorgen, angenehm warm, es roch nach Kiez und alles war neu. Die Stadt lag noch in den Federn, denn Kreuzberger Nächte sind ja bekanntlich lang. Und so schlenderte ich ein wenig durch den Görlitzer Park, legte mich dort noch ein bisschen auf die Wiese, hörte dem Vogelgezwitscher zu, beobachtete die Leute und genoss die morgendliche Stille.
Gelegentlich kamen ein paar ältere Berliner Witwen in unregelmäßigen Abständen mit ihren Kleinsthunden an mir vorbei und schienen irgendwie zufrieden zu sein. Vielleicht ist es gerade dieser Blickwinkel im Alter, die kleinen Dinge vermehrt zu sehen, nur noch wenig Erwartungshaltung zu haben und auf ein bereits gelebtes Leben zurückschauen zu können, die Dinge einfach so anzunehmen, wie sie eben sind. Und vielleicht sind es genau nur noch diese wenigen Höhepunkte, wie der alltägliche Spaziergang durch den Park, die diese Leute zufrieden machen.
Das Kontrastprogramm hierzu ließ dann aber nicht lange auf sich warten, denn einige Nachtschwärmer, vornehmlich in Schwarz gekleidet, zogen vorbei. Einigermaßen betrunken oder bekifft, mal lauter, mal still, schienen sie teilnahmslos, mitunter apathisch auf dem Heimweg oder wohin auch immer zu sein. Die durchzechte Nacht stand ihnen in den Gesichtern geschrieben. Und sofort fiel es mir ein. Berlin, die Stadt, die niemals schläft und 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet ist. Ein völlig neues Erlebnis für jemanden aus der schwäbischen Provinz.
Gegen Mittag dann Kaffee und Kuchen in einem der vielen Cafés am Lausitzer Platz. Kreuzberg erwachte nun richtig, und seine Bewohner drängten ins Freie, füllten die Liegewiesen, die Bars und Restaurants und sorgten so für ein buntes und lebendiges Treiben. Ich machte mich wie-der auf den Weg, lief ein wenig ziellos umher und beobachtete die Szene. Sehr viele kleine türkische Läden und Fressbuden prägten das Straßenbild. Und nur junge Leute in meinem Alter. Hier fühlte ich mich wohl, hier wollte ich hin, hier wollte ich sein.
Ein kleiner Abstecher noch zum Mariannenplatz, das Bethanien stand auf dem Plan. Hier lebten und wirkten also „Ton Steine Scherben“, die Band, die mich seit den Siebzigern so begeistert und beeinflusst hatte. Sofort erinnerte ich mich an ihren Song „Land in Sicht singt der Wind in mein Herz“, und hier Vorort bekam dieser sofort eine völlig neue Tragweite. Am frühen Abend brach ich dann auf nach Kreuzberg 61 und fuhr ein erstes Mal mit der U1 in Richtung Hallesches Tor. Von dort fünf Gehminuten entfernt, Tempelhofer Ufer 6, erster Hinterhof, Aufgang links, hier wohnten Gabi und Andreas, alte Bekannte aus der schwäbischen Heimat. Er war ein alter Klassenkamerad und schon ein paar Jahre in Berlin, um hier irgendwas mit Design zu studieren.
Aus der Wiedersehensfreude wurde allerdings nichts, da die beiden gerade irgendwo mediterran auf Reisen waren. Umso mehr freute es mich, dass sie mir ihre Wohnung für ein paar Tage anboten und ich endlich wieder ein Dach über dem Kopf hatte. Die verabredete Schlüsselübergabe verlief problemlos, und so stand ich einen Moment später schon in der Küche, kochte mir einen Kaffee, stellte das Radio an und legte mich auf die Couch, um das Erlebte Revue passieren zu lassen.
Irgendwie ging mir Annette nicht aus dem Kopf. Wohlbehütete junge Frau aus bürgerlich münsteranerischen Verhältnissen und dann dieser Typ. War da etwa so was wie Neid? Aber egal, ich riss mich zusammen, beruhigte mich mit einem Bier und dachte schon an den nächsten Tag. Montag stand so einiges auf dem Programm. Immatrikulation für den Studiengang Geografie vormittags an der Freien Uni und dann sofort zur TU-Mensa, Wohnungssuche auf dem Schwarzen Brett. Endlich wieder Bewegung, eine leichte Spannung, es fühlte sich gut an.
Wohnungssuche – Nochmal Glück gehabt
Früh um acht am nächsten Morgen. Ein schnelles Frühstück mit Kaffee, Toast und Marmelade, und schon machte ich mich auf den Weg zum U-Bahnhof. Mit der U1 ging's zuerst zum Wittenbergplatz, dort dann Umstieg in die U2 zur Krummen Lanke.
Der schnöde Alltag hatte uns wieder, und die Atmosphäre in der gut gefüllten Bahn brachte das nur zu gut zum Ausdruck. Die meisten lasen Zeitung, ein Buch oder sonst irgendwas. Andere wieder träumten so vor sich hin oder schauten betreten zu Boden, bloß keine Blickkontakte, nur keine Irritationen. Kaum Gespräche, Stille, die nur durch das nervige, andauernde Schienengerattere gestört wurde.
Endlich erreichten wir den U-Bahnhof Dahlem-Dorf. Ich stieg aus und musste erstmal durchatmen. Dann draußen auf dem Uni-Campus angelangt, der kulturelle Gegenentwurf: Überall studentisches, umtriebiges und internationales Treiben. Jeans und bunte kurzärmlige T-Shirts bestimmten hier die Szene. Berlin war wieder weit weg. Nicht weit entfernt, direkt um die Ecke, war das Verwaltungsgebäude der Freien Universität.
Drinnen winkte mich der zuständige Sachbearbeiter nach halbstündiger Wartezeit zu sich rein, und wir gingen nochmal im Schnelldurchlauf meinen bereits ausgefüllten Immatrikulationsantrag durch. Alles war soweit in Ordnung, und so saß ich eine Stunde später schon wieder in der U-Bahn. Nächste Station: TU-Mensa in der Harden-bergstraße. Das berühmt-berüchtigte Schwarze Brett, vor dem mich Andreas bereits gewarnt hatte.
Es war so mittags gegen eins, und von überall her strömten Studenten in die Mensa und warteten in mehreren Schlangen geduldig auf ihr Essen. Irgendwie tickte das hier anders. Es war eben die Technische Uni, und ich bildete mir ein, hier mehr diesen vermeintlich technisch orientierten männlichen Typus vorzufinden. Aber ganz sicher war ich mir da auch nicht, und wer ist schon frei von Vorurteilen. Und auch hier auffällig viele ausländische Studenten. Vornehmlich Exil-Iraner, die wohl nach dem Sturz des Schahs 1979 durch Khomeini ins Ausland flüchten mussten.
Nach einem schnellen Kaffee und anschließender kurzer Suche im Foyer sah ich es dann, und mir wurde nicht zu viel versprochen. Ein schwarzes Aushängebrett gigantischen Ausmaßes, bestimmt zwei mal zehn Meter groß, und überall waren wahllos Zettel mit Reißzwecken angepinnt. Es dauerte eine Weile, bis ich den Abschnitt der Zimmer- und Wohnungsgesuche fand. Nach längerem Durchsuchen notierte ich mir vielleicht zehn Kontakte und verließ die Mensa wieder, um die nächste Telefonzelle aufzusuchen, die direkt am Eingang stand.
Und schnell machte sich jetzt Ernüchterung breit. Einige Anbieter waren schlichtweg nicht erreichbar, und für andere war ich, nachdem erst mal alles gut zu sein schien, einfach zu alt mit meinen 27 Lenzen. Ein letzter Anruf schien dann aber doch noch vielversprechend zu werden. Eine Ingrid war am Apparat und teilte mir mit, dass sie für den Nachmittag einige Vorstellungstermine in ihrer 7-Zimmer-WG anberaumt hätte und dass um 18 Uhr noch was frei wäre. Erleichtert sagte ich spontan zu, und ich glaube, sie bemerkte meine Freude darüber.
Ein kurzer Abstecher danach zum Ku’damm war da schon eher etwas befremdlich, und ich merkte schnell, dass ich dort so gar nicht hingehörte. Gespannt stand ich so gegen fünf dann wieder am Bahnhof Zoo und nahm die Wannsee-S-Bahn nach Nikolassee.
Ich nutzte die halbstündige Fahrt, um mich schon mal ein bisschen zu sortieren, und schaute voll inniger Freude auf den vorbeiziehenden, lichtdurchfluteten Grunewald. Viele Eichen, Kastanien und Ahorne und noch viel mehr Kiefern säumten unseren Weg. Vereinzelt sah man Spaziergänger in leichter Sommerbekleidung, die das schöne Wetter sichtlich genossen und ohne Eile durch den Wald schlenderten. Das Geratter und Getöse der alten Bahn aus den Zwanzigern mit ihren nicht sehr bequemen Holzbänken hatte dabei was sehr Beruhigendes. Langsam näherte sich der Zug Nikolassee. Wir waren im kleinstädtisch geprägten Zehlendorf angekommen, und ich hatte sofort das Gefühl, hier nicht mehr so richtig in Berlin zu sein. Punkt sechs erreichte ich mein Ziel. Studentendorf Schlachtensee, Wasgenstraße 75, Haus 27, dritter Stock. Die ganze Anlage schien aus den frühen Siebzigern zu stammen. Etwas lieblos, aber funktional zubetoniert, entsprach sie der typischen Bauweise aus jener Zeit. Dieser Eindruck setzte sich dann leider auch im Treppenhaus fort. Bestimmt kein Ort zum längeren Verweilen.
Ich klingelte oben und die blaugrün lackierte Tür öffnete sich. Da stand sie, Ingrid, dunkelhaarig, gutaussehend. Mit einem Lächeln begrüßte sie mich und bat mich herein. Sie war eine rheinische Frohnatur, ein echtes kölsches Mädche so um die 20. In der Küche, sie machte einen Kaffee, saßen wir dann eine Weile, und es war diese Art von Begegnung, wo man sich sofort wohlfühlte.
Wir redeten so über dieses und jenes, und was sie bewogen hatte, nach Berlin zu kommen, wollte ich wissen. In Köln ließe sich Psychologie doch bestimmt auch gut studieren. Sie quittierte es mit einem Lächeln und berichtete lieber von den sieben Mitbewohnern in der WG und davon, dass es manchmal schon sehr anstrengend wäre mit so vielen Leuten. Dazu ständig Gäste in Feierlaune auf engstem Raum, die oft bis in die Morgenstunden blieben. Das sei nichts für Ruhebedürftige, warnte sie mich. Ich erwiderte ihr, dass ich nichts anderes suchen würde. Zu guter Letzt wollte sie natürlich auch noch wissen, was es mit meinem für einen Studienanfänger doch eher unüblichen Alter auf sich hatte. Ich erzählte ihr vom Abbruch meines Jurastudiums und dass ich danach zu einem Freund nach Riedlingen gezogen bin, um Gewächshäuser in der Gärtnerei seiner Freundin zu bauen. Und von den sich allabendlich anschließenden Trinkgelagen und meiner sowieso allgemeinen Orientierungslosigkeit in diesen Jahren.
Ingrid lächelte ein wenig und war durchaus amüsiert, sie zeigte offenbar Verständnis. Plötzlich ging die Tür auf, und zwei weitere Damen des Hauses gesellten sich zu
uns. Juliane und Silke stellten sich vor und begutäugelten mich eher beiläufig, aber durchaus wohlwollend.
So gegen sieben verabschiedete ich mich dann mit einem intuitiv guten Gefühl. Ich war mir sicher, Ingrid und ich, wir mochten uns. Ziemlich aufgewühlt und voller Freude ging mir so vieles durch den Kopf auf der Rückfahrt zu meinem Kreuzberger Domizil, die gefühlt eine halbe Ewigkeit dauerte. Und ich ahnte auf einmal, wie groß Berlin wirklich ist.
Wie verabredet rief ich Ingrid am Tag danach an, und schon im ersten Augenblick war es klar. Sie hatten sich für mich entschieden, und ich konnte im Oktober einziehen. Eine große Last fiel von mir ab. Ich war angekommen in meiner neuen Stadt, in meinem Sehnsuchtsort Berlin.
Studentendorf Schlachtensee 1984 - 1986
Die Wohngemeinschaft – Geschlafen wird tagsüber
Am 1. Oktober 84, ich glaube, es war an einem Mittwoch, kam ich nachmittags nach zehnstündiger Fahrt aus dem Süden ziemlich erschöpft in Berlin an. Qualvoll lange Stunden auf der Autobahn und gefühlt ebenso langes Warten an den Grenzübergängen Rudolphstein und Dreilinden machten das Ganze zum Härtetest. Und auch an meinem geliehenen und bis an die Oberkante vollgepackten, leicht überladenen VW-Bus ging diese Tortur wahrscheinlich nicht spurlos vorbei. Einen großen Anteil daran hatte der katastrophale Zustand der DDR-Autobahn aus Vorkriegszeiten, die noch in alter Betonplattenbauweise zu bestaunen war.
Aber endlich war es so weit. Ich war wieder in West-Berlin, und angelangt auf dem großen Parkplatz vor dem Studentendorf Ecke Wasgenstraße stellte ich den Bus ab und war erleichtert. Glücklich und auch ein wenig angespannt ging ich ins Haus, klingelte und Ingrid öffnete mir. Da war es wieder, dieses einladende, offene Lächeln, irgendwie sofort wohlfühlend vertraut, als würde man sich schon eine halbe Ewigkeit kennen. Passiert nicht alle Tage, dachte ich so bei mir. Sie zeigte mir sofort den kompletten Wohnbereich und mein neues Zimmer. Und auch wenn die in ausnahmslos blaugrün gehaltenen Türen und Fensterrahmen nicht so ganz überzeugen konnten, war ich doch sehr angetan von den gebotenen drei mal vier Metern Grundfläche. Für den Start war es absolut ausreichend, mehr brauchte ich nicht. Platz genug für eine Matratze, Tisch, Stuhl und eine Stereoanlage mit großen, selbstgebauten Boxen.
Zurück wieder in der Küche, die Kaffeemaschine lief schon auf Hochtouren, da kamen ein paar Augenblicke später Silke, Juliane und Aneta aus ihren Zimmern. Und anders als bei der ersten Begegnung zeigten sich die Frauen jetzt deutlich interessierter, es ging ja schließlich jetzt auch um meinen konkreten Einzug.