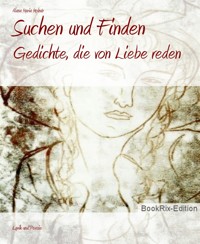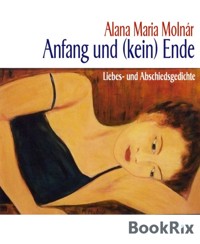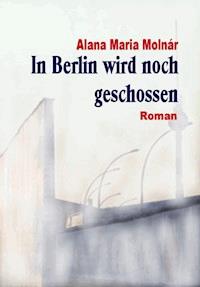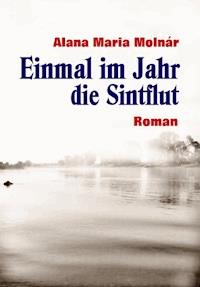
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben in einem Dorf im Nordosten Ungarns in den Jahren 1956–1965. Den Krieg kennt meine Generation nur noch vom Hörensagen, die Hungerjahre unmittelbar danach hat sie nicht erlebt; auf dem Land gab es immer reichlich zu essen. Das tägliche Leben wird von den Jahreszeiten und der Arbeit auf den Feldern, im Garten, im Haus und Hof bestimmt. Die Strukturen der Großfamilie sind noch lebendig, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Die Auswirkungen des Aufstandes 1956 (in der offiziellen Sprache "Konterrevolution" genannt) bekommt fast jede Familie zu spüren, auch in der Provinz. Im Geschichtsunterricht wird das Thema erst Mitte/Ende der 1960-er Jahre vorsichtig behandelt. Sonst funktioniert die politische Schizophrenie im Alltag tadellos: Die Parteifunktionäre lassen ihre Kinder zwei-drei Dörfer entfernt in der Kirche taufen und wenn diese das heiratsfähige Alter erreichen, erhalten sie eben noch ein Dorf weiter den priesterlichen Segen zur Eheschließung. In der Familie Márton herrscht größte Einigkeit der Ansichten und Werte: Der Vater ist nach eigenem Bekennen Atheist (und stolzer Besitzer des Parteibüchleins samt Abzeichen, das er stets am Revers seiner Jacke zur Schau trägt), die Großmutter praktizierende Katholikin (und erbitterte Gegnerin von allem "Rotgefärbten") und die Mutter steht mit allem Mystischen auf Du und Du (sie stammt aus Siebenbürgen und ist trotz ihrer "Spinnerei" die bodenständigste von Allen).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alana Maria Molnár
EINMAL IM JAHR
DIE SINTFLUT
Roman
Imprint Einmal im Jahr die Sintflut - Roman Alana Maria Molnár published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de Copyright: © 2012 Alana Maria Molnár ISBN 978-3-8442-3674-3
Das Leben in einem Dorf im Nordosten Ungarns in den Jahren 1956–1965. Den Krieg kennt meine Generation nur noch vom Hörensagen, die Hungerjahre unmittelbar danach hat sie nicht erlebt; auf dem Land gab es immer reichlich zu essen.
Das tägliche Leben wird von den Jahreszeiten und der Arbeit auf den Feldern, im Garten, im Haus und Hof bestimmt. Die Strukturen der Großfamilie sind noch lebendig, mit all ihren Vor- und Nachteilen.
Die Auswirkungen des Aufstandes 1956 (in der offiziellen Sprache "Konterrevolution" genannt) bekommt fast jede Familie zu spüren, auch in der Provinz. Im Geschichtsunterricht wird das Thema erst Mitte/Ende der 1960-er Jahre vorsichtig behandelt.
Sonst funktioniert die politische Schizophrenie im Alltag tadellos: Die Parteifunktionäre lassen ihre Kinder zwei-drei Dörfer entfernt in der Kirche taufen und wenn diese das heiratsfähige Alter erreichen, erhalten sie eben noch ein Dorf weiter den priesterlichen Segen zur Eheschließung.
In der Familie Márton herrscht größte Einigkeit der Ansichten und Werte: Der Vater ist nach eigenem Bekennen Atheist (und stolzer Besitzer des Parteibüchleins samt Abzeichen, das er stets am Revers seiner Jacke zur Schau trägt), die Großmutter praktizierende Katholikin (und erbitterte Gegnerin von allem "Rotgefärbten") und die Mutter steht mit allem Mystischen auf Du und Du (sie stammt aus Siebenbürgen und ist trotz ihrer "Spinnerei" die bodenständigste von allen).
Die Autorin:Übersetzerin für die ungarische Sprache und bildende Künstlerin, lebt seit 1972 in Berlin.
„Jedermann erfindet sich früher oder später
eine Geschichte, die er für sein Leben hält.“
Max Frisch
Für meine Eltern
Letzter Arztbesuch
Beim Einsetzen meiner ersten eigenen Erinnerungen bin ich knapp fünf Jahre alt. Mein Großvater ist neunundfünfzig und krank. Er ist so krank, daß er im Bett liegen bleiben muß, er ist halbseitig gelähmt. Weder die rechte Hand noch den rechten Fuß kann er bewegen, er spüre darin nichts, sagt er, nur eine große Kälte. Doktor Horváth kommt zweimal die Woche zum Großvater, um ihn zu behandeln. Feri, der Barbier auch, nur an anderen Tagen als der Arzt. Feri hat ein Friseurgeschäft in der Hauptstraße, eine kleine dunkle Kammer mit immer schmutzigen Fensterscheiben. Während er Hausbesuche macht, bedient seine betagte Mutter die Kundschaft; rasieren und Haare waschen kann sie schließlich auch. Feris gewellte blonde Haare duften nach Pomade, sein rosiges Gesicht ziert eine noch rosigere Nase und er bringt immer gute Laune mit. Mit ihm weht ein frischer Wind ins Krankenzimmer, das eigentlich die Wohnküche meiner Großeltern ist.
Wie ein Zauberer im Varieté holt Feri ein großes Tuch aus seiner Tasche, die ein bißchen wie die Arzttasche von Doktor Horváth aussieht, nur daß sich ab und an eine sorgfältig verkorkte Flasche zwischen die Utensilien seiner Zunft verirrt. Die Flasche sieht genauso aus wie die, die Großmutter für zahlende Kundschaft im Weinkeller abfüllt.
Feri wedelt ein paarmal mit dem blütenweißen Tuch, bevor er es Großvater umbindet. Großvater sitzt jetzt aufrecht im Bett, im Rücken von mehreren Kissen gestützt. Inzwischen hat Großmutter schon warmes Wasser in die Schale gegossen, die Feri aus den Untiefen seiner Tasche hervorgezaubert hat. Dann kommt der große Auftritt des Figaro: Mit lockeren Bewegungen aus dem Handgelenk rührt er Seifenschaum in der Schale an, vorher hat er das ausklappbare Rasiermesser an einem Lederriemen geschärft. Ich halte jedesmal vor Spannung die Luft an, wenn Feris Messer an Großvaters faltigem Hals und an dem hervorstehenden Adamsapfel hinauf- und hinuntergleitet.
Am Nachmittag kommt wieder Doktor Horváth zum Großvater. Großmutter schickt mich wie immer hinaus.
»Du kannst bald wieder hereinkommen«, sagt sie, »wenn der Herr Doktor fertig ist.«
Vor der Tür lausche ich auf jedes Geräusch. Ich höre Großvater stöhnen. Als der Arzt weg ist, tröste ich ihn damit, daß ich ihn garantiert heilen werde, weil der Doktor das offensichtlich nicht kann.
Früher als sonst schläft Großvater an diesem Abend ein.
»Sei leise, wenn du hinausgehst«, ermahnt mich Großmutter, »ich bin froh, daß er jetzt schläft und keine Schmerzen spürt.«
Großvater ist gegangen
Großvater liegt auf dem kalten Fußboden der guten Stube. Sein Kinn ist mit einem Tuch hochgebunden. Wie bei dem Hasen mit Zahnweh in meinem neuen Bilderbuch. Aus dem Bett kann er nicht gefallen sein.
Das schwarzgestrichene Eisenbett, in dem er die letzten anderthalb Jahre gelegen hat, steht in der Wohnküche, Fuß an Kopf zum Zwillingsbett der Großmutter, gleich neben dem alten, emaillierten Herd. Der Herd hat auf der Oberseite drei Platten in unterschiedlicher Größe und jede Platte hat eine kleine Mulde, in die man mit dem Schürhaken hineinlangen kann, um die Platte abzuheben. Das hat Großvater immer beim Feueranmachen getan. »Damit das Feuer Luft bekommt«, erklärte er mir.
Jetzt aber sagt er gar nichts, obwohl ich ihn schüttele und rüttele, er soll vom kalten Fußboden endlich aufstehen. Er holt sich noch den Tod. Das sagt Großmutter immer, wenn meinem kleinen Bruder irgendwas nicht paßt, sich auf den Boden schmeißt und brüllt.
Nur Großvater sagt nichts.
»Wer hat Júlia in die Stube gelassen?«
Die Tonlage der Mutter ist so hoch, daß es in den Ohren schmerzt. So hört sich ihre Stimme an, wenn sie wütend ist, in der Küche steht und nach etwas Ausschau hält, was sie auf den Fußboden werfen könnte. Manchmal findet sie auch was, dessen Zertrümmerung ihr nicht leid tut. Meistens aber schleicht sie nach dem Anfall geknickt im Hof herum und trauert um das gute Stück Geschirr oder den verbeulten Kochtopf.
Jetzt scheint die Ursache der bedrohlichen Stimmlage der qualmende Herd zu sein, denn sie hat mich aus der guten Stube der Großeltern in die Küche gezerrt. Mutter stochert im Herd und im Nu ist die Küche voller Rauch. Der kriecht mir in die Nase und von dort in die Kehle, daß ich husten muß.
»Ihr könnt alle nicht heizen«, hustet auch Vater, der gerade hereinkommt. Er sieht wieder mal nach dem Rechten. Er öffnet ein wenig die Tür vom Herd, schiebt den Regler von links nach rechts und zurück, mit dem Ergebnis, daß noch mehr Rauch aus dem Inneren des Herdes herausquillt. Der Qualm kriecht durch alle Ritzen.
»Der Schornstein ist verstopft und der Herd müßte neu ausschamottiert werden«, bemerkt Mutter, »das bete ich seit Jahren schon vor«.
»Was versteht ihr davon«, blafft Vater sie an.
Wer sonst noch außer Mutter gemeint ist, kann man bei Vater nie genau wissen, er tadelt immer im Plural.
»Was macht Großvater auf dem Fußboden?« frage ich dazwischen, bevor die Eltern erneut zum Streit ansetzen, der manchmal Marathonlänge erreichen kann.
»Nichts«, antwortet Vater und dreht sich weg.
»Wieso erklärst du es deiner Tochter nicht?« hakt Mutter nach und das ist das Stichwort für Vater. Wie im Theater: die Akteure brauchen eine Merkstelle, an der sie wissen, daß jetzt ihr Einsatz kommt. Damit das Stück weitergehen kann. Meine Eltern haben viele Stücke für das Familientheater, in dem jeder eine feste Rolle mit festen Stichwörtern hat. Mein Bruder und ich sind Statisten, Zuhörer und Zuschauer in einem und je älter wir werden, bedenken uns die Eltern zunehmend mit kleineren Nebenrollen.
»Sag du es ihr, wenn du es besser weißt«, nimmt Vater sein Stichwort auf und beeilt sich, aus der Küche zu kommen. Anstatt die Tür offen zu lassen, damit der Rauch abziehen kann, knallt er sie zu, daß die Scheiben scheppern. Und damit es keinem einfällt, ihn mit weiteren lästigen Fragen zu löchern, schlägt er auch noch die dicke fensterlose Außentür aus Holz zu.
»Wir müssen Großvater wecken, sonst holt er sich noch den Tod«, sage ich.
»Den hat er schon«, antwortet Mutter und erschrickt.
Draußen schimpft Großtante Klára, dem Anlaß entsprechend halblaut, mit Vater.
»Nicht mal jetzt, wo doch dein Vater tot ist, könnt ihr euch anständig benehmen!«
Ihr Spitzmausgesicht ist noch spitzer und der Mund noch schmaler als sonst, die Augen noch mehr gerötet. Sie quetscht sich ein paar Tränen aus den Wimpern. Sie beweint ihren Schwager, weil es sich so gehört. Den jüngeren Bruder ihres Mannes konnte sie nie richtig leiden, obwohl die beiden wie Zwillingsbrüder aussehen: groß, hager, weißhäutig, schwarzhaarig und blauäugig, beide tragen kleine Bärtchen unter der Nase, wie die kleinsten Bürsten in unserer Putzkiste, mit der man die Wichse auf die Schuhe schmiert.
Meine kleine und runde Großmutter kann ihren Schwager auch nicht leiden, aber sie kann den Grund, im Gegensatz zu Großtante Klára, angeben: Großonkel János hat nämlich ein kaltes Herz. Das hat Großmutter mit ihrer analytischen Spürnase herausgefunden.
»Wie der Mann im Märchen, du weißt«, sagte sie zu mir. Das Märchen hat sie mir nicht nur einmal vorgelesen, als ich noch nichts davon begreifen konnte.
Also geht es in der Großfamilie stets gerecht zu und jedes einzelne Mitglied hat eine mehr oder weniger unerschütterliche Position inne. Mittels kleinerer und größerer Teufeliaden kann ein jeder auf der traditionellen Leiter eine Stufe höherklettern, dafür steigt ein anderer eben eine Stufe tiefer. Die Justitia der Großfamilien ist nicht blind wie die Göttin der Gerechtigkeit: sie guckt bei den ewigwährenden Zänkereien einfach weg. Aber sie weiß, was vor sich geht und sorgt dafür, daß jeder seine Strafe kriegt. Früher oder später.
Großonkel János kriegte seine Strafe ziemlich spät dafür, daß er meinen Großeltern, meinen Eltern und damit auch uns, die Hälfte des Grundstücks, auf dem das Haus der Urgroßeltern heute noch steht, unter unserm Hintern weg verkauft hat. Er leidet an der Vergeßlichkeitskrankheit, heute sagt man Alzheimer dazu. Zum Schluß, denn er wird über neunzig, weiß er nicht einmal mehr, wer er ist. Das aber ist kein Trost für die Großmutter und die Eltern, sie grämen sich jeden Tag wegen der neuen Nachbarn, die nicht zur Großfamilie gehören und ihr Haus unverschämterweise genau vor unsere Nase gebaut haben, nur mit zwei Winzlingfenstern zu uns hin, obwohl zur anderen Seite jede Menge Platz ist. Großmutter wird es später tröstlich finden, daß Großvater das neue Nachbarhaus nicht mehr habe sehen müssen.
Er liegt immer noch auf dem kalten Fußboden und keiner kümmert sich um ihn. Auch um mich nicht, so kann ich mich auf die Suche nach Großmutter machen. Wenn Mutter und Vater als Fragequellen versiegen, bekomme ich von der Großmutter wenigstens eine Antwort. Ich finde sie im Stall.
Der einzige Ort, an dem sie Ruhe finde, sagt sie. Sie brauche Ruhe zum Weinen. Ihre Augen sind anders rot als bei Großtante Klára, das Weiße ihrer Augen ist rot, sogar das helle Wasserblau ist mit roten Äderchen durchzogen.
»Mein Einziger, mein Liebster«, schluchzt sie, »warum hast du mich verlassen?«
»Großvater liegt in der guten Stube und wird sich erkälten«, sage ich. Großmutters Weinen geht in ein langgezogenes Jammern über. Den Ton kenne ich.
Großmutter nimmt mich nämlich heimlich, Mutter und Vater dürfen es nicht wissen, als Verstärkung zu Sterbebegleitungen mit. Verschrumpelte Mütterchen in schwarzen Kleidern und mit schwarzen Kopftüchern hocken auf Stühlen, die um das Bett herum aufgestellt sind. Dunkle, leise murmelnde Raben mit raschelndem Rosenkranz in den Händen. Perle um Perle rieselt durch die knotigen alten Finger, die Lippen formen kaum hörbare Gebete. Dazwischen das vorsichtige Kommen und Gehen von Angehörigen. Fast alle beugen sich zum Bett hinunter, flüstern etwas und gehen dann auf Zehenspitzen hinaus.
Dann kommt ein Seufzen vom Bett herüber. Die Raben hören auf zu rascheln und zu lispeln. Derjenige, der am Kopfende des Bettes sitzt, schließt die Augen des Toten. Eine Stille im Raum, die man kaum beschreiben kann. Es ist wie das leise Schlagen von Vogelflügeln, aber aus der Ferne. Große weiße Vögel stelle ich mir dabei vor, die die Seele wegtragen. Das habe ich auf einer Abbildung in Büchern gesehen. Ich spüre die Anwesenheit von etwas, was ich nicht benennen kann, was mir aber keine Angst macht und nach einer Weile wird es kalt im Zimmer.
Die verhalten betenden Raben erheben ihre Stimmen, sie fangen an zu jammern und zu wehklagen. Es ist kein richtiges Weinen und immer wieder gleich. Sie beklagen den Weggang des soeben Dahingeschiedenen und vermeiden das Wort Tod. Von Jenseits und Himmel ist die Rede und immer wieder von Gott, bei dem der Entschlafene gut aufgehoben sei, hoch oben, im Himmel.
»Und was ist mit dem Fegefeuer?« frage ich Großmutter.
Sie erzählte mir doch, daß Gestorbene zuerst dorthin kämen und daß es sich dort entscheidet, ob man im Himmel bei den Engeln Harfe spielen darf oder unten in der Hölle schmoren muß.
»Nicht jetzt«, wimmelt mich Großmutter ab, »das erzähle ich dir später«.
Dann wird der Dahingeschiedene gewaschen und für den letzten Gang angekleidet. Das Waschen und Ankleiden darf ich nicht mehr sehen, Großmutter sagt, das sei nichts für mich. Die Alten, die dem Jenseits schon näher seien als dem Diesseits, könnten das ruhig machen, denen mache das nichts aus und die meisten der Totenwäscherinnen hätten ihre Sterbehemden längst schon in der Kleidertruhe. Großmutter geht vor der Waschung jedesmal mit mir weg. Sie ist nicht so alt, daß sie für diese Dienste in Frage käme.
»In der Nacht«, sagt jetzt Großmutter, »ist er dahingegangen.«
»Warum hast du mich nicht geweckt?« frage ich.
»Das ist nichts für Kinder.«
Ich werde ihr nie verzeihen, daß ich Großvater nicht sehen durfte, bevor er starb. Das aber beschließe ich erst später, jetzt glaube ich noch, daß er wieder aufsteht, sich die lächerliche Hasenzahnwehbinde vom Kopf reißt, mich auf die Schultern hebt, um mit mir auf dem langen Flur entlangzugaloppieren. Ich glaube noch nicht, daß ich nicht mehr meine behandschuhten Hände über der Herdplatte ganz heiß werden lassen kann, um seine kalte und gelähmte rechte Seite zu wärmen. Ich glaube noch, am nächsten Abend sein Gesicht durch die hochliegende Fensterscheibe der Tür wieder zu sehen, die die Wohnküche meiner Eltern von der guten Stube der Großeltern trennt; nur um noch einmal nach mir zu sehen. Damit ich gut schlafe, denn mein Kinderbett steht vor dieser Tür.
Mein Großvater wird aufgebahrt. Er liegt auf zwei zusammengestellten Tischen, so hoch, daß ich ihn nur sehen kann, wenn ich auf einen Hocker steige. Die schwarzen Raben sind jetzt überall im Haus, sie haben den dreiteiligen Spiegel mit einem Tuch verhängt. Damit Großvater keinen Schrecken bekomme, wenn er in den Spiegel schaut, sagen sie. Dann kann er also doch aufstehen, denke ich mit heimlichem Triumph, er tut nur so, als wäre er tot.
Am selben Nachmittag bringen vier Männer eine große Holzkiste mit Goldverzierung und legen Großvater hinein und er läßt das alles mit sich geschehen. Über Nacht liegt er darin. Am nächsten Tag kommen viele Menschen und der Priester und tragen Großvaters Sarg auf den Friedhof. In ein tiefes Loch wird die Kiste hinuntergelassen und die ausgehobene Erde darübergeschaufelt. An einem Ende des Hügels, aus der Erde entstanden, die nicht mehr in das Loch hineinpaßt, stecken sie ein Holzkreuz mit goldenen Buchstaben.
Vater sagt, daß der Name von Großvater darauf steht und die zwei Zahlen bedeuten das Jahr, in dem er geboren wurde und das, in dem er gestorben ist.
Mein Großvater, József Márton, der Vater meines Vaters, ist mit 59 Jahren gestorben. Er hat von 1897-1956 gelebt.
Großmutter geht jetzt jeden Tag auf den Friedhof und ich gehe mit, helfe ihr Blumen auf Großvater zu pflanzen und beim Gießen bin ich besonders eifrig. Es könnte ja sein, daß er aus den Blumen herauswächst. Obwohl ... ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wieviel Erde sie über ihn geschaufelt haben.
Vater und Mutter kriegen heraus, daß Großmutter mich im zarten Alter von vier-fünf Jahren zu den Totenwachen mitnimmt.
»Und jetzt schleppt sie das Kind auch noch jeden Tag auf den Friedhof«, murrt Vater.
»Sie geht freiwillig mit«, versucht Mutter zu schlichten, Vater aber läßt sich nicht mehr bremsen. Er flucht, daß das zarte Grün der Bäume im Garten errötet.
»Sie machen das Kind noch völlig fertig, mit Ihrer Gottanbeterei und mit dem ganzen Kirchenhokuspokus«, beschimpft er die Großmutter.
Die Höflichkeit seiner Generation, und das nicht nur in einem kleinen Dorf wie unseres, schreibt das Siezen der Eltern vor. Diese Ehrerbietung ist für Vater aber kein Hinderungsgrund, um mit seiner Mutter abzurechnen. Von der Kirche hält er nichts, von den verlogenen Pfaffen noch weniger und das Gotteshaus habe er seit seiner Eheschließung nicht mehr betreten. Worauf er stolz sei.
Die Hochzeit meiner Eltern fand im Kriegsjahr 1944 statt, in einer idyllischen kleinen Kapelle in Buda, von der Vater später mit mehr Wohlwollen spricht als jetzt von der Kirche im allgemeinen. Er ist ein überzeugter Atheist, betont er bei jeder Gelegenheit.
»Ein Ungläubiger«, sagt Großmutter verächtlich.
»Was ist ein Ungläubiger, Großmutter?«
»Das ist einer, der nicht an Gott glaubt und nicht betet und nicht in die Kirche geht. Dafür wird Gott ihn strafen.«
Großmutter sät manch unguten Samen in meinen aufnahmebereiten Kindesacker. Es kostet mich in Erwachsenenjahren viel Mühe, die vielen Kukuckspflanzen von den eigenen zu unterscheiden. Aber Großmutter sät auch eine Menge Praktisches. Das Nützliche allerdings ist nicht geistiger Natur. Großmutter ist die Hüterin von Traditionellem und Wichtigem, sie kann fast alles, was man mit zwei Händen bewerkstelligen kann und schenkt großzügig ihr Wissen der Enkelin.
Die Mutter meiner Mutter starb, als Mutter sechs Jahre alt war und die Stiefgroßmutter, die nur ein kurzes Gastspiel bei uns gab, war eine alte Hexe und geisterte eine ganze Weile nur als böses Gespenst in den Erzählungen meiner Mutter. Leibhaftig erscheint sie erst später auf der familiären Bildfläche.
Dörfliche Idylle
Der Ort, wo sich das Bisherige und fast alles Spätere abspielt, ist ein Dorf im Nordosten Ungarns. Unser Dorf ist viel größer als andere in der Gegend. Die anderen bestehen nur aus einer langen Hautpstraße: Man fährt an dem einen Ende hinein, dann immer geradeaus und wenn das zweite Ortsschild im Blickfeld auftaucht, ist man auch schon wieder draußen.
Unser Dorf hingegen hat ein ganzes Gespinst aus Straßen und Gassen, die allesamt nach Dichtern und Freiheitskämpfern der zahlreichen Unabhängigkeitsbewegungen Ungarns benannt sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach den Helden des Arbeitskampfes und politischen Größen der jüngsten Geschichte. Die Hauptstraße, die genauso heißt wie alle Hauptstraßen der umliegenden Dörfer, ist die einzige asphaltierte, die anderen sind nur notdürftig befestigt. Kopfsteinpflaster gibt es bei uns nicht, größere und kleinere Kieselsteine ragen aus dem sandigen Boden hervor und rütteln die Pferdewagen ordentlich durch. Mit denen befördern die Bauern Heu, Mist, Saatgut, Korn, Mais, Kartoffeln und außerordentlich selten Ausflügler ins Grüne.
Glücklich ist, wer auf einem mit Heu und Stroh beladenen Wagen mitfahren darf. Der kommt sich vor wie ein König auf dem Thron, der obendrein noch auf vier Rädern von meistens zwei Pferden gezogen wird. Nur hin und wieder steigt der Dampf von frischen Pferdeäpfeln nach oben, aber das kann die Nase der Wagenmajestäten nicht beleidigen, denn gegen soviel duftendes Heu behauptet sich der Roßapfeldunst nicht lange; er ist im Nu auf und davon. Verflogen.
An den Hängen von zwei Gebirgen, Ausläufer der Karpaten, gedeiht ein guter Wein, der den Charakter der Umgebung bestimmt. Die meisten Bauern besitzen Weinfelder und große kühle Weinkeller in den traditionell gebauten, langgezogenen Landhäusern. Die meisten haben eine überdachte, mit einer meterhohen Mauer eingegrenzte und mit Säulen unterteilte Veranda, tornác genannt. Davor rankt bis zum Dachfirst Wein hoch, den man gleich zum Essen ernten kann, ohne auf die Felder zu gehen.
Der Wein spielt in unserer Gegend die Hauptrolle. Vom frühen Frühjahr bis zum Spätherbst werden die Rebstöcke gehätschelt, beschnitten, hochgebunden, vor Schädlingen geschützt, und der Boden wird zwischen den Reihen regelmäßig aufgelockert. Die Tage nach der Blüte, wenn die Beeren ansetzen, sind heikel, besonders, wenn es Spätfröste gibt. Ein stetiger Grund zur Sorge ist ein zu feuchter, warmer Sommer. Und wenn die ersten Trauben zu reifen beginnen, beten die Bauern, daß das Wetter bis zur Lese sonnig und trocken bleiben möge. Soviel Fürsorge lassen sie ihren Kindern selten angedeihen.
Auch nach der Ernte wird der Wein mit viel Aufmerksamkeit bedacht, wenn die Trauben gepreßt und der junge Wein in den großen Holzfässern gärt. Dann darf man nur mit einer brennenden Kerze in den Keller. Wenn die Flamme erlischt, empfiehlt es sich, schleunigst an die frische Luft zu gehen. Manch benebelter Winzer oder unbedachtes Kind überlebt eine solche Exkursion in den Hades der Weinkeller nicht.
Nachdem der junge Wein sich abreagiert hat, wird er domestiziert. Das ist die Hohe Schule des Kelterns. Hierbei entscheidet es sich, ob aus der Ernte des jeweiligen Jahres Weinessig oder ein Qualitätswein wird. Großonkel János keltert gewöhnlich Weinessig, behaupten Großvater und Vater einvernehmlich, und wenn dieser hin und wieder eine glückliche Hand an den Wein anlegt, kommt bestenfalls eine trübe hefige Brühe dabei heraus, bei der man die nachträgliche Zuckerung herausschmeckt. Großvater hatte mit Vergnügen über den Wein seines Bruders gelästert, dessen Kaufkundschaft hauptsächlich aus der oberen Region, aus dem Norden des Landes kam. Das waren Bergleute, die keine Ahnung von echter Qualität hatten.
Großvater bekam regelmäßig Besuch von Freunden, wenn der junge Wein bereits genießbar war. Er hatte im Spätherbst und Winter erstaunlich viele Freunde. Mit ihnen verschwand er am Vormittag im Weinkeller, tauchte vergnügt und mit einer verräterisch roten Nase zum Mittagessen auf, um danach wieder einen Ausflug in Gesellschaft in die Unterwelt zu wagen. Am Abend waren Großvater und Freunde nicht mehr ganz sicher auf den Beinen und kamen sie von außerhalb, konnte man ihre Rückreise nicht verantworten. Also blieben sie zum Frühstück am nächsten Tag. So erzählt es immer wieder Großmutter.
Unser Weinkeller, den Urgroßvater angelegt hat, ist vollständig erhalten. Die Wände sind mit großen Natursteinquadern gemauert, an denen entlang die Fässer in allen Größen aufgereiht sind. Auf den oberen Treppenstufen und einer Ablage überwintern die Geranien und von der gewölbten Decke hängen die gebündelten Knollen von Dahlien und Gladiolen. Auf halber Höhe des Treppenabgangs ist der kleine Kartoffelkeller. Hier hätten sich die Frauen in den letzten Kriegstagen versteckt, erzählt Großmutter, sie hatte man für ein paar Tage eingemauert. Und damit sie nicht erstickten, hatte man ein Loch durch die Decke des Kellers zur Kornkammer geschlagen, und ein Lüftungsrohr eingeschoben. Das Loch dort ist heute noch zu sehen.
Die Straße, in der unser Haus steht, hat zwar einen amtlichen Namen, sie wurde nach einem berühmten Dichter benannt, trotzdem kennt sie jeder im Dorf nur als Rübenzeile. Die Mártons stammen ursprünglich aus der ungarischen Tiefebene und haben dort offenbar Rüben angebaut. Ob Zucker- oder Futterrüben, das weiß niemand mehr oder will niemand es genau wissen; Wein zu kultivieren ist eine weit höhere Aufgabe als sich mit gewöhnlichen Rüben abzugeben. So erinnert nur noch der Spitzname an die einstige Hauptbeschäftigung meiner Vorfahren.
Vor fast allen Häusern der Straße steht die kleine Bank, der Ausruh- und Ausschauplatz der Alten. Am Sonntagnachmittag sitzt vor jedem Haus ein altes Mütterchen in Schwarz oder ein alter Mann mit blankgeputzten Stiefeln und Hut und lassen sich von den Vorbeigehenden grüßen.
»Ruhen Sie sich aus, Onkel János oder Tante Teréz?« fragen sie. Und obwohl sie sehen, daß die Alten offensichtlich nichts anderes tun als dort zu sitzen und sich auszuruhen, empfiehlt es die Höflichkeit, danach zu fragen. Vielleicht auch noch nach der werten Gesundheit, wobei der Fragende sich etwas mehr Zeit für die Antwort der Alten nehmen sollte, denn das Thema kann mit zwei, drei Sätzen nicht abgehandelt werden. Die kleine Bank der Alten ist wie ein Logenplatz im Theater, den man sich mit jahrzehntelanger mühevoller Arbeit verdienen muß. Und so kommt es, daß die Alten zwar nicht mehr viel in Haus und Garten tun können, von den Jüngeren bei wichtigen Entscheidungen dennoch gefragt werden: »Wie denken Sie darüber, Vater oder Mutter?«
Großmutter wird von meinen Eltern nicht gefragt, aber sie gibt ihre Kommentare auch ungefragt ab. Nach Großvaters Tod ist sie jetzt das altersmäßige Oberhaupt der Familie. Jedenfalls meint sie das und benimmt sich auch so.
»Was mischen Sie sich überall ein?«
Vater ist über Großmutters ungebetene Ratschläge ungehalten. Beleidigungen fliegen durch die Luft, vom Vater zur Großmutter hin und von der Großmutter zum Vater zurück. Vater flucht, Großmutter weint, Mutter versucht zu schlichten und obwohl sie Vaters Meinung ist, steht sie ihm nicht bei. Großmutter zieht sich zurück. Sie geht in ihre Wohnküche. Auf einem kleinen weißen Schränkchen, das früher als Ablageplatz für den Wassereimer diente, hat sie sich einen Hausaltar aufgebaut. Drei in zarten Farben bemalte Heiligenfiguren aus Biskuitporzellan stehen darauf und zwei hohe schmale Glasvasen, die immer mit Blumen gefüllt sind. Über dem Altar hängt ein kleines Holzkreuz. Großmutter kniet davor und betet. Anschließend beschwert sie sich, daß ihre Knie weh tun. Nach kurzer Zeit kommt sie mit geröteten Augen, aber gutgelaunt wieder heraus.
»Ihr habt die Ziege wieder nicht rechtzeitig eingesperrt«, bemerkt sie trocken und verschwindet im Garten.
Vater flucht wieder, weil er weiß, was das bedeutet: Die Ziege ist, da das Gartentor offensteht, wieder da drin gewesen und hat zum zigstenmal seine neue Weinzüchtung abgefressen. Merkwürdigerweise rührt das Tier nichts anderes an als diesen einen Rebstock mit den rötlichen Knospen, der solange die Ziege da ist, kaum eine Chance hat, stattliche Blätter, geschweige denn Früchte anzusetzen.
Die Enten sind tot
Mutter hat sich in den Kopf gesetzt, Enten großzuziehen. Sie überredet Vater, gleich fünfzig Küken zu kaufen. Der Hof ist groß genug, zu fressen haben sie auch. In den ersten Wochen bekommen sie gemahlene Maiskörner mit kleingeschnittenen Brennesseln und etwas Wasser vermischt. Die Brennesseln wachsen im Wassergraben hinter dem Haus.
Der Graben, Flachsdeich genannt, dient zum Einweichen von Flachsgarben. Wenn sie lange genug im Wasser liegen, kann man sie ausschlagen. Dabei lösen sich die Fasern, die sich - gesponnen - als Kettfäden beim Weben nützlich machen. Ein erbärmlicher Gestank überzieht den Graben und die Umgebung, aber hier wachsen die kräftigsten Brennesseln. Die Hände in Lappen gewickelt, gehen wir mit Großmutter Brennesseln schneiden.
»Schon wieder so eine neumodische Idee von deiner Mutter«, sagt sie. »Was muß sie jetzt auch noch Enten großziehen, hat sie nicht genug zu tun?«
Großmutter beschwert sich bei mir über Mutter und Mutter über Großmutter. Ich bin der Abladeplatz für beide, stehe dazwischen und kann mich nicht entscheiden, wer von den beiden recht hat.
Die Entlein gedeihen gut, werden zusehends größer. Niemand hat gemerkt, wann sie ihre gelben Flaumen gegen das weiße Federkleid getauscht haben. Ihr Appetit wird immer größer, und sie watscheln jedem erwartungsvoll entgegen, der den Geflügelhof betritt.
An einem Morgen kommt Mutter kreidebleich in die Küche. »Alle Enten sind tot«, sagt sie. »Es war bestimmt der verdammte Köter von Onkel Józsi.«
Der Onkel vom Nachbarhof ist ein entfernter Verwandter von Großvater. Er hält einen reinrassigen braunen Jagdhund, der hin und wieder, wenn er ein Loch im Zaun zwischen den beiden Gärten entdeckt, gerne die Hühner und anderes Vieh erschreckt. Ein verspielter junger Kerl, mit dem ich herumtoben kann, ohne daß er mir etwas tut.
Der von Mutter ausgesprochene Verdacht hängt in der Luft wie ein Damoklesschwert und wartet darauf, erhärtet oder entkräftet zu werden. Der einzige, der das kann und demzufolge auch muß, ist Vater. Er weiß, daß die Frauen von ihm erwarten, daß er zu Onkel Józsi geht und ihn zur Rede stellt. Vater erhebt sich umständlich vom Frühstückstisch und macht ein paar Schritte in Richtung Küchentür. Dann bleibt er abrupt stehen.
»Woher weißt du, daß der Hund es war?"«
»Ich weiß es nicht, ich dachte nur ...«
»Du solltest nicht denken, sondern nachsehen«, sagt Vater, seiner Wichtigkeit in der Situation bewußt.
Er geht mit energischen Schritten voraus, um eine Untersuchung vor Ort vorzunehmen. Großmutter, Mutter, mein Bruder und ich können ihm kaum folgen. Die Tür des Entenstalls ist offen, Mutter hatte sie vor Schreck nicht wieder verschlossen. Vater bückt sich, um sich am niedrigen Eingang nicht den Kopf zu stoßen. Gespannt warten wir auf das Ergebnis der Untersuchung. Vater läßt sich Zeit. Schließlich kommt er heraus, er trägt eine Ente im Arm. Dann geht er wieder in den Stall, bringt diesmal zwei Tiere mit und wiederholt den Vorgang einige Male.
»Haltet nicht Maulaffen feil«, knurrt er, »seht ihr nicht, daß ich Hilfe brauche? Los, packt mit an!«
Was er vorhat, erklärt er mit keinem Wort, wir können nur raten.
»Die Enten fühlen sich warm an«, bemerkt Großmutter. »Wenn sie tot wären, wären sie kalt."«
Vater erwidert nichts auf Großmutters Bemerkung. Als alle Tiere in Reih und Glied unter dem Maulbeerbaum liegen, stellt er den Gartenschlauch an. Mit einem nicht zu starken Strahl bespritzt er die Enten, so wie er im Garten das Gemüse und die Himbeersträucher sprengt.
Langsam kommt Leben in die Entenreihen. Das Gefieder verklebt und von den zerdrückten Maulbeeren bläulich gefärbt, versuchen sich die Tiere aufzurichten. Torkelnd und schnatternd machen sie die ersten Gehversuche. Die Richtung ist klar: der große Wassertrog. Sie drängeln sich um den Trog, purzeln hinein und versuchen wieder herauszukommen, was ihnen nicht gleich gelingt. Viele Schnäbel tauchen gleichzeitig in das erfrischende Wasser, die Enten schlagen immer munterer mit den Flügeln. Vater erneuert das Wasser so oft, bis die letzte Ente aus dem Trog heraus ist und wieder gerade gehen kann.
Wir, die Zuschauer, verstehen gar nichts. Mit Ausnahme meiner Mutter, die ein erschrockenes Gesicht macht. Durch das aufspritzende Wasser steigt uns allen der beißende Geruch von gärenden Früchten in die Nase. Neben der Tonne, in der Fallobst gesammelt wird, das sich später in der dorfeigenen Destille in hochprozentigen Obstler verwandelt, liegen noch ein paar Kirschen. Die Zeit der Kirschen ist aber schon vorbei. Wie kommen sie dorthin?
Plötzlich läuft vor meinen Augen der Film ab: Ich sehe meine Mutter frischgepflückte Sauerkirschen in einen großen Ballon füllen. Und in der nächsten Szene, wie sie den Inhalt ebendieses Ballons voller Wut auf den Geflügelhof kippt ... Sie hat ihre Kirschen, aus denen kein Schnaps, sondern ihr weit über die Grenzen unseres Dorfes bekannter Kirschwein mit dem klangvollen Namen Debrőer Rubin werden sollte, neben ihrer Feldarbeit vergessen. Das ist gestern gewesen, und wie mir, dämmert es auch dem Rest der Familie, was geschehen ist. Die Enten haben am Vortag die Früchte aufgefressen. Unsere Enten haben einen handfesten Alkoholrausch bekommen, der sie in einen todesähnlichen Schlaf versetzt hat.
Ausnahmsweise gibt Vater keinen Kommentar ab, er schaut nur Mutter an. Dann fängt Mutter an zu lachen. Es ist ein Lachen der Erleichterung, der Freude darüber, daß ihre Enten wieder wohlauf sind. Sie lacht, bis ihr die Tränen über die Wangen rollen.
»Und ich hab gedacht, der Hund von Onkel Józsi... Ein Glück, daß du nicht rübergegangen bist«, sagt sie zum Vater. Mutter lacht und weint gleichzeitig und Vater geht mit dem Schlauch in den Garten, denn er muß schließlich das Gemüse auch noch sprengen. Während er mit dem Rücken zu uns mit dem Wasserschlauch hantiert, sehen wir seine Schultern zucken. Selbst das Lachen verkneift er sich in unserer Gegenwart, wie auch andere Gefühlsregungen. Ich kann mich selten erinnern, seine streichelnde Hand auf meinem Kopf gespürt zu haben, niemals habe ich Tränen über seine Wangen rollen gesehen, nicht einmal, als Großvater gestorben ist.
Die betrunkenen Enten sorgen wochenlang für Gesprächsstoff in unserer Straße. Wir müssen wieder und wieder die Geschichte erzählen. Darüber, daß Mutter den Hund von Onkel Józsi verdächtigt hat, unsere Enten totgebissen zu haben, fällt kein Wort. Im Spätsommer werden die Enten bei der Aufkaufstelle für schlachtreifes Geflügel im Dorf abgegeben. Meine Mutter begleitet den Transport nicht und sie kauft nie wieder kleine flauschige Entchen, um sie großzufüttern.
Danach gibt es hin und wieder ein paar Gänse bei uns. Auf die Gänseküken, diesmal von Großmutter erstanden, muß ich aufpassen und mit ihr zusammen Brennesseln schneiden. »Die sind gut gegen Rheuma«, meint Großmutter, wenn wir mit feuerroten Händen und brennenden Beinen vom Sammeln zurückkehren. Daß ich mit meinen fünf Lebensjahren nicht unter rheumatischen Beschwerden leide, kommt ihr nicht in den Sinn.
Sie hat auch mit dem Stopfen der Gänse keine Probleme, sie nimmt schließlich nur Maiskörner, die sie vorher in erwärmtes Fett gerührt hat. Und sie bringt mir Gebete und Kirchenlieder bei, während sie mit der linken Hand den Schnabel der Gans aufhält und mit der rechten die Maiskörner einfüllt. Wenn der Schnabel voll ist, hält sie ihn mit einer Hand zu und mit der anderen streicht sie die Maiskörnerbeulen am Gänsehals nach. Sie wiederholt die Prozedur, bis jede Gans die von ihr vorgesehene Portion, meist nicht ohne Protest und Nachhelfen, geschluckt hat. Rebellische Vögel klemmt sie zwischen ihre Knie. Damit die Gänse den größtmöglichen Nutzen bringen, werden sie einmal im Sommer bei lebendigem Leibe und ein zweites Mal nach dem Schlachten gerupft. Mit den Federn füllt Großmutter Kopfkissen, mit den feinen Daunen Zudecken, für die sie aus festem Nesselstoff die Innenbezüge näht.
Großmutter kann überhaupt alles nähen. Früher, das war in den dreißiger Jahren, hat sie die Kleider für die beiden Schwestern von Großvater geschneidert. Sie waren damals in dem Alter gewesen, da junge Mädchen anfangen, auf Bälle zu gehen. Im Winter, wenn es auf den Feldern nicht mehr viel zu tun war, hat sie ganze Nähwochen veranstaltet. Es sollte sich schließlich lohnen, wenn man die Nähmaschine aufstellt, Schnitte aus der Versenkung holt und Stoffe einkauft. Großmutter holt ihr Kästchen hervor, in dem sie alte Bilder aufbewahrt. Auf vergilbten Fotografien sind all ihre Werke für die Nachwelt erhalten.
Blaue Schlafaugen
Mutter kommt eines Abends mit strahlendem Gesicht in die Küche. »Wir fahren nach Budapest, du und ich«, sagt sie und schaut mich an. »Ich komme gerade von Großtante Klára.« Was das bedeutet, weiß ein jeder in der Familie: Mutter hat von der Großtante Geld geborgt. Und weil Großtante Klára meine Großmutter genausowenig mag wie ihren verstorbenen Schwager, verschwestert sie sich mit meiner Mutter. Sie kommt oft zu uns herüber und erkundigt sich nach besonderen Kochrezepten.
Mutter kocht anders, viel raffinierter, mit weniger Fett als es in gewissen Haushalten üblich ist, sagt Großtante Klára und überzeugt sich mit einem Seitenblick davon, daß Großmutter es hört. Mir fallen dabei die Streitereien über den Fettverbrauch in unserem Haushalt ein und wie Mutter, jedesmal, wenn Großmutter Mittagessen gekocht hat, demonstrativ eine Kelle nimmt und die dicke Fettschicht vom Essen abschöpft. Großmutter könnte sie dafür in einer Kelle Wasser ertränken, wie es bei uns heißt, am liebsten in der Kelle, mit deren Hilfe Mutter sie soeben der Verschwendungssucht überführt hat.
Mutter zeigt mir Budapest, ihren Wohnort in den Kriegsjahren. Es ist Oktober 1956 und die Geschäfte in der Promenierstraße in der Innenstadt sind voller Sachen, die ich nie zuvor gesehen habe. Eine Puppe hat es mir in einem Schaufenster angetan, eine mit lockigen braunen Haaren und blauen Schlafaugen.
Blaue Augen sind für mich das größte, was der liebe Gott einem Menschen mit dunklen Haaren schenken kann.
Für meine Mutter offensichtlich auch, weil sie, so oft sie kann, ihre Enttäuschung über die plötzliche und heimtückische Veränderung meiner Augenfarbe äußert.
»Du warst vielleicht ein halbes Jahr, bis dahin waren deine Augen blau, ein tiefes Veilchenblau, und dann gucke ich nach 'ner Weile mal genau hin und was sehe ich: Das Kind hat auf einmal braune Augen!«
Eine Schande. Daß ich ihre braunen Augen geerbt habe, kommt ihr nicht in den Sinn. Die ganze väterliche Familie besteht aus Menschen mit dunklem Haar und blauen Augen. Und alle haben eine helle Hautfarbe. »Weiß wie Milch«, wie Großmutter es nennt. Sie bemüht sich nach Kräften, ihre Haut nicht allzusehr der Sonne auszusetzen, denn sie bevorzugt die vornehme Blässe. Wenn sie besonders wütend auf meine Mutter ist, nennt sie sie eine halbe Zigeunerin.
»So braun, von Natur aus, sind nur diese fahrenden Leute«, sagt sie, weil sie es nicht wagt, ein zweites Mal jenes Wort in den Mund zu nehmen.
»Trotzdem haben sich die Männer nach mir umgedreht«, schlägt Mutter zurück. »Freilich, als ich jünger war ...«
Ihr Blick ist verträumt. Ob sie dabei an meinen Vater denkt? Der Zustand von Verträumtheit hält nicht lange an, Mutter holt wieder aus. »Hier kann man sich nicht mal anständig waschen, ohne beobachtet zu werden, mit welcher Seife und was man anschließend anzieht! Hier wird einem hinterherspioniert, man sollte sich was schämen!«
Mutter redet sich in Rage und Großmutter weiß, wann sie sich zurückziehen muß. Denn man und hier sind nur zwei Ersatzwörter für Großmutters Ausspioniererei der Schwiegertochter, für die kleinen Teufeleien, die sie sich ausdenkt, um die Frau ihres ältesten Sohnes zu ärgern. Großmutter zieht sich also zurück.
Das Haus der Groß- und Urgroßeltern beherbergt zwei Wohnungen, die hintereinander aufgereiht sind. Die Wohnstätten sowohl der Großeltern als auch später der Eltern hat je eine Wohnküche und eine gute Stube, alle Räume sind mit Dielenfußböden und Balkendecken ausgestattet. Die Dielen weißgescheuert, die Decken weißgestrichen, die Sprossenfenster klein, alle haben von innen einhakbare Läden und vor den verglasten Türen eine zweite aus massivem Holz. Das alte Haus wurde aus Lehmziegeln gebaut. Vater schimpft auf die Urgroßeltern, die, anstatt sie für das Haus zu verwenden, eine Zweimetermauer aus Ziegelsteinen um das halbe Grundstück haben errichten lassen. Dafür ist das Dach mit vornehmen Holzschindeln gedeckt.
»Damit es besser brennt«, kommentiert Vater aufgebracht. »Alles Angabe, Augenwischerei«, wettert er weiter, »die Leute sollten denken, die Mártons haben es dicke. Von wegen!«
Dann kommt die Geschichte vom Urgroßvater János, der Betrügern aufgesessen war und sein gesamtes Barvermögen nebst der noch nicht eingebrachten Weinernte gegen wertlose Aktien eingetauscht hatte. Als er es erfuhr, bekam er einen Schlaganfall und starb. Nun müssen wir alles ausbaden. So hat Vater den Unterschied am eigenen Leib erfahren müssen, wie das ist, wenn man vom Großbauerssohn plötzlich in den Sohn eines verarmten Großbauern verwandelt wird. Vielleicht war das auch der Grund für seine spätere Entscheidung, als die LPGs bei uns nach sozialistischem Muster den Grundbesitz ablösen sollten, als einer der ersten in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft einzutreten. Er hat mit Grundbesitz, den man einem jederzeit wegnehmen kann, nichts mehr zu tun haben wollen.