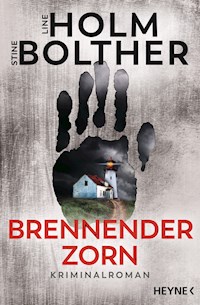10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Maria-Just-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie kämpft für die Rechte der Toten, die in Vergessenheit geraten sind. Und deckt dabei die Sünden der Gegenwart auf
Beim Joggen stößt Polizeihistorikerin Maria Just auf einen Lieferwagen, in dem sich ein nackter Toter befindet. Ihm wurden beide Hände abgetrennt. Alles deutet auf einen Mord des organisierten Verbrechens hin. Während die Ermittler Mikael Dirk und Frederik Dahlin zunächst im Dunkeln tappen, kämpft Maria um ihre Zukunft im Polizeimuseum. Da kommt ihr der Cold Case einer ungelösten Kindesentführung gerade recht: 1986 verschwand der neun Monate alte Anton auf einer Anti-Atomkraft-Demo aus seinem Kinderwagen. Als Maria ein altes Tagebuch zugespielt wird und die Hände des Toten aus dem Lieferwagen auf einer Fähre auftauchen, ist sie sicher, dass beide Fälle zusammenhängen. Doch dann begeht sie einen folgenschweren Fehler, der sie alles kosten könnte.
Die neuen Co-Autorinnen von Jussi Adler-Olsen mit ihrer eigenen Krimireihe: Spannend, mit Tiefgang und psychologischem Geschick.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
In einem verlassenen Lieferwagens in Østerbro liegt ein toter Mann, nackt und verstümmelt. Sein Zustand deutet auf eine Liquidation im Milieu von Kopenhagens organisiertem Verbrechen hin, aber die Ermittler Mikael Dirk und Frederik Dahlin haben Mühe, das Bild zusammenzusetzen. Unversehens wird die Polizeihistorikerin Maria Just in den Fall hineingezogen, während ihr Leben gerade in die Brüche geht. Die Beziehung zu ihrer Jugendliebe Jakob ist vorbei, und ein neuer Forscher bedroht ihre Karriere im Polizeimuseum. Als ihr das Tagebuch einer verstorbenen Frau in die Hände fällt, in dem es um ein altes, ungelöstes Verbrechen geht, stürzt sich Maria deshalb in die Arbeit. In ihrem Eifer, die Wahrheit aufzudecken, betritt sie allerdings gefährliches Terrain. Der anhängige Fall und das geheimnisvolle Tagebuch enthüllen nach und nach vergangene Sünden im Umfeld von mächtigen Personen.
Die Autorinnen
LINE HOLM wurde 1975 geboren und ist eine mehrfach ausgezeichnete Investigativjournalistin. Sie arbeitet für die Berlingske, eine der größten dänischen Zeitungen.
STINE BOLTHER wurde 1976 geboren. Sie ist Fernsehmoderatorin und seit achtzehn Jahren als Kriminalreporterin tätig.
Hautnah bei den echten Ermittlungen dabei zu sein hat die beiden dazu inspiriert, ihren ersten gemeinsamen Kriminalroman zu schreiben. Mit ihrem Debüt »Gefrorenes Herz«, dem Auftakt der Reihe um Polizeihistorikerin Maria Just, gelang den beiden Autorinnen auf Anhieb ein SPIEGEL-Bestseller. Die Reihe wurde mit dem Bestseller »Brennender Zorn« fortgesetzt.
Lieferbare TitelGefrorenes Herz
EISKALTE SCHULD
KRIMINALROMAN
Aus dem Dänischen von Franziska Hüther und Günther Frauenlob
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Natjæger erschien erstmals 2023 bei Politikens Forlag, Kopenhagen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 01/2025
Copyright © 2023 by Line Holm and Stine Bolther and JP/Politikens Hus A/S in agreement with Politiken Literary Agency
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 Mü[email protected]: Maike Dörries
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO GbR, München, unter Verwendung von © Alamy (ADDICTIVE STOCK CREATIVES), Shutterstock.com (Evannovostro, Malira, Neil Lang)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31877-2V003
www.heyne.de
Juli 2022
1
Heute musste sich das Blatt wenden. Das hatte der Junge verdient.
Jannik schaltete den Motor aus und sah hinüber zu seinem Sohn. Er sah müde aus. Halb geschlossene Augen in der Morgensonne, der Thermosbecher baumelte zwischen seinen Fingern. Das Haar ungewaschen, das T-Shirt zerschlissen, die Shorts zu weit. Hatte er im Lauf des Frühjahrs nicht arg abgenommen? Er nahm zu viel auf sich und schleppte zu schwer, schonte seinen Vater.
»Hast du okay geschlafen?«
Sein Sohn zuckte stumm mit den Schultern, fischte eine Dose aus einer seiner vielen Taschen und schob sich einen kleinen weißen Nikotinbeutel über den Backenzahn in den Mund. Der Snus beulte die Oberlippe aus, was ihm in Kombination mit dem struppigen Bart ein löwenartiges Aussehen gab, das Jannik als beunruhigend und fremd empfand.
»Deiner Mutter hätte das nicht gefallen, Jonas. Du warst das einzige Kind ohne Löcher in deiner Klasse, und jetzt ruinierst du dir die Zähne mit diesem Zeug.«
»Ma ist tot, und ich bin zweiundzwanzig. Halt dich da raus, Pa.« Der trotzige Blick seines Sohnes versetzte Jannik vierzehn Jahre zurück in die Vergangenheit. Zu einem Jungen, der dreiundneunzig Tage lang Morgen für Morgen im Flur stand und sich weigerte, seinen Ranzen aufzusetzen. »Was, wenn Mama stirbt, während ich in der Schule bin?« Jeden Morgen dieselbe Frage und dieselbe bebende Stimme. Bis zu jenem Montag, als Junes Bett leer stand. Die Bestatter waren am Samstagabend da gewesen. An jenem Morgen ging er einfach.
Jannik legte seinem Sohn eine Hand auf den Arm.
»Ich meine ja nur … Denk an die Firma, Jonas. An uns zwei. Meine Schulter ist hin, in zehn Jahren werde ich nicht mal mehr einen lausigen Untersetzer die Treppe runtertragen können. J&J Krull steht und fällt dann mit dir.« Er schluckte. Wusste nicht recht, ob aus Reflex oder Unbehagen. Für Gefühlskram war June zuständig gewesen. »Ich hab doch nur dich.«
»Ja. Das Weltunternehmen J&J Krull. Nachlassauflösung mit Gewissen«, spie Jonas und malte ein imaginäres Schild in die Luft. »Davon träumen alle in meinem Alter. Um sieben aufstehen, den ganzen Tag den Gestank von Staub und Tod einatmen und wertloses Gerümpel ausräumen. Geil.« Jonas öffnete die Wagentür und spuckte auf den Asphalt. »Lass uns einfach anfangen! Wollte die Anwältin jetzt nicht kommen?«
Jannik brummte gekränkt. June hatte sich den Firmen-Slogan ausgedacht, und Jannik war so begeistert davon gewesen, dass er ihn mit gotischen Buchstaben auf ihren damals nagelneuen Sprinter hatte kleben lassen. Jetzt war der Transporter schwer in die Jahre gekommen, und die Hälfte von »Krull« hing herunter und flatterte laut im Fahrtwind. Jonas zufolge war die schnörkelige Schrift immer schon unlesbar gewesen und einer der Gründe, weshalb sich neue Kunden nie von sich aus an J&J Krull wandten.
Jonas schlug die Tür zu und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Sein im Nacken langes Haar wurde an der Scheibe platt gedrückt.
Jannik hatte June hoch und heilig versprochen, ihrem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Wie sich das nun mal gehörte. Man sorgte für seine Nachkommen. Stellte die eigenen Bedürfnisse hintan, um der nächsten Generation den Weg zu ebnen. Beseitigte Probleme, überschüttete das Kind mit Liebe. Das war wohl das elterliche Los. Blutsbande.
Am liebsten hätte er die Scheibe heruntergekurbelt, seinem Sohn durch die Haare gewuschelt und – wie damals – gesagt, dass schon alles werden würde. Aber das würde ihn bestimmt nur wütend machen. Noch wütender als ohnehin schon.
Jonas war frustriert darüber, in Odense auf der Insel Fünen festzusitzen, und das in einer Branche, in der es mehr Tod als Leben gab und die meisten Kollegen reif für den Ruhestand waren. Ihn frustrierten die schlecht laufenden Geschäfte und die Tricksereien, derer sie sich zunehmend bedienen mussten, um ihnen ein halbwegs vernünftiges Auskommen zu sichern; unerwartet wertvolle Gegenstände, um die sie sich »kümmerten« und die sie bis auf Weiteres sozusagen »einlagerten«.
Aber alles war so verflucht teuer geworden! Diesel, Kaffee, Butter, Brot, Eier, sogar Milch! Er war nur eine unvorhergesehene Rechnung davon entfernt, mit Stromgesellschaft oder Mechaniker eine demütigende Ratenzahlung vereinbaren zu müssen. Und an die Folgen eines eisigen Winters wagte er gar nicht zu denken. Erst gestern hatte ihm der Betreiber der Lagerhalle, in der sie Papiere, Gemälde und Möbel aus den Nachlässen aufbewahrten, eine baldige Mieterhöhung um dreißig Prozent angekündigt.
»Muss die Hütte ja heizen«, wie er erklärt hatte, wohl wissend, dass es ohne Lagerfläche mit J&J Krull vorbei wäre.
Janniks spärliche Ersparnisse waren aufgebraucht, seine Selbstachtung als Vater so gut wie dahin. Das Vorhaben, Jonas ein wenig Startkapital für eine günstige Mietwohnung zu geben, konnte er sich abschminken. Ganz sicher saß June irgendwo dort oben und wiegte kaum merklich den Kopf, wie immer, wenn sie enttäuscht war.
Jannik schlug sich selbst fest auf die Wangen. Selbstmitleid führte geradewegs in die Hölle oder zur Flasche. Er griff ins Handschuhfach und zog die Unterlagen für den heutigen Auftrag heraus. Man musste es positiv sehen. Die Sonne schien, und heute stand kein Auftrag für die Gemeinde auf dem Programm.
Jonas hasste die Fälle, wenn keine Erben vorhanden waren und die Haushaltsauflösung über die Gemeinde abgewickelt wurde. Der chemische Geruch dahingesiechter Körper und ausgelöschter Hoffnungen in diesen Wohnungen erinnerte ihn an Junes letzte Tage. Häufig fanden sich Spuren menschlicher Überreste oder toter Haustiere, Exkremente, Urin und Blut auf dem Boden. In anderen Fällen mussten sie sich durch Kisten und Berge von Müll graben, um sich überhaupt einen ersten Überblick zu verschaffen. Benutztes Geschenkpapier, Kontoauszüge, Telefonbücher, Werbeprospekte, kaputte Käsehobel, mottenzerfressene Wollknäuel und Gläser mit verschimmeltem Rotkraut. Kriegskinder hoben alles auf.
Das ungeübte Auge sah hier nur Chaos. Doch mit Jonas verfügte Jannik über eine Geheimwaffe. Sein Sohn besaß einen Riecher dafür, in den Bergen aus Dreck den Goldklumpen zu finden. Jonas dachte oft, dass diese Fähigkeit einer besonderen psychologischen Einsicht geschuldet sein musste; es konnte nicht spurlos an einem Kind vorbeigehen, seine Mutter dahinsiechen und sterben zu sehen und sich durch die Jahre zu manövrieren, in denen Jannik seine Trauer mit Alkohol betäubt hatte und niemand es wagte, Junes Namen laut auszusprechen. Als Schattenkind zu leben.
Selbst wenn die amtlichen Nachlasspfleger sich alles unter den Nagel gerissen hatten, was ansatzweise von Wert war, um die Begräbniskosten der oder des Verstorbenen zu decken, fand Jonas immer eine versteckte Schatulle und ein Silberbesteck oder das eine Keramikstück, für das Sammler hohe Summen zu zahlen bereit waren. Jannik bezeichnete seinen Sohn im Stillen als Nachtjäger. Ein Wesen mit einem besonderen Riecher und geschärftem Blick, wo andere blind waren.
»Da könnte was zu holen sein, was meinst du?«, fragte Jonas. Seine Laune schien sich etwas gebessert zu haben, als er mit dem Kinn auf ihren heutigen Auftrag wies, eine Backsteinvilla im wohlhabenden Hunderup-Viertel von Odense.
»Könnte sein. Die Verstorbene war alleinstehend. Dreiundachtzig Jahre alt. Nie verheiratet, keine Kinder, keine Schulden«, sagte Jannik nach einem Blick in die Unterlagen.
»Das Haus ist bestimmt zwei, drei Millionen Kronen wert, oder? Die Kohle …«
»Geht direkt in die Staatskasse, ja.« Jonas fuhr zusammen, als eine Frau in einem sandfarbenen Kostüm hinter ihnen auftauchte. »Es sei denn, ein Angehöriger meldet sich und erhebt Anspruch aufs Erbe.« Die Frau reichte ihnen die Hand. »Julie Albo, Rechtsanwältin. Ich wurde als Nachlasspflegerin eingesetzt. Tut mir leid, dass Sie warten mussten.« Sie zog einen Schlüssel aus ihrer Aktentasche. »Wollen wir?«
Die Anwältin schob sich an ihnen vorbei und stakste mit ihren hohen Absätzen um die Löcher in der Auffahrt herum zum Haus.
»Gudrun Sivertsen, die Verstorbene, ist mir etwas rätselhaft, muss ich zugeben«, sagte sie. »1987 hat sie dieses Haus per Barzahlung gekauft und offenbar all die Jahre allein hier gelebt.«
»Hm, hm«, murmelte Jonas und ging an der Anwältin vorbei durch die Küche ins Wohnzimmer, wo ausgeblichene Rechtecke an den Wänden und eine lückenhafte Möblierung verrieten, dass die Einrichtungsgegenstände von Wert bereits von beauftragten Auktionshäusern abtransportiert worden waren. Jannik erkannte am Blick seines Sohnes, dass er den Rest scannte. Er war auf der Jagd.
»Gudrun Sivertsen war ein Einzelkind und nie verheiratet. Keine Kinder, keine nahen Angehörigen. Ich habe eine Anfrage beim Landesarchiv gestellt, denke aber nicht, dass da was bei rauskommt. Meiner Erfahrung nach sind selbst die entferntesten Verwandten ruckzuck zur Stelle, wenn sie Wind von einer reichen Großtante bekommen, vor allem in solchen Zeiten«, fuhr die Anwältin fort, während sie durchs Erdgeschoss schritt. »Wie Sie sehen, ist das Haus sehr groß für eine betagte und zudem demenzkranke Frau.«
»Wie viele Quadratmeter?«
»Einhundertachtzig plus sechzig Keller.«
Jonas pfiff leise und lang gezogen. »War sie vermögend? Sieht nicht aus, als hätte sie hohe Beträge in die Instandhaltung des Hauses gesteckt. Was hat sie beruflich gemacht?«
»Laut Finanzamt bestanden ihre einzigen Einkünfte in den Erträgen aus Wertpapieren. Offenbar hat sie klug investiert und sparsam gelebt.«
»Also eine richtige Knauserin«, meinte Jonas, und Jannik musste ein Lächeln unterdrücken. Knauserer hoben alles auf, was für sie beide größere Gewinnchancen bedeutete.
»Das würde ich nicht sagen«, entgegnete die Anwältin brüsk. »Die Verstorbene hat regelmäßig hohe Summen für wohltätige Zwecke gespendet. Außerdem hat sie in Kunst und Möbelklassiker investiert.«
»Wie zum Beispiel?« Jonas trat eifrig einen Schritt auf die Anwältin zu.
»Das steht jetzt natürlich alles zum Verkauf. Wegners Papa Bear Chair und Finn Juhls Poet Sofa standen hier, falls Ihnen das was sagt? Beide in selten gutem Zustand. Und dann die Kunst. Etwas zu sentimentale Motive für meinen Geschmack, aber laut Auktionshaus Bilder im Wert von mehreren Hunderttausend Kronen.«
»Was für Motive waren das?«
»Ach … Sehr romantisch alles, Sie wissen schon, fette Putten, irgendwas mit einer Mutter und einem Baby. Familienmotive. So in dem Stil hier.« Albo deutete auf eine runde, goldgerahmte Lithographie an der Wand, eine Schwanenmutter mit ihren Jungen, die Jannik als einen Henry-Heerup-Klassiker identifizierte. Sie war vergilbt, konnte an einem guten Tag aber noch immer drei- bis viertausend Kronen einbringen.
»Und im Testament sind keine Erben erwähnt?«
»Keine Einzelpersonen, nein. Den Nachbarn zufolge hatte die Verstorbene nie Besuch, nur hin und wieder einen Handwerker«, antwortete die Anwältin. »Es gab noch nicht mal einen Pflegedienst, obwohl ihre Demenz laut Hausarzt im fortgeschrittenen Stadium war.«
»Das heißt, wir räumen das Haus komplett aus?«
Julie Albo zuckte mit den Schultern und reichte Jannik ihre Karte. »Ich will das Haus einfach verkaufsbereit haben. Wenn Sie etwas von privater Natur finden – Tagebücher, Belege, Unterlagen, Briefe –, lagern Sie es ein, dann sehe ich es mir bei Gelegenheit an. Mit dem Rest können Sie tun, was Sie wollen. Verbrennen, verkaufen, wegschmeißen, ganz egal.« Sie trippelte die Stufen vor der Haustür hinab. »Ziehen Sie dann einfach die Tür hinter sich zu.«
Jannik ging als Erstes mit einem Abfallsack ins Badezimmer. Alle alten Leute hatten Medikamente, und Gudrun Sivertsens Medizinschrank war keine Ausnahme. Paracetamol, Hustenstiller, ein Blutdruckmedikament und zwei Schachteln Citalopram, ein Antidepressivum. Letzteres war eher die Regel als die Ausnahme bei einsamen älteren Menschen.
Er seufzte. Kein Schmuck. Hier war alles für den Müll.
»Pa?«, rief Jonas aus dem Obergeschoss.
Sie begannen mit dem Entrümpeln in der Regel oben, danach nahmen sie sich den Keller vor und zum Schluss das Erdgeschoss, um die Treppenlauferei auf frischen Beinen hinter sich zu bringen.
Er fand Jonas in einem der drei Zimmer im Obergeschoss, einer Art Büro mit einem leeren Schreibtisch. Sein Sohn hockte auf allen vieren unter einer Schrägwand und zog Kartons und Tüten aus einer Kniestocktür. Er warf seinem Vater ein schiefes Lächeln über die Schulter zu.
»Hier haben die Auktionsfuzzis natürlich nicht geguckt.«
»Was ist das?«
»Weihnachtsschmuck. Einiges von Georg Jensen und Royal Copenhagen, sieht alles unbenutzt aus. Das Zeug ist was wert. Ich habe auch eine Kiste mit Notizbüchern gefunden. Schaust du die durch, ob da was für die Anwältin dabei ist? Ich fang jetzt mit Möbelraustragen an.«
Jannik nickte verlegen. So lief das jetzt offenbar. Jonas schleppte die schweren Sachen, er selbst war zum Papierfritzen abgestiegen.
Er griff sich eines von fünf schwarzen, identischen Notizbüchern aus der Kiste, ledergebunden und von teurer Qualität, aber leider allesamt vollgeschrieben. Er versuchte, die etwas krakelige Handschrift zu entziffern. Offenbar hatte die demenzkranke Gudrun beschlossen, ihre Lebensgeschichte zu Papier zu bringen, ehe es zu spät war. Zumindest standen auf der Titelseite des ersten Notizbuchs die Worte »Meine Kindheit«. Auf der des zweiten »Meine Jugend«. Aus dem dritten, »Meine Reisen«, ging hervor, dass Gudrun in den Neunzigern zu teuren Zielen wie Bali, Peru und Grönland gereist war. Das vierte Notizbuch wirkte verworren und trug den Titel »Meine schwarzen Tage«, eine plausible Erklärung für die Antidepressiva im Bad.
Beim fünften Titel stutzte er und las ihn noch einmal.
»Mein Verbrechen« stand da.
Jonas entfuhr ein hoffnungsvolles Glucksen. Vielleicht enthüllte Gudrun hier, wie sie zu ihrem Geld gekommen war. Er setzte sich auf den Schreibtischstuhl am Fenster und buchstabierte sich durch die schnörkeligen Bekenntnisse. Als die Bedeutung der Worte in dem Notizbuch langsam sackte, blätterte er zurück und las das Ganze von vorn, um sich zu vergewissern, dass er die verworrenen Sätze richtig verstanden hatte.
Wenn das alles stimmte, dann konnte einem wirklich übel werden!
Er stand auf und schaute aus dem Fenster, um sicherzugehen, dass Jonas draußen war. Erleichtert sah er seinen erwachsenen Sohn mit zwei übereinandergestapelten Korbstühlen in den Transporter steigen. Er betrachtete ihn liebevoll, von hier oben sah er so klein aus, fast wie der Junge von damals. Schmale Schultern, die Schritte verantwortungsschwer, ein Kopf, der niemals stolz erhoben war. Er war ein Junge, mit dem die Welt es nicht gut meinte.
Jannik öffnete das Fenster, um seinem Sohn ein »Hey« zuzurufen, ein aufmunterndes »Ich sehe dich, gute Arbeit, mein Junge«, doch in diesem Moment fuhr ein Toyota mit dem Klang nach kaputtem Vergaser vor dem Nachbarhaus vor und übertönte alles. Also setzte Jannik sich wieder hin und las weiter, blätterte vor und zurück, versuchte zu begreifen.
Am Ende des Buches hielt er inne. Auf einmal ein Name inmitten des wirren Gekritzels.
Eine Hitze, deren Ursprung er nicht genau identifizieren konnte – Fassungslosigkeit, Wut, Gier –, strömte von dem Buch in seine Hände und hinauf in seine Brust. Als hätten das Aufschlagen des Tagebuchs und die Befreiung des darin enthaltenen unverzeihlichen Geheimnisses sowohl die Seiten als auch ihn selbst in Brand gesetzt.
Wenn das, was darin beschrieben stand, nicht nur die Spinnereien einer kranken Frau waren, dann musste er handeln. Das Schicksal hatte seinem eigenen Kind übel mitgespielt, und er war machtlos gewesen. Aber das hier! Einem Kind war Böses angetan worden. Ein Kind war geopfert worden!
Das verlangte nach Rache. Vergeltung!
Aufgewühlt, wie er war, kam ihm eine Idee. Erst nur als vager Gedanke, dann als konkrete Erwägung. Der Gerechtigkeit könnte tatsächlich Genüge getan werden. Dieses Buch mit dem vernichtenden Wissen konnte Jonas und ihm zugutekommen. Jemandem helfen, dem so hart mitgespielt worden war und der so viel durchlitten hatte wie sie beide, das musste Karma sein. Womöglich hielt er hier den Fund in Händen, der J&J Krull aus dem finanziellen Todesreigen befreien würde.
Er stand auf und lief umher. Versuchte, einen freien Kopf zu bekommen. Vielleicht sollte er Jonas das Buch zeigen, sein Sohn kam gerade die Treppe herauf.
»Packst du auch noch mal mit an, oder wie sieht’s bei dir aus?« Jonas reichte ihm eine Flasche, sein T-Shirt war voller Schweißflecken, seine Wangen glühten.
»Setz dich her, mach kurz Pause, dann tragen wir zusammen den Schreibtisch runter.« Jannik klappte das Notizbuch zu und schob es rasch in seine Beintasche. Nein, kein Grund, seinen Sohn zu involvieren, ehe er die Umstände näher untersucht hatte.
»Was gefunden?« Jonas setzte die Flasche an die Lippen und musterte ihn, während er trank.
»Nicht wirklich«, wollte er sagen, kam aber nicht dazu.
Ein Poltern, als wäre im Erdgeschoss etwas auf den Boden gefallen, drang zu ihnen herauf. Jonas stellte die Flasche ab und lauschte. Erneute Geräusche. Etwas wurde verschoben, das trockene Rascheln von Papier. Dann dumpfe Schläge und scharrende Laute, Holz auf Holz.
»Hast du die Haustür zugemacht?« Jannik war aufgestanden.
»Nein, ist doch sauheiß. Ist vielleicht eine Katze mit reingekommen?«
Ein vernehmliches Knarzen ließ keinen Zweifel. Etwas oder jemand lief dort unten herum.
»Das ist doch keine Katze. Ich schau mal nach.« Jannik warf einen Blick aus dem Fenster. Der lärmende Toyota von eben hatte direkt hinter ihrem Sprinter geparkt.
»Warte, Pa, ich geh vor.« Jonas hielt ihn am Arm zurück, und Jannik empfand eine Mischung aus Scham und Zuneigung, weil sein Sohn sich als der Stärkere von ihnen beiden betrachtete.
»Vergiss es.« Jannik holte tief Luft und ging voran die Treppe hinab. Jonas folgte ihm mit nur einer Stufe Abstand. Am Fuß der Treppe blieb Jonas so abrupt stehen, dass sein Sohn ihm unweigerlich auf die Ferse trat.
Im Wohnzimmer, den Rücken zu ihnen und über einen Sekretär mit aufgeklappter Schreibfläche gebeugt, stand ein Mann, dessen Kleidung sich nicht merklich von ihrer Arbeitskluft unterschied: weißes T-Shirt, Shorts mit Taschen, Sicherheitsschuhe.
»Wer zum Teufel sind Sie?« Jannik versuchte, barsch zu klingen, doch seine Stimme war alles andere als das.
Der Fremde fuhr herum und musterte sie von Kopf bis Fuß. Hinter ihm waren sämtliche Schubladen des Sekretärs herausgezogen, Papiere schauten heraus, Quittungen, Klarsichthüllen und Notizblöcke lagen auf dem Boden verstreut. Die ganze Szene sah nach einem Einbruch aus, der Mann jedoch wirkte wie ein Amateur.
»Where is she?« Der Fremde sah von Jannik zu Jonas.
Jannik war noch nie gut in Englisch gewesen, er schielte hilfesuchend zu Jonas.
»Who?« Jonas starrte den Mann kalt an.
»Where is she?« Der Mann kam näher, in seiner Stimme schwangen Unsicherheit und Verzweiflung mit.
»Wer sind Sie? Ein Angehöriger?«, gab Jonas auf Englisch zurück.
Statt einer Antwort wandte der Fremde sich ab und verschwand ins Esszimmer.
»Was zum …«, murmelte Jonas und stapfte hinterher.
Am Klang seiner Schritte erkannte Jannik, dass sein Sohn wütend war. Er spürte ein schwaches Gewicht an seinem Oberschenkel und schloss die Taschenschlaufe über dem Notizbuch, ehe er Jonas folgte.
»Who are you?«, versuchte es Jonas erneut.
Der Fremde würdigte sie keines Blickes. Er hatte die Türen eines großen Schranks im Esszimmer geöffnet, der neben Tellern und Gläsern einen Briefhalter aus Holz enthielt, den er hektisch durchwühlte.
»Will you fucking stop?!« Jonas machte ein paar Schritte auf den Fremden zu, doch der Mann ignorierte ihn weiter und ging zu einem alten Nähtischchen.
Er riss den herausziehbaren Korb nach vorn, tastete die Unterseite des Tisches ab, fand nichts. Er wollte sich an Jonas vorbeidrängen, doch der hatte jetzt endgültig genug.
»Get out!« Jonas griff den Mann am Oberarm, der sich mit einer Drehbewegung entwand, Jonas am Kragen seines T-Shirts packte und seinen Kopf ganz nah an sein Gesicht zog. Er war mindestens fünfzehn Jahre älter und fünfzehn Kilo schwerer als Janniks schmächtiger Sohn.
»Ich kenne sie«, zischte er auf Englisch. »Sie hat etwas, das ich brauche.«
Neben seiner Verblüffung spürte Jannik nun Wut aufsteigen. Für einen Angehörigen verhielt der Mann sich verdammt unangemessen.
»Sie ist tot. Dead. Gudrun is dead!« Jannik verpasste dem Fremden einen Stoß.
Der Mann sah ihn überrascht an, als erwachte er jäh aus einem Traum, und lockerte den Griff.
Jannik griff in seine Gesäßtasche, zog die Visitenkarte der Anwältin heraus. »Jonas, sag ihm, er soll hier anrufen, wenn …«
»Einen Scheiß werd ich.« Jonas machte sich von dem Fremden los. »Von wegen Anwältin. We will call the police.«
Der Mann machte einen Satz, eine offensichtliche Fluchtreaktion angesichts des Wortes »Polizei«, doch dann stürmte er wider alle Logik die Treppe hinauf in den oberen Stock. Sie hörten, wie er oben Schubladen und Schranktüren aufriss.
»Was zur Hölle sucht der? Wir können ihn doch hier nicht einfach rumwühlen lassen.« Jonas stürzte zur Treppe, doch Jannik hielt ihn zurück.
»Warte, da oben ist nichts von Wert.«
Sie starrten beide zur Treppe, und es dauerte dreißig, höchstens fünfundvierzig Sekunden, dann polterte der Mann herab. In der Hand hielt er etwas Mattschwarzes und Viereckiges. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, rannte er direkt zur Haustür.
»Was hatte der da? Haben wir was übersehen?«, fragte Jonas, setzte dann aber, ohne Janniks Antwort abzuwarten, dem Fremden nach.
Als Jannik bei der Haustür anlangte, saß der Typ bereits in seinem Auto. Jonas schlug gegen die Scheibe und rüttelte am Handgriff, doch die Tür war verschlossen. Der Motor heulte auf. Die Reifen knirschten über den Asphalt, als der Mann das Gaspedal durchdrückte und gleichzeitig das Lenkrad herumriss. Es krachte, gefolgt von einem Splittern und metallischen Scheppern, als der Toyota gegen ihren alten Mercedes knallte. Dazu das Jaulen des Motors und Jonas’ lautes Fluchen, als der Wagen beschleunigte.
Eine gefühlte Ewigkeit stand Jannik da und sah der Heckscheibe des Toyotas nach.
Jonas sprintete auf dem Bürgersteig hinterher, doch ihn einzuholen, war aussichtslos.
»Du Arschloch!«, brüllte er, als der Wagen um die Ecke bog. Dann war er weg, und Jonas rang einen Augenblick lang vornübergebeugt nach Luft.
»Das wird sauteuer zu reparieren. Wie sollen wir das bezahlen?«, schnaufte er und zeigte auf ihren Transporter. Seine Stimme überschlug sich. »Hast du das Kennzeichen gesehen?«
»Nein.« Jannik fuhr sich mit der Hand über die Lippen, sein Mund war trocken.
»Wenigstens hat sich der Penner sein eigenes Auto an der Front auch total demoliert. Das war ein polnisches Kennzeichen, so viel hab ich immerhin gesehen. ›PL‹ stand da. Glaubst du, der gehört zur Konkurrenz aus Nyborg? Ich hab gehört, Olsen heuert Osteuropäer an. Der und sein Kompagnon glauben anscheinend, sie können den ganzen Markt hier an sich reißen, wenn sie nur möglichst wenig Stundenlohn zahlen.«
Jannik antwortete nicht.
Er ging vor dem ramponierten Heck des Sprinters in die Hocke. Ein unterdrücktes und verbotenes, destruktives Gefühl erwachte in ihm, er hatte Lust auf ein Bier, obwohl es noch nicht einmal neun war.
Die Stoßstange des Transporters hing auf Halbmast, auf dem Asphalt glitzerten rote und gelbe Scheinwerfersplitter. Zorn loderte in ihm auf, das Notizbuch brannte in seiner Tasche. Das einzige Notizbuch, das der Fremde nicht erwischt hatte.
ERSTER TEIL
5. September – 8. September 2022
2
Maria Just zog ihren Pferdeschwanz aus ihrer Cap und rieb sich die Schläfen. Das scharfe Stechen, das während der gesamten Laufrunde im Takt mit ihrem Puls gepocht hatte, begann über den Ohren und endete als dumpfer Schmerz im Nacken. Ihre Augen brannten, ohne dass sie wusste, warum.
Vielleicht hatte sie für die neun Kilometer bei energischem Tempo zu wenig Wasser getrunken. Vielleicht hätte sie statt dieser Runde lieber die Uferpromenade Langelinie und um das Kastell von Kopenhagen laufen sollen.
Vielleicht kamen die Kopfschmerzen von … tja, zu vielen Kopfschmerzen. Zu viel Grübelei. Sie sehnte sich nach ihrem Bett, musste aber erst noch etwas zu essen besorgen und ihr Auto finden, in dem der Blazer lag, den sie für morgen brauchte. Im 7-Eleven am S-Bahnhof Nordhavn Station kaufte sie zwei Hühnchenspieße und ein Päckchen Paracetamol, dann setzte sie ihren Weg nordwärts die Østbanegade entlang fort.
Nach hundert Metern schaute sie sich ratlos um. Sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, wo sie ihr Auto abgestellt hatte.
Ihr verschmutztes Laufshirt klebte klamm am Rücken. Es war der erste Montag im September, und selbst an einem milden Tag wie diesem wurde es kühl, sobald die Sonne hinter dem Horizont versank. Maria war sich sicher, ihren Clio hier geparkt zu haben, als sie voriges Wochenende aus Jütland zurückgekommen war. Die Østbanegade war einer der wenigen Orte, wo man mit etwas Glück auch spätabends noch einen freien Parkplatz fand.
Sie drückte auf ihren Autoschlüssel und hielt nach einem Blinken in der Nähe Ausschau. Nichts.
Das Wochenende zu Hause in Thorup Strand war alles andere als entspannt gewesen. Mads, ihr normalerweise überfürsorglicher älterer Bruder, grollte ihr immer noch wegen der Trennung von Jakob. Er und Jakob waren seit ihrer Kindheit enge Freunde, und zum ersten Mal in ihrem Leben war Mads stinksauer auf sie.
Sie hätte gar nicht erst hinfahren sollen. Dann würde sie jetzt auch nicht erschöpft und frierend durch die Dämmerung irren. Bald hätte sie die Vordingborggade und das S-Bahn-Viadukt erreicht, unter dem hindurch die einzige Autoverbindung vom alten Østerbro rüber ins Hafenareal mit dem neu entstehenden Stadtteil Nordhavn führte; langsam fielen ihr keine weiteren Parkmöglichkeiten mehr ein. Doch, ein Stück weiter vorn, vor einem hufeisenförmigen Gebäude im Sechzigerjahre-Stil, befanden sich drei kleine Einbuchtungen mit jeweils Platz für sechs Autos. Dort hatte sie schon häufiger eine Parklücke gefunden.
Mads’ Wut machte ihr zu schaffen. Sie konnte nicht leugnen, dass die Beziehung zu Jakob durch ihre Schuld zerbrochen und das Ganze keineswegs schön abgelaufen war. Schließlich war sie fremdgegangen. Doch die Trennung war nicht ihre Entscheidung gewesen.
Letzten Sommer hatte sie eine ungeplante Nacht mit dem Polizisten Mikael Dirk verbracht. Als sie Jakob ihren Seitensprung gebeichtet hatte, war er willens gewesen, es noch mal zu versuchen und ihre Beziehung zu retten, tatsächlich aber zog er sich ab diesem Tag zurück. Vierzehn Jahre lang hatte er sie geliebt. Er hatte sie gewonnen und wieder verloren, getrauert und geduldig gewartet. Er hatte ihr Leben gerettet und sie zurückgewonnen. Das verdiente mehr Respekt, als sie ihm erwiesen hatte, und das ließ sich nicht mehr kitten. Die Liebe war noch da, der Glaube an ihre Beziehung jedoch zerstört.
»Es geht nicht um Mikael. Auch nicht um mich oder um uns oder um Vergebung. Sondern nur um dich. Du suchst etwas, das ich dir nicht geben kann, du willst mit allem allein fertigwerden«, hatte er am zweiten Weihnachtsfeiertag gesagt, als Maria wegen der Arbeit zurück nach Kopenhagen musste.
Sie begriff nicht richtig, was er damit meinte. Allein zurechtzukommen war fester Bestandteil ihres Lebens, seit sie mit zwölf ihren Vater verloren hatte, der durch einen Unfall ertrank. Sie hatte keine andere Wahl gehabt. Diese Lebenseinstellung zu verändern, würde sie verändern.
Jakob war gefasst gewesen. Stark. Er hatte sogar gelächelt, als empfände er ihren bevorstehenden Abschied als Erleichterung. Was es bestimmt auch war. Er war nie schöner gewesen, und sie hatte ihn seither nicht mehr gesehen.
Ihre Augen brannten. Sobald Jakob in ihren Gedanken auftauchte, konnte sie nichts dagegen tun. Doch sie war zu dem Schluss gelangt, dass es besser so war. Jakob dort, sie hier –vierhundertfünfzig Kilometer zwischen ihnen. Alle Liebe der Welt änderte nichts an dem Umstand, dass sie unmöglich zurück nach Thorup Strand ziehen konnte, um die Tochter ihres verstorbenen Vaters und Jakobs Frau zu sein.
Doch ab und zu – so wie jetzt, als sie einen Ford Transit sah wie den, in dem Jakob im Sommer seine Surfbretter transportierte – verspürte sie Sehnsucht. Dieser Transporter war allerdings in erheblich schlechterem Zustand. Die Motorhaube bestand aus einem behelfsmäßigen Ersatzteil, rostbraun mit dunkelblauen Flecken, der Rest des Wagens schmutzig weiß mit rostigen Stellen um Reifen und Türen. Die Karosserie hing traurig herunter. Das Fahrzeug hatte offenbar einen Platten hinten rechts, und an der Frontscheibe steckte ein Knöllchen.
Eine Gruppe Jungs, offenbar zu Unsinn aufgelegt, stand um den Lieferwagen herum. Einer trat dagegen. Ein anderer warf Steine darunter, als versuchte er, sie über den Asphalt flitschen zu lassen.
»Hey, hört auf damit!«, rief Maria.
Die vier Jungs hielten inne und drehten sich zu ihr um. Sie waren nicht groß genug, um ihr hier in der Dämmerung Angst einzuflößen, sehr wohl aber, um Schaden am Fahrzeug anzurichten. Wahrscheinlich war ihr Rufen Abschreckung genug, und sie hatte sich heute schon mit genug Idioten herumgeschlagen, um sich jetzt noch mit vier fremden Jungs abzugeben.
Sie wandte sich ab, klickte auf ihren Autoschlüssel und erschrak beinahe, als in fünfzehn Meter Entfernung ein oranges Licht aufblinkte. Da stand ihr Clio, auf dem letzten Parkplatz in der Reihe, und im hinteren Seitenfenster hing ihr blauer Blazer.
Der Ministerpräsident hatte für morgen einen Energiegipfel zur Energieversorgung der Zukunft im Tivoli Hotel in der Kopenhagener Innenstadt einberufen, und Bodil, Marias Chefin im Polizeimuseum, hatte sie gebeten, oder besser: ihr befohlen, die Kommunikationsabteilung der Polizei Kopenhagen bei diesem Anlass zu unterstützen.
Den Polizeidirektionen in Zeiten hoher Auslastung in Sachen öffentliche Kommunikation behilflich zu sein war keine ungewöhnliche Aufgabe für die Mitarbeiter des Polizeimuseums. Als Angestellte der dänischen Polizei konnten sie bei größeren Anlässen beispielsweise die Journalisten betreuen. Maria hatte das in der Vergangenheit schon getan, das war nicht das Problem, aber das Timing störte sie.
Am Morgen war Bodil in Begleitung eines unbekannten Mannes in Marias Büro geplatzt. Henry Hall, Anfang vierzig ohne den kleinsten Hauch von Grau im kastanienbraunen Haar, war Amerikaner und Professor für Geschichte und Kriminologie von der University of Maryland.
»Dem führenden Institut auf diesem Gebiet in den USA«, wie Bodil betonte.
Nach mehreren Jahren erfolgreicher Lehrtätigkeit waren Henry Hall, der eine dänische Mutter hatte und mit lang gezogenen As sprach, von einem der mächtigen privaten dänischen Forschungsfonds Fördermittel in sechsstelliger Höhe bewilligt worden. Während des nächsten Jahres würde er damit im Polizeimuseum zum Thema DNA technology and investigative genetic genealogy forschen.
»Ich werde mein Bestes tun, um Ihnen einen Einblick in die science und die cold cases zu geben, die ich bisher gecrackt habe«, hatte er mit einem all American smile gesagt – als wüsste Maria nicht, dass mehrere ungelöste Mordfälle während der letzten Jahre auf diese Weise aufgeklärt worden waren. Insbesondere in den USA waren dank der Kombination aus verbesserter DNA-Technologie und guter alter Ahnenforschung eine Reihe von Mördern und Vergewaltigern Jahrzehnte nach Verüben der Tat überführt worden. Henry Hall war offenbar an mehreren der aufsehenerregenden Durchbrüche beteiligt gewesen.
Hierzulande verfügte die Polizei nicht über dieselben Möglichkeiten, was mehrere der führenden Ermittler mit dem Argument kritisierten, dass nur noch wenige Mörder und Vergewaltiger ungeschoren davonkämen, wenn genetische Ahnenforschung zum Standardwerkzeug der Polizei würde.
Das Thema war sowohl aktuell als auch irre spannend, doch Maria wurde nicht schlau aus der Miene, die Henry Hall während des gesamten Gesprächs beibehalten hatte. Außerdem konnte sie ihren Neid über die unerhört hohe Fördersumme nur mit Mühe verhehlen. Sie selbst hatte nie auch nur eine müde Krone bekommen.
Der Neid war zu echter Besorgnis angewachsen, als Bodil Henry hinausschickte und die Tür schloss, um unter vier Augen mit Maria über ihre weiteren Aufgaben zu sprechen. In der Folge von Henrys Einstellung müsse sie sich »darauf einstellen, künftig etwas in den Hintergrund zu treten«, wie Bodil es ausdrückte.
Das ergab keinen Sinn. Maria hatte zu Ostern eine Ausstellung mit dem Titel »Die verschwundenen Kinder von Dänemark« eröffnet, welche die überraschend vielen Fälle spurlos verschollener Kinder in der Geschichte des Landes zum Thema hatte. Das Publikum war ins Museum geströmt, die Presse hatte groß berichtet. Sollte die Belohnung dafür etwa sein, dass sie »in den Hintergrund trat« und langweilige Ad-hoc-Aufträge in der Stadt übernahm, während ein Neuling ihren Platz im Museum stahl?
Ein Gefühl von Demütigung stieg in ihr auf. Wieder einmal.
»Entschuldigung? Können Sie uns helfen?«
Maria drehte sich um. Einer der Jungs vom Transporter war ihr gefolgt. Er war der Größte der vier und offenbar der Mutigste.
Sie wich einen Schritt zurück, leicht auf der Hut. »Bei was?«
»Unser Ball ist unter den Lieferwagen da drüben gerollt, und wir kommen nicht dran.« Der Junge hielt den Blick gesenkt, entweder war er verlegen, oder er verheimlichte etwas.
»Nimmst du mich auf den Arm?«
»Nein.«
Maria ließ den Zweifel zu seinen Gunsten sprechen und ging mit ihm zurück zu den anderen Jungs. Sie zeigten auf den Ford Transit. Tatsächlich, der Ball hatte sich ein ganzes Stück unter der Karosserie verklemmt.
»Den hab ich zum Geburtstag gekriegt. Am Samstag bin ich acht geworden. Der ist aus echtem Leder. Mein Vater schlägt mich tot, wenn ich den verliere«, sagte einer der Jungs, der ein Messi-Shirt trug.
»Fußbälle sind nicht aus echtem Leder, Carl«, merkte einer der anderen an, ein schwarzhaariger Junge im Adidas-Pulli.
»Schon probiert, euch auf den Bauch zu legen? Du hast doch lange Beine«, sagte Maria an den großen Jungen gewandt.
»Hab ich schon versucht, aber …« Der Junge stockte.
»Aber was? Also, das müsst ihr schon selbst mach…«
»Ich muss schon längst zu Hause sein. Und das Auto stinkt voll! Ich hätte fast gekotzt.« Die Augen des Ballbesitzers füllten sich mit Tränen.
»Das stimmt.« Der große Junge sah Maria mit so ernstem Blick an, dass sie die Schultern sinken ließ. »Das Auto stinkt krass. Ich glaube, da ist was drin«, schob er flüsternd hinterher.
»Stinkt? Wonach?«
»Nach totem Pferd!« Die Bemerkung des schwarzhaarigen Jungen fiel wie ein Knall.
»Halt die Klappe, Juan!«
»Was? Mein Vater arbeitet in einer Schlachterei, August. Ich habe mal einen Container voll mit toten Tieren gesehen, der hat genauso gero…«
»Da kann ja wohl kein echtes Pferd drin sein«, meldete sich der Jüngste der Gruppe zu Wort, der bis jetzt stumm zugehört hatte.
»Okay, Schluss jetzt, Jungs. Carl, richtig? Ich hole deinen Ball da raus, aber dann geht ihr auf direktem Weg nach Hause. So spät solltet ihr nicht mehr auf der Straße sein.«
Maria kniete sich neben den Wagen und schaute unter das Fahrzeug. Wenn sie sich auf die Seite legte und das Bein unter den Wagen schob, müsste sie damit eigentlich an den Ball gelangen.
Doch so weit kam es nicht. Süßlicher Verwesungsgestank schlug ihr mit voller Wucht entgegen, und sie krabbelte rückwärts – weg von dem, was sich anfühlte wie ein Angriff auf ihre Sinne.
Der große Junge sah zu ihr hinunter. Er hielt sich den Pulli vor Mund und Nase, sein Blick flackerte nervös.
»Sag ich doch. Ich glaube, da ist was drin«, flüsterte er mit zitternder Stimme.
»Ein Zombie?« Der Jüngste, dem Aussehen nach Augusts kleiner Bruder, wagte sich, den Arm vor Mund und Nase haltend, näher.
Maria rappelte sich auf und bemühte sich um einen Autorität gebietenden Ton. »Zombies gibt es nicht.«
Carl mit dem Messi-Shirt sah sie mit großen, glänzenden Augen an, doch sie brachte es nicht über sich, einen weiteren Ballrettungsversuch zu unternehmen. Stattdessen zog sie den Reißverschluss ihrer Laufjacke bis oben hin, hielt sich den dünnen Stoff vor Mund und Nase und ging um den Transporter herum.
Es lagen keine Ratten, toten Katzen oder Taubenkadaver in der Nähe. Eine S-Bahn fuhr quietschend auf den Hochgleisen vorbei. Die Gleise waren höchstens drei Meter entfernt, und es war schon vorgekommen, dass der Zug jemanden erfasst hatte. Doch der Gestank konzentrierte sich genau hier an dieser Stelle. Der große Junge hatte recht, es musste etwas im Lieferwagen sein. Maria hatte Polizisten darüber sprechen hören, dass zwielichtige Hintermänner Flaschensammler oder ungelernte Handwerker aus Osteuropa hierherbrachten und die armen Menschen dann in Transportern an allen möglichen Orten in Kopenhagen übernachten ließen. Wenn das hier so ein Fall war, lagen womöglich verdorbene Lebensmittel im Wagen. Abfall. Vielleicht sogar Exkremente. Ein toter Hund.
Vielleicht gehörte der Lieferwagen auch zu einem der großen Onlinesupermärkte. Vielleicht hatte der Fahrer seine miserablen Arbeitsbedingungen so übergehabt, dass er das Fahrzeug mit frischem Fleisch und Gemüse einfach hier abgestellt und sich aus dem Staub gemacht hatte.
Mikael Dirks Gesicht glitt in Marias Gedanken vorbei, seine Nummer war immer noch in ihren Kontakten eingespeichert, aber sie hatten sich ein Jahr lang kaum gesehen, lediglich ein paar verhaltene SMS gewechselt. Besser, sie setzte einen Notruf ab. Aber die Polizei war unterbesetzt und würde wohl kaum aufgrund ihres Gefühls, dass etwas nicht stimmte, anrücken.
Blieb eigentlich nur eines. Sie hielt die Luft an, trat abermals zum Wagen und zog am Griff der Beifahrertür. Abgeschlossen, natürlich. Sie spähte durch die Scheibe, konnte aber nichts Außergewöhnliches entdecken. Abgewetzte Sitzpolster, aber keine zurückgelassenen Papiere, keine Essensverpackungen, keine Plastikflaschen. Also begab sie sich zur Rückseite des Wagens und zog versuchshalber am Griff der Hecktür.
Zu ihrer Überraschung ging sie auf, doch nichts hätte Maria auf die Wolke konzentrierten, warmen und süßlichen Verwesungsgestanks vorbereiten können, die aus dem Laderaum quoll, nachdem dieser Gott weiß wie lang luftdicht verschlossen in der Spätsommerhitze gestanden hatte. Feucht und schwer sickerte der Geruch in die kühle Abendluft. Mit einem erstickten Laut stolperte Maria zurück.
Der schwarzhaarige Juan beobachtete amüsiert ihre Reaktion, doch der große Junge bemerkte sofort ihre Unruhe.
Sie taumelte hinüber zum Gebüsch und kämpfte mit der Übelkeit.
»Jungs. Hey. Geht weg! August, Carl, Juan, geht hier weg!« Sie bemühte sich, ruhig zu klingen, doch bei »geht« überschlug sich ihre Stimme, und zu ihrer Überraschung gehorchten die Jungs augenblicklich.
Maria steckte sich ihre Kopfhörer in die Ohren, schaltete die Taschenlampe an ihrem Handy ein und zog die Türen des Lieferwagens weit auf. Sie trat ein Stück weg, um tief Luft zu holen, hielt dann den Atem an, fasste sich ein Herz und machte zwei Schritte, dann einen kleinen Hüpfer hinauf in den Laderaum. Maria landete in einer halb getrockneten, braunschwarzen Lache, und ungünstigerweise atmete sie einen Mundvoll Verwesungsgeruch ein, als sie ihre Laufschuhe anhob, um zu schauen, in was sie da getreten war.
Blut?
Sie leuchtete mit der Taschenlampe über die Innenwände des Laderaums. Er war vollkommen leer, bis auf einen Haufen hellgrüner Fleecedecken von der Sorte, wie man sie für ein paar Kronen bei Ikea bekam. Die Decken lagen am Ende des Laderaums zu einer Art Wurst zusammengerollt. Maria wählte die 112 und trat zögerlich einige Schritte näher, während sie auf das Freizeichen wartete. Hier drinnen konnte man unmöglich atmen, sie würde kein Wort herauskriegen. Sie sollte schleunigst hier raus, aber vorher wollte sie nur mal kurz schauen …
Sie zog sich ihren linken Ärmel als behelfsmäßigen Handschuh über die Finger und griff nach dem Deckenhaufen. Doch es war kein Haufen. Nur ein oder zwei große Fleecedecken, die um etwas gewickelt waren, und als sie sachte daran rüttelte, geriet der Haufen in Bewegung. Er rollte auf sie zu, und ein totes, schwarz-lila angelaufenes Gesicht mit offenem Mund und weißen Augen stierte in den Schein ihrer Handytaschenlampe.
Ein nackter Männerkörper löste sich mit einem schmatzenden Geräusch aus der Deckenverpuppung. Ein Arm schlug mit einem kurzen Laut auf den Boden, und Marias Gehirn registrierte noch vor ihren Augen, was falsch war. Der Arm endete im Nichts, da war keine Hand, und jetzt wusste sie, woher das Blut unter ihren Sohlen stammte.
»Notrufleitzentrale«, sagte eine ruhige Frauenstimme an ihrem Ohr.
Maria machte einen viel zu kurzen Schritt aus dem Lieferwagen, ihre Füße verfehlten den Asphalt, sie schlug mit der linken Hüfte zuerst und einem schweren Stöhnen auf dem Boden auf.
»Benötigen Sie akut Hilfe?«, fragte die Frauenstimme. Lauter jetzt, wach und bestimmt, doch Maria hörte sie kaum.
»Er hat keine Hände«, murmelte sie, während sich ihr Magen in Wellen zusammenzog. »Er hat keine Hände.«
3
Mikael Dirk hob das rot-weiße Absperrband an und ließ seinen Partner Frederik Dahlin darunter hindurchschlüpfen.
Er selbst blieb stehen, wanderte mit dem Blick umher.
»Kleinen Moment«, rief er Frederik hinterher. Er wusste aus Erfahrung, dass es in Kürze zu spät sein könnte, sich einen ersten Eindruck vom Fundort aus dem Blickwinkel des Täters zu machen.
Er sah auf seine Uhr und dann hinauf zum Himmel. Es war nach neun, die hellen Nächte waren für dieses Jahr unwiederbringlich vorbei, nur ein Streifen Septemberblau leuchtete noch weit oben am Firmament, reichte jedoch nicht herab in diesen merkwürdigen Randbezirk von Østerbro.
Der Stadtteil gehörte zu den teuersten Kopenhagens, aber in dieser Gegend fanden sich keine exklusiven Wohnungen, und das nächststehende Gebäude mit den kleinen Balkonen erinnerte an einen Wohnblock in einer klassischen Arbeitersiedlung. Tagsüber ratterten die S-Bahnen im Fünf-Minuten-Takt vorbei und schreckten damit effizient jegliche Investoren ab.
Nein, in die Stichstraße kam man nur, wenn man in der Gegend etwas zu erledigen hatte. Sie war schlecht beleuchtet und wurde durch Kanalisationsarbeiten sowie über die Gehwege wuchernde Büsche verunstaltet. Außerdem handelte es sich um eine Einbahnstraße voller Temposchwellen, hier fuhr man also nicht einfach so durch, notierte sich Mikael im Geiste. Die Straße wirkte eher wie eine Erweiterung des zu dem Wohnblock gehörenden Gartens.
Warum also war ausgerechnet hier eine Leiche in einem Lieferwagen zurückgelassen worden, wo eine zweistellige Zahl an Balkonen »mitschaute«? Das konnte bedeuten, dass es sich bei dem Täter entweder um einen Anwohner handelte, der in der Gegend nicht weiter auffiel, oder um einen Fremden, der sich hierher verirrt hatte.
Mikael holte Notizblock und Kugelschreiber hervor, notierte sich »Warum hier?« und bückte sich ebenfalls unter dem Absperrband hindurch. Gedämpfte, Anweisungen und Informationen austauschende Stimmen tanzten wie ein murmelnder Chor zwischen dem Wohnblock und der Hochbahntrasse. Etliche Kollegen waren vor Mikael und Frederik am Fundort eingetroffen; der Sommer in der Hauptstadt war ruhig verlaufen, daher hatten Ermittler und Kriminaltechniker in den Startlöchern gestanden, als der mögliche Mord in Østerbro gemeldet wurde.
Einige Beamte hoben den Kopf und nickten Mikael und Frederik grüßend zu. Die beiden brauchten ihre um den Hals hängenden Polizeiausweise nicht vorzuzeigen – alle kannten Mikael Dirk und seinen festen Partner.
Bei ihrem ersten gemeinsamen Fall vor zweieinhalb Jahren wäre Mikael beinahe ums Leben gekommen, und Frederik mit seinem sonst so sonnigen Gemüt hatte mit einer Art posttraumatischer Belastungsstörung reagiert, die er noch immer in monatlichen Therapiegesprächen verarbeitete. Solche Geschichten hatten die Eigenschaft, immer wilder ausgeschmückt zu werden, und inzwischen umgab Mikael und Frederik fast schon eine legendäre Aura. Vor allem die jungen Beamten – Herrgott, Mikael war selbst mal einer von ihnen gewesen, als er bei der Polizei Kopenhagen angefangen hatte – glaubten irrigerweise, traumatische Erfahrungen seien eine Art obligatorische Weiterbildung, die einen erst zum richtigen Ermittler machten.
Mikael und Frederik wussten es besser. Wenn diese Erfahrung sie etwas gelehrt hatte, dann, dass das Leben kurz und kostbar war. Beide hatten sie mittlerweile Kinder, eine Familie, an die sie denken mussten. Es gab keinen Grund, als Ermittler den harten Hund zu spielen.
Ein weißhaariger Mann kam ihnen humpelnd entgegen. Nach zwölf Monaten Rehatraining war Niels Carlsen als Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen zurückgekehrt, und Mikael, der ihn in seiner Abwesenheit vertreten hatte, konnte wieder einen Gang zurückschalten. Weniger Besprechungen, mehr frische Luft, geringere Verantwortung.
»Guten Abend, Chef. Wie ist die Lage?«
Wie immer hatte Carlsen als Erster die Meldung des Leichenfunds erhalten.
»Dirk, Dahlin, gut, dass ihr da seid. Ich weiß nicht mehr als das, was ich euch schon am Telefon gesagt habe. Ein entkleideter, verstümmelter Mann, zurückgelassen im Laderaum des Transporters da.« Carlsen zeigte auf den Wagen. »Auf den ersten Blick jung oder mittleren Alters, heißt es von den Technikern, aber wir haben keine Ausweise von ihm und auch keine Tatwaffe.«
Der Transporter war mindestens fünfzehn Jahre alt, ziemlich ramponiert, kein Kennzeichen. Vier Männer in Schutzkleidung bewegten sich schweigend in einem größeren Umkreis um den Wagen herum. Mikael erkannte Jan Munch, den Leiter des Teams, der mit kurzen freundlichen Kommandos die Spurensicherung choreographierte.
Die Leiche im Wagen würden Mikael und Frederik erst in einigen Stunden in Augenschein nehmen können, wenn die Arbeit der Kriminaltechniker beendet war. Zunächst musste alles auf dem Boden fotografiert werden. Zigarettenstummel, Glassplitter und Härchen wurden zur näheren Untersuchung eingesammelt und Fußabdrücke gesichert. Niemand wagte es, sich zu nähern, ehe Munch sein Okay gab.
»Machen wir ein kurzes Briefing.« Carlsen zeigte hinter sich zur mobilen Einsatzzentrale.
In dem Wagen mit dem kleinen Besprechungstisch saßen bereits ihre Kollegen John Langbjerg und Christine Eliasen und schenkten Kaffee in braune Pappbecher.
»Okay, Leute.« Carlsen sank mit einem Seufzen auf einen der Stühle. »Der aktuelle Stand ist, dass wir keine Ahnung haben, wer der Tote ist. Er war vollkommen nackt in Decken eingerollt, als er gefunden wurde, und unmittelbar gibt es keine persönlichen Papiere, Tätowierungen oder andere besondere Merkmale. Ohne Identität ist es schwer, Überlegungen bezüglich des Täters oder der Täterin anzustellen. Den Namen des Opfers in Erfahrung zu bringen hat deshalb Priorität.«
»Und die Mitteilerin? Eine Joggerin, richtig?«, fragte Frederik.
»Genau genommen ist zuerst eine Gruppe Kinder auf den Wagen aufmerksam geworden«, warf Christine Eliasen ein. »Aber eine Frau, die zufällig vorbeikam, hat ihnen geholfen. Ich habe sie befragt, sie arbeitet im Polizeimuseum und meinte, dass sie euch kennt.« Christine Eliasen blätterte in ihrem Notizblock. »Maria Just heißt sie.«
Frederik sah Mikael überrascht an. »Maria? Wusstest du das?«
Mikael schüttelte stumm den Kopf und senkte den Blick, es kribbelte zwischen den Schultern. In Bezug auf Maria gab es ein Davor und ein Danach. Sie hatten vor einem Jahr miteinander geschlafen, er hatte mehr gewollt und erhofft, aber Maria war in einer Beziehung, und so war der Kontakt allmählich zum Erliegen gekommen. Sie wollte nicht. Er konnte nicht.
»Das ist doch kein Problem, oder?«, fragte Carlsen. »Ich hab sie Eliasen überlassen.« Sein neutraler Tonfall gab zu verstehen, dass er ein »Natürlich nicht« als Antwort erwartete.
»Nein, kein Problem«, sagte Mikael. Er spürte Frederiks prüfenden Blick auf sich und sah hoch. Bemühte sich, nicht zu spitz zu klingen: »Überrascht mich nicht. Sie läuft bestimmt dreißig, vierzig Kilometer die Woche und wohnt nur ein paar Straßen von hier. Und sie ist neugierig wie nur was. Steckt überall ihre Nase rein. Wisst ihr ja.«
Eliasen ignorierte seine Bemerkung. »Die Zeugin ist natürlich erschüttert. Sie sagt, sie hätte das Opfer vorher noch nie gesehen. Die ersten Gespräche mit den Kindern, die bei dem Transporter gespielt hatten, haben auch nichts ergeben. Es ist spät, ihre Eltern sind gekommen, um sie abzuholen. Wir haben alle Namen und Telefonnummern notiert. Einem der Eltern ist der Wagen vor ein paar Tagen aufgefallen, aber die meisten haben überhaupt nicht bemerkt, dass er hier stand. Ich denke, sie bringen uns in Bezug auf die Identität des Opfers nicht weiter. Wenn du einverstanden bist, Carlsen, würden wir die Kinder und Eltern deshalb gern nach Hause schicken.«
Der Chef nickte. »Dann wollen wir uns mal die Hauptperson des heutigen Tages ansehen.«
Er klappte seinen Laptop auf und verband ihn mit einem Monitor. Pixelige Videobilder aus dem Inneren des Transporters erschienen. Man hörte den Atem des filmenden Kriminaltechnikers und zwischendurch eine vorbeifahrende S-Bahn.
»Wie es aussieht, hat der Mann mehrere Tage im Laderaum gelegen, die Techniker haben sogar Leichenflüssigkeit unter dem Wagen gefunden«, erklärte Carlsen.
Die Kamera schwenkte über den Leichnam. Von den Füßen hinauf zum Oberkörper, über beide Arme und hoch zum Gesicht. Die offenen Augen des Toten blickten leer geradeaus. An den Handgelenken ragten weiße Knochenstümpfe und verwestes Fleisch hervor.
»Er war in diese Fleecedecke gewickelt, die ihr hier seht. Seine Hände wurden abgeschnitten oder abgesägt und waren nicht im Auto.« Carlsen räusperte sich, stoppte den Film und trank einen Schluck Kaffee.
Mikael stutzte. »Moment, du sagst, er war ursprünglich in eine Decke gewickelt?«
»Ja, das hab ich zu erwähnen vergessen. Die Mitteilerin hat den Wagen betreten und nach der Decke gegriffen, ehe ihr klar wurde, dass eine Leiche darin eingewickelt war.«
»Das heißt, wir hatten eine Unbefugte am Fundort? Man riecht doch schon von Weitem, dass da eine Leiche liegt.« Mikael wusste selbst nicht, warum er sich so aufregte, und er spürte, dass Frederik seinen Blick suchte. »Maria weiß doch wohl besser als irgendwer sonst, dass ein kontaminierter Fundort uns Stunden oder Tage zurückwerfen kann. Das ist echt unfassbar.«
»Meinst du nicht, dass Munch und Juul damit klarkommen?«, besänftigte ihn Frederik, ohne den Blick von ihm zu nehmen.
Mikael sah weg, griff nach dem Kaffeebecher.
»Juul ist bereits verständigt, kommt aber erst, wenn alles für ihn bereit ist«, sagte Carlsen.
Natürlich, dachte Mikael, der Rechtsmediziner Andreas Juul war dafür bekannt, dass er nicht gerne wartete.
»Was ist mit Überwachungsaufnahmen und Telekommunikationsdaten, hat sich da schon wer drum gekümmert?«, wechselte Frederik das Thema. Er war geschickt darin, die Stimmung zu heben.
»Wie ich dich kenne, schlägst du dich doch am liebsten selbst damit rum, Dahlin«, sagte Carlsen. »Und ihr anderen: Wir müssen eine Reihe Dinge untersuchen. Wer ist der Besitzer des Lieferwagens? Wurde er als gestohlen gemeldet? Wo sind die Kennzeichen? Das Opfer hatte zwei Schussverletzungen. Wo ist die Schusswaffe? Womit wurden die Hände abgetrennt? Und nicht zuletzt: Wo sind die Hände jetzt?«
»Ich übernehme das mit dem Wagen.« John Langbjerg sprang auf. Seine Geduld bei Besprechungen hielt niemals länger als einen Becher Kaffee.
»Dirk, bleibst du noch kurz?«, sagte Carlsen, als alle aufstanden. Sie warteten, bis sie allein in der Einsatzzentrale waren. »Ich bin jetzt seit Stunden auf den Beinen und kann nicht mehr.« Der Chef stockte verlegen. Selbst ein Jahr nach dem verübten Anschlag auf ihn war er noch lange nicht wieder der Alte. Er hatte Ringe unter den Augen, und die Haut war fahl, obwohl er den Sommer in Spanien verbracht hatte. »Du musst für den Rest des Abends das Kommando übernehmen. Geht das?«
Mikael legte seinem Chef die Hand auf die Schulter und drückte sie kurz.
»Na klar«, sagte er und trat hinaus in die Dunkelheit.
4
Die Katastrophenschutzbehörde hatte Zelte aufgestellt, um den weißen Transporter vor der Witterung und neugierigen Blicken zu schützen. Es brannten starke Scheinwerfer darin, doch ab jetzt beschränkte sich das Schauspiel auf die Schatten der arbeitenden Kriminaltechniker.
Mikael sah, wie Frederik sich den Weg durch die Schaulustigen bahnte und Richtung Strandboulevarden ging. Vielleicht hatten die Mitarbeiter des Baumarktes um die Ecke etwas bemerkt. Sobald sich die Nachricht von dem Leichenfund verbreitete, würde bestimmt noch Input von Passanten kommen. Mit den beiden stark frequentierten Bahnhöfen Østerport und Nordhavn Station in unmittelbarer Nähe konnte es gut sein, dass Pendlern der ramponierte Lieferwagen aufgefallen war.
»Dirk! Ich finde Carlsen nirgends.«
Die tiefe Stimme war unverkennbar. Andreas Juul, Professor für Rechtsmedizin, war eingetroffen, um den Fundort zu untersuchen, und das auf der Stelle.
»Der ist nicht hier, Sie müssen sich mit mir begnügen«, erwiderte Mikael und versuchte, Juuls gefurchte Stirn mit einem Lächeln zu glätten. Er wollte Carlsen nicht bloßstellen; dass der Chef erschöpft war und Schmerzen hatte, ging niemanden etwas an. Auch Andreas Juul nicht. Doch der bestausgebildete Rechtsmediziner des Landes war Perfektionist bis in die Fingerspitzen und erwartete dasselbe von den Leuten um sich herum. In seiner Welt war es Zeitverschwendung, wenn er sich an einem Fundort mit jemand anderem als dem Leiter des Dezernats für Gewaltverbrechen persönlich abgeben musste. Von Chef zu Chef, so arbeitete Juul bevorzugt. Mikael nahm an, dass es sich hierbei um eine Berufskrankheit infolge von Juuls vielen Einsätzen in Katastrophen- oder Kriegsgebieten handelte, wo Sterne auf den Schulterklappen für einen reibungslosen Ablauf entscheidend waren.
Juul und Mikael zogen die Schutzmontur über und warteten auf Munchs Signal, ehe sie zu dem erleuchteten Zelt gingen. Mikael hatte es schon so oft erlebt, trotzdem überrumpelte ihn der Leichengeruch, und der Mundschutz verstärkte den übelkeitserregenden Gestank noch.
»Eins zur Info, bevor Sie anfangen: Die Mitteilerin war im Wagen. Sie hat die Decke von der Leiche gezogen, das ist also nicht die ursprüngliche Position, in der der Tote zurückgelassen wurde«, sagte Munch.
»Na toll, damit hätte sich meine Arbeit soeben erschwert. Man wundert sich immer wieder, wo die Leute überall ihre Nase reinstecken.« Juul seufzte genervt.
»Sie haben ja keine Ahnung«, brummte Mikael.
Sie mussten die Köpfe einziehen, um in den Laderaum des Transporters zu steigen, und stellten sich eng beisammen in einem Halbkreis um den namenlosen Mann. Normalerweise hatte Munch einen Assistenten dabei, doch der Fundort war zu klein, daher übernahm er selbst das Fotografieren bei der Leichenschau. Unterdessen diktierte Andreas Juul konzentriert, was er sah.
»Beginn der äußeren Leichenschau Montag, 5. September 2022, 21.54 Uhr.« Er nahm ein digitales Thermometer zur Hand. »Lufttemperatur fünfzehn Grad«, stellte er fest, ehe er das Thermometer in den Enddarm des Leichnams schob und einen Moment wartete. »Körpertemperatur ebenfalls fünfzehn Grad. Sichere Todeszeichen: Leichte Fäulnis und Totenflecke.«
Mikael beobachtete, wie der Rechtsmediziner sich systematisch vorarbeitete und mit seiner behandschuhten Hand den verwesenden Körper abtastete.
»Unmittelbar keine Anzeichen von Leichenstarre«, sagte Juul mechanisch in sein Diktiergerät.
»Darf ich eine Frage stellen«, unterbrach Mikael ihn bei seiner Arbeit. Der Gestank in dem kleinen Laderaum machte es schwer, die erforderliche Geduld aufzubringen.
»Wenn es nicht warten kann«, antwortete Juul, ohne den Blick von der Leiche zu nehmen.
»Was denken Sie über den Todeszeitpunkt? Wie lange liegt er schon hier?«
Andreas Juul seufzte tief. »Das fragt ihr mich immer, und meine Antwort ist jedes Mal dieselbe: Das kann ich jetzt noch nicht sicher sagen. Der Anfang des Herbstes war bisher ungewöhnlich warm, der Mann hat in dieser Stahlkiste also in einer Art Backofen gelegen. Ich muss erst Berechnungen am Institut vornehmen, ehe ich eine qualifizierte Aussage machen kann. Aber da die Leichenstarre sich schon wieder gelöst hat, sind mindestens zwei Tage vergangen.«
»Was denken Sie in Bezug auf die Hände? Warum wurden sie abgetrennt?«
Juul lachte meckernd auf. »Das war auch das Erste, was ich mich gefragt habe. Schauen Sie hier.«
Er winkte Mikael näher heran. Ein schlaffer Arm baumelte zwischen Juuls Händen, beim Anblick der grün-gelb gefärbten Haut drehte sich Mikael der Kaffee im Magen um.
»Da«, sagte Juul. »Mir ist gleich aufgefallen, dass an den Handgelenken kaum Blut ist. Das deutet darauf hin, dass der Mann bereits tot war, als die Hände abgeschnitten oder abgesägt wurden. Hätte sein Herz noch gepumpt, wäre der ganze Laderaum rot. Natürlich nur, sofern die Amputation hier vorgenommen wurde.«
»Okay, verstehe.«
»Außerdem kann ich sagen, dass die Hände mit einem scharfen, gezahnten Gegenstand abgetrennt wurden. Munch, die Knochen müssen auch untersucht werden«, fuhr Juul fort.
Munch nickte hinter der Kamera, während Mikael von einem Bein aufs andere trat.
»Dann würde ich spontan auf Bandenmord tippen«, sagte er. »Eine Auseinandersetzung zwischen ein paar Typen, die sich für ganz große Kerle halten. Erst wird er erschossen, dann sägt man ihm die Hände ab. Vielleicht hat er sich in der Kasse bedient oder die Freundin von jemandem zu lange angeschaut, deshalb hat ihm der Täter symbolisch die Hände abgetrennt. So wie bei diesem Gangster drüben auf Amager, dem die Zunge abgeschnitten wurde, weil er seine Kumpels bei der Polizei verpfiffen hatte.«
»Hm, ja … kann sein«, meinte Juul zögernd.
»Halten Sie sich nicht zurück«, sagte Mikael. »Im Moment ist jeder Input gut.«
»Ich arbeite seit dreißig Jahren in diesem Bereich, und so viel habe ich gelernt: Mörder kommen auf die merkwürdigsten Einfälle. Ich finde das mit den Händen nicht weiter ungewöhnlich. Ich hatte mal einen Fall, da hat der Mörder seinem Opfer nur wegen einem kostbaren Armband eine Hand abgeschlagen. Anders hätte er es nicht abgekriegt, weil die Leichenstarre schon eingetreten war. Das war nichts Symbolisches, sondern einfach nur Gier.« Juul drehte sich um und zeigte auf eine der Fleecedecken. »Was ich persönlich interessanter finde, ist die Decke, in die er gewickelt war. Die Leiche war in dem Transporter sowieso schon verborgen. Warum sich die Mühe machen und den Mann zudecken?« Er hob fragend die Augenbrauen. »Das hat fast etwas Fürsorgliches. Ich habe schon viele Morde gesehen, aber Fürsorge für die Leiche im Anschluss an die Tat eher selten. Falls es das ist, könnte das für eine persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter sprechen.«
»Oder das genaue Gegenteil«, warf Munch ein. »Opfer und Täter kennen sich überhaupt nicht, und als das Opfer tot auf dem Boden liegt, bekommt der Täter ein schlechtes Gewissen, kann den Anblick von dem, was er getan hat, nicht ertragen.«
»Hm. Vielleicht«, meinte Mikael. »Oder die Decke war einfach nur der Versuch, die Schweinerei zu verbergen. Vielleicht wollte der Täter die Leiche ursprünglich woanders entsorgen. Es gibt viele Möglich…«
»Jaja«, unterbrach ihn Juul. »Ich bin nur ein kleiner, bescheidener Mediziner. Motive und Theorien überlasse ich getrost Ihnen.« Er ließ abermals sein meckerndes Lachen hören und wies mit dem Kinn auf die Hecktüren. »Und jetzt raus hier, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Heute Abend werde ich nichts Handfestes mehr liefern können. Ich nehme an, Sie kommen morgen Vormittag zur Obduktion? Neun Uhr. Pünktlich, wenn ich bitten darf.«
5
Er konnte es nicht länger hinauszögern. Schon als er sich aus seinem Schutzanzug schälte, spürte er ihre Anwesenheit. Sie stand mit einer Tasse Kaffee in den Händen und einer Rettungsdecke des Katastrophenschutzes um die Schultern einige Meter weit weg. In einem merkwürdigen Outfit aus Laufhose und schickem dunkelblauem Blazer. Das rotblonde Haar, das normalerweise ihren vermaledeiten Dickschädel umwallte, war zu einem Dutt zusammengedreht und von einer schwarzen Kappe bedeckt. Ihr Gesicht war ausdruckslos, die Sommersprossen blass, der Blick dunkel.
Er sah sich nach einem Feuchttuch um. Fand eines bei den Technikern. Konzentrierte sich darauf, jede einzelne Falte in seinen Händen akribisch abzurubbeln. Nahm ein weiteres, wischte sich damit übers Gesicht. Versuchte, Zeit zu schinden. Dann stand sie hinter ihm.
»Mikael.«
Er würde diese Stimme auf mehrere Hundert Meter Entfernung erkennen. Es war zum Verzweifeln.
»Dirk, ein Vater von einem der Kinder will mit dir reden«, erklang die Stimme von Christine Eliasen.
Mikael wandte sich um und bemühte sich um eine professionelle Miene.
»Ich denke, wir können Maria Just jetzt nach Hause schicken. Sie wurde vernommen, den Bericht schreibe ich morgen«, fügte seine Kollegin hinzu.
»Natürlich, Christine.« Er schaute Maria an. »Tut mir leid, dass du warten musstest. Hi.« Dankbar registrierte er, dass Eliasen ein Stück beiseitetrat, schwer beschäftigt damit, ihre Notizen durchzugehen. »Was zur Hölle ist hier passiert?«, brach es aus ihm heraus. »Ich meine, was machst du hier?«
»Soll ich alles noch mal erzählen? Ich habe mein Auto gesucht. Das steht da drüben. Ein paar Kinder …«
»Nein, nein, das weiß ich alles. Du hast den Lieferwagen oder den Toten vorher nie gesehen, ja?«
»Ich kann dir nicht sagen, ob er schon hier stand, als ich letzten Sonntag hier geparkt habe. Einer der Jungs wollte wissen, ob da ein Zombie im Auto ist. Und genau so hat er ausgesehen. Der Tote. Wie eine groteske Halloweenpuppe.« Sie verstummte und blinzelte mehrmals, ehe sie mit geröteten Augen fragte: »Wisst ihr, wer er war?«
Mikael bemerkte ihre schwarzen Fingerkuppen, sie hatten ihre Fingerabdrücke genommen. Er senkte den Blick und versuchte, seine Gedanken in Schach zu halten. Das ging so nicht. Er war der Ermittlungsleiter, vertrat Carlsen als Dezernatschef, sein Privatleben hatte am Fundort nichts verloren.
Reiß dich zusammen, ermahnte er sich.
»Wir arbeiten daran. An allem. Du kannst jetzt ruhig nach Hause gehen«, sagte er.
»Wie spät ist es?«
Mikael sah auf die Uhr. »Zwanzig nach zehn.« Er räusperte sich. »Das war keine gute Idee, dass du in den Transporter gestiegen bist. Zu dem Toten, meine ich.« Er klang, als würde er eine Teenagerin zurechtweisen. »Nicht nur wegen der unschönen Erfahrung für dich. Und für die Kinder, die … Aber du hast möglicherweise unseren Fundort mit deiner DNA, deinen Kleidungsfasern, Haaren, Fußabdrücken kontaminiert. Das ist katastrophal für eine Ermittlung. Oder zumindest zeitraubend. Das muss dir doch klar gewesen sein, du bist ja nicht unvertraut mit Polizeiarbeit, oder?«
Marias Augen weiteten sich, ein Schatten huschte über ihr Gesicht.
»Ich musste doch erst mal schauen, was in dem Wagen ist, bevor ich Himmel und Hölle in Bewegung setze. Immerhin habe ich etwas unternommen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten, die einfach vorbeigegangen sind!«
Rote Flecken erschienen über dem Kragen ihrer Laufjacke, als sie auf die Schaulustigen auf der anderen Seite des Absperrbands zeigte. Ein bekanntes Gesicht, Jeppe Findsen, alias Krimi-Jeppe von der Morgenavisen