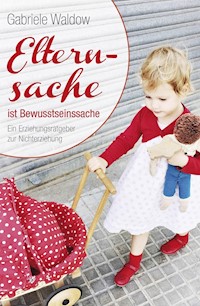
9,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erziehungssache ist in erster Linie Elternsache - und die eigene Persönlichkeitsentwicklung die erste und alles entscheidende Erziehungsmethode. Eltern sind das Modell - besonders in den ersten Lebensjahren - dem ihre Kinder folgen. Anhand einer Fülle von Beispielen zeigt das Buch, wie Eltern den Herausforderungen des Erziehungsalltags erfolgreich begegnen und dabei selber wachsen können. Fallen alltäglicher Kommunikation und emotionaler Betroffenheit, wie sie fast jeder kennt, werden beschrieben und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Anregungen und konkrete Hinweise für das persönliche Wachstum führen zu einem bewussten Umgang mit sich selbst sowie mit der eigenen Elternrolle auch in schwierigen Situationen. Nicht nur der Umgang mit den Kindern, auch die Partnerschaft profitiert davon!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elternsache ist Bewusstseinssache
Elternsache ist Bewussteseinssache
©2016 Gabriele Waldow
Verlag tredition GmbH, Hamburg
Umschlag: Torge Niemann
Satz: Michael Vervin
Paperback ISBN 978-3-7345-0027-5
Hardcover ISBN 978-3-7345-1811-9
e-Book ISBN 978-3-7345-0382-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gabriele Waldow
Elternsache
ist Bewusstseinssache
Ein Erziehungsratgeber zur Nichterziehung
Die Würde des Kindes ist unantastbar.
Sie, diese Würde, ist das einzige Ziel der Menschenbildung und zugleich das erste Mittel für sie.
Heinrich Pestalozzi
Inhalt
Etwas zur Einführung
Die Würde des Kindes
Der Flügelschlag des Schmetterlings
Etwas über Eltern, Kinder und Erziehung
So einfach ist das!
Wer ist Max?
Hilfe, ich bin schuld
Stopp, damit es so nicht weitergeht
Hilfe, ich bin nicht gut genug
Ja, nein, lass das oder du darfst
Gehorsam oder was sonst
Grenzen schützen und wahren
Gärtnern und lesen
Zeige mir, wie du es machst
Kinder brauchen Aufmerksamkeit
Einen Bewusstseinsraum öffnen
Etwas über Kommunikation
Die Energie hinter unseren Worten
Herzenstüren öffnen
Wie man in den Wald hereinruft
Aber ich habe doch nur gesagt!
Selbstermächtigung und Verantwortung
Ehrlich sein ohne Vorwurf
Welche Pakete wollen wir senden?
Die Falle alltäglicher Bewertungen
Richtig oder falsch … gut oder böse?
Orientierung durch liebvolle Konsequenz
Etwas über Gefühle
Im Wechselbad der Gefühle
Das Stimmungsbarometer
Emotionale Überlebensstrategien
Wahrnehmen, was wir fühlen
… wenn dann doch der Kragen platzen will
Macht, die frei macht
… und wenn das alles nicht so leicht geht
Frei von Angst sein
Etwas mehr über Bewusstsein
Kollektive Bewusstseinsfelder
Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung
Die lautlosen Impulse zur Veränderung
Eine Landkarte des Bewusstseins
Der Bereich des Egos
Integrität und Liebe
Sündenfall oder Resonanz
Etwas über Lebensskripte
Raupe oder Schmetterling
Der unbewusste Lebensplan
Destruktive Grundbotschaften
Den Bann brechen
Entscheidungen treffen – Energie freisetzen
Verstehen, was uns dann noch antreibt
Wir haben die Wahl
Entscheidung zur Freiheit
Anhang
Sich selber kennenlernen
Quellenverzeichnis
Die Würde des Kindes
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“, so steht es in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Hier hat man erfahren, wie verletzbar die Würde ist und hat sie zum ersten Grundrecht eines jeden Menschen erklärt.
Doch wie sieht es im Kleinen aus, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, den Paarbeziehungen, in den Familien, im Kontakt der Eltern zu ihren Kindern? Gerade im Umgang mit Kindern ist die Würde am allerverletzbarsten, und sie wird unbedacht, unwissend oder rücksichtslos tagtäglich wehrlosen Geschöpfen gegenüber angetastet, angegriffen und verletzt, die voll Vertrauen aufschauen zu denen, deren Aufgabe es ist, sie zu führen und zu leiten, indem sie ihnen vorleben – und im Umgang mit ihnen erfahrbar machen – was wahre Menschenwürde ist.
‚Würde’ ist ein Ausdruck, der in unserer Alltagssprache kaum vorkommt und uns zunächst einmal als ein abstrakter Begriff entgegentritt. Kein Versuch, sie mit Worten näher zu umschreiben, keine Definition und keine Erklärung konnten mich zufrieden stellen, um das auszudrücken, was nur jeder Mensch tief im seinem eigenen Inneren erfühlen kann. Und so möchte ich gleich zu Beginn dieses Buches Sie, liebe Leserin, lieber Leser mit auf eine Reise in die eigene Innenwelt nehmen, indem ich Sie einlade, sich für wenige Augenblicke nach innen zu wenden, um sich Ihrer inneren Präsenz, Ihrer Einmaligkeit und inneren Schönheit bewusst zu werden.
Wer die Augen schließt, still wird und der Spur seines Einatmens folgt, vermag die Zartheit, Empfindsamkeit und Größe dieser innersten Essenz – die oft auch als Seele bezeichnet wird – zu erahnen. In der Stille des Inneren begegnet sie uns wie ein kostbares Geschenk des Lebens, das wir in uns tragen – und nur allzu oft vergessen, wenn unsere Sinne einseitig nach außen gerichtet sind. Und doch ist es gerade dieser Teil, der unsere wahren Lebensimpulse in sich trägt, der uns führen möchte und leiten und sich in unserem Leben durch unser Denken, Fühlen und Handeln mitteilen und zum Ausdruck bringen möchte.
Jede einseitige Ausbildung des Intellekts, jedes Urteil und Vorurteil, jede weltanschauliche Fixierung, jeder Impuls, der den Kopf über das Herz – und damit eine vorgefertigte Anschauung über die augenblickliche Wahrnehmung – stellt, hält uns fern von unserer Seele, unserer inneren Impulsgeberin, und damit fern von uns selbst.
Wir können die Essenz unseres Seins – die Quelle wahrer Menschenwürde – nur im aktiven Wahrnehmen des gegenwärtigen Momentes erfahren. Mit der nur intellektuellen Seite des Verstandes können wir sie niemals begreifen, geschweige denn uns als eins mit ihr erleben. Je öfter wir mit unserer Wahrnehmung in diesen inneren Ort des Selbst-Seins eintauchen, in diese Stille lebendiger Gegenwart, umso mehr können wir Freude und Dankbarkeit erleben, die uns aus dieser Quelle zufließen. Und wir beginnen, Verantwortung zu tragen und Liebe zu fühlen für die stille und zugleich machtvolle Präsenz in uns.
Selbstverantwortung für unser Denken, Fühlen und Handeln ist eine Folge dieser Präsenz und zugleich Ausdruck von Selbstachtung und Wertschätzung unserer selbst, die uns zum Erfahren der eigenen Würde befähigen.
Würde ist ein dem Menschen innewohnender Wert. Sie wird geboren aus der Einmaligkeit und Größe der menschlichen Seele, deren Ursprung wir nicht kennen oder nur erahnen und aus dem Geheimnis des Lebens selbst.
Was macht den Menschen so wertvoll, was macht jeden Einzelnen von uns so bedeutsam? Ist es nicht diese Einzigartigkeit, mit der wir in dieses Leben kamen? Unsere Fähigkeit zu einem ganz individuellen Lebensausdruck? Unsere besonderen Begabungen? Unsere Möglichkeit, mit ihnen in dieser Welt wirksam zu sein? Das Leben zu gestalten, zu verändern und Neues zu schaffen und zu erschaffen? Und schließlich unsere persönliche Freiheit zu wählen, was auch unsere Entscheidungsfreiheit für und gegen die Kräfte des Lebens mit einschließt? Ist es nicht das, was jeder Einzelne mitgebracht hat, eine Facette eines großen Ganzen und doch gleichzeitig selbst ein Ganzes?
„Würde bezeichnet die Eigenschaft, eine einzigartige Seinsbestimmung zu besitzen“1), können wir bei Wikipedia lesen. Aber auch „Ansehen beziehungsweise Stellung“ in der Gesellschaft seien Ausdruck dieser Würde. Befreien wir das Ansehen von allem Dünkel einer privilegierten Stellung innerhalb einer sozialen Rangordnung und anderer Unterscheidbarkeiten äußerlicher persönlicher Daten und übersetzen es in eine Sprache sozialer Interaktion, heißt es: Ich sehe dich als der, der du wirklich bist – ein einmaliges, unverwechselbares Geschöpf, das sich hier auf dieser Erde in einem Körper ausdrücken und verwirklichen möchte, um mit seinem kreativen Potenzial selbst Schöpfer zu sein. Ich sehe dich in dieser erhabenen Stellung. – Wie wäre es, wenn wir ein Kind jeden Morgen neu mit Gefühlen und Gedanken in dieser Haltung willkommen hießen?
Wer den Film ‚Avatar’ gesehen hat, mag sich vielleicht erinnern, wie der Ex-Marine Jake auf einer Mission auf dem extraterrestrischen Planeten Pandora auf die Na’vi-Frau Neytiri trifft und wie beide ihre tiefe Liebe ausdrücken – über alle äußerlich wahrnehmbaren Formen hinweg – mit den Worten: Ich sehe dich!
Ich sehe dich als einen wunderbaren Ausdruck des Lebens – was geschähe, wenn Eltern es sich tagtäglich bewusst machen würden, welche einmalige Aufgabe sie ihren Kindern gegenüber haben: dem Wunder der Menschwerdung selbst mehr und mehr im irdischen Leben zum Ausdruck zu verhelfen?
Jetzt hast du schon wieder alles kaputt gemacht! … Kannst du denn nie aufpassen? … Immer wirfst du alles um! … Guck mal, wie du wieder aussiehst! … Für dich muss man sich ja schämen! … Dich kann man keine fünfMinuten alleine lassen! … Was du wieder angerichtet hast! … Siehst du, das kommt davon! … Wollen wir wirklich unter solchen Sätzen das Wunder des keimenden Lebens begraben? Ich gehe davon aus, dass keiner das will, und wenn er es trotzdem tut, liegt es vielleicht in erster Linie daran, dass er die eigene Würde nicht oder nur unvollständig lebt. Wer die eigene Würde in sich nicht kennt, kann sie auch beim anderen nicht wahrnehmen.
Strafe, Drohungen, Einschüchterung, Schuldgefühle provozieren und Verantwortung abladen, die ein Kind nicht tragen kann, ins Zimmer sperren, Abwertung und Kritik – all das tastet die Würde eines Kindes nachhaltig an.
Eine Erziehung hingegen, die Selbstbestimmung, Selbstachtung und Selbstverantwortung fördert, die die individuelle Ausdrucksform eines Kindes respektiert, einfühlend achtet und wertschätzt und der freien Entfaltung seines in ihm veranlagten Potenzials Raum gibt, befähigt zum Erfahren der eigenen Würde.
Der Flügelschlag des Schmetterlings
Menschliche Entwicklung ist Geheimnis und Wunder zugleich. Doch es ist ein Geheimnis, das uns nicht gänzlich verschlossen bleiben muss. Wir können uns ihm nähern, weil wir auch nach dem Ende der eigenen Kindheit uns entwickelnde Wesen bleiben und dabei beobachten können, wer oder was in uns diesen fortdauernden Entwicklungsprozess vorantreibt. Dass das nicht selbstverständlich und automatisch geht, wissen wir. Jedes ‚So bin ich nun mal’ und jedes Einverständnis zu Alter und Abbau entfernt uns von der Quelle dieser Entwicklungsimpulse.
Als die Ereignisse in meinem eigenen Leben nicht so liefen, wie ich es mir in jugendlichem Selbstverständnis vorgestellt hatte, als mich Erfahrungen, die ich machte, überraschten und manchmal auch erschütterten, machte ich mich auf die Suche, wie ich Disharmonien und Missklänge in meinem Leben wieder in Harmonie und Klang verwandeln konnte. Ich wollte Kongruenz zwischen mir und den Ereignissen, die das Leben für mich bereithielt. Ich wollte die Gewissheit, dass das Leben mir nicht entgleitet in eine Richtung, die ich ihm nicht selbst gewiesen hatte. Und ich wollte dieses Gefühl von Lebenssicherheit, das sich aus dem ergibt, was heute oft mit dem Wort ‚Flow’ umschrieben wird. Ich wollte den Fluss des Lebens zurückgewinnen, wollte mich wieder seiner Strömung anvertrauen, wie ein es Kind tut, bevor der Erwachsene durch sogenannte ‚Erziehungsmaßnahmen’ zu tief eingegriffen hat. Dabei ging es mir zunächst einmal darum, in ‚Ein-Klang’ mit mir selbst zu kommen, mit meinen Wünschen an das Leben, mit meinen Lebenszielen und meinen Lebensaufgaben. Ich wollte die Hindernisse in meinem Lebensfluss aufspüren und zur Seite räumen.
Schnell war mir klar, dass die Harmonie, die ich anstrebte, weder durch Anpassung an scheinbar gegebene Strukturen noch durch oberflächliche Neu-Strukturierung meiner Glaubenssätze zu erreichen war. Heute spricht man in diesem Zusammenhang von Affirmationen, durch die wir uns vorübergehend selbst betäuben können, sofern sie nicht in Einklang sind mit unseren innersten Impulsen.
Einklang von Bewusstsein, Denken, Wahrnehmen und Handeln entsteht, wenn wir uns selbst kennengelernt haben und es uns gelingt, von dieser inneren Quelle aus nach außen zu wirken und uns ‚ein-stimmig’ durch Körper, Geist und Seele zum Ausdruck zu bringen.
Dieses Selbst stand von da an im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Und je mehr ich dieses Selbst in mir entdeckte und mich mit ihm verbunden fühlte, umso stärker erlebte ich, wie ich über dieses Selbst gleichzeitig mit allen anderen Menschen verbunden war. Wie in einem Geflecht von Familie, Freunden, Kollegen, aber auch spontanen Begegnungen, saß ich selbst in der Steuerzentrale eines riesigen Netzwerkes – ebenso wiejeder andere auch. Drehen wir uns ein wenig, ändern einen Gedanken, klären ein Gefühl, fassen einen Entschluss, dreht sich das gesamte Netz wie die Formation eines Vogelfluges am Himmel. Das war eine großartige Entdeckung. Alles hängt mit allem zusammen. War das der bekannte ‚Flügelschlag des Schmetterlings’, den ich da erfuhr?
Der Meteorologe Edward N. Lorenz machte mit seiner Aussage, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen könne, eine Metapher beinahe über Nacht weltweit populär. In unserer vermeintlich kalkulierbaren und berechenbaren Welt können scheinbar unbedeutende Ereignisse unerwartete Folgen haben und die Grenzen des Machbaren zeigen.
Nicht nur das Wetter ist hiervon betroffen, sondern auch andere komplexe und dynamische Systeme, wie beispielsweise die Entwicklung der Börse oder politische Entwicklungen bis hin zum Verlauf der Geschichte. Ohne ein kleines unbedeutendes Ereignis, das zum Auslöser des ersten Weltkrieges geworden ist, hätte unsere Geschichte vielleicht einen anderen Verlauf genommen. Aber auch der Verlauf eines Krankheits- beziehungsweise Heilungsprozesses kann vom ‚Flügelschlag eines Schmetterlings’ in Form einer Diagnose oder eines heilenden Wortes abhängen.
Wenn wir uns bewusst machen, wie komplex soziale Zusammenhänge sind, und wie angreifbar in ihnen das System Mensch ist – welche Dynamiken jeder Einzelne in seinem eigenen Leben und im Leben anderer durch einen ‚Flügelschlag’ auszulösen vermag –, werden wir vielleicht in Zukunft besser auf unsere Worte und unser Verhalten unseren Kindern gegenüber achten.
Der Mediziner und Psychologe Dr. Alex Loyd beschreibt in seinem Buch „Der Healing-Code“ die Geschichte einer Patientin, die mit dem Problem zu ihm kam, ihren eigenen beruflichen Erfolg immer wieder selbst zu boykottieren, obwohl sie mit einem IQ von 180 für diesen Erfolg doch geradezu prädestiniert erschien. In der therapeutischen Arbeit konnte Loyd mit ihr gemeinsam die Ursache für diesen Misserfolg aufdecken: Im Alter von fünf Jahren hatte ihre Mutter ihrer Schwester ein Eis am Stil gekauft, weil diese ihr Essen ‚brav aufgegessen’ hatte – ihr jedoch nicht, weil sie ihr Essen eben nicht brav aufgegessen hatte. Die Enttäuschung darüber hatte sich tief in ihr Unbewusstes eingegraben und blieb dort mit den Augen der Fünfjährigen bis zu ebendieser Therapiesitzung gespeichert.
„Vor dem Erwerb des logischen Denkens liegende Erinnerungen können wie Schreckensgespenster durch unser ganzes Leben geistern“2), was zur Folge hat, dass solche Erinnerungen im Laufe des Lebens immer wieder reaktiviert werden, wenn der Mensch in eine vergleichbare Situation kommt. Wenn sich also beispielsweise – wie bei Loyd beschrieben – in einer Firma zwei um den gleichen Posten bewerben, kann das Scheitern und die Zurücksetzung durch eine früh erlebte ‚Eis-am-Stil-Geschichte’ tief unbewusst zur Selbstsabotage führen, ohne dass der Erwachsene sich dessen bewusst ist oder einzugreifen vermag.
Auch wenn wir es manchmal kaum für möglich halten, sind diese subtilen Vernetzungen unserer Handlungen und Entscheidungen mit unseren unbewussten Erinnerungen in der psychologischen Praxis hinlänglich erwiesen. Kleine Ursachen können große und unkalkulierbare Auswirkungen in unserem Leben und im Leben unserer Kinder haben.
Das Drama dabei ist, dass sich schmerzliche oder angstbesetzte Erlebnisse aus der Kindheit oft vor uns verstecken und wir als Erwachsene zunächst einmal keinen Zugang mehr zu ihnen haben. Wir haben sie in uns verkapselt, weil sie schmerzhaft waren und wir nicht mehr an sie erinnert werden wollten. Gerade diese nicht bewussten Erinnerungsbruchstücke führen aber dazu, dass sich ein Mensch nicht mit der Kraft und Fülle seiner ganzen und ungebrochenen Individualität durch einen Körper ausdrücken und in seinem Leben verwirklichen kann. Er lebt fragmentiert und bleibt nicht selten in den Irrungen und Wirrungen des Lebens ein Opfer der Umstände und ein lebenslang Suchender nach dem ewig reinen und heilen Ursprung seiner selbst.
Doch wer die Sprache des Schicksals zu lesen gelernt hat, weiß, dass es häufig gerade die scheinbaren Hindernisse im Leben sind, die uns zu diesen, vom Bewusstsein abgetrennten, Erfahrungsanteilen zurückzuführen vermögen. Nicht selten ereignen sich solche Anstöße in der Partnerschaft und im alltäglichen Umgang mit Kindern, die wir immer dann erfahren, wenn aus dem Miteinander ein Gegeneinander wird. Besonders Erfahrungen, die wir manchmal lieber vermeiden würden, können dazu führen, dass wir uns selbst immer besser kennenlernen, sofern wir bereit sind, ihre Herausforderung als Aufforderung zur Entwicklung zu verstehen und uns ihre Botschaft zu entschlüsseln. Mit den Themen dieses Buches begegnen Ihnen als Leser viele Hinweise, die in diese Richtung weisen. Eine spontane Erkenntnis, eine emotionale Erschütterung, ein plötzliches Verstehen kann wie ein ‚Flügelschlag’ wirken und auf den Weg zu Bewusstwerdung, Integration und Ganz-Werdung führen.
Je mehr ich mich mit der Struktur und dem Entwicklungspotenzial des menschlichen Bewusstseins befasste, umso mehr entfaltete sich das Wunder des Menschseins und damit das Wunder kindlicher Entwicklung vor meinem inneren Auge. Aber auch die Störfaktoren dieses sich natürlich entfaltenden Prozesses wurden mir bewusst. Ich erkannte, dass uns die Kausalität rein dualistischen Denkens wie eine Falle umschließen kann und wir dieses Denken häufig schon früh an unsere Kinder weitergeben.
Das Wachstum und die permanente Verwandlung von Kindern geschehen mit solcher Geschwindigkeit, dass wir ihnen beinahe dabei zusehen können. Was sind die Gesetze dieser Wandlung? Nach welchen Entwicklungsimpulsen und welchen Formgesetzen verändern sie sich? Sind es in erster Linie die Gene, sind es die Vererbungsmerkmale, die Wachstum und persönliche Entwicklung beeinflussen? Welchen Einfluss hat die Umgebung auf das sich verändernde Kind? Und welche Bedeutung in diesem Prozess hat schließlich die Individualität eines Kindes selbst? Zu all diesen Fragen gibt es eine große Anzahl von Büchern, und auch wenn wir sie studiert haben, erhalten wir keine verbindlichen Antworten. Das Fazit ist oft eher weltanschaulicher Natur, und am Ende unserer Forschungsreise bleibt menschliche Entwicklung für uns noch immer ein Mysterium.
Und doch weiß jeder, der mit Kindern zu tun hat, aus eigener Erfahrung, dass die Art, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir sie ansprechen, mit welchem Respekt und mit welcher Achtung, welche Worte wir zu ihnen sagen, welche Angebote wir ihnen machen, welche Verhaltensweisen wir ihnen vorleben, welche Gedanken wir denken und welche emotionalen Energien wir ausstrahlen – dass all das einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung hat. Und das betrifft sowohl ihr Wachstum und ihre gesundheitliche Konstitution als auch ihr Sozialverhalten, ihr Interesse an der Umwelt, ihr Selbstwertgefühl, ihr Vertrauen ins Leben und vieles mehr.
Unser Verhalten findet in der Regel besonders in den Sprachmustern, die wir nutzen, seinen Ausdruck. Wer Respekt und Wertschätzung seinen Kindern gegenüber hat, wird in Konfliktsituationen andere Worte wählen als jemand, dem dieser Respekt fehlt. Wer Selbstachtung und Selbstliebe kennt, wird seinen Kindern anders begegnen als jemand, der darauf angewiesen ist, Anerkennung von außen zu erhalten. Wem die Einmaligkeit und das Wunder menschlicher Entwicklung bewusst ist, wird anders auf ein Kind zugehen als jemand, der niemals über den Sinn und die Bedeutung des eigenen Lebens nachgedacht hat. Wer seine eigene Größe kennt, sieht sie auch in seinen Kindern!
Indem ich meinem wachsenden Interesse folgte, menschliches Sein immer tiefer verstehen zu wollen, erlangten Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung für mich an Bedeutung. Ich verstand zunehmend, wie unser gegenwärtiges Sein mit jeder Handlung, jedem Wort, jedem Gedanken, mit jedem Gefühl und jedem Sinneseindruck unser zukünftiges Sein beeinflusst; ich erlebte, welche Macht uns dadurch gegeben ist – verstand aber auch, welche Ohnmacht wir erleben müssen, wenn wir unbewusstes Sein dem bewussten vorziehen.
Mein Blick auf menschliches Verhalten veränderte sich. Ich erfuhr die Verwundbarkeit und Unsicherheit vieler Menschen – ‚fernab von sich selbst’ – und besonders die Verletzlichkeit und Zartheit der Kinder, die den Kontakt zu sich selbst oft schon in jungen Jahren durch sogenannte wohlgemeinte Erziehungsmaßnahmen verloren hatten. Ich erfuhr ihre Bildsamkeit und ihre Offenheit, ihr Vertrauen, ihre Abhängigkeit und ihre Bereitschaft alles zu nehmen, was ihnen geboten wurde – Gedankenmuster, emotionale Muster und Verhaltensmuster ebenso wie die tagtägliche Nahrung. Ich sah die Kinder und gleichzeitig das Netz all dieser Informationen, in denen sie hingen. Alles war viel zerbrechlicher, fließender, beeinflussbarer, als ich es mir je hätte vorstellen können.
Je mehr Wissen wir über uns selbst erlangen, und je mehr Erfahrungen wir im Umgang mit Menschen gewinnen, indem wir unser eigenes Handeln und die Reaktion, die wir hervorrufen, beobachten – je mehr wir dabei bereit sind, auch uns selbst infrage zu stellen und zu verändern –, umso umfassender wird auch unser Blick auf andere.
Nach und nach tut sich eine neue Form der Wahrnehmung vor uns auf. Ein einseitig selbstbezogen fokussierter Blick öffnet sich, und wir können Dinge sehen, die wir zuvor nicht sehen konnten. Wir beginnen, die Ereignisse in unserem Leben von vielen Seiten zu betrachten, auch von denen, die zunächst von uns abgewandt waren. Eine lineare, auf sich selbst bezogene, Sichtweise löst sich zugunsten einer umfassenderen und räumlichen Wahrnehmung auf, die sich nach und nach in uns entwickelt, und die wir wie eine Form von Hellsichtigkeit erfahren können. Wer mit Menschenbildung zu tun hat, sollte sich um Umsicht und Weitsicht in diesem Sinne bemühen. Sie ist jedem möglich, und jeder kann sie entwickeln, der sich auf den Weg macht.
Aus meinen Erfahrungen sowie dem Anliegen, Bewusstseinsräume zu öffnen, wurde der Impuls geboren, das hier vorliegende Buch zu schreiben – mit dem Ziel, einen erweiterten Blickwinkel auf sich selbst und eine erweiterte Wahrnehmung im Umgang mit Kindern einnehmen zu können. Während des Schreibprozesses wurde mir von Kapitel zu Kapitel immer deutlicher: Erziehung ist zweitrangig, Selbsterziehung vorrangig. Ich strich Kapitel, die sich mit Erziehung beschäftigten und fügte neue hinzu, die Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis in den Vordergrund stellten. Und ich wählte den etwas provokanten Untertitel ‚Ein Erziehungsratgeber zur Nichterziehung’, durch den ich zum Ausdruck bringen möchte, dass Erziehung in erster Linie Selbsterziehung bedeutet.
Kinder schauen auf uns und ahmen uns nach. Wenn wir die eigene Persönlichkeit entwickeln, werden sie sich an unserem Vorbild orientieren und zu denjenigen heranreifen, die wir durch unsere Erziehungsmaßnahmen oft vergeblich zu formen versuchen, wenn unser eigenes Vorbild fehlt. Was wollen wir ihnen vorleben und was ist wert genug, ihnen für ihr eigenes Leben mitgeben zu wollen?
Bieten wir unseren Kindern mit unserem Vorbild gute Wahlmöglichkeiten, damit sie in ihrem Leben ihr höchstes Potenzial entfalten und ihre Körper als ein wunderbares Werkzeug nutzen können, um sich auf Erden vollständig mit all ihren Möglichkeiten zu realisieren und mitzuteilen – mit ihren Talenten, mit der ihnen innewohnenden Intelligenz und Kreativität und mit ihrer Fähigkeit zu tiefem Verständnis und Empathie.
Und machen wir uns immer wieder aufs Neue bewusst, welche Prozesse wir durch die Wahl unserer Worte, unserer Gedanken und Gefühle sowie durch unser Verhalten bei unseren Kindern in Gang setzen, wie kleine Störungen und Irritationen im Leben unserer Kinder zu großen, nicht vorhersehbaren Wirkungen führen können, damit unsere ‚Flügelschläge’ nicht zu Schlägen werden, sondern unseren Kindern selbst Flügel verleihen!
Jede Erziehung ist Selbsterziehung,
und wir sind eigentlich als Eltern, Lehrer und Erzieher
nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes.
Wir müssen die günstigste Umgebung abgeben,
damit an uns das Kind sich so erzieht,
wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen muss.
Rudolf Steiner
Und weil, trotz allen pädagogischen und psychologischen Wissens, das uns heute zur Verfügung steht, noch immer die Flügel vieler Kinder gestutzt werden, möchte ich in den nächsten Kapiteln ein wenig die Türen in die Kinderzimmer hinein öffnen, damit wir hinschauen können auf das, was häufig hinter geschlossenen Türen vor sich geht: Alltägliche Kommunikationsmuster im Umgang mit Kindern – fast immer ohne schlechte Absicht, oft hilflos und meistens unwissend, was sich hinter diesen Mustern verbirgt.
Auch wer vieles von dem hier Geschilderten weit von sich weisen möchte, es nicht wahrhaben oder bagatellisieren will, weil es doch gar nicht so schlimm sei, dabei aber auch nur ein Fünkchen Wahrheit bei sich selbst entdeckt, hilft sich selbst und seinen Kindern und macht die Welt ein bisschen besser.
Es gibt viel gute Literatur über gute Pädagogik. Doch wenn wir in der Erziehung unserer Kinder an unsere Grenzen stoßen oder uns gar Vorwürfe machen, weil es eben doch nicht so einfach ist, wie es in vielen guten Beispielen zur Erziehung manchmal erscheint, dann liegt das häufig daran, dass wir uns unserer eigenen Muster im Denken, Fühlen und Handeln zu wenig bewusst sind – besonders solcher, die bereits über Generationen kollektiv geprägt wurden.
Es geht nicht darum, sich schlecht zu fühlen, wenn man sich mit dem eigenen Verhalten konfrontiert sieht oder durch andere konfrontiert wird, sondern darum, den Boden zu erkennen, von dem man sich abstoßen muss, wenn man Neuland betreten möchte.
Je besser wir uns selbst kennenlernen, umso leichter und freier können wir neues Verhalten wählen oder bewusst das alte beibehalten, wenn wir es für gut befunden haben. Und je bewusster uns als Erwachsene das unbewusst Gewohnheitsmäßige wird, umso größer ist die Chance auf Befreiung von nicht hinterfragten Überzeugungen und Verhaltensmustern, die unseren Blickwinkel auf das Leben einschränken und uns selbst in unseren Möglichkeiten begrenzen – und umso größer ist damit zugleich auch unsere Befähigung, in unseren Kindern ein freies und unbeschwertes Gedanken- und Gefühlsleben zu veranlagen. Werden wir zum Detektiv unserer eigenen Innenwelt!
Zur Einstimmung folgen einige Beobachtungen aus dem Umgang mit einem dreijährigem Kind, das ‚Gehorchen’ im herkömmlichen Sinne einer traditionellen Erziehung noch nicht gelernt hat. Folgsamkeit über das abstrakte Wort ist ihm noch fremd, die Welt der Bilder hingegen vertraut. Wie selbstverständlich geben wir kleinen Kindern Bilderbücher, weil wir wissen, dass sie durch bloßes Vorlesen die Geschichten noch nicht begreifen können. Aber wenn es um Gebote oder um Verbote geht, wollen wir sie häufig nur durch die Kraft unserer Worte erreichen – und wundern uns, wenn wir keinen Erfolg haben.
In den ersten Lebensjahren sollte das Vertrauen gelegt werden, dass das Wort der Eltern gilt und dass es gut ist. Darum ist es von großer Bedeutung, dass Klarheit nicht Strenge und Druck bedeutet. Je klarer und entschiedener die Ansprache an das Kind ist, umso liebevoller und verständnisvoller sollte ihr Inhalt kommuniziert werden, ohne dabei die Entschiedenheit im Sinne einer Doppelbotschaft infrage zu stellen.
Die folgenden Beispiele stammen von Eltern, die Schwierigkeiten im Umgang mit ihrem Sohn hatten. Nachdem ihnen ihr eigenes Kommunikationsverhalten bewusst geworden war, entwickelten sie Alternativen und probierten neues Verhalten aus.
So einfach ist das!
So:
Max fährt den Salzstreuer wie ein Auto um seinen Teller herum.
Beim Essen spielt man nicht!
Max reagiert nicht.
Du stellst jetzt sofort den Salzstreuer weg!
Max reagiert immer noch nicht.
Der Vater reißt ihm den Salzstreuer aus der Hand.
Wenn du ihn noch einmal nimmst, gehst du in dein Zimmer.
Max ist im Spiel versunken. Wie alle kleinen Kinder lebt er noch mit ungeteilter Aufmerksamkeit ganz im Augenblick. Vielleicht hört er, was der Vater sagt, aber es hat im Moment des Spiels keine Bedeutung für ihn.
Oder so:
Max fährt den Salzstreuer wie ein Auto um seinen Teller herum.
Das ist ein Salzauto, nicht wahr? Kannst du das Salzauto zu mir
herüberfahren? Ich brauche etwas Salz.
Schnell erreicht das Auto Vaters Teller.
Danke. Bis wir fertig gegessen haben, darf das Salzauto jetzt
in einer Garage parken. Wo ist die Garage für das Salzauto?
Vielleicht ist sie unter einem Brotkorb oder hinter der Butterdose.
Max findet schnell einen geeigneten Platz und isst in Vorfreude,
das Auto bald wieder aus der Garage befreien zu dürfen.
So einfach ist das!
Der Vater gewinnt Max’ Aufmerksamkeit durch eine Frage. Er steigt ins Spiel ein und lenkt es in eine neue Richtung. Max fühlt sich verstanden und ist Teil der Entscheidung, erst nach dem Essen weiter zu spielen. Im ersten Beispiel fühlt Max sich vermutlich sehr unwohl. Er erlebt den Vater als übermächtig und sich selbst nicht in Ordnung. Er reagiert mit Anpassung, Rückzug oder Rebellion. Er hat keine andere Wahl.
So:
Max nimmt Vaters Handy.
Lass es liegen! Du gehst da nicht dran!
Max hört nicht.
Leg es sofort wieder hin!
Max hört immer noch nicht. Er beginnt mit dem Handy zu spielen.
Der Vater reißt es ihm aus der Hand.
Hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe?
Max weint.
Oder so:
Max nimmt Vaters Handy.
Du möchtest auch einmal mit Papas Handy telefonieren?
Max strahlt.
Der Vater legt eine Hand ans Ohr und sagt:
Hallo Max, bist du da?
Max strahlt noch mehr.
Papa sagt,
dass er ihn lieb hat oder dass Max ihm gleich helfen darf oder dass das Stofftier Wusch im Zimmer auf ihn wartet … der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Und dann sagt er ihm,
dass er sein Handy jetzt braucht
und dass es ein Handy für große Leute ist.
Max hat verstanden und gibt dem Vater das Handy zurück!
So einfach ist das!
Ich kann verstehen, wenn sich da der ein oder andere Vater fragt, ob denn das wohl wirklich funktionieren könne. Vielleicht ‚funktioniert’ es auch nicht jedes Mal, doch worum es in den Beispielen geht, ist darauf aufmerksam zu machen, dass es über Verbote hinaus andere und einfachere Möglichkeiten gibt, kleine Kinder zu erreichen, wenn wir in ihre Erfahrungswelt eintauchen.
So:
Die Mutter schenkt Max einen kleinen Plastikbagger.
Max strahlt. Voll Freude fährt er gleich los und rutscht – brrr brrr brrr – auf Knien hinter seinem neuen Spielzeug her – nichts hält ihn auf
– geradewegs an die nächste Wand.
Oh Schreck! Die Baggerschaufel ist an einer Seite abgebrochen.
Vielleicht kann man sie wieder heil machen, hofft Max
und zeigt den Bagger seiner Mutter.
Guck mal, was du jetzt wieder gemacht hast!
Gerade habe ich dir den schönen neuen Bagger gekauft, und du musst ihn gleich kaputt machen. Immer machst du alles kaputt!
Max Blick trübt sich. Er stellt den Bagger in die Ecke. Die kaputte Schaufel erinnert ihn daran, dass er etwas ‚Schlechtes’ getan hat.
Er ist nicht in Ordnung. Immer macht er etwas kaputt.
Max ist traurig.
Oder so:
Max zeigt den kaputten Bagger seiner Mutter.
Oh, da ist die Schaufel abgegangen.
Da ist der Bagger wohl ein wenig schnell gefahren?
Max ist erleichtert, Mutter versteht ihn.
Wie wäre es, wenn du den Bagger jetzt schnell in die
Werkstatt fährst und wir reparieren ihn?
Okay, sagt Max.
Schnell wird eine Zimmerecke zur Werkstatt und der Bagger wird repariert. Und wenn die Reparatur nicht möglich ist, kann man die Baggerschaufel möglicherweise auch ganz abnehmen und aus dem Bagger wird im Handumdrehen ein kleiner Trecker.
Max weiß jetzt, dass er lieber ein wenig vorsichtiger fahren sollte. Was Mama nicht alles kann! Max ist glücklich.
So einfach ist das!
So:
Der kleine Max sitzt vor einer großen Scheibe Brot. Er hat keinen Hunger.
Max schaut auf das Brot. Die Scheibe sieht riesig aus. Max ist unruhig.
Sitz still, du stehst erst auf, wenn du aufgegessen hast!
Max kneift die Lippen zusammen.
Iss jetzt, du bist schon ganz dünn! Schau mal,
wie gut der Paul immer isst! Der ist richtig stark.
Max spürt, er ist nicht in Ordnung; er ist zu dünn, er is(s)t nicht gut genug.
Jetzt mag er erst recht nichts mehr essen;
sein kleiner Magen ist wie zugeschnürt.
Die Mutter schiebt ihm das Brot zwischen die Zähne.
Los – beiß jetzt ab!
Max presst seine Lippen aufeinander.
Er schiebt das Brot in seinem Mund hin und her.
Am liebsten würde er es ausspucken, aber dann gibt es Ärger.
Das hat Max schon erlebt. Stattdessen kippelt er nervös auf seinem
Stuhl und kratzt mit einer Gabel auf dem Tischtuch.
Beim Essen wird nicht gespielt!
Die Mutter ist jetzt sichtlich genervt und zieht ihm die Gabel aus der Hand. Max ist erschrocken. Er wehrt sich und macht eine heftige Bewegung. Der Stuhl fällt um.
Jetzt reicht’s!
Die Mutter springt auf und reißt den Teller weg.
Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer!
Max weint.
Oder so:
Max will nicht essen. Er mag sein Brot nicht.
Du hast heute keinen Hunger? Ich glaube, es ist dir zu viel.
Max nickt mit vollem Mund. Die Mutter schneidet das Brot in Streifen.
Iss noch einen Streifen, dann bist du fertig und darfst aufstehen.
Max ist zufrieden. Das kann er überblicken.
Schnell ist der Streifen im Mund verschwunden.
Max freut sich über seinen Erfolg –
und schiebt schnell noch einen zweiten Streifen hinterher.
So einfach ist das!
So:
Max’ Mutter unterhält sich mit ihrer Freundin Nicole.
Nach einer Weile fängt Max an, unruhig zu werden.
Er macht allerlei Geräusche, und als die Mutter nicht reagiert,
fährt er ihr mit seinem Spielzeugauto ans Bein.
Max will wieder mal Aufmerksamkeit,
hört Max seine Mutter zur Freundin sagen.
Sie spricht über ihn zu jemand anderem, aber ihn schaut sie
dabei nicht an. Sie ignoriert Max, als sei er Luft.
Max wird lauter. Sein Auto wird zum Polizeiwagen.
Tatü tata, tatü tata,
grölt Max jetzt mit voller Stimme.
Siehst du nicht, dass du störst,
ruft Mutter ihm ärgerlich zu.
Max lässt sich nicht beeinflussen und fährt lautstark in seinem Spiel fort.
Seine Mutter schimpft, aber das ist nichts Besonderes. Sie schimpft
jeden Tag mit ihm. Doch dieses Mal schickt sie ihn auch noch weg:
Geh in dein Zimmer! Und da bleibst du, bis ich dich rufe!
Max rollt sich in eine Ecke und lutscht am Daumen.
Oder so:
Die Mutter unterbricht kurz ihr Gespräch, schaut Max an
und bückt sich zu ihm herunter:
Du möchtest Aufmerksamkeit von mir, nicht wahr, Max?
Du möchtest, dass ich mit dir spiele?
Max nickt bestätigend und schlingt seine Arme um die Mutter.
Die Mutter umarmt ihn liebevoll und entfernt dann sanft die kleinen Arme:
Wenn Nicole gegangen ist, habe ich für dich Zeit.
Dann können wir zusammen spielen.
Und jetzt möchte ich mich noch ein wenig mit Nicole unterhalten.
Max ist zufrieden und fährt mit seinem Auto in die Spielecke.
Er weiß, gleich hat Mutter Zeit für ihn.
So einfach ist das!
So:
Max stößt an sein Glas, die Milch ergießt sich über den Tisch,
und das Glas fällt zu Boden.
Max ist sehr erschrocken. Als ihm das erste Mal etwas umfiel, war er auch ein wenig erschrocken, aber jetzt ist sein Schreck viel größer! Jedes Mal, wenn ihm etwas umfällt oder etwas kaputt geht, ist sein Schreck größer. Sein kleiner Körper ist für Sekunden wie eingefroren, wenn ihm der Schreck in die Glieder fährt aus Angst vor dem, was jetzt passiert. Und da ist es schon:
Kannst du nicht aufpassen!
Guck mal, was du da wieder gemacht hast!
Immer musst du so herumturnen! Bei Tisch sitzt man still!
Max weint. Wieder einmal hört er, wie dumm er ist, wie zappelig,
wie unkonzentriert – und erfährt dabei, dass er nicht in Ordnung ist.
Aber das weiß er ja schon. Man hat es ihm schon oft gesagt.
Mutter hat doch letzte Woche auch etwas umgeworfen –
Max erinnert sich noch genau daran.
Oder so:
Max stößt an sein Glas, die Milch ergießt sich über den Tisch, und das Glas fällt zu Boden.
Da hast du dich erschrocken, nicht wahr Max?
Du hast wohl einen Moment nicht aufgepasst. Das kann passieren.
Mir ist es auch schon einmal passiert.
Komm wir machen es schnell zusammen wieder weg.
Die Mutter reicht Max ein Stück Papier von der Küchenrolle.
Gemeinsam wischen sie die Flüssigkeit auf.
Die Glasscherben legen sie vorsichtig auf die Kehrschaufel,
und Max lernt, wie man Glassplitter vorsichtig anfassen kann,
und dass man auch die kleinen Splitter gut entsorgen muss,
damit sich niemand die Füße verletzt.
Alles ist wieder in Ordnung. Max bekommt ein neues Glas Milch,
und zufrieden setzen sie ihre gemeinsame Mahlzeit fort.
So einfach ist das!
So:
Max’ Mutter hat keine Zeit, sie macht gerade drei Sachen gleichzeitig. Sie ist hektisch und reagiert ärgerlich, wenn Max sie stört. Auch sein Vater hat keine Zeit, er hat viel zu tun, ist angespannt und gestresst. Max nimmt die Unruhe auf, die um ihn herum ist. Er wird fahrig und laut, tobt durch die Wohnung und reagiert nicht auf die Ansprache seiner Eltern.
Die Mutter braust auf und schimpft mit ihm, ohne wirksam mit Max in Kontakt zu treten. Ihre Worte kreisen nervös und kraftlos wie über ihn hinweg und erreichen ihn nicht.
Max hört die Mutter nicht; er schmeißt den Korb mit Eisenbahnschienen um und beginnt seine Eltern mit allerlei unmotivierten Verhaltensweisen zu provozieren.
Jetzt reagiert auch der Vater – überreizt und ärgerlich:
Er hält Max fest und schüttelt ihn – redet auf ihn ein.
Max kann nicht anders. Er schlägt mit einem Hubschrauber, den er gerade in den Händen hält, unkontrolliert um sich. Der Vater fühlt einen Schlag im Gesicht und fährt jetzt endgültig aus der Haut:
Hey, was soll das? Soll ich dir mal so ins Gesicht schlagen?
Er kneift seinen Sohn in die Backe. Max weint und schreit.
Unruhe und Unzufriedenheit wachsen auf beiden Seiten, und die Aggressionsspirale dreht sich höher. Schließlich wird Max in sein Zimmer gesperrt.
Max weint. Was hat er getan?
Sein Vater hat es ihm gesagt – und Max weiß jetzt wieder etwas mehr über sich: Er ist böse.
Oder so:
Der Vater nimmt seine eigene Unruhe, die Nervosität seiner Frau und die Fahrigkeit seines Sohnes wahr. Er entscheidet, sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um das Geschehen zu beruhigen. Bevor er einschreitet, nimmt er ein paar tiefe Atemzüge, um sich von dem Stress, den er gerade in sich erlebt, zu lösen. Dann setzt er sich auf den Boden und beginnt wortlos die herumgeschmissenen Eisenbahnwagen auf die Schienen zu setzen.
Nach wenigen Minuten kommt Max dazu, setzt sich neben ihn und schiebt die Lok auf ein Gleis. Er beginnt zu spielen. Der Vater bleibt noch einige Minuten sitzen, atmet bewusst und fokussiert sich auf Ruhe. Er legt Max eine Hand auf den Rücken. Max spürt unbewusst die beruhigende Wirkung, die von Vaters Hand ausgeht, und schaut seinen Vater an. Die Atmosphäre im Raum ändert sich. Der Vater kann es wahrnehmen. Er lächelt seinen Sohn an und ist dankbar, weil er gerade erleben durfte, wie leicht es ist, so machtvoll zu sein.
So einfach ist das!
Das Beispiel möchte darauf hinweisen, dass die Unruhe kleiner Kinder fast immer nur ein Spiegel der Unruhe der Erwachsenen ist, deren Gedanken und Emotionen sie unmittelbar und ungefiltert aufnehmen. Ich kenne ein Kind, das mit seinen Eltern die halbe Welt umreist hat – mit ständig wechselnden Eindrücken. Wie erstaunt war ich, das Kind nach einem halben Jahr der Abwesenheit ausgeglichen und in innerer Harmonie wiederzusehen. Beide Elternteile sind tolerant und verständnisvoll im Umgang miteinander und tragen Ruhe in sich und mit sich, wo immer sie sich gerade befinden. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass das Bewusstseinsfeld der Eltern in jungen Jahren bedeutsamer für ein Kind ist als die Ereignisse in seiner Umgebung.
Wer ist Max?
Max ist ein kleiner Junge, der noch nicht weiß, wer er ist; er kann noch auf keine Erfahrungen zurückblicken. Aber da gibt es ja die Worte und das Verhalten seiner Eltern und Erzieher, die ihm sagen, wer er ist. Daran kann er sich orientieren. Er ‚kennt’ sich jetzt von Tag zu Tag besser:
Max ist ein Lümmel, ein Junge, der immer alles kaputt macht, der herumzappelt und nicht anständig essen will. Er ist ein Schlingel, der nicht hören will, der immer alles falsch macht. Er ist schuld, wenn es seiner Mutter nicht gut geht und wenn sie traurig über ihn ist. Und weil er Vaters Handy kaputt gemacht hat, ist er böse und darum selber schuld, dass Vater wütend auf ihn ist. Überhaupt – hört er über sich sagen – sei er ein richtiger Kaputtmacher. Natürlich ist er dann selber schuld, wenn seine Eltern ihn ausschimpfen und auch wenn er bestraft wird, wenn man ihm etwas wegnimmt oder Vater ihn in sein Zimmer sperrt. Es sei seine eigene Schuld, das habe er sich selbst zuzuschreiben, sagen sie. Und natürlich auch, dass er so dünn ist, weil er nicht richtig essen will und dass er jetzt schon wieder einen Schnupfen hat, weil er die Mütze nicht aufgelassen hat. Seine Eltern haben es ihm gesagt. Er weiß mit jedem Tag mehr von sich.
Auf Zurechtweisung, Kritik oder Strafe reagiert Max manchmal trotzig oder aggressiv und andere Male verstört und unsicher. Früh erfährt er, was es bedeutet, ein ‚schlechtes Gewissen’ zu haben, wenn er den Erwartungen seiner Eltern nicht entspricht. Aus Angst vor Bestrafung verhält er sich deshalb immer häufiger so, wie es von ihm erwartet wird.
Und manchmal wird er dann sogar gelobt, weil er jetzt schon richtig gut ‚gehorchen’ kann. Jetzt sei Max schon gar nicht mehr so ‚schlimm’, hört er dann über sich sagen, er sei schon richtig groß geworden, und man müsse sich gar nicht mehr so viel um ihn kümmern und ständig auf ihn aufpassen, damit er keine ‚Dummheiten’ macht.
Max ist jetzt mehr und mehr sich selbst überlassen und bekommt – solange alles reibungslos läuft – kaum Zuwendung. Seine Eltern sind mit eigenen Aufgaben und Problemen beschäftigt. Da stört Max nur, wenn er mit ihnen spielen oder etwas mit ihnen gemeinsam machen möchte.
Doch tief unbewusst ‚weiß’ Max ja auch, dass er neue Aufmerksamkeit bekommt, wenn er wieder etwas falsch macht. Und weil das dann nicht das erste Mal ist, sondern sich alle gleich an die vergangenen Situationen erinnern, fällt die Reaktion entsprechend hart aus. Max kann nie still sitzen, muss immer stören, hat nie Geduld, … hört er. Gleich ist Max wieder der Depp, der sich nicht benehmen kann, immer macht er alles falsch.
Ja, jetzt weiß Max wieder, wer er ist. Er steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und fühlt sich sehr, sehr unwohl. Am liebsten möchte er verschwinden, wenn es nur ginge; so zieht er sich mehr und mehr in sich selbst zurück.





























